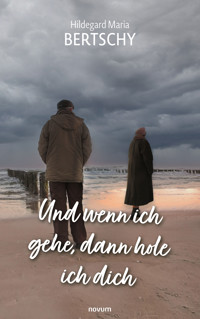
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dass die wahren Geschichten das Leben schreibt, beweist Bertschy mit ihrem Text, der wie ein Gespräch zwischen Freunden auch vor der tiefsten Scham und der schlimmsten Trauer nicht Halt macht. Gemeinsam mit Alexander, dem vom Schicksal geschlagenen und dennoch lebensfrohen Protagonisten, erkunden wir das Leben im Zweiten Weltkrieg, die Nachkriegszeit, den Mauerfall. Das Abenteuer Spanien gibt Alexander neue Lebensgeister, als er, gemeinsam mit Julia, in der Pension den Schritt wagt, auszuwandern. Dass auch in sonnigen Gefilden nicht immer alles eitel Sonnenschein ist und das Leben so seine Schatten wirft, muss Alexander im Krankenhaus erfahren. Nie hätte er gedacht, dass seine Gesundheit und seine Beziehung so eng miteinander verbunden sein könnten, aber man lernt bekanntlich nie aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0087-5
ISBN e-book: 978-3-7116-0088-2
Lektorat: Jasmin Fürbach
Umschlagfoto: Michal Bednarek | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Die ersten Jugendjahre
Alexander, ein Knabe aus gutbürgerlichen Verhältnissen, man schrieb das Jahr 1929. Der Vater Karl, geboren am 04.10.1895 in Hamburg, war ein stattlicher Mann mit stolzer Haltung, die ihn größer erscheinen ließ, als er in Wirklichkeit war. Sein Blick war freundlich und gutmütig, über seinen breiten, schön gezeichneten Lippen trug er einen gut geschnittenen und gepflegten, schmalen Oberlippenbart. Das hellbraune Haar war links gescheitelt und flach zur rechten Seite gekämmt. Seine Mutter Dora, geboren am 01.02.1896 stammte vom Lande, aus Buchholz, Kreis Harburg. Sie sprach Plattdeutsch, war aber der hochdeutschen Sprache mächtig, welche sie in der Schule erst lernte. Dora hatte eine zierliche Figur, dunkle, leicht gewellte Haare und war auch nicht besonders groß gewachsen. Wie ich den Fotos von ihr entnehmen konnte, hatte ihr Gesichtsausdruck etwas Melancholisches. Dora gebar die Söhne Malte und Alexander, ihren zweiten Sohn, im Jahre 1929 am 28. August in Hamburg Harburg-Wilhelmsburg in der Klinik Maria Hilf. Alexander war ein Junge, welcher mit zehn Monaten bereits laufen konnte, wie ihm von seiner Mutter gesagt wurde. Sie erzählte ihm auch immer wieder, wie sie zusammen Fangen spielten, er unter dem Wohnzimmertisch durchlaufen konnte, ohne nur einmal sich am Kopf zu stoßen, so klein war er. An die Spiele mit seiner Mutter erinnerte er sich noch, da musste er aber schon älter gewesen sein. „Oh, ich habe ihr Lachen noch heute präsent, wir hatten viel Spaß zusammen“, sagte er mir. Als kleiner Junge bereitete Alexander das Sprechen große Mühe. Als er mit zwei Jahren damit begann, bekam er die Worte, welche er eigentlich sagen wollte, kaum auf die Reihe. Das erste Wort, welches über seine Lippen kam, war „tschasch“, deswegen bekam er den Spitznamen Tschaschi. Von allen Familienmitgliedern wurde er wärend seiner Kindheit so genannt und später auch von seinen Freunden. Heute ist er nicht mehr Tschaschi, aber die Sprachhemmung begleitet ihn weiterhin. Damit meine ich nicht, dass er stottert oder nicht flüssig spricht. Es zeigt vielmehr, wie tiefgreifend und anhaltend sich diese Sprachhemmung auf ihn auswirkt. Mir fiel nur auf, dass er zu den Menschen gehört, die im Gespräch leicht den Faden verlieren, wenn sie unterbrochen werden. Leider haben die meisten keine Geduld zuzuhören und lassen gerade diese Leute nicht ausreden. Vor allem, wenn Alexander nervös oder aufgeregt ist, zeigen sich bei ihm die Sprechhemmungen. Er benötigt einfach mehr Zeit sich auszudrücken. Dazu kommt, dass er eine eher ruhige und leise Sprechweise an den Tag legt. Dadurch gelingt es ihm kaum, sich durchzusetzen so wie andere, die eine resolute Stimme besitzen.
Vater Karl, ein beherrschender Mann, war im Jahre 1931 Kapitän auf großer Fahrt, so lautete der damalige Berufstitel, heute würde man sagen: Kapitän auf Handelsschiffen. Diese Schiffe, auf denen er tätig war, verkehrten zwischen Hamburg, Chile, Japan und Hamburg. Die Mutter, Alexander und sein Bruder Malte waren viel auf sich selbst gestellt, der beruflichen Tätigkeit des Vaters wegen. Auf Mutter Dora lasteten viel Verantwortung und Arbeit mit den zwei Knaben. Sie war eine sehr fleißige Frau und hatte den Haushalt gut im Griff. Auch die Erziehung war größtenteils ihre Aufgabe, welche sie außerordentlich gut meisterte. Die Knaben wurden stets zur Ordnung ermahnt, denn was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Selbstständig müssen sie werden, meine Knaben, äußerte sie sich oft, wenn Vater zu Hause war. Sie nähte die Kleider der beiden Jungen selbst, um da und dort etwas an Geld einsparen zu können. Alexanders Bruder Malte kam im Dezember 1921 zur Welt. Eigentlich nahm er dadurch den um beinahe acht Jahre älteren Bruder in der ersten Lebensphase seiner Kindheit nie richtig wahr. Er überlegte und sagte nach einer Pause: „Es muss wohl an der Distanz unseres Alters gelegen haben. Er besuchte schon die Schule und wenn er nach Hause kam, interessierten ihn andere Sachen, ich war ihm gleichgültig.“ Er selbst war scheinbar kein Wunschkind, wie er erzählte, denn mit einem zweiten Kind hatte man nicht gerechnet, wie ihm später immer wieder zu Ohren kam. „Was der Mensch doch alles schlucken muss“, zog die Mundwinkel nach hinten und lachte verschmitzt. „Ich kam trotzdem und bin immer noch da.“ Seine Aussage belustigte mich, denn diese Formulierung war typisch für ihn, so sitzt ihm der Schalk im Nacken. Wie er mir weiter erzählte, liebte er seine Mutter über alles, sein Vater sei damals meistens unterwegs gewesen, bedingt durch die Arbeit. Im Haus, in dem Dora und die Jungen lebten, waren insgesamt acht Familien wohnhaft. Mit den Jacks, ältere Leute ohne Kinder, wurde man nicht groß miteinander bekannt, denn die verließen das Haus kaum. Da war die Familie Plöse, die Hausbesitzer, mit ihren zwei Kindern, die jünger waren als Alexander und sein Bruder. Heinickes, ruhige zurückgezogene Nachbarn, lebten ihr eigenes Leben, so wie die Jacks. Kontakte und Gespräche mit den Mitbewohnern mieden sie, aber waren stets korrekt und freundlich. Die Familie Fischer hatten zwei Töchter, die um einiges älter waren. Beide lebten außerhalb Hamburgs und waren bereits verheiratet. Auf der linken Seite ihrer Wohnungstüre befand sich der Eingang von Herrn und Frau Reichmann. Das Paar lebte allein und hatte noch keine Kinder. Die Reichmann, eine hübsche blonde Frau, hatte stets ein Lachen auf ihrem rot geschminkten Mund, was Alexander immer gefiel. Sie war auch die, welche für den Knaben stets ein gutes, liebes Wort fand und ihm manchmal auch mit der Hand über die Haare strich. Man wusste, wenn sie das Haus verließ, denn das Getrippel ihrer Schuhe war absolut nicht zu überhören. Außerdem verteilte sich der Duft ihres süßen Parfüms im gesamten Treppenhaus. Dann war da noch der Deisböck mit seiner dicken Frau, die auch im gleichen Haus wohnten. Er, ein Beamter, eine schlaksige, konservative Erscheinung, hatte seine Nase immer gegen den Himmel gerichtet, so wie Hans guck in die Luft. Er trug meistens einen grauen Anzug, darunter ein helles Hemd und eine bräunliche Krawatte. Gesellig war er absolut nicht, und hätte man sich nicht zufällig ab und zu im Treppenhaus gesehen, wäre er für die Mitbewohner bestimmt fremd geblieben. Seine Frau besorgte den Haushalt, und wenn man sie im Treppenhaus erblickte, sah sie einen von der Seite an, erwiderte zwar den Gruß, zog aber sogleich von dannen. Die beiden waren die Eltern eines kleinen Jungen, der noch im Kinderwagen saß. Auf der rechten Seite des Treppenhauses befand sich die Eingangstüre von Beckers. Das waren die mit den Zwillingen, einem Mädchen und einem Jungen, etwa fünf Jahre jünger als Alexander. Im Haus herrschte Frieden, alle begegneten sich freundlich, es gab keine Intrigen und jeder lebte so, wie er wollte. Langeweile kannte Alex in seiner Kinderzeit kaum. Manchmal stand er am Fenster im Wohnzimmer, um dem Treiben auf der Straße zuzusehen. Damals verkehrten lediglich Fuhrwerke und Kraftfahrzeuge, die mit Diesel angetrieben wurden. Man sah außerdem Personenwagen der Marken DKW, Opel, Triumph und Mercedes. In den nobleren Autos waren die Personen in den üppigen Polstern so eingebettet, dass sie kaum zu erkennen waren. Zu jener Zeit vermochten es nur die reichen Leute, sich solche Fahrzeuge zu leisten. Viele Menschen gingen zu Fuß oder hatten das Glück, ein Fahrrad zu besitzen. So konnten sie mit dem Stahlross ihre täglichen Angelegenheiten schneller bewältigen. „Stell dir vor, wir besaßen nicht einmal ein Fahrrad!“ sagte Alexander. Es befand sich alles, was sie zum Leben brauchten in unmittelbarer Nähe des Hauses, und so erübrigte sich der Wunsch nach einem fahrbaren Untersatz. Dann gab’s noch die Familie, welche in der Nachbarschaft über der Straße lebte, das waren sehr spezielle Menschen. Die hatten ein Kind, einen Jungen der Günter hieß, das war ein feiner Bursche. Den Vater des Nachbarjungen kannte Alexander nicht persönlich und es bot sich auch niemals die Gelegenheit mit ihm zu sprechen. Der Mann verbrachte seine Tage mit Nichtstun, so kam es ihm zumindest vor. Der schaute stundenlang, den Kopf in seine Hände gestützt, aus dem Fenster hinab zur Straße. Günters Mutter sah man selten, die war bestimmt mit dem Haushalt beschäftigt und hatte sicherlich viel zu tun. Auch mit ihr bot sich während seiner Jugendzeit und auch später nie die Möglichkeit, nur ein Wort zu wechseln. Für Alexander etwas eigenartig und unverständlich, dass sich Leute so verhielten. Er war doch oft mit Günter, ihrem Sohn, beim Spielen unterwegs. Mutter Dora verhielt sich in dieser Hinsicht anders. Es freute sie, wenn sich die Kinder an der Haustür zeigten, so hatte sie die Kontrolle darüber, mit wem sich ihr Sohn traf. Alexander wurde an der Haustüre seines Spielkameraden nie Einlass geboten, was er eigentlich verstand, denn damals war es nicht üblich, dass sich Kinder gegenseitig in den Wohnungen besuchten. Nur hätte es ihm gefallen, mit den Eltern von Günter doch wenigstens mal zu plaudern. Nach seinem eigenen Dafürhalten hatten Günters Eltern eine Verhaltensweise, die von den gesellschaftlichen Normen abwich. Die ließen sich bestimmt vom Staat finanzieren. Günther war ein netter, lustiger Junge, mit dem man Spaß haben konnte, Alexander mochte ihn besonders gerne. Im Hof des Hauses durften sich die Jungen nicht aufhalten, es herrschte absolutes Spielverbot. Der knurrige Hausbesitzer Plöse, von Beruf Malermeister, duldete dort keine Kinder. Hier hing meist auch die Wäsche der Hausbewohner zum Trocknen. Die Hausfrauen sahen es auch nicht gern, wenn die Kinder unter die frisch gewaschene Wäsche krochen. Dabei reizte gerade dieses Verbotene so sehr, und die hängenden Bettlaken dienten den Lausbuben als willkommene Deckung beim Versteckspiel. Im Hof standen immer die Arbeitsutensilien von Plöse und bestimmt ängstigte sich dieser seiner Farbeimer und Leitern wegen. So begaben sich die Kinder fast täglich zum Park, der sich gegenüber dem damaligen militärischen Bezirkskommando befand. Die Grünzone lag in der Nähe seines Zuhauses und war für viele Kinder dieser Gegend das Spielparadies. Der Park existiert scheinbar noch heute, so Alexander, an den Namen aber könne er sich nicht mehr erinnern. In unmittelbarer Nähe, über der Straße, wohnte die Frau Tschebong in ihrem eigenen netten Haus. Sie war Jüdin, eine damenhafte, gepflegte, freundliche Frau, deren Mann schon länger verstorben war. Frau Tschebong besaß zur damaligen Zeit die Leihbücherei, die gut besucht war. Bei ihr habe er immer die Bücher von Karl May ausgeliehen, erzählte Alexander, der oft nur mit dem Spitznamen Alex angesprochen wurde. In der Leihbücherei standen die Gestelle und man konnte durch die Reihen mit den einsortierten Büchern durchlaufen. Oftmals traf man bei ihr auf Leute, die tiefversunken über ein Buch gebeugt an den aufgestellten kleinen Tischchen saßen. In der Bibliothek musste man leise sein und getraute sich kaum, mit den Schuhen aufzutreten oder gar zu husten. Für das Auslehnen der Bücher verlangte Frau Tschebong nur einige Pfennige und man durfte diese für eine bestimmte Zeit behalten. Frau Tschebong wurde plötzlich eines Tages von der Gestapo, der Geheimen Staatspolizei, abgeholt. Man brachte sie ins Konzentrationslager in Fuhlsbüttel, hieß es in der Nachbarschaft, oder man nahm es zumindest an. Die Leihbücherei war ab sofort dann leider geschlossen und die arme Frau sah man nie mehr wieder. Fuhlsbüttel ist ein Stadtteil von Hamburg und liegt im nördlichen Teil der Stadt. Alexanders Mutter hatte immer den gleichen Kommentar, wenn eine Person aus derselben Straße, die man kannte, abgeholt wurde. „Dieser verflixte Nationalsozialismus, die oder den sehen wir auch nicht wieder, glaub mir, du wirst schon sehen“, hörte Alexander sie dann sagen. Bei ihrer Aussage hatte sie immer einen nachdenklichen Gesichtsausdruck und man sah, wie sie die Stirn hochzog und dabei tiefe Falten in ihrer Mimik entstanden. Was sie mit den Worten sagen wollte, war für Alexander noch unverständlich, seiner Meinung nach einfach nur Gerede von Mutter. Fast jeder wusste allerdings bereits, was die Abkürzung KZ hieß. Umerzogen sollten die Leute im Konzentrationslager werden, darüber hinaus das Denken des Nationalsozialismus im Dritten Reich annehmen, soviel war klar. Was zum damaligen Zeitpunkt aber wirklich geschah, darüber hatten die Leute noch keine Ahnung. Es kamen nicht nur jüdische, sondern auch unangepasste Personen, Menschen anderer Herkunft wie zum Beispiel Roma in diese Konzentrationslager. Viele, die das Denken Adolf Hitlers nicht befolgten, Regimekritiker waren, wurden kurzerhand abgeholt und hatten Zwangsarbeit zu leisten, das hörte man. Über den großen geschmiedeten Eisentoren der Konzentrationslager stand: ARBEIT MACHT FREI. Diese Parole war allgemein bekannt und Alexander verstand diese Worte als Kind so. Wenn die Menschen dort gut arbeiten würden, kämen sie bald wieder frei. Er machte sich oft Gedanken über Frau Tschebong, eine rechtsschaffende äußerst nette Frau, die ihr Herz am rechten Fleck trug. Sie hatte immer gearbeitet, warum musste gerade sie dorthin gebracht werden, war sie wohl doch nicht so gut, wie Alexander das immer angenommen hatte? Fragen über Fragen, auf die er damals keine Antwort erhielt, die Erwachsenen wussten es ja selbst nicht.
Mutter Dora pflegte guten Kontakt zu ihren Freundinnen, deren Männer ebenfalls zur See fuhren. Weil die Frauen viel und über lange Zeit allein waren, mussten sie sich wohl oder übel selbst organisieren. So lud Mutter einmal im Monat ihre Freundinnen zum Kaffeekränzchen ein. Bevor die Damen eintrafen, wurde fleißig gebacken und Alex durfte seiner Mutter dabei helfen. Er mischte mit einer Holzkelle die Masse für die Kuchen, die seine Mutter in einer Schüssel vorbereitet hatte. Dabei grub er immer seinen Zeigefinger in den süßen Teig und naschte davon, wenn es Mutter nicht sah, erzählte er. Alexander mochte damals Süßes schon zu gerne leiden und konnte schwer widerstehen, obwohl Mutter es nicht schätzte, wenn er das tat. Seinen Mund zu einem breiten Grinsen geformt, sagte er: „Die Gerüche der verschiedenen feinen Backwaren, die Mutter hervorzauberte, habe ich noch immer in meiner Nase. Würde ich meine Augen schließen, ich stünde mit ihr wieder mitten in der Küche am Tisch. Stehe ich heute in einer Bäckerei und betrachte die leckeren Torten und das Gebäck in den Vitrinen, kommen Erinnerungen an früher, an meine Kinderzeit. Dann kann ich mich oft nicht zurückhalten und gönne mir stets etwas Gutes.“
Alex, er war noch ein kleiner Junge, immer nett angezogen, der sich meist angepasst benahm. Nach alten Fotos war er ein hübsches Kerlchen, einfach so wie Mütter ihre Kinder mögen. Wenn die Freundinnen von Dora eintrafen, da war ihm im Vorfeld schon angst und bange. „Oh, ich weiß noch immer, wie mich Paula zwischen ihren großen Brüsten fast erdrückte, ich habe manchmal nach Luft gerungen, um in der Üppigkeit ihres Busens nicht zu ersticken!“, er lachte. Ich meinerseits versuchte, mir diese Situation bildlich vorzustellen, und es amüsierte mich. „Glaube mir, wie ich diese Übergriffe hasste, diese Art von Umarmung“, sagte er und verzog dabei das Gesicht zu einer Grimasse. Wenn es Mutter erlaubte, machte er sich, wenn möglich, immer schon im Voraus vom Acker. Anna Viertel und Sofie Jörn waren da anders als die großbusige Paula und entsprachen ihm eher, die hatten Format. Es waren sehr gepflegte Damen, gut gekleidet, und sie überfielen Alexander nicht schon in der Eingangstür. Sie gaben ihm zur Begrüßung lediglich die Hand und behandelten den Jungen so, wie er das von seinen Eltern gewohnt war. In der Familie gab es diese Art von Umarmung nicht, oder war zumindest ungewohnt. Er wurde von seinen Eltern nicht oft geknuddelt. Das Verhältnis zu Vater und Mutter war nett, aber eher förmlich und Körpernähe dieser Art wurde kaum praktiziert.
An einem Wochenende im Sommer 1936, es war kurz vor Alexanders siebtem Geburtstag. Sein Vater, welcher wieder einmal zurück von einer großen Reise gekommen war, machte ein mürrisches Gesicht. Alex merkte wohl die Unstimmigkeiten seiner Eltern, während sie bei Tisch das Essen einnahmen. Es herrschte zwischen den beiden auch nicht die Herzlichkeit, die er eigentlich gewohnt war. Nicht weil sie gestritten hätten, nein, er vernahm die spürbare Unstimmigkeit anhand ihrer Gesichter. Mutter hatte an jenem Tag einen traurigen Ausdruck in den blauen Augen und Alexander glaubte sogar, Tränen darin bemerkt zu haben. Vater Karl blieb stumm, sein Gesichtsausdruck wirkte hart und flößte dem Jungen beinahe Angst ein. Eigentlich wurde in der Familie unter normalen Umständen rege gesprochen, besonders Vater hatte von seinen Reisen immer Interessantes zu berichten. Alex klebte dann mit offenem Mund beinahe an seinen Lippen und horchte den Worten des Vaters aufmerksam zu, als er sprach. Spannend, wenn er von hoher See erzählte, von den Gefahren, welche sein Beruf barg. Wie damals, als sie am Kap Horn in Seenot geraten waren, bedingt durch einen schnellen Wetterumschlag. Da erzählte er von Wellen, die meterhoch waren. Von Kawenzmänner, die sich aus heiterem Himmel plötzlich wie eine Wand vor dem Schiff auftürmten. Er als Kapitän und die 23 Mann Besatzung wurden bis an ihre Grenzen gefordert. Die Sicherheit der Seeleute, welche in ihrer Heimat zum Teil Frau und Kinder hatten, für die trug er die alleinige Verantwortung. Er erzählte davon, wie er und die Mannschaft das 150 Meter lange Schiff durch die monströsen Wellen steuern mussten. Kleine Schiffe hatten nach seiner Aussage auf der gefürchteten Route an jenem Tag keine Chance, sie vermochten dem enormen Wellengang nicht zu trotzen und wurden gnadenlos vom Meer verschlungen. Die Maipo, welche von Alexanders Vater über die Weltmeere gesteuert wurde, erschien dem Knaben riesengroß. Stolz erfüllte den Jungen, wenn er seinen Vater in der Kapitänsuniform betrachtete, er sah darin gut aus. Leider waren die Landgänge immer nur kurz bemessen und immer viel zu schnell stachen sie wieder in See. Dora verstand es, sich schick zu kleiden, und putzte sich heraus, wann immer sie gemeinsam den Vater zum Hamburger Hafen begleiteten. Der Abschied war stets freudlos, kurz und trocken, wenn er ging, denn man wusste, es war eine Trennung, die oft mehr als ein Jahr dauerte. Dann standen die beiden neben vielen anderen am Quai. Alexander hielt immer Mutters Hand, während sie hinaus in den Mastenwald der Schiffe blickten. Jedes Segel war ein Zeugnis der Abenteuer, die auf hoher See erlebt wurden. Da lag es, das mächtige stolze Segelschiff, auf dem sein Vater Kapitän war, ein herrlicher Anblick. Bald schon verließ die Maipo, zusammen mit Vater und der Besatzung, den Hafen und Tränen schossen in Alexanders Augen, es machte ihn traurig. Viele Anwesende, die ihre Väter und Söhne zum Hafen begleiteten, winkten noch lange, bis das Schiff schließlich auslief. Alexander war sich bewusst, dass Vater für lange Zeit wieder auf See war und er mit Mutter und seinem Bruder allein zurückblieb. Obschon ihm dieser Ablauf nicht fremd war, überkam ihn stets die gleiche unbändige Traurigkeit.
An jenem Sonntag im Sommer beim Essen, er wusste natürlich nicht, was der Anlass der Missstimmung war, die er zwischen seinen Eltern bemerkte. War es etwa seinetwegen, hatte er etwas falsch gemacht? Sein Bruder Malte war nicht zu Hause und deswegen konnte er mit niemandem über seine Ängste sprechen. Die Eltern darauf anzusprechen, das war unmöglich, denn damals erhielt man nicht die Antwort, die einem geholfen hätte, zu verstehen. Außerdem waren Fragen in seiner Jugendzeit meistens ein Tabuthema. Die Sorgen der Kinder, die interessierten keinen, so blieb der junge Alexander an jenem Tag im luftleeren Raum stehen. Das Verhältnis seiner Eltern verbesserte sich auch keineswegs, als Vater nach Monaten in die Heimat zurückkehrte, im Gegenteil. Die Unstimmigkeiten nahmen zu, während er zu Hause weilte, und oftmals gab es auch heftige Streitereien zwischen den Eltern. Das bekamen die Knaben zu spüren, auch Alex wusste, dass das nichts Gutes verhieß. Er glaubte, dass Mutter jetzt froh war, wenn Vater endlich wieder ging. Im darauffolgenden Jahr kam die unabwendbare Trennung seiner Eltern, zu einer Scheidung kam es nie, denn das wollte Dora nicht. Das musste so kommen, hörte Alex eines Tages Malte zur Mutter sagen, denn jeder von euch lebt sozusagen für sich. Alexander, der eigentlich meistens mit seiner Mutter zusammen war, spürte diese Trennung kaum. Sein Bruder aber litt furchtbar unter dem Zustand, denn er bekam bedeutend mehr mit als der Jüngere. Die Trauer seines Bruders beeindruckte Alex zu jener Zeit nicht sonderlich, denn er hatte ja glücklicherweise seine Mutter. Er hatte schließlich noch seine Freunde in der Straße, mit denen er fast täglich spielte. Dora war nach der Trennung besonders lieb zu den Söhnen, aber handelte besitzergreifend. Sie brachte es fertig, die beiden Knaben immer wieder gegen ihren Vater aufzuhetzen. Es war verständlich, dass sie gegen ihren Mann Zorn hegte, aber die Jungen vom Vater zu trennen, das war nicht klug. Er lebte nun schon seit geraumer Zeit nicht mehr im gleichen Haus, sondern zog in eine Einzimmerwohnung um. Warum es zu Unstimmigkeiten und später zur Trennung kam, erfuhr Alexander viel später einmal. Vater hatte scheinbar eine Affäre mit einer anderen Frau, die von ihm ein Kind erwartete. Mit schlechten Worten schaffte es die Mutter, ihre Söhne vom Vater fernzuhalten. Was blieb den zwei Knaben denn anderes übrig, hatten sie eine Wahl? Nach der Trennung der Eltern blieben die beiden Buben mit der Mutter in Hamburg Harburg zurück. Alexander begegnete seinem Vater in den kommenden neun Jahren nicht ein einziges Mal und das bis nach dem Krieg. Nach der Trennung von ihrem Mann blieb Dora mit den Söhnen weiterhin in dem Dreietagenhaus wohnen. Das Haus, 1890 erbaut, barg einfache Wohnungen ohne Bad mit primitiven Küchen. Immerhin gab es zu jener Zeit schon eine Heizung, nur im Schlafzimmer blieb es im Winter bitterkalt, schilderte mir Alexander. Dora besaß ein außerordentliches Geschick, Räume praktisch einzurichten. Die Wohnung wirkte anmutig, alles war immer aufgeräumt und fein säuberlich geordnet. Betrat man die Wohnung vom Treppenhaus her, gelangte man über den Flur in den großen Wohnraum und anschließend zum Herrenzimmer. Links befand sich ein übergroßes Schlafzimmer, dort bestand keine Möglichkeit, das Zimmer zu heizen. Lag man im Bett und atmete mit offenem Mund aus, konnte man den Hauch des Atems erkennen, so kalt war der Raum. Im Winter bildeten sich Eisblumen an den Fensterscheiben, die sahen aus wie Gemälde. An den vereisten Scheiben zeigten sich Sterne, verschiedene Blumen und Blätter, der Fantasie waren keinerlei Grenzen gesetzt. Das Schlafzimmer, das man sich zu dritt teilte, war groß und geräumig. Alexander erinnert sich zurück und erzählt, wie die Aufteilung des Zimmers aussah. In der Mitte des Schlafraumes befand sich das Ehebett, wo Mutter allein wie auf einer Insel schlief. Links davon stand das Bett seines Bruders Malte und neben seiner Schlafstätte war ein kleiner Schrank platziert. Am Fenster, rechts von Mutter, schlief klein Alex in seinem Kinderbett. Am Fußende der Betten standen eine Frisierkommode und davor ein Hocker mit fellartigem Überzug. Dort jeweils sitzend, frisierte sich Mutter täglich, dabei sah er ihr zu gerne zu. Wie sie mit dem Kamm gekonnt ihr Haar in Wellen legte, faszinierte den Jungen. In den Seitenspiegeln der Frisierkommode begutachtete sie anschließend ihr Werk und sah dabei, ob ihr Haar ordentlich gekämmt war. Bewegte man die Seitenspiegel in die richtige Position, bestand die Möglichkeit, sich von allen Seiten zu betrachten, das fand der Junge sehr spannend. Begab man sich ins Wohnzimmer, sah man auf der Fensterbank den Volksempfänger, oder Radio „VE 301“, stehen. Es gab damals auch den teureren Gemeinschaftsempfänger, die Goebbelsschnauze, nach Adolf Hitlers Pressesprecher Dr. Goebbels so genannt. Mit dem aus Bakelit gegossenen, günstigen Geräten, die im Schnelllauf produziert wurden, wollte man an das Volk treten, sie dienten der Propaganda und verfügten lediglich über zwei Wellenlängen. 1933, am 01. Januar, war die Machtübernahme der Nazis und Goebbels wollte ein preiswertes Gerät auf den Markt bringen, welches sich jeder leisten konnte. So wurde schließlich die einfache Ausgabe für ca. 78 RM auf den Markt gebracht. Die Bezeichnung (VE 301) hatte eine Bedeutung, VE stand für Volks Empfänger und die Zahl 301 für den 30. Januar, weil das Gerät dann erstmals vorgestellt worden war. Das Radio war schwarz, hoch und schmal und unterhalb sah man die Skala mit dem Suchlauf. In der Mitte, über das runde Lautsprecherloch, war grobe Jute gespannt. Links und rechts befanden sich die Knöpfe für das Einstellen von Empfang und Lautstärke. Das Gerät, nicht einfach zu bedienen, musste immer mit beiden Händen manipuliert werden, um einen guten Empfang zu erreichen. Für das Abhören der Sender hatte man die monatliche Gebühr von 2 Reichsmark zu entrichten, was sich fast jeder noch leisten konnte. Schaute man im Wohnzimmer nach rechts, stand dort die lange Anrichte. Ein besonders edles Stück, das mit geschwungenen Türen und Reliefarbeiten verziert war. Darüber links und rechts angebracht die hohen Vitrinen, in denen verschiedene langstielige Gläser standen. Was Alexander damals faszinierte, war, dass man bei der Anrichte Tablare ausziehen konnte, um Porzellan und Besteck zu platzieren. Hatten seine Eltern Gäste, wurde das gute Porzellan mitsamt hochpoliertem Silberbesteck aus dem Kasten geholt. Mutter legte das steif gestärkte blütenweiße Tischtuch mit Spitzenbordüren auf den Tisch. Darauf kamen die weißen Porzellanteller mit den blauen Blumen und das silberne Besteck besonders gut zur Geltung. Deckte sie den Tisch für die Gäste, durften ihr die Jungen lediglich zusehen, denn immer hatte sie Angst um die guten Stücke, welche sie hütete wie eine Glucke ihre Eier. Im gleichen Raum existierte ein eleganter Ofen, der bis zur Decke reichte und mit weißen Kacheln besetzt war. Beheizte man den, entstand schnell eine wohlige Wärme im Raum. In den kälteren Monaten, wenn man die Zeit zu Hause bei stundenlangem Spiel am Tisch verbrachte, genoss man es besonders, nicht frieren zu müssen. Schach oder Kartenspiel, das war in der Familie ein beliebter Zeitvertreib. Darüber hinaus widmete sich Alexander auch gerne seinem Metallbaukasten. Mit den metallenen Grundplatten konnte man nach Plan etwas aufbauen und zusammenschrauben, das machte dem Jungen großen Spaß. Der dunkle wuchtige Esstisch, an dem sie spielten, war aus Holz und rund um den Tisch herum platziert standen die mit Leder überzogenen Stühle. Schwere und dicke goldfarbene Vorhänge hingen von der Decke herunter und bedeckten beidseitig die weißen, feinen Gardinen. Im Herrenzimmer oder Raucherzimmer, so nannten sie den Raum, stand ein ausziehbarer Tisch mit dazugehörenden Stühlen. Mit gemustertem, hellgrauem Stoff war ein protziges Sofa überzogen, das zusammen mit zwei passenden Sesseln an einer Wand stand. Über dem Sofa hing das große Ölbild, mit goldfarbenem, breitem Rahmen eingefasst, auf dem ein Segelschiff zu sehen war. Alex stand oft als Knabe staunend davor, er fand das Gemälde wunderschön. War Besuch im Haus, lief alles immer nach dem gleichen Muster ab. Die männliche Gesellschaft verzog sich nach dem Essen ins Herrenzimmer, um dort bei einem Cognac und üblicher Zigarre ihre eigenen Gespräche zu führen. Die Bezeichnung des Raumes sagte eigentlich alles. Frauen und Kinder hatten dort nichts zu suchen, das wusste jeder und hatte es zu respektieren. Durch die Türe vernahm man das angeregte Gespräch der Männer, diese trennte das Wohnzimmer von dem besagten Gemach. Die Frauen der Schöpfung beschäftigten sich mit dem Abwasch und der Jungmannschaft. Im Herrenzimmer stand ein dunkelgrauer Kanonenofen aus Gusseisen, der wurde am Morgen selbstverständlich schon eingeheizt, wenn männliche Gäste geladen waren. Mit alten Zeitungen und kleinen Holzspänen entfachte man das Feuer und auf die Glut gab man anschließend Eierkohle, die langanhaltende Wärme abgab. Später, als Dora von ihrem Mann getrennt lebte und der Raum nicht mehr benutzt wurde, diente dieser bald schon dem älteren Sohn Malte als Schlafraum. Alex nächtigte weiterhin bei seiner Mutter im Zimmer, dort war Platz genug für zwei.
Zur damaligen Zeit war es noch selten, dass jemand ein Badezimmer in der Wohnung besaß, wie es heutzutage nicht mehr wegzudenken wäre. Man wusch sich in der Küche am Abwaschbecken mit Waschlappen und Seife, auch die Zähne putzte man dort. Die Familie war im Besitz einer Zinkwanne, die am Sonnabend zum wöchentlichen Bad jeweils aus dem Keller in die Wohnung getragen wurde. Alles sich Befindliche im Raum musste im Vorfeld zur Seite geschoben werden, damit die Wanne überhaupt in der Küchenmitte Platz fand. Auf dem Herd erhitzte man in großen Mengen das Wasser, welches nachträglich in die graue Zinkwanne gegossen wurde. Die Küche hüllte sich jeweils in dichten Nebel, es dampfte und man konnte kaum noch etwas erkennen. Nicht jeder hatte sein eigenes Badewasser, alle benutzten sie dasselbe. Nur wurde mit einem Henkelgefäß immer wieder mal Wasser ausgeschöpft und durch heißes ersetzt. Dieses wöchentliche Ritual war ein angenehmes Vergnügen, aber gestaltete sich als unglaublich zeitaufwendig. Im Winter legte Mutter die Badetücher immer auf den geheizten Ofen, und wenn man aus der Wanne stieg, hüllte man sich im warmen Tuch ein. Ihr temporäres Badezimmer war sehr klein und ungemütlich. Hätte es kein Fenster gehabt, wäre es eher einer Abstellkammer gleichgekommen. Der Herd in der Küche wurde wie die Öfen mit Kohle beheizt. Das setzte voraus, dass täglich eingefeuert wurde, wenn man etwas Warmes auf den Teller bringen wollte. Die Kohle des täglichen Bedarfes trugen meist die beiden Jungen in Metalleimern vom Keller hoch. Heizte Dora ein, und es wollte sich kein rechtes Feuer entwickeln, ergab sich oft ein beißender Qualm in der kleinen Küche. Man drohte im Rauch beinahe zu ersticken, wedelte mit beiden Händen und riss schnellstens das kleine Fenster zum Hof auf. Das Klo befand sich auf einer der unteren Etagen im Haus, welches man mit vier anderen Familien zu teilen hatte. Man war also gezwungen, die Wohnung zu verlassen, um die Notdurft zu verrichten. Über die geschwungene Holztreppe erreichte man die Toilette und war dann heilfroh, wenn man nicht anzustehen brauchte. Im Winter gefror stets das Wasser in den Leitungen, eine mühsame Angelegenheit. Eine Petroleumlampe stand hinter der Schüssel und blieb über den ganzen Winter dort stehen, um die Installation eisfrei zu halten. Mit der Flamme der Petroleumlampe taute man die jeweils vereisten Rohre auf, damit das Spülwasser wieder floss. Klopapier schnitt sich jeder im eigenen Haushalt aus alten Zeitungen zurecht. Die Seiten wurden anschließend mit einer dicken Nadel auf eine Hanfschnur aufgezogen. Lief man zum Klo, trug man das Papierbündel wie eine Handtasche mit sich. Nicht sehr angenehm, sich mit dem rauen Papier den Hintern zu reinigen, aber man kannte nichts anderes. Im Keller des Hauses befand sich eine große Waschküche, welche nur über den Hof zu erreichen war. Hof und Grundstück waren umzäunt von einem Holzzaun, welcher dunkel gestrichen war. Betrat man durch die Eingangstüre vom Hof her die Waschküche, so stieß man rechts des Eingangs auf zwei Zinktröge, die auf einem massiven Eisengestell standen. Der große Waschkessel aus Kupfer, der ebenfalls mit Kohle beheizt werden konnte, befand sich in der Ecke und rechts davon stand die Mange. Lange hölzerne Wäschekellen, die wie übergroße Kochlöffel aussahen, hingen verteilt an einer Wand. Hatte Dora Waschtag, war Alexander oft dabei. Er erwies sich als guter Helfer und so durfte er ihr beim Mangen der nassen Wäschestücke helfen. Mutter fischte die heiße, gekochte Wäsche mit einer der langen Holzkellen aus dem Kupferkessel und gab sie in einen der zwei Tröge. Das dampfte und es hüllte sich alles wie beim Baden in der Küche in dicken Nebel. In den Trögen spülte Dora die Wäschestücke gründlich durch und zu guter Letzt kam dann Alexanders Einsatz. Die Mange war eine Maschine mit zwei dicken Gummirollen, die über einem viereckigen Trog angebracht waren. Durch die wurde die nasse Wäsche gedreht, was zur damaligen Zeit eine große Hilfe für jede Hausfrau darstellte, denn sonst hätten sie die Wäsche per Hand auswringen müssen. Betätigen konnte man die Rollen per Handkurbel, es war eine Knochenarbeit für den Jungen. Er half Mutter im Freien auch beim Spannen der Wäscheleinen, die sie an der Hausmauer an Haken einhängten und an den Stangen, die im Hof eingemauert waren, fixierten. War das Wetter gut, wurde die Wäsche im Hof auf die gespannten Leinen gehängt, ansonsten schleppte Mutter die schweren Wäschekörbe zum Trockenboden, welcher sich im Dach des Hauses befand. Waschtage gestalteten sich zur damaligen Zeit als sehr streng und beanspruchten einen ganzen Tag, und das von früh bis spät.
Einschulung
Alexander wurde am 01. April 1936 in Hamburg-Harburg eingeschult, da war Vater aber noch zu Hause. Er besuchte die Volksschule, die eine reine Knabenschule war. Nach Beendigung dieser kam er mit zehn Jahren in die Mittelschule. Sein Bruder Malte, damals schon in der Oberschule, war ein besonders guter und fleißiger Schüler, dem das Lernen besonders leichtfiel. Auch Alex bereitete der Schulstoff nicht große Mühe, er fühlte sich oft unterfordert. Überaus gerne ging er jedoch nicht hin, verrät er mir grinsend. Seine Mutter war stets die treibende Kraft und erbarmungslos bestand sie darauf, dass die Schularbeiten minuziös erledigt wurden. Man schrieb noch mit dem Griffel auf die schwarze Schiefertafel. „Wie mir das hörbare Kratzen des Griffels beim Schreiben auf die Tafel auf die Nerven ging, es tat mir in meinen Ohren weh, aber man hatte es hinzunehmen“, Alexander lacht. „Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern erst gewesen. Schrieb ich etwas nicht zur Zufriedenheit von Mutter, putzte sie mit feuchtem Schwamm das Geschriebene bis zur Unkenntlichkeit aus. Wie habe ich mich dann über sie aufgeregt, das kann ich dir ehrlich eingestehen. Danach kam ihre Ermahnung, es das zweite Mal richtig zu machen. So kratzte ich verärgert weiter mit dem Griffel auf meiner schwarzen Tafel. Zwar oftmals mit etwas Missmut, jedoch bemüht, es besser zu machen, ich kannte die Konsequenzen.“ In der Schule hatte Alexander einen strengen Lehrer, der aber zu allen Knaben gerecht war, er mochte ihn gut leiden. Dieser Lehrer brachte es fertig, seine Schüler zu motivieren, und es gab fast keinen Jungen, der am Ende des Jahres ungern den Unterricht bei ihm besuchte. Er bestrafte die Knaben auch nicht mit dem Stock, wie es zur damaligen Zeit üblich war, sondern bediente sich seiner eigenen Methoden. Die Schüler, welche nicht gehorchten oder den Unterricht störten, mussten nachsitzen, die Hausaufgaben erledigen oder etwas schreiben. Alexander kam immer ohne Strafe davon, er war ein gehorsamer und angepasster Schüler, der nie auffallen wollte und das tat, was von ihm verlangt wurde. Damals waren die Klassen sehr groß, meist mit bis zu vierzig Schülern in einem Unterrichtsraum. Für den Lehrer bestimmt nicht einfach, da die Übersicht zu behalten. Deshalb bedienten sich sicherlich auch viele Pauker der berüchtigten Stöcke, mit denen sie die Kinder züchtigten und so zum Gehorsam erziehen wollten. Damals gab es auch zu Hause keinerlei Unterstützung der Eltern, wenn Kinder von den Lehrern geschlagen wurden. Manch einer hütete sich davor, zu Hause davon zu erzählen. Die Angst war zu groß, auch dort zusätzlich eine Ohrfeige oder eine Tracht Prügel zu erhalten. „Glücklicherweise schlug mich meine Mutter nie.“
An seinem zehnten Geburtstag, es war ein Mittwoch am 28. August 1939, da benahm sich Mutter geheimnisvoll. Sie wollte mit ihm am Nachmittag in die Innenstadt laufen, warum ihr aber so viel daran lag, wusste der Junge nicht und er kam auch nach langem Raten zu keinem Ergebnis. Die beiden zogen nach dem Schulunterricht am späteren Nachmittag los und bewegten sich zu Fuß Richtung Stadt. Alex begleitete seine Mutter mit Gefallen, wenn es zum Einkaufen in die Stadt ging, denn meistens schaute eine Kleinigkeit für ihn dabei heraus. Und so vermutete er, werde das auch am heutigen Tag der Fall sein. „Diesen Geburtstag werde ich mein ganzes Leben lang nie vergessen, als ich mit Mutter zusammen das Geschäft betrat. Da standen Fahrräder in allen Größen und ich durfte mir dann tatsächlich eines davon aussuchen“, erzählt er. Ausschließlich für ihn allein, er konnte sein Glück kaum fassen. Seine Mutter erzählte ihm, das Geld von seiner Großmutter väterlicherseits erhalten zu haben. Er selbst war der Überzeugung, dass sein Vater diese Sache beeinflusst hatte, denn bei seiner Großmutter wusste er nicht so recht. Er hatte immer ein sonderbares Gefühl im Bauch, wenn er Großmutter gegenüberstand. Er wusste wohl, dass er bei ihr nicht besonders hoch im Kurs war. Das störte ihn lange nicht mehr, er war es gewohnt, in der zweiten Reihe zu stehen und hatte es schon lange aufgegeben, über das Warum zu grübeln. Der ältere Enkel, sein Bruder, der war ihr wichtiger und ans Herz gewachsen, wie sie es oft auch verlauten ließ. Jetzt sollte er ausgerechnet von ihr dieses Fahrrad erhalten haben, das war sonderbar. Die Großeltern besaßen ein vornehmes Haus in einer bevorzugten Lage von Harburg-Eisendorf. Alexander war manchmal zu Besuch bei seiner Oma, aber diese Begegnungen empfand er nie als herzlich und es blieben ihm auch keine schönen Erinnerungen an diese Momente. Er mochte seinen Opa viel lieber leiden, der kam oft zu Besuch und immer dann, wenn er von seiner Arbeit nach Hause lief, schaute er kurz vorbei. Oma kam selten, denn sie konnte sich nicht damit abfinden, dass ausgerechnet ihr Sohn eine einfache Frau geheiratet hatte. Alexander wusste von seiner Mutter, dass sie vom Lande war und in primitiven Verhältnissen herangewachsen war. Im Gegensatz zu Oma, die aus gehobenen Verhältnissen stammte und einen anderen Lebensstil pflegte.
Als er mit seiner Mutter, die ihm beratend zur Seite stand, im Geschäft das passende Fahrrad der Marke Adler gefunden hatte, wurde dieses gleich seiner Größe angepasst. Man entfernte den bestehenden Sattel, denn dieser war für den Knaben um einiges zu hoch. Damals befestigte man einen neuen an der Querstange hinter dem Lenker. Diese Möglichkeit bot sich bei dem Fahrradmodell glücklicherweise an und so konnte der stolze Junge sich mit seinen Füßen am Boden abstützen. Nach der Anpassung nahmen Mutter Dora und ihr Sohn das Rad gleich mit. Oh, wie er sich freute. Zu Fuß begaben sich die beiden wieder nach Haue und Alexander konnte es kaum abwarten, sein Rad das erste Mal auszuprobieren. Zu Hause angekommen war es dann so weit, er setzte sich auf den Sattel des Rades und die ersten Versuche vorwärtszukommen, gelangen schon recht gut. Er stellte die Füße auf den Boden und mit gehenden Bewegungen kam er gut voran. Jeden Tag machte er Fortschritte, traute sich, die Beine anzuheben, um in das Pedal zu steigen. In Kürze entpuppte er sich als geübter Radfahrer, was ihm großen Spaß bereitete. Für dieses großartige Geschenk war er seiner Oma unendlich dankbar und schrieb ihr auch bald schon einen langen Brief, auf den sie allerdings nicht reagierte.
Wie gut es war, dass seine Mutter sich entschlossen hatte, das Rad am selben Abend noch mitzunehmen, das stellte sich am darauffolgenden Tag heraus. Im einzigen Fahrradgeschäft von Harburg wurden alle Fahrräder für das Militär konfisziert, hieß es. Harburg war eine Industriestadt und beinahe alle Geschäfte wurden von Juden betrieben, so auch das Fahrradgeschäft, in dem sie am Vortag eingekauft hatten. Danach wusste man, dass wieder einer ins Konzentrationslager gebracht worden war, dem man zuvor alles weggenommen hatte.
Nach und mit Beginn der Machtübernahme von Adolf Hitler 1933 wurden der staatliche und einzige Verband deutscher Jugend für Knaben (DJ) und für Mädchen der BDM (Bund deutscher Mädchen) gegründet. Dann später, im Jahre 1939, wurden diese zu einer gesetzliche Jugenddienstpflicht umgewandelt. Alle männlichen Jugendlichen in Alter von zehn Jahren mussten dem Jungvolk beitreten. Alexander kam dazu am 01.10.1939, kurz nach seinem zehnten Geburtstag, er war zum damaligen Zeitpunkt stolz dabei zu sein. Den ersten Tag beim Jungvolk erlebte er wie eine lose Zusammenkunft von Jugendlichen. Alles war für ihn wie ein Spiel, wie mit seinen Spielkameraden in dem ihm vertrauten Park. Das Erste, was den Neuankömmlingen vermittelt wurde, war sich in Dreierreihen lose zu formieren, auf Befehl des Jungzugsführers still und stramm zu stehen. Danach hieß es, rührt euch und immer wieder die gleichen Befehle, bis alles blind funktionierte. Das fand Alexander noch lustig und es gefiel ihm, es den Erwachsenen gleichzutun. Später kamen dann die Übungen rechts um, links um, rührt euch, stillgestanden, im Gleichschritt marsch. Alexander hört es noch heute in seinen Ohren, links, zwei, drei, vier, links, zwei drei, vier. So lernten die Knaben, mit Befehlen und Gehorsam umzugehen, zu marschieren und das im Alter von nur gerade zehn Jahren. Der feinfühlige Alexander hatte noch keine Ahnung, was ihm bevorstand, und wofür er da mit vielen anderen Knaben gedrillt wurde. Es war alles so spannend, vieles erlebte er, was ihm zu Hause nicht geboten wurde. Die Pimpfe (Bedeutung Furz oder Zünder für einen Marschflugkörper), so nannte man die Knaben im Sprachgebrauch. Jeder besaß zwei Uniformen, eine leichtere für den Sommer und eine wärmere diente der Zeit für kalte Monate. Ein braunes Hemd mit langen Ärmeln, die kurze dunkle Hose mit Gürtel gehörten zur Ausstattung. Um den Hals trug man ein dunkles Tuch, das mit einem braunen Lederknoten zusammengehalten wurde und am linken Ärmel die rote Bandage mit schwarzem Hakenkreuz. Zur Winterausstattung kriegten die Pimpfe eine lange warme Hose, dazu noch eine Schildmütze, mit Ohren- und Nackenklappen. Jeder erhielt beim Eintritt auch ein Fahrtenmesser, oder Kampfdolch, so nannte man den, war aber als Waffe glücklicherweise untauglich. Er erinnert sich zurück und erzählt, wie stolz und erfreut er über seinen neuen Besitz war. Wie er sich in voller Montur im Spiegel von Mutters Kommode damals von allen Seiten immer wieder betrachtete. Geschenkt wurde die Ausstattung keinem, denn seine Mutter musste dafür bezahlen. Sie hätte dieses Geld damals bestimmt besser einsetzen können, schimpfte sie oft. Diese Ausgaben zu meistern, das war damals bestimmt nicht einfach für Mutter Dora. Alexander schaute mich an und sagt: „Oh, ich höre heute noch, wie sie darüber fluchte und dabei erzürnt sagte: Das haben wir alles diesem Hitler zu verdanken! Hätte sie das während des Krieges gesagt, wäre sie gleich hops gegangen und im Konzentrationslager zur Umerziehung gelandet, wie es damals hieß“, sagt Alexander. Dora war immer schon eine Gegnerin Hitlers, jedoch außerhalb der Wohnung war sie vorsichtig mit ihren Äußerungen. Alexander warnte seine Mutter oft, sie solle mit ihren gewagten Worten etwas vorsichtiger umgehen, die sie bislang glücklicherweise nur zu Hause verlauten ließ. Er hatte Angst um sie, außerdem wusste man nie, wo sich der Feind gerade befand, sogar die Wände hatten Ohren. Zur damaligen Zeit durfte man keinem trauen, nicht einmal seinem besten Freund. Der junge Alexander war durch sein Mitwirken beim Jungvolk beinahe schon fanatisch und überzeugt von dem, was er lernte und schon gelehrt hatte. Dass die ganze Sache einen militärischen Hintergrund anstrebte, bekam er erst später mit, als er alles besser verstand. Die Absicht, welche hinter allem verborgen blieb, eröffnete sich dem jungen Alexander mit zunehmender Reife und Hinterfragung vieler Dinge. Die Pimpfe wurden militärisch und sportlich geschult, auch Loyalität und Gehorsam gehörten zum Pflichtenheft. Man musste auch einen Teil von Hitlers Lebenslauf kennen, des Horst-Wessel-Liedes mächtig sein, dessen Melodie von Josef Hayden komponiert wurde. Den Text habe er immer noch präsent und er beginnt zu singen: „Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen! SA marschiert mit ruhig, festem Schritt. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unsern Reihen mit.“ Diese politischen Lieder hatten etwas Kämpferisches und rissen die Masse mit. Im Jungvolk lernte er viele solcher Lieder und sang auch selbst kräftig mit. Die Bedeutung der Texte war ihm nicht wichtig, er verstand sie nicht. Vielmehr waren es die Melodie und der Rhythmus, die diese Lieder für ihn ausmachten. Erst später erkannte er die Bedeutung der Texte, die ihn zum Nachdenken anregten. Einmal pro Woche trafen sich die Pimpfe, in Uniform gekleidet, in einem Gebäude, das nur dem Jungvolk zur Verfügung stand. Im Fähnlein der Gruppe wurden die Kinder politisch geschult, erzogen und gefügig gemacht. Ebenfalls wurde den Jungen erklärt, warum Hitler gegen die Juden war. Juden wurden so dargestellt, dass nur sie das Geld besaßen. Damit konnten sie ihre Geschäfte betreiben und sich alles kaufen, während die anderen zu wenig zur Verfügung hatten. Geld muss doch jeder zum Überleben haben, so fasste das Alexander auf und er verspürte eine große Ungerechtigkeit. Wenn die Juden das ganze Geld besaßen, war es ja klar, dass die Eltern davon wenig besaßen. Dazu bestand noch die Pflicht, die Kosten der Uniformen für die Kinder zu tragen, das tat Alexander leid. Es entwickelte sich allmählich auch in den Reihen des Jungvolkes Zorn gegen die Juden. Man spürte, wie auf den Straßen Unmut wuchs und die Juden zunehmend gemieden wurden. Man betitelte sie als Diebe der Nation. Leute, mit denen man sich zuvor auf der Straße ausgetauscht hatte, die man gerne mochte, denen wich man plötzlich aus. Zu sehen waren in Hetzzeitungen Karikaturen von Juden, dargestellt mit langen, spitzen Hakennasen. Die bösen, verzerrten Gesichter, auf einen Blick schreckliche, angsteinflößende Gestalten. „Wenn ich mich an jene schlimmen Zeiten erinnere, könnte ich vor Scham heulen“, sagt Alexander. „Dass wir als zehnjährige Kinder schon erfolgreich negativ beeinflusst wurden, indem man uns weismachen wollte, man werde von Juden des Geldes beraubt, war kriminell. Wir Kinder glaubten das, und es hatte zur Folge, dass auch wir in unserem noch jugendlichen Alter die Juden hassten. Wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, muss ich zugeben, dass es damals leicht war, die öffentliche Meinung zu manipulieren“, sagt Alexander. „Die Menschen hatten keine Arbeit, das tägliche Leben war schwierig, und so war es für Hitler leicht, ein ganzes Land in seinen Klauen zu halten. Gott sei Dank ist es heute nicht mehr so einfach, weil die Menschen anfangen, nachzudenken.“
Die Schwertworte der Pimpfe lauteten: Jungvolkjungen sind hart, schweigsam und treu, Jungvolkjungen sind Kameraden und des Jungvolksjungen Höchstes ist die Ehr. Als Pimpfe hatte man die Möglichkeit, sich Abzeichen zu verdienen: Eisen im Alter von 15 Jahren, Bronze ein Jahr später, Silber mit 17 Jahren und zuletzt Gold mit Eichenkranz. Viele Jahre später verstand jeder diese Taktik sehr gut, sie war motivierend und zielgerichtet. Heute kann Alexander dazu nur eines sagen: „Ich konnte mir keine Abzeichen verdienen, denn mittlerweile war ich sehr kritisch geworden, besonders dem gegenüber, was geschah und mir undurchsichtig vorkam. Wenn mir etwas nicht gefiel, habe ich oft nachgefragt und galt deswegen bei Führern und meinen Kameraden als steter Nörgler. Das jedoch beeindruckte mich kaum, denn ich musste und wollte die Wahrheit erfahren.“ Sein noch so junges Leben ging weiter, der Winter 1939 stand vor der Tür und es nahte die Weihnachtszeit. Meistens gab es zu Weihnachten etwas Schnee und so bot sich die Gelegenheit, in das nahe gelegene Erholungsgebiet Haake zu gehen, denn nur dort konnte man rodeln. Dieses Gebiet erreichte man mit einer Stunde Fußweg, es war weit, jedoch für Alexander normal und immer ein großartiges Erlebnis. Mutter Dora begleitete ihren Sohn gerne und so war das Vergnügen auf dem Berg mit ihr zusammen doppelt so schön. Immer bevor sie zusammen den Heimweg antraten, wurde die große Butterstulle verdrückt und dazu gab es Tee. Mutter trug den Proviant, den sie zu Hause hergerichtet hatte, immer in dem braunen, mit Lederriemen versehenen Rucksack mit. Um sich für den erneut stündigen Fußmarsch zu stärken, brauchte man nach so einem Tag schon etwas Deftiges.
Auf dem Platz roch es nach Tannenharz und Süßigkeiten, es herrschte eine besondere Stimmung. Der Hauch von Zimtgeschmack, der dem Glühwein beigemengt wurde, durchströmte die Luft am Weihnachtsmarkt. Dora und die beiden Knaben liebten diese Zeit besonders. An Heiligabend zogen die drei los, um sich den Christbaum in der Innenstadt auf dem Rathausplatz zu besorgen. Immer beim gleichen Krämer, Herrn Lehmann, der seinen Verkaufsstand am Weihnachtsmarkt betrieb, schauten sie als Erstes vorbei. Alexander kicherte und sagte: „Die Auswahl des Baumes war schon eine Herausforderung. Drei Meinungen und unsere Mutter brachten wir zur Verzweiflung. Schau der, oder doch den anderen und schon sahen wir Brüder noch einen schöneren Baum. In der Tat, nach langem Hin und Her wurde dann schließlich entschieden und den Schönsten kaufte man.“ Es standen in der Adventszeit viele verschiedene Stände am Rathausplatz und die Marktleute boten so manches an verlockenden Waren an, die man als Geschenke zum Fest erwerben konnte. Man sah in fröhliche Gesichter, die durch die Gassen des Marktes schlenderten. Es herrschte eine entspannte und friedliche Stimmung. Die drei Besucher interessierte, wie viele andere, was alles ausgestellt auflag, und sie blieben an einigen Ständen stehen, um die zum Teil selbst hergestellten Geschenkartikel zu bewundern.
Es nahte Heiligabend und die Buben schmückten am Morgen des 24. Dezember mit ihrer Mutter zusammen den in der Wohnstube aufgestellten Baum. Mit den goldenen Kugeln und dem schmucken Lametta und den weißen Kerzen sah er sehr schön aus, der Weihnachtsbaum von Dora und ihren Kindern. Die Spannung wuchs. Was es wohl dieses Jahr zur Bescherung geben würde, fragten sich Alexander und sein Bruder Malte. Sie konnten den Abend kaum erwarten. Vor der Bescherung bereitete Mutter immer das Wunschessen der Söhne zu. Es gab heiße Wienerwürstchen mit feinen, krossen Brötchen, das Festessen war perfekt. Auf dem Tisch standen die selbstgebackenen Kekse, dazu gab es Datteln und Orangen. Schokolade, die in einer Pappschachtel mit weihnachtlichen Motiven verziert war, fehlte an Weihnachten nie. Zu dem damaligen Zeitpunkt konnte man noch alles kaufen, was im darauffolgenden Jahr bereits nur noch mit Lebensmittelkarten zu erstehen war. Nun war es endlich an der Zeit, die Geschenke durften ausgepackt werden. Die Freude von Alexander war unbändig, denn er erhielt von Mutti seinen ersten Fotoapparat, dabei handelte es sich um die Agfa Box. Die obligaten Strümpfe und Unterhosen, die man ja gut gebrauchen konnte, interessierten Alexander an dem Abend kaum. Mutter Dora erhielt von ihren Söhnen einen verchromten Teekessel, den sie in der Küche gut einsetzen konnte. Alexander liebte die besinnliche Weihnachtszeit. „Ach, war das immer schön. Wie mir die schönen traditionellen weihnächtlichen Melodien aus dem Radio damals schon gefielen. Ich genoss das gemütliche, stimmungsvolle Beisammensein“, schwärmt er. Das neue Jahr stand vor der Tür, dazu wünschten sich die Leute Glück, Gesundheit und Zuversicht. Viele fragten sich, was es wohl bringen würde, das Jahr 1939. Wie sich die Zukunft gestalten werde, man ahnte Schlimmes.
Am 01. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall durch die deutsche Wehrmacht in Polen. Ein trauriges Kapitel hatte seinen Anfang genommen. Männer und ihre Söhne wurden eingezogen und mussten in den Krieg ziehen. Viele davon würden nie mehr nach Hause zurückkehren, dessen war man sich bewusst, das Leid war unbeschreiblich. Familien, deren Oberhaupt jetzt allein die Mütter waren, hatten eine schwere und harte Zeit vor sich. Wie lange diese Misere dauern würde, darauf gab es zum damaligen Zeitpunkt keine Antwort.
Im Oktober wurden die Lebensmittel rationiert. Ab diesem Zeitpunkt konnte jeder nur noch mit Lebensmittelkarten, die vom Staat ausgegeben wurden, einkaufen. Mit der Rationierung, die während des Krieges und bis 1950 galt, war eine bessere Kontrolle und Verteilung für die Bevölkerung gewährleistet. Für z. B. 30 Gramm Käse oder ein Ei wurde eine Marke mit Ablaufdatum ausgegeben. Ohne Marke bekam man nichts und die Einkaufstasche blieb zwangsläufig leer. Für jeden gekauften Artikel bezahlte man den Warenwert und gab dem Händler die ausgeschnittene Marke. Der Kaufmann klebte sie auf ein Blatt, wie das später abgerechnet wurde, weiß Alexander nicht mehr genau.
Die Hitlerjugend war 1930 eine wichtige Organisation im nationalsozialistischen Deutschland, die dazu diente, die Jugend körperlich und ideologisch auf die Ziele des Regimes vorzubereiten. Eine der vielen Aktivitäten, die von der HJ organisiert wurden, war das Basteln und spätere Präsentieren von Modellflugzeugen. Diese Aktivitäten sollten nicht nur technische Fähigkeit vermitteln, sondern auch den Gemeinschaftsgeist stärken. Alexander erinnert sich, wie an einem sonnigen Nachmittag im Frühjahr 1940 am Uferplatz Tische aufgebaut und diese mit dünnem Karton abgedeckt wurden. Die Tische waren ordentlich in Reihen angeordnet, und jeder Junge hatte seinen eigenen Platz, um sein Modellflugzeug zu präsentieren. Die selbstgebauten Flugzeuge aus Pappe waren in den Originalfarben bedruckt, einige trugen Markierungen und Abzeichen, die den echten Fliegern nachempfunden waren. Eine große Menge an Zuschauern, darunter neugierige Passanten und Eltern, sammelten sich um die Tische, um die handwerklichen Fähigkeiten der Jungen zu bewundern. Wärend der Präsentation erklärten die Jungen mit Begeisterung die Besonderheiten ihrer Modelle und die Techniken, die sie beim Bau des Fliegers angewendet hatten. Alexander war an diesem Tag aus einem besonderen Grund am Uferplatz. Er wollte sich unbedingt einige von diesen Flugzeugmodellen kaufen. Er ging von Tisch zu Tisch, bewunderte das handwerkliche Geschick, das in jedes der Modelle eingeflossen war. Zudem war er von der Leidenschaft und dem großen Wissen der Jungen, die alle etwa 14 Jahre alt waren, begeistert. Man konnte, sich die Flugzeugtypen, die zur Besichtigung aufgestellt waren, als Bastelbögen erstehen. Kaufte man einen davon, erhielt man auch gleich den Uhu Kleber dazu. Es waren nicht nur deutsche Modelle zu kaufen, sondern auch englische Flieger, wie zum Beispiel die Spitfire. Alexander erwarb damals die ME-109, die Stucka und ein Sturzkampfflugzeug, dazu noch den Bomber ME-111 und einige Modelle mehr. Mit den Modellfliegern unter dem Arm verließ Alexander den Uferplatz. Er wusste, dass er mit diesem Kauf eine neue Leidenschaft, eine Quelle der Kreativität entdeckt hatte. Viele Stunden verbrachte er am Tisch und schnitt die vorgedruckten Bögen sauber aus. Mit großer Sorgfalt, Freude und Hingabe klebte er die Modelle so zusammen, wie ihm das die Jungen am Uferplatz erklärt hatten. Ganz zum Schluss zog er noch Fäden zum Aufhängen ein. Die fertigen Flieger hingen später, mit Erlaubnis seiner Mutter, im Schlafzimmer an der Decke. Stolz betrachtete und fotografierte Alexander seine schwebenden Flugzeuge mit der Agfa Box, um dann anschließend die Erinnerungsbilder in seinem Album zu archivieren.
Sechs Wochen nach Alexanders Eintritt in die Mittelschule, am 01.04.1940, da fielen die Bomben auf den Stadtteil von Harburg. Zur damaligen Zeit sah man überall in der Stadt Werbung hängen, darauf las man in fettgedruckter Schrift: Mütter, verschickt eure Kinder. Traurig, aber wahr, muss ich gestehen und ein Schauer durchfährt meinen Körper. Bin ich dankbar, dass ich nicht in dieser instabilen Zeit zur Welt kam. Die Kinder, die damals in der Zeit des Dritten Reiches ihre Jugendjahre verbrachten, wurden derer beraubt. Leider werden solche Zustände niemals der Vergangenheit angehören, denn bis heute hat sich die Vernunft der Menschheit nicht verbessert und die Welt wird niemals ohne Krieg sein. So kam es, dass Mädchen und Knaben, auch Alexander, auf die Reise geschickt wurden. Die Kinderlandverschickung (KLV) war ein Programm im Dritten Reich, das wärend des Zweiten Weltkriegs organisiert wurde, um Kinder aus bedrohten Städten in sichere ländliche Gebiete zu bringen. Nebst dem Schutz vor Luftangriffen hatten diese Verschickungen noch einen anderen Sinn. Die Lager wurden von speziell ausgebildeten Jugendleitern geleitet, die die Kinder nach nationalsozialistischem Muster erziehen sollten. Von den Eltern getrennt sein, das fiel manchem Kind besonders schwer. Mit großer Angst und der Sorge, dass während ihrer Abwesenheit zu Hause etwas passieren könnte, sie bei der Rückkehr aus der Fremde ihre Eltern nicht mehr lebend sehen würden, war eine zusätzliche Belastung.
Erste Kinderlandverschickung Bamberg-Bayern
Die erste Kinderlandverschickung war im April 1940 und dauerte bis im September 1940. Den Eltern wurde dringend empfohlen, ihre Zustimmung zu geben. Besonders Kinder aus stark betroffenen Kriegsgebieten wollte man schnellstens wegbringen. Eltern durften ihre Kinder auch zu Hause behalten, oder aufs Land zu Verwandten bringen, das war jedem freigestellt. Die Knaben der Mittelschule von Hamburg wurden per Bahn transportiert, um dort von den Bombenangriffen verschont zu bleiben. Alexander erzählte mir, dass jedes Kind vor der Verschickung geprüft wurde und sich einem Eignungstest zu unterziehen hatte. Jüdische oder schwer erziehbare Kinder hatten keine Möglichkeit wegzugehen, es war ein aussichtsloses Unterfangen. Kosten für die Eltern entstanden bei der Landverschickung keine, denn der Staat übernahm Reise und Verpflegung. Alle Knaben der Mittelschule, insgesamt vier Klassen mit 80 Schülern, hatten sich jetzt für die Verschickung vorzubereiten. Die Reise führte die Kinder nach Bamberg in Bayern. Damals war es für die Behörden eine gewaltige logistische Leistung, muss man ergänzend erwähnen. Alexanders Mutter war sehr traurig über die Entscheidung, die sie fällen musste. Das geschah allein zum Wohl ihres jüngeren Sohnes. Ihr blieb nichts anderes übrig, so packte sie den Koffer für ihren elfjährigen Sohn für das bevorstehende Reiseziel. Wie lange die Kinder in der Fremde bleiben mussten, wusste am Tag der Abreise keiner. Der Vormittag im Frühjahr 1940, ein wunderschöner Morgen, die Sonne schien und man hätte meinen können, die Schüler würden einen Ausflug machen. Die Stimmung war derart gut und viele freuten sich auf das bevorstehende Abenteuer. Andere aber weinten, klammerten sich an ihre Eltern, sie wollten nicht weg von daheim. Während die Kinder mit ihren Lieben





























