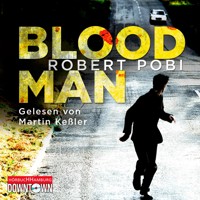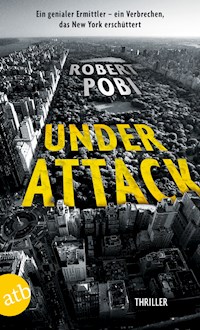
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Dr. Lucas Page Thriller
- Sprache: Deutsch
Feuer in New York.
An einem Oktoberabend wird in dem weltberühmten Guggenheim-Museum in New York eine große Gala gefeiert. Bis eine Explosion die Nacht erschüttert und viele Menschen in den Tod reißt. Doch wo ist das Motiv? Beim FBI beschließt man, sich ungewöhnliche Hilfe zu holen. Lucas Page, genialer Astrophysiker, versteht es, einen Tatort auf besondere Weise zu lesen. Doch kaum beginnt er zu ermitteln, werden er und seine Familie bedroht ...
Ein Kriminalroman mit einem ungewöhnlichen Helden – Lucas Page ist ehemaliger Agent und ein brillanter Spurenleser.
»Ein ungewöhnlicher Plot … explosiv spannend.«Wall Street Journal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
An einem scheinbar ruhigen Oktoberabend ist das weltberühmte Guggenheim-Museum in New York City wegen einer privaten Gala eines Technologieunternehmens geschlossen. Bis eine Explosion die Nacht erschüttert und 702 Menschen in den Tod reißt – während der Schaden am Gebäude selbst minimal ist. Eine Explosion dieser Art kann kein Zufall sein, daher mobilisiert das FBI alle Kräfte, doch die schiere Zahl der Opfer überfordert ihre Ressourcen. Waren alle 702 Opfer zur falschen Zeit am falschen Ort, oder gab es nur ein Ziel und 701 unglückliche Umstehende? Brett Kehoe, der verantwortliche Special Agent in Manhattan, beschließt, sich ungewöhnliche Hilfe zu holen. Lucas Page, genialer Astrophysiker, Universitätsprofessor und ehemaliger FBI-Agent, versteht es, einen Tatort auf besondere Weise zu lesen. Obwohl Page nichts mit dem FBI zu tun haben will, wird seine Stadt angegriffen und seine Familie bedroht, so dass er eingreift, um einen Mörder zu finden, bevor dieser wieder zuschlägt.
Über Robert Pobi
Robert Pobi war Antiquitätenhändler, bis er sich entschied, freier Autor zu sein. Er lebt in einem kleinen Haus in den Bergen - ohne Telefon und Internet. Wenn er eine E-Mail scheiben will, fährt er in eine Kleinstadt acht Meilen entfernt. Im Aufbau Taschenbuch erschien von ihm bisher der erste Roman mit Lucas Page: „Manhattan Fire“.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Robert Pobi
Under Attack
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Thon
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
1.: Solomon R. Guggenheim Museum, New York City
2.: MONTAUK, NEW YORK
3.: SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM
4.: MONTAUK, NEW YORK
5.
6.
7.: LONG ISLAND
8.
9.: FBI-KOMMANDOFAHRZEUG
10.: 26 FEDERAL PLAZA
11.: CNN-BÜROS IM TIME WARNER CENTER, COLUMBUS CIRCLE
12.: 26 FEDERAL PLAZA
13.
14.
15.
16.: CNN-EILMELDUNG
17.: 26 FEDERAL PLAZA
18.: WALL STREET
19.: MIDTOWN
20.: UPPER EAST SIDE
21.: 52. STRASSE WEST
22.: UPPER EAST SIDE
23.
24.: TRIBECA
25.: 72. ECKE BROADWAY
26.: 60 HUDSON STREET
27.: 111 EIGHT AVENUE
28.: 111 EIGHT AVENUE
29.: UPPER EAST SIDE
30.
31.: UPPER EAST SIDE
32.: UPPER EAST SIDE – FIFTH AVENUE
33.: FIFTH AVENUE
34.
35.: PELHAM GARDENS
36.: PELHAM GARDENS
37.
38.: SIEBENUNDFÜNFZIGSTE STRASSE
39.: UPPER EAST SIDE
40.: UPPER EAST SIDE
41.: LIGHTHOUSE PARK, ROOSEVELT ISLAND
42.: UPPER WEST SIDE
43.: UPPER EAST SIDE
44.: 26 FEDERAL PLAZA
45.
46.
47.
48.: 57. STRASSE ECKE FIFTH AVENUE
49.: 26 FEDERAL PLAZA
50.: MEDUSA, NEW YORK
51.
52.: HOCKNEY BUILDING
53.: COUNTY ROUTE 357 UPSTATE NEW YORK
54.
55.: FOREST HILLS, QUEENS
BROOKLYN
HOBOKEN, NEW JERSEY
CASTLETON CORNERS, STATEN ISLAND
56.: 26 FEDERAL PLAZA
57.: PALISADES PARKWAY
58.: 26 FEDERAL PLAZA
59.: PALISADES PARKWAY
60.: 26 FEDERAL PLAZA
61.: PALISADES PARKWAY
62.: 26 FEDERAL PLAZA
63.: UPPER EAST SIDE
64.: COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER FORT LEE, NEW JERSEY
65.: BLEECKER STREET
66.: COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER FORT LEE, NEW JERSEY
67.
68.
69.: ABC 7 EYEWITNESS NEWS
70.: COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER FORT LEE, NEW JERSEY
71.: FORT LEE, NEW JERSEY
72.: UPPER EAST SIDE
73.
74.
75.: EAST VILLAGE
76.
77.: UPPER EAST SIDE
78.: UPPER WEST SIDE
79.: UPPER WEST SIDE
80.: UPPER EAST SIDE
81.: UPPER WEST SIDE
82.: UPPER WEST SIDE SONNENAUFGANG
83.: UPPER EAST SIDE
84.: 26 FEDERAL PLAZA
85.: COLUMBIA UNIVERSITY
86.: 26 FEDERAL PLAZA
87.
88.
89.
90.
91.: UPPER WEST SIDE
92.: 33°03'50.7''N 117°48'31.0''W – VOR DER KÜSTE SÜDKALIFORNIENS
93.
94.
95.: ZWANZIG MEILEN VOR DER MARCH AIR RESERVE BASE, SÜDKALIFORNIEN
96.
97.: 26 FEDERAL PLAZA
98.
99.
100.
101.
102.
103.: 81. STRASSE WEST
104.: COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER
105.: COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER
106.: UPPER EAST SIDE
Impressum
Wer von diesem Thriller begeistert ist, liest auch ...
1.
Solomon R. Guggenheim Museum, New York City
Dana Goldrich fragte sich, der wievielte Drink es mittlerweile war. Der fünfte? Der achte? Im Grund spielte es keine Rolle, denn dies hier war ihr letzter. Na ja, nicht unbedingt der allerletzte, aber derjenige, der sie über die Grenze von nicht beschwipst genug zu nahezu volltrunken befördern würde. Es war eine schmale Demarkationslinie, deren behutsame Überschreitung Dana dreißig Jahre lang bei Golfturnieren, Wohltätigkeitsauktionen, Galas mit fünfstelligen Beträgen pro Gedeck, endlosen Unternehmensevents und vielen Nächten allein in ihrem Haus in Connecticut perfektioniert hatte. Und sie genoss die Übung.
Aber sie wollte nicht so viel trinken, dass sie sich blamierte. Ihr Vater hatte sie gelehrt, dass es nichts Schlimmeres gab als einen Säufer, der die Kontrolle über sich selbst verlor. Also war das hier der letzte Schluck aus dem Brunnen. Doch um sicherzugehen, dass die Dinge nicht aus dem Ruder liefen, beschloss Dana, ein Gelöbnis abzulegen, und fuhr die schweren Geschütze auf: »großes Pfadfinderehrenwort«, »Kleiner-Finger-Schwur«, »Indianerehrenwort« (war dieser Ausdruck politisch noch korrekt?), »Hand aufs Herz« und »Bei meinem Leben«.
»Bei meinem Leben« erfüllte die meisten Kriterien. Schließlich wurde dieses Gelöbnis durch die romantische Vorstellung erhärtet, der Tod sei der Ehrlosigkeit vorzuziehen.
Bei meinem Leben, dachte sie inbrünstig.
Als sie zur Verstärkung ihres Schwurs zusätzlich die Hand aufs Herz legte, verschüttete sie etwas von ihrem Wodka, was sie aus irgendeinem Grund urkomisch fand. Sie leckte die Tropfen von ihrem Daumen und beschloss, die spiralförmige Rampe im Museumsinneren hinaufzugehen.
Alle Anwesenden schienen sich großartig beim Small Talk oder beim Fachsimpeln zu amüsieren, das sich an diesem Abend vorzugsweise um zwei Themen drehte: Umwelt und Aktien. Beim Thema Umwelt ging es um Recycling, Nachhaltigkeit und alternative Energien, bei den Aktientipps um Gewinnmaximierung. Für Dana war die hier versammelte Mischung aus Ökofreaks und Dotcom-Abgreifern eine explosive Melange, die nur auf einen Funken wartete, bis sie einem um die Ohren flog. Es war unvermeidlich, dass einer der Bäume-Umarmer irgendwann einen Risikokapitalgeber beleidigte, so dass sich die Lage erhitzte und jemand jemandem einen Drink ins Gesicht schüttete. Vielleicht warf man einander sogar Unflätigkeiten an den Kopf. Dass es zu Schlägereien kam, bezweifelte Dana. Die Wall-Street-Typen mochten sich für brutal halten, zogen aber eher den Schwanz ein, als sich die Fresse polieren zu lassen. Aber auch ihre Widersacher, die Anti-CO2-Ausstoß-Freaks, neigten eher zu Massenumarmungen als zu Massenschlägereien.
Danas Mann Sheldon, meist »Shelly« genannt, mischte sich irgendwo im Atrium unter seine Hedgefonds-Kumpels. Dana überflog das Meer von Abendkleidern, aber es waren bestimmt 500 Leute hier. Die Hälfte davon trug Smokings, einschließlich der Kellner. Dazu kam, dass Shelly nicht besonders groß war, also hätte Dana ebenso gut in einem Eiskübel nach einem Diamanten suchen können. Was ihr letztendlich ganz recht war. Sie hatte kein Interesse, Shelly dabei zuzuhören, wie er einen seiner Fonds anpries. Zurzeit waren ausländische Rentenfonds der Hit, meist von den Saudis abgesichert.
Natürlich redeten alle über das Unternehmen, das die heutige Veranstaltung ausrichtete, Horizon Dynamics. Shelly war ganz aus dem Häuschen wegen eines Gerüchts, das unter seinen Kumpels kursierte. Angeblich erwartete sie alle heute Abend eine sensationelle Ankündigung, die sämtlichen Beteiligten ein Vermögen einbringen würde, wenn der Börsengang morgen früh über die Bühne ging. Offenbar war das nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn Dana hatte bereits gehört, wie einige Gäste über Möglichkeiten diskutierten, die Steuer auszutricksen.
Dana bewegte sich mit bedächtigen Schritten die Korkenziehergalerie des Museums hinauf. Die koordinierten Bewegungen sprachen dafür, dass ihr Blutalkoholwert nahezu perfekt war. Sie hatte es mal nachgelesen, es war ein simpler biologischer Vorgang: Ethanol, das die Blut-Hirn-Schranke durchdringt, stört das Gleichgewicht, weil der Mensch sein Innenohr von den Haien geerbt hat. Es war eine so schlichte Weisheit, dass man beinahe darüber stolperte. Was Dana auch prompt tat, doch sie fing sich am Geländer ab. Und verschüttete noch mehr von ihrem Cocktail.
In Sheldons Büro stolperte sie ein zweites Mal, diesmal über die Gemahlin eines Kundenbetreuers, eine Frau mit einem dieser scheußlich-süßlichen Saccharin-Spitznamen, an die Dana sich nie erinnern konnte. Muffy oder Missy oder so ähnlich. Sie war in Begleitung einer Schickimicki-Freundin im Cruella-de-Vil-Look, komplett mit einer zweifarbigen Marmorwelle.
Als Muffy/Missy Dana sah, quietschte sie und tippte aufgeregt wie ein Zwergspitz mit den Füßen auf. »Dana! Was für eine entzückende Überraschung.« Ihre Gesichtsmuskeln bewegten sich kaum, aber sie schaffte es immerhin noch, ihre Lippen zu einer Grimasse zu formen, das die meisten Menschen mit etwas Wohlwollen als Lächeln interpretieren würden.
Dana hielt ihren Drink vorsichtig vom Körper weg und beugte sich vor, um mit Muffy/Missy Luftküsse zu tauschen. »Wie schön, Sie zu sehen …«, säuselte sie und versuchte, sich an den Namen der Frau zu erinnern.
Muffy/Missy stellte ihre Cruella-Freundin vor, aber deren Name ging im Lärm unter. Cruellas Gesicht zeigte das Ergebnis der gleichen taxidermischen Verfahren, so dass ihr Mund wie eine überbackene Pizzatasche aussah.
Noch mehr bussi, bussi.
Muffy/Missy fragte nach Danas Kindern, obwohl sie gar keine hatte, und wollte wissen, wann sie und Sheldon, den sie »Shelbon« nannte, mal wieder auf ein fabelhaftes Wochenende zum Strand kommen würden. Dabei waren sie noch nie dort gewesen.
Dana deutete vage auf eine Stelle weiter oben auf der Rampe. »Ich bin in ein paar Minuten zurück«, log sie. »Ich habe jemandem versprochen, mit ihm über ein Praktikum für eines seiner Kinder zu sprechen. Wir sehen uns später.«
Muffy/Missy schien es zufrieden, und sie und Cruella entschwebten weiter nach unten.
Während Dana sich zum Oberlicht und den Konfetti-Maschinen hocharbeitete, ignorierte sie den Großteil der ausgestellten Kunstgegenstände. Die Dekoration, denn mehr war es in Wirklichkeit nicht, war eine Mischung aus Ansel Adams’ ikonischen Fotografien von Bergen und Wäldern der USA und Andy Warhols massenproduzierten Drucken diverser Wegwerfartikel. Die Wall-Street-Typen warfen mit Begriffen wie »Juxtaposition«, »Negativraum« und »ungezügeltem Konsumverhalten« um sich, als ob sie diese Begriffe verstünden oder sich tatsächlich dafür interessierten.
Dana arbeitete in der Kunstabteilung von Christie’s und erkannte Werbung, wenn sie welche sah. Betrachtete man Warhols Konservensuppen-Drucke neben einem von Adams’ Sierra-Nevada-Panoramen, konnte man die Botschaft nicht übersehen: zu viel Müll, zu wenig ökologische Weitsicht. Genau deshalb waren sie alle hier: Horizon Dynamics würde die Welt verändern. So verkündeten es auch die siebenstöckigen Folienbanner, die von der Decke hingen, mit einem klassischen Werbeagentur-Zielgruppen-Slogan: Wir lösen schon heute die Probleme von morgen!
Die Arbeiten von Warhol sahen für Dana aus wie T-Shirt-Aufdrucke. Sicher, es war populär. Sicher, man wusste sofort, was man vor sich hatte. Sicher, es war der Zeitstempel einer bedeutenden kulturellen Epoche. Doch wenn Dana sich die Poster und Siebdruckporträts anschaute, sah sie bloß ein Albino mit verrückter Perücke vor sich, das sich aufgerafft hatte, Kunst zur Massenware zu deklarieren.
Warhol war Maßstab sowohl für den versierten Sammler wie auch für den Anleger; er war eine globale Marke, ein Logo mit hohem Wiedererkennungswert. Dabei spielte es keine Rolle, ob es sich um Brillo-Schachteln, ein mit Tarnfarbe verfremdetes Porträt von Jagger oder eine seiner frühen Schuh-Zeichnungen handelte – sie alle waren Ikonen. Es war viel einfacher, einen Warhol bei einer Auktion zu ersteigern, als sich den Kopf darüber zu zermartern, wieso ein kleines Gemälde mehr wert sein konnte als ein großes. Um eines der 250 Exemplare der »Campbell’s Soup II« von 1969 zu erwerben, handsigniert und mit aufgestempelter Seriennummer, musste man nur einen Katalog lesen können.
Bei Ansel Adams war die Sache schwieriger. Sicher, auch er war ein amerikanischer Gigant. Und dass seine Arbeiten hier neben Warhol hingen, einem Symbol für Massenkunst und Massenware, wirkte auf Dana wie ein bissiger Seitenhieb; schließlich war Adams eine Ikone der Naturschützer, zumindest in den Vereinigten Staaten. Doch sie wusste, dass nicht jeder Adams’ Botschaft kapierte. Wenn sie mit Kunden über ihn sprach, bestand die größte Hürde immer darin, die Leute dazu zu bringen, Adams’ Fotos mit anderen Kunstformen gleichzusetzen. Es war traurig, wie sehr der Mann in einer Zeit, in der sich jeder mit einer Handykamera für einen Fotokünstler hielt, an Bedeutung eingebüßt hatte. Aber für Dana war Adams’ Arbeit wie die Lektüre des amerikanischen Dichters Walt Whitman. Entweder man kapierte es, oder man kapierte es nicht. Und die meisten Leute kapierten es nicht.
Etwa auf halber Höhe der letzten Spirale merkte Dana, dass ihr Glas leer war. Da sie das meiste vom Drink verschüttet hatte, hatte sie wohl Anspruch auf Ersatz. Aber das, schwor sie sich erneut, war es dann auch. Nur noch ein einziger, ein allerletzter Drink, dann war Schluss für diese Nacht.
Bei meinem Leben.
Dana warf einen Blick über das Geländer hinunter ins Atrium. Die Bar war viel zu weit weg, um sie auf ihren Absätzen erreichen zu können. Und sie war nicht in der Stimmung, unterwegs Muffy/Missy und Cruella über den Weg zu laufen, um über Kinder zu diskutieren, die sie nicht hatte, und über Ausflüge, die sie niemals machen würde.
Dana sah sich suchend nach dem Aufzug um, als die Lichter gedimmt wurden. Sie stützte sich aufs Geländer und blickte in das Atrium tief unter ihr.
Die Streichergruppe stimmte eine verspielte kleine Komposition an, die wie Vogelgezwitscher klang.
Dann schneite es Folienkonfetti aus den Maschinen, die unter dem Oberlicht befestigt waren. Die Schnipsel flatterten als dichter, funkelnder Schwarm in die Tiefe. Laser zuckten durch diese flirrende Wolke, die zu pulsieren und einen Herzschlag zu entwickeln schien. Sie sah lebendig aus, beinahe heiter-verspielt.
Im Atrium brandete Beifall auf.
Hologramme erblühten aus dem Boden und reckten sich dem Folienregen entgegen. Dreidimensionale Baumstämme, die im Zeitraffer wuchsen und deren Äste sich zum Dachfenster reckten. Ihre ausgestreckten holographischen Gliedmaßen verzerrten sich, als sie das herabflirrende Folienkonfetti berührten, und vollendeten die Verwandlung.
Einen Augenblick lang war das Guggenheim ein üppiger, durchscheinender Wald, in dem mächtige Stämme computergenerierter, uralter Bäume in das dichte Blätterdach der Folie ragten.
Das sanfte Zwitschern, das die Geiger erzeugten, veränderte die Tonhöhe und verwandelte sich in die Rufe exotischer Vögel. Jede Stimme klang anders.
Der Raum verschwand, und Dana wurde in eine unendlich ferne Epoche zurückversetzt – eine Zeit, bevor der Mensch auch nur begonnen hatte, sich dem Zufall der Evolution zu nähern.
Sie stimmte in den Applaus der Partygäste ein.
Und dann …
Danas Verstand hatte gerade noch Zeit, den Blitz zu registrieren. Und die erste Millisekunde der Explosion.
Doch all das verschwand, als sie von der Schockwelle zerfetzt wurde.
2.
MONTAUK, NEW YORK
Lucas Page saß auf der Terrasse und dachte nach. Es war schon zwei Uhr morgens durch, aber er hatte sein Zeitgefühl in dieser warmen Herbstnacht verloren. Sie vermittelte ihm den Eindruck, der Winter würde vielleicht nie kommen. Er saß in dem großen Zedernstuhl mit einer Tasse Kaffee, die schon seit Stunden kalt war. Seine lederne Aktentasche mit den Semesterarbeiten, die er durchsehen musste, lag auf dem Holzboden unter seinem Stuhl. Lucas’ Aufmerksamkeit war auf den breiten, nebligen Streifen der Milchstraße gerichtet, während er dem Rhythmus der Brandung lauschte, die an den Strand schlug – ein Zustand, von dem er vermutete, dass er jener Meditation am nächsten kam, von der ihn die Ärzte in der verschwommenen Nomenklatur ihres Berufsstandes zu überzeugen versucht hatten. Selbstversunkenheit und In-sich-Gehen, hatten sie ihn wissen lassen, könne in stressigen Zeiten ein nützliches Hilfsmittel sein. Pustekuchen: Wenn die inneren Stimmen sich erhoben, ließ nichts und niemand sie verstummen. Sie hielten sich an ihre eigene Agenda. Und die Nachrichten, die Lucas sich vorhin angesehen hatte, gaben den Stimmen gute Gründe für eine kleine emotionale Folterstunde. Es ging doch nichts über einen Flashback, um die Stimmen zum Reden zu bringen.
Lucas Page rückte den Kopf auf dem Liegestuhl zurecht und konzentrierte sein gutes Auge wieder auf die Sterne. Hier draußen, abseits der städtischen Lichtverschmutzung, hatte er einen ziemlich guten Blick auf den Himmel, wenn das Wetter mitspielte. Das Teleskop stand draußen, war aber eigentlich für die Kinder gedacht. Es gehörte zu seinen häufig viel zu aufdringlichen Versuchen, ihnen mehr über das Universum beizubringen. Nach dem Abendessen hatten sie abwechselnd einen Blick in den Kosmos geworfen, doch Lucas war mit den Gedanken immer noch bei der Explosion im Guggenheim. Irgendwann waren die Kinder zurück ins Haus gegangen. Offensichtlich machte es keinen Spaß, mit ihm zusammen zu sein, wenn er ihnen keine Aufmerksamkeit schenkte.
Hier draußen zog Lucas das menschliche Auge dem Teleskop vor, weil das Auge ihm erlaubte, seiner Neigung nachzugeben und das große Ganze zu erfassen, ohne sich auf Details konzentrieren zu müssen – ein Problem, das er seit seiner Kindheit hatte. Seine Aufmerksamkeit wanderte von Stern zu Stern, von Sternbild zu Sternbild, vollzog unbewusst ihre Bewegungen am Firmament, während die Minuten verstrichen. Er starrte auf das Siebengestirn der Plejaden und konnte fünf der Schwestern sehen, was zu dieser Jahreszeit mit bloßem Auge nicht schlecht war.
Erin kam zu ihm, setzte sich auf seinen Schoß und verlagerte dabei behutsam ihr Gewicht auf sein gutes Bein. »He, Mr. Man. Ich dachte schon, du wärst schwimmen gegangen.«
Er lächelte in der Dunkelheit. Das Wasser hier draußen war nie warm, aber so spät im Oktober würde man sich unterkühlen, wenn man hineinstieg. Außerdem hatte Lucas, mit oder ohne Prothesen, die Hydrodynamik einer gusseisernen Nähmaschine. »Ich kann nicht schlafen.«
»Also guckst du in den Himmel.«
»Genau.«
Erin nickte zum Teleskop. »Warum benutzt du nicht deinen schicken Kleiderständer?«
»Das Ding ist für die Kinder. Für mich ist es nichts. Zu große chromatische Aberrationen.«
»Was bin ich für ein Dummerchen! Chromatische Aberrationen, was hätte es sonst sein können?«
Er lächelte und beugte sich vor, schob sein Gesicht in das dichte rote Haar, das Erin über die Brust und das blaue Wonder-Woman-T-Shirt fiel. Sie war warm und roch nach dem Bulgari-Parfüm, das einen großen Teil des mentalen Schnappschusses ausmachte, den er stets von ihr mit sich herumtrug. »Ich denke über ein paar Dinge nach, weißt du.«
Sie hatten von dem Moment an, als sie die Nachrichten gesehen hatten, einen stummen Dialog geführt, und auch wenn »ein paar Dinge« keine sonderlich präzise Antwort war, genügte sie.
»Wie lange werden wir uns noch am Strand verstecken?« Erin lehnte den Kopf an seine Schulter und folgte seinem Blick zum Himmel.
Er griff zu dem anderen Liegestuhl und nahm mit der rechten Hand die Decke von der Rückenlehne, um sie Erin über die Schultern zu legen. »Wir verstecken uns nicht.«
»Okay.«
»Wir warten einfach. Ereignisse wie dieses wiederholen sich oft in rascher Folge. Im Moment fühle ich mich hier draußen wohler, wo die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kinder in die Luft fliegen, statistisch gesehen nicht so groß ist.«
Ihr Schweigen ließ ihn erkennen, dass sie sich zumindest in diesem Punkt einig waren.
Erin zog unter der Decke ihre Füße auf seinen Schoß. »Das Krankenhaus hat sich nicht gemeldet. Das bedeutet, wir mussten keine Überlebenden aufnehmen.«
»Weil es keine gab.«
Als ihr Körper sich versteifte, begriff er, dass sie diese Möglichkeit gar nicht in Betracht gezogen hatte. »Woher weißt du das?«
Die Handy-Schnappschüsse von Passanten, die CNN ausgestrahlt hat, und die Teleaufnahmen vom Guggenheim auf Fox hatten ein grobes Bild geliefert. Das Oberlicht und die Eingangstüren waren mit verheerender Gewalt aus dem Gebäude herausgesprengt worden, aber die äußere Fassade hatte relativ wenig Schaden davongetragen. Ging man von einer Zahl von mehr als fünfhundert Opfern aus, bedeutete das, die Explosion war auf die Vernichtung menschlicher Körper angelegt gewesen, weniger auf die Zerstörung von Inventar. Und es gab nur eine Art von Explosion, die diese beiden spezifischen Anforderungen erfüllen konnte.
»Vertrau mir«, sagte er.
»Sitzt du deshalb hier draußen und schaust in den Himmel, den du offenbar die meiste Zeit uns Menschen vorziehst?«
Er wusste, dass sie das Ende ihres einstudierten Dialogs erreicht hatte. Was bedeutete, dass sie entweder ins Haus gingen oder dass Erin ihm die Frage stellte, die sie bisher vermieden hatte.
Sie lehnte den Kopf an seine Schulter. »Glaubst du, sie werden dich anrufen?«
Yep, werden sie. »Mit Terroristen habe ich nichts zu tun. Zumindest nicht mit dieser Art von Terroristen«, sagte er dennoch.
»Du bist sicher, dass es ein Terroranschlag war?«
»Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir über gar nichts sicher, außer dass eine Menge Leute getötet wurden.«
»Was die Menschheit braucht, ist ein bisschen mehr Menschlichkeit.«
»Was die Menschheit braucht, ist zu beenden, was sie begonnen hat, und endlich auszusterben.«
»Mach nicht auf zynisch. Mit deinem Sarkasmus kann ich leben, weil er meistens Humor hat. Aber du bist viel zu liebenswert, um ein Zyniker zu sein.«
»Sie werden die gesamte amerikanische Geheimdienstgemeinde mobilisieren, um diese Schweinebande zu erwischen. Vielleicht holen sie auch alle möglichen anderen Leute aus der Mottenkiste, aber das ist nicht mein Gebiet. Dieser Abschaum hat eine standardisierte Vorgehensweise und ist meist nicht besonders schlau. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie erwischt werden. Das Bureau könnte mich höchstens bitten, mir ein paar Dinge anzusehen. In dem Fall möchte ich, dass du und die Kinder hierbleiben.« Das war so ehrlich, wie er nur sein konnte.
»Okay. Und nun? Gehen wir ins Bett?« Sie stand langsam auf und stieß sich von seinem Aluminiumbein ab. Dann hielt sie ihm die Hand hin. »Überleg dir deine Antwort gut.«
Sie gingen ins Haus und ließen das Teleskop stehen, auf den klaren Nachthimmel gerichtet.
3.
SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM
Brett Kehoe, der für Manhattan zuständige FBI Special Agent, tigerte durch das Blue-Bird-Kommandofahrzeug und überwachte seine Leute, die sich mit den Officers vor Ort abstimmten. Doch Kehoe befand sich in einer anderen Dimension, in der nichts existierte, nicht einmal das Kommandofahrzeug. Für ihn gab es nur die Videoübertragungen seines Teams, das die Trümmer im Inneren des Gebäudes beseitigte, mehr nahm er nicht wahr.
Die Aufnahmen auf der Monitorwand hätten auch von HD-Kameras einer archäologischen Ausgrabung vom Grund des Ozeans stammen können. Die gebündelten Lichtstrahlen der Quasar-Scheinwerfer durchbohrten die aufgewirbelten Staubwolken, die an aufgewühlten Schlick erinnerten. Die Männer in der speziellen Schutzausrüstung hätten ebenso gut Tiefseetaucher sein können. Ihre chemischen Atemschutzmasken waren Heliox-Helmen nicht unähnlich, und sie bewegten sich langsam und bedächtig. Fehlten nur die Luftblasen.
Die beteiligten Behörden, das New York Police Department, das New York City Fire Department und das FBI, verschwendeten keine Zeit mit der Frage, ob es sich bei der Explosion um einen Unfall gehandelt haben könnte. Das Guggenheim war eines der herausragenden ungeschützten Ziele auf der Anti-Terror-Liste des FBI und eine bekannte Größe in Bezug auf Unfallwahrscheinlichkeit. Schon die Struktur des Gebäudes hätte niemals einen Unfall dieser Größenordnung zugelassen.
Vor allem beunruhigte es Kehoe, dass die Sorte kreativer Massenmörder, die offenbar auch hier die Hand im Spiel gehabt hatten, ihre Verbrechen gern mit allen möglichen zusätzlichen Schweinereien anreicherten: Biologische und chemische Waffen standen ganz oben auf der Liste, gefolgt vom Schreckgespenst der Radioaktivität. Falls ihnen finanzielle Mittel oder die nötige Intelligenz fehlten, konnten selbst minderbegabte Irre den Ablauf ihrer Tat so planen, dass sie das größtmögliche Echo in den Medien hervorriefen: erst einen Haufen Leute umbringen, dann auf die ersten Reporter warten und anschließend ein weiteres Gemetzel anrichten.
Ihre Bemühungen, die Explosion zurückzuverfolgen, liefen nicht sonderlich gut, da kein einziges Handy oder eine Kamera im Inneren des Gebäudes den Vorfall überstanden hatte. Selbst die Hochgeschwindigkeits-Überwachungskameras im Museum hatten nur weißes Rauschen aufgezeichnet, bevor sie sich abschalteten. Ihre letzten Augenblicke waren in der Cloud gespeichert worden, dann hatte die Explosion sie zerfetzt.
Nur ein paar Überwachungskameras im Park hatten ein paar Sekunden brauchbares Material geliefert. Doch selbst als die Ermittler die Aufzeichnung in Zeitlupe ablaufen ließen, sahen sie nur, wie vor dem Hintergrund grellroter Glut das Oberlicht und die Vordertüren herausgesprengt wurden, als wäre im Inneren des Guggenheim ein Vulkan ausgebrochen.
Während die Gefahrgut- und Sprengstoff-Crews das Gelände durchkämmten, tat das FBI, was es am besten konnte: Es machte sich auf die Suche nach Informationen. Die digitalen Teams tauchten in den sozialen Medien in sämtliche Abgründe der Nekromantie ein und durchkämmten Foren, Profile, Websites und Konten. Die zuständigen Stellen des Bureaus hatten sich an das Justizministerium gewandt, das gemeinsam mit dem Heimatschutzministerium nach Gruppen oder Einzelpersonen suchte, deren Profil den psychologischen, politischen oder religiösen Parametern des Geschehens entsprach. E-Mails wurden durchsiebt, Texte und Telefonate aus Datendepots abgerufen, Ankunftslisten von Passagieren und kürzlich gekaufte Flugtickets abgeglichen. Alles im Namen von Big Data, das, soweit Kehoe wusste, diese Leute bereits am Haken hatte.
Die Gästeliste der Horizon-Dynamics-Gala wies 594 registrierte Personen auf, ein Konglomerat aus schwerreichen Investoren und einer nicht minder wohlhabenden, ökologisch orientierten Iss-keinen-Thunfisch-aus-Dosen-Fraktion. Ein ansehnlicher Prozentsatz des Park-Avenue-Vermögens war soeben durch Erbschaft neu verteilt worden. Es würde tränenreiche Gottesdienste und blumige Nachrufe regnen, ehe Manhattan von neuen Bentleys überschwemmt wurde.
Sie hatten 32 Teilnehmer ausfindig gemacht, die vorzeitig abgereist waren. Damit blieben 562 Seelen unauffindbar. Weitere sechzig Opfer hatten für die Cateringfirma gearbeitet, hinzu kamen 42 Museumsmitarbeiter. Zusammen mit den Menschen draußen vor dem Eingang, die von den Flammen gegrillt, und von den Fußgängern, die auf dem Bürgersteig von den explodierenden Glastüren gehäckselt worden waren, zählte man 702 Tote.
Wohlhabende waren mit Wohlhabenden vernetzt, und die Telefone liefen bereits heiß. Kehoe hatte Gespräche mit dem Bürgermeister, dem Gouverneur und dem Generalstaatsanwalt geführt, gekrönt von einem sehr frostigen Austausch mit dem Vizepräsidenten. Die Ermittlungen würden zur öffentlichen Zurschaustellung von Besorgnis werden. Stürzt ein Bus voller Kinder auf dem Weg zum Ferienlager in einen Fluss, zünden die Leute Kerzen an und halten Mahnwachen. Wird ein Haufen reicher Weißer in die Luft gesprengt, geht der ganzen Kontinent auf die Barrikaden. Dieser Vorfall hier würde gute alte amerikanische Prioritäten vom Feinsten zurück ans Licht zerren, die, auf den kleinstmöglichen Nenner gebracht, mit Anbetung des Geldes übersetzt werden konnten.
Kehoe trank den letzten Rest seines Tees und warf den Becher in den Papierkorb, als Calvin-Wade Curtis, Chef der forensischen Sprengstoffeinheit, hereinkam. Curtis hatte drei Dienstzeiten mit einem Bombenentschärfungskommando in Afghanistan abgerissen, wo die Kinetik der Detonationen seine Faszination geweckt hatte. Seine Erfahrung – plus sein Abschluss in Molekularchemie – machte ihn für Kehoe interessant.
Curtis war relativ klein und sah zwanzig Jahre jünger aus, als er war, vor allem wegen seiner geringen Größe und seines zerzausten blonden Haars. Seine Zeit draußen in der weiten Welt hatte den Country-Boy-Akzent nicht mildern können. Er klang immer noch so, als versuche er, einem irgendetwas zu verkaufen. Aber er war clever, redete nicht sehr viel und wusste mehr über Sprengstoff als jeder andere Mensch, den Kehoe je getroffen hatte. Außerdem war er ein hervorragender Bluesgitarrist. Diese Fähigkeit zauberte er jeden Donnerstagabend in einer Bar in der Houston Street aus dem Hut. Seine einzige schlechte Angewohnheit war ein nervöses Lächeln, das er zu den unpassendsten Zeiten aufsetzte. So wie im Moment.
Curtis trug jetzt wieder Uniform, doch die rote Linie auf Stirn und Nase zeigte, wo sich der Schutzanzug und der chemische Atemschutz an seiner Haut festgesaugt hatten, als er inmitten der verkohlten Rigipsplatten und der menschlichen Überreste im Inneren des Museums chemische Archäologie betrieben hatte. Curtis schlug die Tür zu, schenkte sich einen Kaffee aus dem Automaten ein und ließ sich auf den einzigen freien Schreibtischstuhl im Raum fallen.
Dann holte er tief Luft und nickte Kehoe zu. »Chawla hat mich geschickt, um mit Ihnen zu reden.« Samir Chawla war der leitende Special Agent, den Kehoe mit der Untersuchung beauftragt hatte. »Keiner der Filter, Abstriche, Kulturen, Plaketten oder Spektrometer hat irgendetwas Radioaktives, Chemisches oder Biologisches registriert. Es gibt ein paar Exoten, deren Untersuchung ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, aber ich denke, wir haben alles im Griff.« Er trank einen Schluck Kaffee, griff in seine Hemdtasche, holte einen Spurensicherungsbeutel heraus und hielt ihn Kehoe hin. »Aber ich habe das hier gefunden.« Sein nervöses Lächeln war ein wenig abgeklungen, wirkte aber immer noch deplatziert.
Kehoe hielt den Umschlag gegen das Licht. Für ihn sah der Inhalt aus wie eine winzige Menge Zigarettenasche.
Curtis fuhr sich mit der Hand durchs Haar und wischte sie dann an seiner Hose ab. »Ich habe Proben ins Labor geschickt, wo wir sie durch ein Massenspektrometer jagen werden, aber unter dem Mikroskop sieht es aus wie ein MIV, ein metastabiler intermolekularer Verbundstoff. Ich glaube, es war als Konfetti getarnt.«
Als Kehoe den Blick von dem kleinen Umschlag fragend auf Curtis richtete, erklärte der Sprengstoffexperte: »Ein MIV ist ein Nanothermit, ein Nanobrennstoff.«
»Und was bedeutet das?«
»Dass es sich nicht um eine Detonation gehandelt hat, sondern um eine thermobarische oder eine Aerosol-Explosion.« Wieder fuhr Curtis sich mit der Hand durchs Haar. »Das Dach, die Fenster und die Eingangstüren sind regelrecht aus dem Gebäude herausexplodiert. Das war der erste Blitz auf den Überwachungsbildern. Den Leuten im Inneren wurden die Trommelfelle, die Augäpfel und die Lunge von einer Schockwelle zerquetscht, bei der die gesamte Luft aus dem Raum gesaugt wurde. Dabei wurde von ebendieser Luft ein Feuersturm erzeugt, der unter hohem Druck stand. Da der in der Luft schwebende Nanobrennstoff verpufft und nicht im herkömmlichen Sinne detoniert ist, atmeten die meisten Opfer das brennende Zeug ein. Und da die erste Schockwelle dem Hirngewebe nur wenig Schaden zugefügt hat, weil es durch die relativ dicken Schädelknochen geschützt ist, dürften viele Opfer noch Sekunden oder sogar Minuten gelebt haben, nachdem sie gekocht worden sind.« Sein Lächeln schwächte sich bei diesem letzten Satz immerhin ein wenig ab. »Keine schöne Art, abzutreten.«
Für Kehoe war es eine Frage des Stolzes, im Job nie Emotionen zu zeigen. Obwohl er müde war, blieb er sich treu, als er antwortete: »Gute Arbeit.«
Das Gebäude hatte relativ geringfügige Schäden davongetragen, anders als die Menschen, die sich darin aufgehalten hatten. Aber das Museum würde Monate geschlossen bleiben, während die Bauarbeiter versuchten, die Schäden zu beseitigen. Die Fenster waren regelrecht verdampft und einige der Innenwände zertrümmert worden, aber das Guggenheim war noch immer als eines der ehemals markantesten Wahrzeichen der Stadt erkennbar. Das war mehr, als man von den Opfern sagen konnte. Sie sahen aus wie Gussabdrücke aus Pompeji.
Knapp eine Stunde nach dem Anschlag tauchten zwei Vertreter der Versicherungsgesellschaft des Museums auf und verlangten, den Schauplatz besichtigen zu dürfen. Kehoe ließ ihnen nicht einmal die Chance, sich auf die Brust zu trommeln, sondern befahl ihnen, seinen Kommandowagen schleunigst zu verlassen. Aber erst, nachdem er ihnen die Überreste einer jungen Frau unter die Nase gehalten hatte, die wie ein geschmolzener Reifen aussah.
Sie würden wohl nicht noch einmal hier auftauchen.
Kehoe gab Curtis den Beutel zurück und deutete mit einem Nicken zur Tür. Er brauchte frische Luft.
Die beiden traten hinaus in den schwachen Wind des Herbstmorgens. Der Kontrast zu dem stickigen, beengten Innenraum des Kommandofahrzeugs hätte nicht größer sein können. Es war zwar auf dem neuesten Stand der Technik, aber wenn man mehr als die empfohlenen 8,6 menschlichen Körper darin unterbrachte – in ihrem Fall 22,4 Individuen mehr –, wurde der Raum schnell zu einer nach menschlichen Ausdünstungen stinkenden Abstellkammer. Kehoe trat auf den Asphalt und atmete tief ein, überrascht, dass die Luft hier draußen, neben einem nur wenige Meter entfernten Gebäude voller druckgegarter Menschen, so frisch schmeckte.
Sie hatten die unmittelbare Umgebung für den gesamten Verkehr gesperrt. Von der 88. bis zur 90. Straße und von der Fifth Avenue bis zur Park Avenue. Das bedeutete, die Geräusche der Stadt wirkten weniger intim. Alle Autos waren aus der gesperrten Zone abgeschleppt worden, und die Anwohner waren die einzigen Fußgänger, die sich innerhalb des Sperrgebiets bewegen durften, was für die New Yorker Polizei eine Reihe von Problemen nach sich zog, wenn sie die Ausweise kontrollierte. Kehoe war stolz darauf, New Yorker zu sein, wenn auch nur durch Verpflanzung, denn die Bürger der Stadt waren besser als ihr Ruf. Er hatte es während des 11. September und des großen Stromausfalls von 2003 erlebt. Die Menschen spendeten Decken, verteilten Turnschuhe an die Leute in Bussen und U-Bahn-Tunneln und organisierten Eiscreme. Aber dieses Mal fühlte es sich anders an; es schien, als könnte ganz Manhattan jeden Moment durchdrehen. Kehoe und die von ihm fürs Denken bezahlten Analysten glaubten, dass die Social-Media-Kultur dafür verantwortlich war, da sie ständig Trennlinien zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zog und das soziale Gefüge in immer kleinere Stücke zerschnitt, was dadurch verschlimmert wurde, dass viele Menschen mehr und mehr dazu neigten, die Welt in Begriffen wie »Wir gegen sie« zu sehen.
Samir Chawla, der mit den Ermittlungen betraute Special Agent, tauchte mit einem Kaffeebecher in der Hand auf. Curtis steckte den Umschlag mit den Beweismitteln ein, sagte mit seinem allgegenwärtigen nervösen Lächeln: »Ich halte Sie auf dem Laufenden«, und verschwand ohne Händedruck.
»Irgendwas Neues?«, wollte Kehoe von Chawla wissen.
Der leitende Special Agent war ein schlanker Mann, sehnig und topfit, der sich hauptsächlich von Koffein und Salat ernährte. »Bei mehr als 700 Opfern sind unsere Leute unter so vielen Informationen begraben, dass man damit selbst Google ersticken könnte. Ich habe zusätzliche Agenten aus dem Bundespool angefordert. Aus Vermont, Jersey und Massachusetts sind bereits ein paar eingetroffen. Hundert weitere erwarten wir noch. Wir werden in einer der leeren Etagen Arbeitsplätze einrichten. Die Rechenkapazität, die wir bei diesem Fall benötigen werden, dürfte beträchtlich sein.«
Kehoe schaute die Straße hinauf. Die Menge drängte zwar nicht direkt gegen den Zaun, veranstaltete aber bereits eine Menge Lärm. Die ersten Verrückten hatten schon gestern Abend Plakate hochgehalten, auf denen sie den Anschlag als »Operation unter falscher Flagge« bezeichneten, die von der Regierung inszeniert worden wäre. Einige trugen rote Baseballcaps, andere QAnon-T-Shirts, wieder andere Nazi-T-Shirts, und ein paar Spaßvögel waren als Muppets verkleidet. Da es nicht mehr lange bis Halloween war, fanden sich massenweise Kostüme in der Menge, was wiederum ein Sicherheitsproblem darstellte. Kehoe fragte sich, wann genau die Post-Literarität in völlige Dummheit umgeschlagen war. Er versagte es sich, Mitleid mit diesen Leuten zu empfinden, weil sie seiner Meinung nach keinen so großen emotionalen Raum verdienten. Denn was ihn wirklich störte, war ihr unermüdliches Bemühen, ein Wirrwarr von Punkten, die kein erkennbares Muster bildeten, miteinander zu verbinden, wo sie nicht einmal imstande waren, ein funktionierendes Modell auch nur der grundlegendsten Fakten zu erstellen. Das war der Grund dafür, dass sich die Dummen immer dann, wenn es einen Zwischenfall mit vielen Toten gab, massenhaft dazu hinreißen ließen, von einer Verschwörung zu faseln. Kehoe war kein Pessimist; in seinem Job hätte ein Schwarzseher die Klamotten gleich hinschmeißen können. Aber hin und wieder war er versucht, diesem Impuls nachzugeben.
Neben den Gaffern machten ihm die Medien das Leben zur Hölle. Offenbar hatte jeder Nachrichtensender auf dem Planeten eine, wenn nicht sogar mehrere Crews zum Schauplatz der Explosion geschickt. Das bedeutete, fast 2000 Personen aus der Info- und Entertainmentbranche waren vor Ort. Sie hatten Zelte im Park aufgestellt, wurden bis jetzt aber auf Abstand gehalten. Das FBI hatte noch keine umfassende Erklärung abgegeben, außer dass man in der Anfangsphase der Untersuchung eines Vorfalls stecke, der sämtliche Anzeichen eines Terroranschlags aufweise. Diese wenig spektakuläre Aussage brachte viele Journalisten dazu, die Schuld schon jetzt entweder auf muslimische oder auf rechtsextreme Täter zu schieben, je nach Quelle.
Doch im Moment hatte Kehoe andere Probleme, als sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die irgendwelchen Mist absonderten. Er überquerte die Straße zum Tatort. Zwei seiner Mitarbeiter flankierten ihn als Bodyguards. Vor dem Museum blieb er stehen und fragte sich, was für ein Mensch – oder was für Menschen – vor sich rechtfertigen konnten, mehr als 700 Unschuldige bei lebendigem Leib zu kochen. Die dreißig Jahre, die er versucht hatte, den kaputten Rädchen der Gesellschaft geistig eine Drehung voraus zu bleiben, konnten die Abscheu, die er in Momenten wie diesem empfand, kein bisschen lindern.
Obwohl alle Untersuchungsbeamten die gleichen weißen Overalls trugen, hatte Kehoe kein Problem, sein Team von dem der Gerichtsmediziner zu unterscheiden: Die Leute vom FBI durchwühlten die Trümmer, um nach Beweisen zu suchen; die Handlanger der Forensik karrten die Toten aus dem Staubnebel und verfrachteten sie in Transporter, die seit letzter Nacht ständig hin und her fuhren. Zwei weiß vermummte Leute aus dem Büro des Gerichtsmediziners rollten eine weitere Leiche hinaus. Während Kehoe zusah, ärgerte er sich darüber, dass er in Zahlen dachte und nicht in Leben.
Die Gerichtsmedizin verfügte über zwei Stockwerke mit Büros und Laboren in der Innenstadt, besaß aber nicht annähernd genug Kapazitäten, um mit so vielen Leichen fertig zu werden. In einer Lagerhalle, die für genau solche Notfälle vorgesehen war, hatte man eine provisorische Einrichtung aufgeschlagen, in der die Techniker der Gerichtsmedizin während des nächsten Monats heraussortieren würden, welche Leiche zu welchem Namen gehörte.
»Also, was fehlt Ihnen noch?«
Chawla dachte nicht lange über die Frage nach. »Ich brauche mehr Analysten. Und mehr Programmierer. Leute, die gut mit Zahlen umgehen können.«
Hinter Kehoe entstand ein Aufruhr, und er drehte sich um. Seine Männer traten schützend vor ihn.
Ein Typ mit roter Schirmmütze wurde von zwei mit Karabinern bewaffneten Polizisten in der Nähe der Parkmauer auf der anderen Seite der Fifth Avenue in die Zange genommen. Der Zivilist hatte eine GoPro-Kamera auf seiner Mütze montiert und deutete immer wieder darauf. Die Polizisten schüttelten den Kopf, als er schrie, er kenne seine Rechte.
Einer der Beamten streckte die Hand aus und packte Red Caps Ellbogen. Damit überschritt er die Schwelle von wütend zu aufgebracht: Red Cap spuckte den Polizisten an. Kehoe wusste, dass dies das Ende der Auseinandersetzung bedeutete, was der Cop auch sogleich demonstrierte, indem er zu den Plastikhandschellen an seinem Gürtel griff.
Doch Red Cap hatte nicht vor, klein beizugeben. Er täuschte nach links an, duckte sich dann nach rechts und schlängelte sich wie ein drahtiges Äffchen zwischen den beiden Polizisten hindurch.
Die Menge auf der Straße brach in lautes Gebrüll aus, garniert mit Pfiffen und Applaus. Dann skandierten sie: »Go! Go! Go! Go!«
Red Cap rannte auf eine Bahre zu, die gerade in einen der Leichentransporter geladen wurde. »Falsche Flagge! Falsche Flagge!«, brüllte er, während er ein gelbes Teppichmesser schwang.
Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Polizisten schon unmittelbar hinter ihm und rissen ihn zu Boden, als er auf den Leichensack einschlug und schrie: »Das ist eine Attrappe!«
Aber er hatte sein Ziel erreicht, und die gekochte Leiche rutschte aus dem aufgeschlitzten Sack. »Falsche Flagge!«, schrie Red Cap wieder, als die Polizisten ihn auf den Boden drückten.
Der Mann grinste noch triumphierend, als der verkohlte Schädel der Leiche neben ihm auf die Straße klatschte. »Da! Seht ihr den Beweis? Es ist eine Pup…!« Er verstummte schlagartig, als der Schädel der Leiche aufplatzte, so dass sich das gekochte Innere über den Boden verteilte und ihn mit Blut und Gehirnmasse bespritzte.
Red Cap übergab sich, als die Polizisten ihm Handschellen anlegten.
Die Meute auf der Straße brüllte.
Kehoe war beeindruckt, dass die Cops dem Kerl keine Kugel verpasst hatten. Aber ihr Glück würde nicht ewig anhalten – nicht, solange solche Irren frei herumliefen. Irgendwann würde jemand eine Kugel abbekommen, ob zu Recht oder nicht. Und der beste Weg, so einen Zwischenfall zu verhindern, bestand darin, den Anschlag auf das Guggenheim schleunigst aufzuklären.
Kehoe drehte sich wieder zu Chawla herum, der nur den Kopf schüttelte.
»Brauchen Sie mehr rechnerische Feuerkraft?«, wollte Kehoe wissen.
»Ja, Sir.«
»Sagen Sie Whitaker, sie soll am Hubschrauberlandeplatz auf mich warten.«
4.
MONTAUK, NEW YORK
Lucas Page ärgerte sich mit dem Laubbläser herum. Die Prothesenhand war für die Zugschnur nicht zu gebrauchen. Er hatte mit seiner guten Hand ein paar Mal eher halbherzig daran gezogen, hatte damit aber nur die Neugier des Hundes geweckt, der am Garagentor stand und ihn beäugte, als wären ihm plötzlich Federn gewachsen. Lucas war kurz davor, das Gerät durchs Garagenfenster zu schleudern, kam dann aber zu dem Schluss, dass ein Spaziergang am Strand gesünder sei, als sich mit Gartenarbeit abzumühen. Sie machte ihm ohnehin keinen Spaß, noch bedeutete sie ihm etwas. Ginge es nach ihm, könnten sie das gesamte Grundstück pflastern und grün streichen. Außerdem hatten sie jemanden, der sich um die Gartenarbeit kümmerte. Er hieß Mr. Miller und war ungefähr so alt wie die Steine auf dem Grundstück. Er tauchte exakt alle zehn Tage bei ihnen auf, ob bei Regen, Sonnenschein oder Orkan, und wuchtete einen ebenfalls uralten benzinbetriebenen Rasenmäher von der Ladefläche seines rostzerfressenen Ford Pick-ups. Dann mähte er alles auf dem Grundstück platt – Gras, Unkraut, Blumen, Sträucher und gelegentlich auch Kinderspielzeug. Lucas hegte den starken Verdacht, dass sie die einzigen Kunden von Mr. Miller waren.
Sein Bemühen, sich von der gestrigen Explosion in der Stadt abzulenken, musste sich also auf etwas anderes richten als auf Gartenarbeit. Er stellte den Laubbläser neben dem Kombi auf den Boden und versetzte ihm einen Tritt, der das Gerät gegen die Felge des Vorderreifens schleuderte. Der Hund brachte sich in Sicherheit und wich auf die Einfahrt zurück.
»Was ist, Dummkopf? Wie wär’s mit einem Spaziergang?«
Lemmy gab ein Geräusch von sich, das weder ganz Hund noch ganz Mensch war.
»Ich werte das als ein Ja.« Lucas schloss das Garagentor und ging zur Rückseite des Hauses.
Erin hatte die großen Doppeltüren geöffnet, so dass die Vorhänge taten, was sie im Herbst immer taten: Sie wehten in die Küche hinein, als wüssten sie, dass der Winter bevorstand. Die Kinder waren oben und verpulverten zweifellos Datenvolumen auf ihren jeweiligen Geräten. An den Wochenenden war ihnen jeden Morgen eine halbe Stunde erlaubt. Laurie und Alisha spielten höchstwahrscheinlich mit dem Puppenhaus, das Lucas ihnen am Wochenende des 4. Juli auf einem Flohmarkt in der Nähe gekauft hatte.
Das Wochenendhaus der Pages war nicht so groß wie viele der monströsen Strandhäuser hier an der Küste, und jeder Zentimeter des verfügbaren Platzes wurde von den Kindern und ihrem Kram in Beschlag genommen. Aber Lucas war dankbar für diese Zuflucht. Egal, von welcher Seite er es betrachtete, sie konnten sich glücklich schätzen. Ursprünglich war das Haus mit zwei Schlafzimmern ausgestattet gewesen. Sie hatten das größte Zimmer aufgeteilt und den Dachboden zu einem Raum für die Jungs ausgebaut. Da die beiden jüngsten Mädchen in Etagenbetten in einem der Zimmer schliefen, konnten sie alle fünf Kinder relativ gut unterbringen. Lucas hatte einen Teil seiner Kindheit in Pflegefamilien verbracht, darunter sechs Monate, in denen er in einer Badewanne hatte schlafen müssen. Er staunte immer noch über den vielen Platz, den sie hier hatten. Die Kinder kamen gut damit klar, selbst wenn ihre Freunde auftauchten und sie gezwungen waren, die Schlafsäcke herauszukramen.
Erin saß in dem kleinen Büro neben der Küche und erledigte ihre Arbeit für das Krankenhaus aus dem Homeoffice per Laptop. »Bist du mit dem Laub schon fertig?«, erkundigte sie sich, bemüht, den Spott in ihrer Stimme zu verbergen; es war kein Geheimnis, dass Lucas und die Rasenpflege so viel gemeinsam hatten wie Fische und Fahrräder.
»Ich habe mich für den Denkansatz ›weniger ist mehr‹ entschieden.«
Erin setzte ihre Brille ab und legte sie auf die Tastatur. »Und mit weniger meinst du was genau?«
»In diesem speziellen Fall bedeutet weniger gar nichts. Außerdem ist alles relativ. Mein Weniger ist mehr als das Mehr von jemand anderem, und mein Mehr ist weniger als das Weniger eines Dritten. Ich könnte den ganzen Tag über Semantik diskutieren.« Er trat näher und lehnte sich neben sie an die Schreibtischkante. »Und ich kann es sogar unter dem Deckmäntelchen der Quantenmechanik tun.«
Lemmy tappte zu seiner Schüssel neben dem Kühlschrank und schlürfte lautstark etwa so viel Wasser, wie er dabei auf dem Boden verteilte.
Erin berührte Lucas’ Oberschenkel – den echten. »Willst du am Strand spazieren gehen?«
Wie schaffte sie es nur, seine Gedanken zu lesen? »Ich weiß nicht – dieser Laubbläser sieht nach ’ner Menge Spaß aus. Wenn ich nur herausfinden könnte, wie ich das Ding einschalten kann.«
Erin gab ihr kleines, albernes Lachen von sich. »Einen Laubbläser schaltet man nicht ein, man wirft ihn an.«
»Oder gleich weg, so wie ich. Okay, auf zum Spaziergang. Meinst du, die Kinder hätten ebenfalls Lust?« Ihm fiel auf, dass es im Haus kaum Lärm gab. »Sind sie überhaupt da?«
»Sie machen gerade Hausaufgaben. Und Alisha spielt mit ihren Puppen. Ich glaube, sie machen sich Sorgen, dass du wieder zur Arbeit gehst.«
»Kinder?«, rief er ins stille Haus. »Wer hat Lust auf einen Spaziergang?«
*
Eine halbe Stunde später waren sie unterhalb des Bluff Lookout, einem Aussichtspunkt auf einer Felsspitze. Lemmy führte die Gruppe an. Sein Rudelinstinkt ließ ihn nie weiter als zwanzig oder dreißig Meter vorauslaufen, bevor er zurückgerast kam. Maude trug kniefreie Jeans und ein selbstbedrucktes T-Shirt mit der Aufschrift Eric Clapton Sucks! Damien und Hector jagten unten am Wasser nach Montauk-Monstern. Ihre Turnschuhe waren völlig nass, ihre Jeans durchnässt bis zu den Knien. Hector hatte einen sonnengebleichten Krabbenpanzer gefunden, von dem er behauptete, es sei ein Alienschädel. Laurie und Alisha sammelten Steine, die sie in die große Segeltuchtasche packten, die sie Erin zum Tragen aufgeschwatzt hatten. Maude und Lucas bildeten das Schlusslicht.
Lucas steckte zwei seiner echten Finger in den Mund und stieß einen schrillen Pfiff aus, um zu signalisieren, dass es Zeit war, kehrtzumachen. Die Flut kam zurück, und Turtle Cove würde bald voller Fischer sein. Männer in Wathosen und Schwimmern, alle mit Zehn-Fuß-Ruten, auf der Suche nach Streifenbarschen. Manchmal fischten auch Lucas und die Kinder bei auflaufender Flut, aber meistens nach Wittling oder Makrele am Strand vor dem Haus. Von den Wochenend-Anglern, die mit Hunderttausend-Dollar-SUV und Marken-Outdoor-Kleidung aus der Stadt einfielen, hielten sie sich fern. Diese Typen waren viel zu verspannt.
Als sie kehrtmachten, drehte Lucas den Kopf und blickte mit seinem guten Auge auf den Ozean, ehe er auf seine Tochter Maude schaute. »Trotz all der Sommergäste kann das hier ein reizvolles Plätzchen sein, stimmt’s?«
Mrs. Page hatte hier so viele Sommer verbracht, wie sie nur konnte, und sie hatte Lucas mit diesem Ort bekannt gemacht, als er sechs war. Sie hatten es geschafft, hier zehn Sommer zu verbringen, bevor Mrs. Page das Geld ausging. Von da an waren sie auf Einladungen von Freunden angewiesen, wenn sie gelegentlich ein genussvolles Wochenende hier verbringen wollten.
Als sich Lucas und Erin viel später die Gelegenheit bot, das Haus hier draußen zu kaufen, war es wie eine Heimkehr gewesen. Sie nutzten es an Wochenenden und in den Ferien und vermieteten es im Sommer die meiste Zeit, was half, einen großen Teil der Kosten zu bestreiten.
Erst jetzt beantwortete Maude Lucas’ Frage. »Ich glaub schon, dass es hier cool ist.« Sie zuckte mit den Schultern. Auch wenn sie sich zusehends in eine junge Frau verwandelte, konnte sie augenblicklich in die Rolle des mürrischen Teenagers verfallen, wann immer es ihr passte. »Wirst du wieder für diese Leute arbeiten?«
Daraus, wie Maude »diese Leute« sagte, schloss Lucas, dass sie mit Erin gesprochen hatte. »Derzeit nicht. Ich bin nur für einen kleinen Bereich von Problemen zu gebrauchen, und was gestern passiert ist …«
»Die Explosion im Museum?«
»Ja, die Explosion im Museum. Das ist nicht mein Fachgebiet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich von großem Nutzen für sie sein könnte. Jedenfalls nicht so wie beim letzten Mal.«
»Waren es Terroristen?«
Lucas schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Das weiß niemand.«
»Die Leute im Fernsehen scheinen aber ziemlich sicher zu sein.«
»Es gibt viele, die Falschmeldungen verbreiten, und noch mehr, die keine Ahnung haben. Das Problem ist, dass weder die einen noch die anderen sich aufhalten lassen, sobald sie ein Publikum haben – schau dir das Internet an.«
Lucas liebte alle seine Kinder, doch Maude und er hatten eine ganz besondere Verbindung, die er nicht richtig verstand. Vielleicht lag es daran, dass er so hart hatte arbeiten müssen, um ihr Vertrauen zu gewinnen, oder der Grund war schlichtweg darin zu suchen, dass Maude ihn am stärksten an Erin erinnerte. Obwohl es keine genetische Grundlage hatte, da alle ihre Kinder adoptiert waren. Aber es fiel ihm leichter, mit Maude zu reden als mit den anderen Kindern, als würde er sie auf irgendeine seltsame Weise besser verstehen.
Maude blieb stehen und hob einen Stein auf, der vollkommen rund aussah. Sie gab ihn Lucas. »Und?«
Er warf einen Blick darauf und schüttelte den Kopf. »Elliptisch.«
Maude nahm den Stein zurück und betrachtete ihn ein paar Sekunden lang skeptisch.
»Er misst 3 Zoll ∕ an der längeren Achse, und 3 Zoll, ∕ an der kürzeren«, sagte Lucas.
Maude rümpfte die Nase. »Wenn du es sagst.«
»Du kannst es ja nachmessen«, bot er lächelnd an. Aber er lag nie falsch. Nicht bei Zahlen. Und schon gar nicht bei Maßen.
Maude warf den Stein ins Meer. »Wie machst du das?«
»Ist nur ein dummer Trick. So wie bei jemandem, der mit den Ohren wackeln kann.«
Sie zeigte ihm ihr Ekelgesicht. »Nein, ist es nicht. Man muss nicht schlau sein, um mit den Ohren wackeln zu können.«
Lucas zuckte die Schultern; er hatte schon viele seiner Meinung nach dumme kluge Leute getroffen, besonders in der akademischen Welt. »Mag sein.« Er blieb stehen. »Hast du dir schon überlegt, was du wegen der Schule unternehmen willst?« Die Schule, die Maude zurzeit besuchte, war dem klassischen Kompromiss zwischen Kunst und Kommerz erlegen. Es wurde dort nur wenig gelehrt, was die rechte, intuitiv-emotionale Hirnhälfte anregte, wo Maudes wahre Interessen lagen. Alle Beteiligten wussten, dass sie an einer anderen Schule besser aufgehoben wäre. Also hatten sie Vorstellungsgespräche an einer Schule mit fortschrittlichem Kunstangebot geführt. Nach Vorlage ihrer Zeugnisse war man dort sofort bereit gewesen, Maude anzunehmen. Allerdings musste sie sich bis Freitagmorgen entscheiden – eine Entscheidung, die dem Mädchen eine Menge Stress bereitete. Lucas vermutete, es lag daran, dass sie einen Wechsel als Ende und nicht als Anfang betrachtete.
»Du wirst vermutlich härter arbeiten müssen als jetzt, aber dafür ist es weniger wahrscheinlich, dass du so schnell die Lust verlierst.« Er hielt inne. Maude musste sich selbst eine Meinung bilden. »Aber das weißt du ja alles.«
»Du hast gesagt, ich hätte bis Freitag Zeit.«
»Hast du auch.«
»Aber du gehst wahrscheinlich weg und …«
»Das wissen wir nicht.«
Sie blinzelte, als sie ihn anlächelte. »Wissen wir nicht?«
»Nein. Wissen wir nicht.«
Sie beäugte ihn misstrauisch. »Na gut, ein paar Tage mehr werden auch nichts ändern. Okay. Ich mach’s. Ich gehe auf die LaGuardia.«
Lucas drehte sich um und winkte Erin mit seiner Prothese zu. »Maude geht auf die LaGuardia!«, rief er.
Die ganze Familie jubelte.
Ihr Jubel hing noch in der Luft, als Hector rief: »He, da landet ein Hubschrauber vor unserem Haus!«
Lucas blickte den Strand hinunter, als ein marineblauer Jet Ranger dort aufsetzte. Auf der Seite waren drei große gelbe Buchstaben aufgemalt. Der Helikopter wirbelte eine Staubwolke auf, und Unterschall-Schockwellen fegten wie verrückt gewordene Windhosen übers Wasser.
Lucas’ Blick suchte Erin. Sie schenkte ihm ein liebevolles Lächeln voller trauriger kleiner Botschaften.
Er drehte sich wieder zu dem Hubschrauber herum. Die Türen wurden aufgezogen. Zwei männliche FBI-Standardexemplare sprangen heraus. Eins war sehr groß, das andere war XXXL. Nachdem sie auf beiden Seiten des Vogels Stellung bezogen hatten, ging die unverwechselbare Gestalt von Brett Kehoe die kleine Treppe hinunter.
Lucas glaubte schon, diese alberne Endlos-viele-Clowns-aus-einem-Auto-Nummer sei damit beendet, als sich noch eine vierte Figur aus dem Hubschrauber schälte, eine hochgewachsene schwarzhäutige Frau, die selbst aus zweihundert Metern Entfernung eine Mischung von Pheromonen verströmte, die sie als Naturgewalt kennzeichnete. Special Agent Alice Whitaker. Sie war zweifellos als Hebel für Kehoes Version eines emotionalen Druckmittels hier.
»Damit wäre unser Tag wohl F-U-K-T«, stellte Maude neben ihm fest.
»He, Kleine, was hab ich dir gesagt?« Lucas legte ihr die Hand auf die Schulter. »Sei nicht so nachlässig. Wenn schon, dann buchstabiere es richtig.«
5.
Als sie zum Haus zurückkamen, warteten Kehoe und Whitaker auf der Terrasse. Bei Kehoe hatten nicht einmal drei Jahrzehnte beim FBI die edle Patina von altem Geld abschleifen können. Sie gehörte ebenso zu ihm wie Charme, Manieren und die Aura ständiger Bedrohung. Er hatte seine Frisur upgedated, seit sie das letzte Mal zusammen in einem Raum gewesen waren, und in seinen Augenwinkeln hatten sich ein paar Fältchen mehr eingegraben, aber er sah immer noch aus wie das Werbegesicht irgendeines teuren Lifestyle-Produkts. Er trug einen seiner maßgeschneiderten Anzüge mit dem von ihm bevorzugten gesteppten Revers, und er schien sich selbst hier draußen am Strand wohlzufühlen.
Whitakers weißes Leinenhemd kontrastierte stark zu ihrer dunklen Haut und ihren dunklen Augen, und selbst in ihren Ralph-Lauren-Klamotten sah sie aus, als könnte sie ein Rudel Wölfe mit bloßen Händen erledigen. Wie Kehoe hatte auch sie ihre Frisur verändert. Jetzt trug sie einen Pferdeschwanz aus Predator-Zöpfen, die von einem Satelliten-Ingenieur hätten entworfen sein können. Sie lächelte nicht richtig, aber Lucas sah, dass sie sich freute, ihn zu sehen. Widerwillig stellte er fest, dass er genauso empfand – als wären sie alte Kriegskumpel.
Lucas und Whitaker hatten sich im letzten Winter kennengelernt, während seiner ersten Rückkehr ins Bureau nach fast einem Jahrzehnt. Sie war Agentin im Außendienst gewesen, und obwohl Lucas sich gern sagte, er hätte sie ausgewählt, damit sie ihm half, wusste er, dass Kehoe ihm in Wirklichkeit eine Falle gestellt hatte – er hatte ihn und Whitaker absichtlich zusammengebracht und der Chemie den Rest überlassen. Sie hatten von Anfang an eine widerborstige Zuneigung zueinander entwickelt – eine seltsame Art von Chemie, die das Beste in ihnen beiden zum Vorschein brachte. Whitaker war klug, ging einem nicht auf die Nerven und ließ sich vor allem nicht von ihm verarschen, was eine seltene Eigenschaft war. Mittlerweile hatte Whitaker es auf die sehr kurze Liste von Menschen geschafft, denen Lucas sein Leben blind anvertraute, wodurch sie in gewisser Weise zur Familie gehörte.
Kehoes riesenhafte Bodyguards verschwanden zur Front des Hauses, wo sie sich um die beiden Polizei-Geländewagen aus Southampton kümmerten, die gleichzeitig mit dem Hubschrauber aufgetaucht waren. Der ganze Auftritt war höchst dramatisch, besonders für Kehoe, der normalerweise nicht zu Theatralik neigte. Oder zu unnötigen Machtdemonstrationen.
Lucas schickte Erin und die Kinder ins Haus. Die Kinder rannten nach oben, doch Erin blieb in der Küche, lehnte sich mit verschränkten Armen an die Kochinsel und beobachtete das Geschehen aufmerksam durch das große Fenster. Lucas fragte sich, ob Lippenlesen Teil des Superhero Books war, das sie sich zugelegt hatte.
Die verwitterten Balken der Pergola warfen seltsame rechteckige Schatten, die Kehoe in ein Kompositum aus mehreren Porträts verwandelten. Keines davon wirkte glücklich. Die unvermeidliche Mark-Cross-Aktentasche stand auf dem Stuhl neben ihm und strahlte Bedeutung aus. Alle trugen Sonnenbrillen und sahen aus, als wären sie lieber woanders.
Der Pilot hockte auf einem Klappstuhl unten am Strand, speicherte ein bisschen Vitamin D und las in einem Taschenbuch. Kehoes Bodyguards hatten sich mittlerweile an den beiden Ecken des Grundstücks aufgebaut, am Rand des Rasens mit Blick auf den Strand. Die Männer des Sheriffs hatten auf der anderen Seite des Hauses Posten bezogen, oben an der Straße.
Lucas und Kehoe begutachteten sich eine Zeit lang schweigend. Es war Whitaker, die schließlich das Eis mit einem »Nette Frisur« brach.
Maude hatte Lucas überredet, sich die Haare blondieren zu lassen, als Testlauf für ihr Halloween-Kostüm – sie wollte als Sting gehen, und da waren blonde Haare nun mal ein Muss. Angeblich ließ sich die Färbung problemlos auswaschen, aber jetzt, nach drei Tagen, sah er immer noch so aus wie Frankensteins Punk-Rocker-Monster mit einer teuren Sonnenbrille.
Lucas versuchte ein Lächeln. Die Art und Weise, wie Kehoe auf seinem Stuhl hin und her rutschte, ließ ihn erkennen, dass sein Gesicht dabei diese Narbengewebe-Boris-Karloff-Fratze zog, die die Menschen hier so erschreckte. »Danke«, sagte er.
Whitaker schüttelte lächelnd den Kopf.
Kehoe füllte die Leere, indem er eine SMS beantwortete, die zwölfte, seit er sich gesetzt hatte.
Die komplizierte Natur ihrer Beziehung war kein Geheimnis. Sie hatten über eine Spanne von zehn Jahren nicht miteinander gesprochen. Beide hatten dieses Jahrzehnt genutzt, um ein wenig Vergebung für das aufzubringen, was geschehen war, und für die Dinge, die sie beide verloren hatten. Das Ereignis, wie Lucas es nannte, hatte sein Leben auf molekularer Ebene neu kalibriert, und in gewisser Weise hatte es bei Kehoe zweifellos dasselbe bewirkt. Und es war immer noch da, lauerte im Hintergrund wie eine Gravitationswelle aus den Tiefen des Alls, die nur schwer zu entdecken war. Dennoch konnte man unmöglich so tun, als gäbe es sie nicht.
Das Ereignis hätte Lucas körperlich beinahe zerstört, und er hatte die nächsten Jahre damit verbracht, eine Art Wurmloch zu durchreisen und dabei den neuen und verbesserten Dr. Lucas Page zu entdecken. Als er schließlich am anderen Ende herauskam – mit einer kaputten ersten Ehe, ohne Job, ohne Freunde und mit einem Körper, der aus aller möglicher experimenteller Hardware zusammengestückelt war –, kam ein Mann zum Vorschein, den er zwar kaum wiedererkannte, auf den er aber stolz sein konnte. Er lernte Erin kennen und heiratete sie. Sie machten sich daran, eine Familie zu gründen – mit Kindern, die draußen in der Welt keinen Platz fanden. Er nahm einen Job an der Columbia University an. Eher nebenbei schrieb er ein Buch, das es auf die Bestsellerlisten brachte. Mit der Zeit vergaß er, dass er jemals für das FBI gearbeitet hatte. Bis zu jener Nacht im letzten Winter, als Kehoe ihn besucht hatte, mit all den alten Monstern im Schlepptau.
Erin brachte ein Weidentablett mit zwei Tassen Kaffee und einer Tasse Tee hinaus. Sie stellte es auf dem Tisch ab und verschwand wortlos wieder im Haus.
Nachdem sie fort war, verfiel Kehoe in seinen Vortragsmodus mit dem patentierten poetischen Tonfall. »Die endgültige Opferzahl erfahren wir erst in ein paar Stunden. Im Moment stehen wir bei 702, einschließlich des Museumspersonals, der Catering-Angestellten und ein paar unglücklichen Passanten, die zufällig vorbeigingen, als die Sache … überkochte.« Kehoe nahm die Porzellantasse mit dem Tee vom Tablett und trank einen Schluck.
Lucas beugte sich vor und verschränkte die Finger seiner linken Hand mit denen seiner Prothese; selbst in der warmen Herbstluft fühlten sich die Aluminiumfinger auf seiner Haut kalt an. »Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen bei dieser Sache von Wert sein könnte, Brett.« Kehoes einzige unerschütterliche Managementregel lautete, nur die richtigen Leute mit einer Aufgabe zu betrauen. Und da er hier war, hatte er ohne Zweifel alle Aspekte seiner Aufforderung ausgearbeitet.
Kehoe trank noch einen Schluck und stellte seine Tasse auf die Untertasse zurück. »Bei 702 Opfern dürften die Berechnungen eine Herausforderung sein. Dann wären da noch etliche Unbekannte: Motiv, Verdächtiger, Ideologie, Logistik und die Schlussphase. Im Moment haben wir nicht mal einen Ansatzpunkt. Und bislang hat niemand die Verantwortung für das alles übernommen.«
Das war seltsam. Eine so öffentliche Aktion musste einen Zweck haben, und es ging mehr als nur wahrscheinlich um Publicity. »Nichts?«
Kehoe beantwortete kurz eine SMS. »Nichts Glaubwürdiges«, sagte er dann. »Es gab ein paar Tweets von den üblichen Verdächtigen, zwei von Splittergruppen des IS, einer von al-Qaida, aber es war offensichtlich, dass sie keine Ahnung hatten, wovon sie da redeten. Ein paar der vorhersehbaren Verrückten haben ebenfalls versucht, ihre fünfzehn Minuten Ruhm zu bekommen. Anti-Abtreibungsgruppen, Miliztypen, Anhänger der White Supremacy und Zorn-Gottes-Fanatiker, die üblichen Schwachköpfe. Aber es gibt keine offizielle Stellungnahme einer zuverlässigen Organisation oder Gruppierung.« Kehoe spulte die übliche Taktik der Ermittlungsarbeit ab.
»Und die Nachrichten? Wie handhaben die Sender die Angelegenheit?«
Kehoe las eine weitere Textnachricht und entgegnete, während er mit den Daumen eine Antwort tippte: »Zehn Minuten, nachdem sich der Staub gelegt hat, sind sie uns in die Quere gekommen. Ich habe eine tüchtige Mitarbeiterin auf sie angesetzt, aber sie kann den Presseleuten nicht vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben – sie sind mehr auf Unterhaltung fixiert statt darauf, Fakten zu liefern, und werden uns bei dieser Sache verdammt nerven. Mehr als sonst, denke ich.« Er beendete die SMS