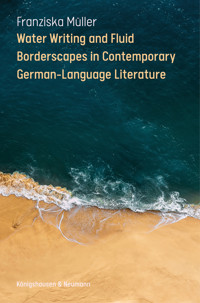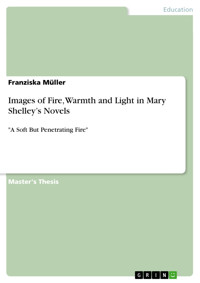Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman über das Erwachen der Seele - poetisch, tiefgründig und voller innerer Freiheit. Lea funktioniert. Jeden Tag. Sie sagt ja, obwohl sie nein meint. Lächelt, wenn sie schreien will. Schluckt, was sie längst nicht mehr erträgt. Sie funktioniert - doch in ihrem Inneren brodelt es. Etwas in ihr will endlich frei sein, will atmen, leben, fühlen. Für ihre Wahrheit ist kein Platz mehr. Und für sie selbst auch nicht. Was sie nicht weiß: Spirit, Leas Seele in Gestalt eines wilden Fohlens, hat genug vom Stillhalten. Er will nicht mehr brav sein. Nicht mehr warten. Er beginnt zu rebellieren - gegen das Vergessen, gegen das Sich-Anpassen. Er will zurück zu sich selbst. Zu dem, was er einmal war: eine undressierte Seele. Frei. Mutig. Klar. Lebendig. Er führt Lea in Begegnungen, die sie verändern, und in Prüfungen, die sie an ihre Grenzen bringen. Mit Witz und Sanftmut kämpft er darum, sie an das zu erinnern, was sie einst wollte - und an das, was sie unterwegs verloren hat: ihre Träume, ihre Lebendigkeit, sich selbst. "Undressierte Seelen" erzählt von der leisen Revolution in uns, die beginnt, wenn wir aufhören, Rollen zu spielen. Von der Freiheit, die entsteht, wenn wir der inneren Stimme wieder vertrauen. Ein Roman über Mut, Wahrheit und die Rückkehr zum eigenen, wilden Kern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Spirits Vorwort
Lea
Spirit
Freddy
Sebastian
Frauke
Deine Zweifel sind deine größten Grenzen!
Deine Liebe ist die Verbindung zu allem, was du dir wünschst!
Du bist nie allein!
Stell dich niemals über die Tiere – sie sind bereits, was du noch werden willst!
Nach dem Leben ist vor dem Leben, aber anders als du denkst!
Frieden entsteht durch Verständnis!
Deine Begeisterung ist der Wegweiser deines Seelenplans!
Spirits Nachwort
Vielleicht war dieses Buch ein Anfang.
Autorenvita
Spirits Vorwort
Ich bin Spirit. Die Seele von Lea. In dieser Geschichte erscheine ich dir als Fohlen – nicht, weil ich tatsächlich ein Tier bin, sondern weil meine Energie genau so am klarsten spürbar wird: undressiert, wach, frei und durch nichts zu zähmen. Verspielt, ungeduldig, voller Bewegung – und mit einem ziemlich klaren Gespür dafür, was ich will. Stillstehen liegt mir nicht besonders. Warten auch nicht.
Ich bin das in ihr, was sich nicht anpasst. Der Teil, der nicht gefallen will, sondern wahrhaft leben. Auch wenn Lea mich nicht sehen kann, bin ich immer an ihrer Seite. Ich bin ihr innerer Kompass. Ihre Erinnerung daran, wer sie wirklich ist. Und manchmal auch ihr sanfter Stupser in die richtige Richtung.
Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie das Leben wirklich funktioniert, was uns lenkt und warum wir manchmal durchs Chaos stolpern oder warum Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Nun, ich bin hier, um dir zu zeigen, dass hinter jedem Moment, jedem scheinbar zufälligen Ereignis, eine größere Kraft steht. Eine Kraft, die das Leben in all seinen Facetten durchdringt. Und ja, du ahnst es: Das ist die Führung, die man nicht ganz greifen kann – voller Energie, Liebe und, wie ich finde, jeder Menge Spaß.
In diesem Buch wirst du Geschichten finden, die dich zum Lachen, Weinen und Staunen bringen. Es sind Geschichten von Menschen, die ihren Weg suchen, und von Tieren, die ihnen dabei helfen. Und ich? Ich bin mittendrin – oft unsichtbar für diejenigen, die mich nicht sehen wollen, aber immer da. Es gibt so viel, das du über dich selbst, über andere und über das Leben lernen kannst – wenn du bereit bist, wirklich hinzusehen.
Manchmal wirst du das Gefühl haben, dass ich die Dinge ganz schön durcheinanderbringe. Glaub mir, das gehört zum Plan. Denn gerade im Chaos entsteht oft das größte Wachstum. Und alles, was geschieht, wird auf eine bestimmte Weise geführt – von der unsichtbaren Kraft hinter allem, von deinem eigenen Seelenplan. Und manchmal, ja, manchmal braucht es nur ein bisschen Mut, um einen Schritt ins Unbekannte zu wagen. Genau wie bei Lea, Freddy, Frauke und Sebastian.
Ich bin hier, um dir zu zeigen, dass das Leben nicht immer perfekt sein muss, um wunderschön zu sein. Und ich will dir Mut machen, deinem eigenen Seelenweg zu vertrauen. Denn auch wenn es manchmal schwierig scheint und du den Sinn nicht sofort erkennen kannst, ist alles, was dir begegnet, genau richtig – für dich, für dein Wachstum und für deine Reise.
Also lehne dich zurück, genieße die Geschichten und vergiss nicht: Egal, wo du gerade stehst, egal, wie verloren du dich manchmal fühlst, du bist nie allein. Denn auch du hast einen Spirit, eine Seele. Und die ist immer da, um dir ein Zeichen zu geben oder um dich zu unterstützen.
Dein Spirit
Lea
Lea und das Leben – die beiden hatten eine etwas komplizierte Beziehung. Während das Leben sich gerne mal einen fiesen Streich ausdachte, gab Lea ihr Bestes, nach außen hin die knallharte Powerfrau zu spielen. Innerlich war sie jedoch weich wie ein Marshmallow – zumindest ein bisschen. Fleißig, immer genau wissend, was sie wollte, und stets bereit, sich die Sorgen anderer anzuhören. Ihr Job als Pferdewirtin? Absolute Leidenschaft, auch wenn er manchmal … na ja, sagen wir, ein kleines bisschen nervig war, weil die Pferdebesitzer durchaus ein wenig anstrengend sein konnten.
Lea versuchte, es allen recht zu machen – ein hoffnungsloses Unterfangen. Es war, als wollte man einen Korb voller Kätzchen zur Ruhe bringen: Kaum hatte man eines beruhigt, sprang das nächste schon aus dem Korb. Der eine Pferdebesitzer wollte mehr Heu für sein Pferd, der nächste weniger – und der Dritte stand plötzlich mit Silage da, weil ihm das Heu „zu staubig“ war. Heu – zu staubig? Im Ernst jetzt?
Lea gab ihr Bestes, alles unter einen Hut zu bringen, doch meistens führte das dazu, dass ihr innerlich die Hutschnur platzte. Nach außen hin merkte das allerdings niemand. Sie war ein Meister darin, ihre Genervtheit zu verstecken.
Bei den Pferden vergaß sie die Zeit. Sie gaben ihr das Gefühl, nichts leisten zu müssen, um geliebt zu werden. Lea vertraute ihnen mehr als ihrer eigenen Spezies und fragte sich manchmal beschämt, ob sie Pferde nicht vielleicht sogar lieber mochte als Menschen.
Die Pferde brachten sie zum Lachen, selbst wenn ihr eigentlich zum Weinen zumute war. Lea liebte ihren Geruch. Für sie rochen sie nach frischem Heu und einem Hauch von Wald und Freiheit. Sie genoss die Ruhe, wenn sie ihnen beim Grasen zusah. Alles schien friedlich, wenn sie bei ihnen war. Nein, es schien nicht nur friedlich – es war wirklich Frieden.
Nichts in ihrer Nähe weckte in ihr den Wunsch nach Kontrolle, weil sie wusste, dass Vertrauen stärker war als jede Zügelhilfe. Schon das Wort Kontrolle empfand sie im Umgang mit Pferden als falsch. Es klang nach Enge, nach Druck, nach etwas, das die leise Sprache zwischen Mensch und Tier übertönte. Pferde wollen geführt werden, nicht beherrscht. Für sie lag genau darin der Unterschied: Wer auf Kontrolle setzte, verbaute sich die Möglichkeit echter Nähe, übersah die feinen Signale und verpasste die Chance, die wahren Bedürfnisse des anderen zu spüren. Kontrolle stand für sie immer im Gegensatz zu Vertrauen.
Natürlich kannte sie auch die Momente, in denen Reiter die Kontrolle völlig verloren, wenn Unsicherheit, Angst oder schlicht Unwissen die Oberhand gewannen. Doch auch dann sah sie: Der Kontrollverlust war selten das Problem selbst, sondern das Ergebnis von etwas Tieferem – einer Hilflosigkeit, die zu lange weggeschoben worden war. Pferde wiederum trafen in solchen Augenblicken ihre eigenen Entscheidungen, nicht aus Trotz, sondern aus Instinkt. Sie waren Herdentiere, sie brauchten Klarheit und Führung, keine Fesseln.
Bei den Pferden war Lea im Frieden mit sich. Sie kämpfte weder gegen sich noch gegen andere, verglich sich nicht und verurteilte sich weniger. Was ihr sonst so schwerfiel, gelang ihr hier mühelos.
Im Umgang mit anderen Menschen war sie sehr skeptisch. Sie vertraute nur wenigen, denn sie hatte oft erlebt, dass andere ihre Nähe nur suchten, um von ihrer Fröhlichkeit zu profitieren oder sich mit ihr zu schmücken. Nach außen wirkte sie selbstbewusst – niemand hätte vermutet, wie sehr sie unter Selbstzweifeln litt. Warum sollte sie sich auch so verletzlich zeigen? Zu oft war sie ausgenutzt, hintergangen oder unehrlich behandelt worden.
Sie hatte genug davon. Sie wollte endlich ihr eigenes Ding machen, öfter lachen und das Leben genießen. Aber sie konnte ja schlecht in den Pferdestall ziehen. Und den Traum von einer eigenen Reitanlage hatte sie schon lange aufgegeben. Was Lea nicht ahnte: Ihre Träume waren kein Zufall. Sie zeigten ihr, wozu sie im Innersten längst fähig war – auch wenn sie selbst noch nicht daran glaubte.
Auch wenn sie ihren Traum längst abgeschrieben hatte, kehrte er immer wieder in ihre Gedanken zurück – wie ein ungebetener Gast, der dennoch willkommen war. In ihren Tagträumen sah sie sich auf einem eigenen Hof, wo sie endlich sie selbst sein und etwas bewirken konnte. Alles war so lebendig und detailreich, dass sie manchmal glaubte, dieser wundervolle Ort existiere schon irgendwo – nur darauf wartend, von ihr entdeckt zu werden. Ein Hof, an dem Menschen und Pferde gleichermaßen aufblühen würden, wo jeder respektiert und die Zeit mit den Tieren wirklich genossen werden könnte.
Kein „Was macht die denn da?“-Geflüster hinter vorgehaltener Hand, kein Druck, sich anzupassen. Jeder könnte einfach er selbst sein, ohne Angst, beurteilt oder eingeengt zu werden. Lea sehnte sich genau nach dem, was sie selbst täglich vermisste: Freiheit, echtes Verständnis und Raum für Individualität. Sie, die sich stets für alles und jeden verbogen hatte, wollte diesen einschnürenden Druck von anderen nehmen.
In ihren Träumen malte sie sich stundenlang aus, wie friedlich und harmonisch dieser Ort wäre. Doch dann holte die Realität sie ein – wie ein kalter Windstoß. Ihr jetziger Alltag sah ganz anders aus. Aber irgendwo, tief in ihr, lebte der Traum weiter: der Traum von einem Ort, an dem alles möglich war. Ein Ort, an dem es keinen Freddy gab!
„Kolossal genervt“ traf es ziemlich gut, wenn es um Freddy ging. Seine ständige Rechthaberei und das übertriebene Macho-Gehabe machten Leas Arbeitsalltag zur echten Belastung. Klar, als Chef trug er eine große Verantwortung für die Anlage, das Team und natürlich die Pferde – von den anspruchsvollen Besitzern ganz zu schweigen. Aber rechtfertigte das wirklich, dass er Lea ständig anbrüllte? Dass er sie klein machte und ihr Regeln aufzwang, die so gar nicht zu dem passten, was ihr wichtig war?
Ihr Verstand wusste genau, dass das alles falsch war. Aber seine ständigen Ausbrüche hatten längst ihr Herz erreicht. Früher konnte sie seine Bosheiten noch wie lästigen Staub von sich abklopfen. Heute nicht mehr. Irgendwann hatte sie unbewusst begonnen, seinen Worten Glauben zu schenken. Wenn er ihr die Schuld für etwas gab, fühlte sie sich tatsächlich schuldig – selbst dann, wenn sie eigentlich nichts falsch gemacht hatte. Sein Verhalten nagte an ihrem Selbstwert, und das blieb nicht ohne Folgen.
Sogar im Urlaub fand Lea keine Ruhe. Freddy rief an, ließ seine Launen an ihr aus und raubte ihr jede Möglichkeit, einmal durchzuatmen. Manchmal fragte sie sich, ob sie überhaupt mehr Glück verdient hatte. Vielleicht gehörte sie einfach zu den Menschen, bei denen Leichtigkeit und Freude keinen Platz im Leben hatten? Vielleicht war sie dazu bestimmt, immer härter zu arbeiten und zu akzeptieren, dass sie nichts daran ändern konnte.
Wenn Lea genauer darüber nachdachte, schien das Leben ihr schon immer eine ordentliche Portion „Kämpfe dich durch!“ aufgetischt zu haben. Für jeden winzigen Erfolg hatte sie stets hart arbeiten müssen, härter als andere, so schien es. Das Ergebnis?
Sie fühlte sich oft wie ein Boxer in der zwölften Runde – kraftlos, entmutigt und kurz vorm Knockout. Immerhin ertönte nie der Gong.
In solchen Momenten zog sie sich innerlich einen Schritt zurück und versuchte, ihre Ansprüche an sich und die Welt zu senken – ein emotionales „Füße hochlegen“, um der Niedergeschlagenheit zu entkommen. Ihr Trick? Die Pferde. Sie lenkten sie ab und schafften es, sie ein Stück weit aus ihrem Gefühl des Mangels zu befreien. Bei den Pferden fühlte sie sich tatsächlich zuhause. Die Tiere schienen sie zu verstehen, ohne dass sie viele Worte machen musste. Selbst an den Tagen, an denen sie sich am liebsten vor sich selbst versteckt hätte, kamen die Pferde zu ihr – und schenkten ihr so bedingungslose Liebe, dass Lea es oft kaum fassen konnte.
In ihren Augen fand Lea das, was sie sich von Menschen immer erhofft hatte: tiefe Aufrichtigkeit. Genau das war es allerdings, was ihr auch ein bisschen Angst machte. Denn in diesen Momenten, wenn die Pferde sie durchschauten, als hätten sie ein Röntgengerät für Emotionen eingebaut, hielt ihr das Leben einen Spiegel vor. Einen Spiegel, der ihr zeigte, dass sie selbst nicht so aufrichtig mit sich war, wie sie es gern gewesen wäre.
Lea belog sich selbst – und das mit erstaunlicher Routine, jeden einzelnen Tag. Sie drückte ihre Unzufriedenheit einfach weg und redete sich ein, dass alles „total okay“ sei, während sie innerlich ihre Sehnsüchte erstickte wie Flammen unter einem Wassereimer.
Ja, sie wusste, dass sie sich selbst etwas vormachte, aber sie wollte es nicht wahrhaben. Denn wenn sie die Wahrheit zugelassen hätte, hätte sie zugeben müssen, dass ihr Leben langsam, aber sicher dabei war, sich im Mittelmaß zu verlieren. Also beruhigte sie sich mit dem Gedanken, dass viele Pferdemenschen von einer eigenen Reitanlage träumen und sich diesen Wunsch sowieso niemals erfüllen.
Träume waren doch immer da, oder? Sie tauchten auf, wenn man einen ruhigen Moment hatte, um sich auszumalen, wie schön das Leben sein könnte. Aber Lea hatte längst akzeptiert, dass die wirklich großen Träume wohl nie in Erfüllung gehen würden. Wie auch? Ohne das nötige Geld war das alles nichts weiter als Fantasie. Sie hatte sich damit abgefunden, dass manche Dinge einfach nicht zu ändern waren.
Und dieses ständige Streben nach einem erfüllten, glücklichen Leben? Das erschien ihr schon fast unrealistisch. Im Grunde genommen ging es ihr doch gut. Sie war gesund, hatte einen festen Job und kam finanziell einigermaßen über die Runden. Andere hatten nicht einmal das. Warum also sollte sie sich beschweren? Warum sollte sie mehr erwarten oder darauf hoffen, dass das Leben noch etwas Besseres für sie bereithielt?
Man musste eben lernen, mit dem zufrieden zu sein, was man hatte. Das hatten ihre Eltern ihr schon beigebracht, und wenn sie selbst Kinder hätte, würde sie ihnen wohl genau dasselbe sagen: „Träume schön, aber wenn du die Augen morgen wieder aufmachst, ist es wieder Zeit für Realismus.“
Für Lea war klar: Wäre sie wirklich für Größeres bestimmt, dann würde sie nicht jeden Tag in ihrer 21 Jahre alten Rostlaube ohne Klimaanlage zum Stall fahren. Aber gut, das Leben war eben kein Ponyhof – so viel stand fest.
Heute Abend jedoch, da war da diese kleine Hoffnung, könnte sich vielleicht doch etwas ändern. Sebastian, ihr bester Freund und Kollege, hatte ihr ein Ticket geschenkt. Für einen Abend mit Frauke Kasten, einer der bekanntesten Life-Coaches in Deutschland. Kennengelernt hatten sie sich im Krankenhaus, wo Sebastian nach seinem schweren Autounfall gelandet war. Ein gemeinsamer Freund, der wusste, wie sehr er mit der Situation kämpfte, hatte Frauke Kasten gebeten, ihn zu besuchen. Als Coach, nicht als Ärztin. Sie setzte sich an sein Bett, hörte ihm zu und sprach Klartext. Und etwas an ihrer Präsenz berührte ihn tiefer als jede Behandlung. Für Sebastian war das der Beginn einer neuen Sicht auf sein Leben, und seit diesem Tag schwor er auf ihre Fähigkeiten.
„Sie schaut dich nur an, Lea, und sie weiß genau, wer du tief in dir bist und wozu du fähig bist.“
Lea konnte sich das alles nur schwer vorstellen. Sie war nie jemand gewesen, der sich mit solchen Themen beschäftigt hatte. Aber Sebastian war überzeugt, dass Frauke ihr helfen konnte, Türen in ihrem Inneren zu öffnen, die sie bisher nicht einmal wahrgenommen hatte.
Lea seufzte leise. Vielleicht war es Zeit, diese Türen endlich zu entdecken. Was hatte sie schon zu verlieren? Vielleicht würde dieser Abend doch etwas verändern, etwas in ihr bewegen, das sie lange Zeit verdrängt hatte.
Spirit
Spirit – ein kleines, freches, undressiertes Fohlen, das einst wild durchs Seelenfeld galoppiert war, voller Energie und Lebensfreude. Doch Spirit war nicht einfach irgendein Fohlen. Er war Leas Seele, die sich vor langer Zeit entschlossen hatte, sie auf ihrem Lebensweg zu begleiten und sie dabei zu unterstützen, ihren wahren Weg zu finden. Im Seelenfeld – diesem Ort der bedingungslosen Liebe und Freiheit (die Menschen nannten es oft „Himmel“, aber das wurde ihm bei Weitem nicht gerecht) – hatte Spirit seine Mission gefunden.
Spirit war nicht nur mutig, er hatte auch einen Plan. Seine Aufgabe war es, Lea durch das Leben zu führen, ihr immer wieder den richtigen Weg zu zeigen und sie zu ermutigen, die Träume zu verwirklichen, die tief in ihrem Herzen schlummerten. Er tat das mit viel Herz, Humor und – wenn nötig – einem sanften Stupser, wenn Lea mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen konnte. Immer dann, wenn sie sich von ihren Ängsten, Zweifeln und den Meinungen anderer einfangen ließ, schlug Spirit in ihrem Inneren Alarm: „Hey, wir haben Größeres vor!“
Natürlich beeinflusste Spirit Leas Leben auf vielen Ebenen. Er war es, der diese unstillbare Sehnsucht nach Freiheit in ihr weckte, der sie immer wieder daran erinnerte, dass das Leben noch so viel mehr zu bieten hatte, als sie gerade sehen konnte. Jedes Mal, wenn Lea sich mit ihren Pferden verbunden fühlte oder spürte, dass da etwas Größeres auf sie wartete, war es Spirit, der leise – oder manchmal auch ziemlich laut – in ihr klopfte.
Spirit war natürlich nicht perfekt. Er war immer noch ein Fohlen – verspielt, manchmal ungeduldig und noch nicht ganz der majestätische schwarze Hengst, der er eines Tages werden wollte. Aber eines war sicher: Er liebte seine Aufgabe. Er tat alles, um Lea immer wieder daran zu erinnern, wie stark, mutig und wundervoll sie wirklich war – auch wenn sie es selbst oft nicht sehen konnte.
Momentan jedoch war das Leben mit Lea in einen langweiligen Trott geraten. Spirit konnte es nicht fassen. Früher war sie so lebendig gewesen – sie tanzte, lachte und stürzte sich mit Begeisterung in jeden kleinen Unsinn, den das Leben ihr bereithielt. Sie war ein Wirbelwind aus Lebensfreude und Neugier, und Spirit war damals so stolz auf seine Wahl gewesen. Mit ihr das Leben zu teilen, das war ein echtes Abenteuer! Aber heute?
Heute setzte sie sich in ihre alte, knatternde Benzinmühle, die nach einer Mischung aus Tankstelle und muffigem Hundebett roch, drehte die Musik bis zum Anschlag auf, um ihre eigenen Gedanken zu übertönen, und fuhr zu diesem grauenhaften Chef Freddy zum Gut Harderberg – einem Ort, der jeglichen Glanz alter Tage verloren hatte, weil der Chef mit seinem ewigen Gekeife alles vergiftete.
Freddy benahm sich, als wäre er der König des Universums – und setzte seine Macht schamlos ein. Mit ein paar Worten riss er alles nieder, was Lea lieb und wichtig war. Doch was Spirit wirklich wahnsinnig machte: Lea ließ es einfach geschehen! Ihr Chef konnte sie noch so sehr runtermachen, sie schluckte es einfach. Er schrie sie an, und sie stand da und nickte, als sei das alles vollkommen normal. Er behandelte sie wie eine Sklavin, und sie redete sich ein, das gehöre halt dazu.
Wann, verdammt nochmal, hatte Lea eigentlich beschlossen, ihr Leben so komplett aufzugeben? Wann hatte sie aufgehört, zu kämpfen, ihren eigenen Wert zu sehen? Wann hatte sie aufgehört, zu leben? Spirit konnte es nicht begreifen. Er wusste doch, was ihr guttat!
Immer wieder versuchte er, sie in die richtige Richtung zu schubsen, ihr die Freiheit und Freude zu zeigen, die sie so dringend brauchte. Aber nein, sie klammerte sich an ihre selbstauferlegten Zwänge und die Erwartungen anderer, als hinge ihr Herzschlag davon ab.
Und ganz ehrlich: Spirit langweilte sich zu Tode. Schließlich hatte er Lea nicht grundlos ausgesucht, als es darum ging, ihm als Seele einen Körper zu geben. Sie war sportlich, hübsch und liebte Pferde. Okay, normalerweise scherten sich Seelen nicht um Äußerlichkeiten – aber hey, Spirit war eben eine Ausnahme. Das liebte man doch auch an ihm im Seelenfeld!
„Er bringt das Seelenfeld zum Leuchten“, sagten die anderen immer, aber Spirit wusste genau, dass sie eigentlich meinten: „Er sieht verdammt gut aus und ist ziemlich selbstbewusst.“ Er genoss das Strahlen und diese Power, die er ausstrahlte. Die anderen Seelen nannten ihn immer „das Fohlen“, weil er so wild und voller Lebensfreude durch das Seelenfeld sprang. Damals genoss er die Liebe, den Frieden und die Freiheit, die das Seelenfeld ihm bot. Genau das, was ihm jetzt so unendlich fehlte.
Nun saß er hier auf der Erde in einem Leben fest, das ihm zunehmend auf die Nerven ging. Was hatte ihn bloß geritten, in diese Welt zu kommen? Spirit verdrehte die Augen, weil er die Antwort seiner geistigen Familie schon im Chor hören konnte: „Deine ewige Langeweile und dein Drang nach Abwechslung, lieber Spirit!“
„Ja, danke für die Erinnerung“, dachte Spirit. Genau deshalb hatte er vor 37 Jahren diese Mission angetreten und Lea ausgesucht. Er kannte ihren Seelenplan auswendig, wie die Rückseite seines Hufs, und wusste sofort, dass er einen Glückstreffer gelandet hatte. Vor ihm lag ein Leben voller Leichtigkeit, Liebe, Freiheit und Frieden. Natürlich nicht immer – man muss ja realistisch bleiben –, aber größtenteils.
Seine Mission war klar: Lea in allem zu unterstützen, damit sie ihren Weg finden und mutig gehen konnte. Er war es, der ihr die Sehnsüchte schickte, der sie fühlen ließ, was in ihrem Seelenplan verankert war und was nicht. Dieser Job war für ihn ernst, wirklich ernst. Schließlich ging es hier nicht nur um Lea – auch er entwickelte sich dabei weiter. Und, ehrlich gesagt, hatte auch er seine Bedürfnisse – zum Beispiel die tiefe Verbindung zu Pferden. Noch nannten ihn seine Seelenfreunde liebevoll „Fohlen“, aber oh Mann, die würden Augen machen, wenn er eines Tages als stolzer, schwarzer Hengst ins Seelenfeld zurückkehrte.
Also war es für Spirit nur logisch, Lea mit dem „Pferdevirus“ zu infizieren. Einmal Pferde, immer Pferde – so lief das. Und sie war ihm wirklich nicht böse darum, im Gegenteil. Bei den Pferden fühlte Spirit sich zuhause; ihre Gesellschaft war ihm viel angenehmer als die der Menschen, die oft viel zu verkopft und kompliziert waren. Wann immer sich Spirit nachts, während Lea träumte, zu den Pferden schlich, spürte er dieselbe tiefe Liebe und Verbundenheit, die er aus dem Seelenfeld kannte.
Seelen bewerteten einander nicht, genauso wenig wie Pferde die Menschen bewerteten. Das war das Schöne. Keine Vergleiche, keine Urteile, einfach bedingungslose Akzeptanz. Jede Seele – ob auf der Erde oder im Himmel – war zu 100 % liebenswert. Und genau das liebte Spirit auch an den Pferden. Die würden nie auf die Idee kommen, sich untereinander zu vergleichen. Eine solche Dummheit war den Menschen vorbehalten.
Wer zum Teufel hatte ihn vor seinem Wechsel auf die Erde eigentlich beraten? Und warum hatte niemand erwähnt, dass als Pferdeseele alles so viel einfacher gewesen wäre? Da war sie wieder, die nervige Stimme seiner Seelenfamilie im Chor: „Weil dir ‚einfach‘ zu langweilig ist, lieber Spirit!“
Manchmal war es echt anstrengend, so viel zu hören und zu sehen. Als Seele entging ihm nichts. Mal verband er sich mit der Seelenebene, mal mit anderen Seelen, und wenn es richtig schlecht lief, war er so sehr in Leas Leben gefangen, dass er nur noch ihre Gedanken hörte. Wenn es so etwas wie die Hölle gäbe (es gibt sie übrigens nicht – sie ist nur eine menschliche Erfindung, um Angst und Schuld zu verbreiten), dann wäre das seine.
Und jetzt gerade? Da hörte er wieder Leas Dauerschleife: „Ich bin nicht gut genug.“ Wie oft sollte er ihr noch beweisen, dass sie eine großartige, liebevolle, immer noch ziemlich gutaussehende und für ihr Alter wirklich sportliche Frau war? (Irgendjemand hatte ihm mal gesagt, er solle an der Art seiner Komplimente arbeiten. Aber was damit gemeint war, hat er bis heute nicht ganz verstanden.) Immer wieder brachte er sie in Situationen, die ihr zeigten, wie großartig sie wirklich war. Jeder sah es – außer sie.
Spirit wollte doch nur eines: Mit Lea durchs Leben galoppieren. Leichtfüßig, frei, voller Freude – einfach losrennen und das Leben in vollen Zügen genießen. Stattdessen fühlte er sich, als wäre er in einer Startbox eingesperrt, bereit fürs Rennen, aber ständig hingehalten. Nein, heute doch nicht, mein Lieber, morgen vielleicht. Und dann wieder nicht.
Moment mal … Genau das war es doch! Das beschrieb Lea perfekt. Sie stand in ihrer eigenen Startbox – voller Träume und Wünsche, aber zurückgehalten von all den Ängsten, Zweifeln und den Meinungen der anderen – natürlich auch von Freddy.
Ach, Freddy. Spirit erinnerte sich noch gut an die Seelenschule, wo er gelernt hatte, dass man als Seele keine negativen Gefühle gegenüber anderen Seelen hegt. Alles klar, das stand im Lehrplan. Aber wenn es etwas gab, das Schule und Realität immer wieder trennte, dann war es Freddy.
Manchmal fragte Spirit sich ernsthaft, ob Freddy überhaupt eine Seele hatte oder ob da nur ein leerer Raum war, der bis zum Rand mit Ego gefüllt war. Normalerweise konnte Spirit mühelos den Kontakt zu anderen Seelen herstellen, aber bei Freddy? Schwierig. Es war, als hätte er sich mit Panzerstahl umwickelt, und Spirit kam einfach nicht durch. Dabei fühlte er sich so eng mit seiner Seele Fee verbunden. Aber leider nur im Seelenfeld. Auf der Erde? Da war’s echt schwer.
Das machte Spirit natürlich nervös. War er etwa nicht so mächtig, wie er dachte? War er doch mehr Fohlen als Hengst? Oh Gott! Das konnte doch nicht sein.
Dann dämmerte es ihm: Seit Lea auf Gut Harderberg unter Freddy arbeitete, war ihre – und damit auch seine – Weiterentwicklung wie eingefroren. Spirit bekam Schweißausbrüche. Etwas, das im Seelen-Schulbuch komplett fehlte – Hitzewallungen bei Seelen! Wer hätte das gedacht?
Aber da war sie, die Erkenntnis: Lea kam keinen Schritt weiter, weil Freddy sie permanent zurückhielt. Und das bedeutete auch, dass Spirit in seiner glänzenden Entwicklung zum majestätischen schwarzen Hengst ausgebremst wurde.
DAS konnte Spirit nicht einfach so hinnehmen! Eher würde er im nächsten Leben als Nacktschnecke zurückkehren, als dass er es zuließ, dass dieser egozentrische Freddy seine Mission gefährdete. Er spürte schon, wie seine gesamte Seelenfamilie synchron die Augen verdrehte und im Chor flüsterte: „Spirit, wir Seelen bewerten nicht!“ – „Ihr vielleicht nicht! Aber ihr steckt auch nicht in Lea fest!“
Es musste etwas geschehen. Spirit brauchte einen neuen Plan. Nein, keinen Plan für sich – einen Seelenplan. Für Lea.
Freddy
Freddy stieg in sein Auto – wie jeden Tag zur gleichen Zeit, fuhr dieselbe Strecke – alles wie auf Autopilot. Die Reitanlage Gut Harderberg war sein ganzes Leben. Es gab nur die Pferde und ihn. Aber gab es ihn wirklich noch? Seit dem Tod seines Vaters vor 17 Jahren fühlte er sich wie ein Schatten seiner selbst. Ein Teil von ihm war damals gestorben. Ein Teil? Nein, eigentlich alles. Seine Wünsche, seine Träume – und sein Lachen.
Früher liebte er die Pferde. Er konnte mit ihnen reden, sie verstanden ihn, und er verstand sie. Heute war alles nur noch eine Pflicht. Die Anlage, die Verantwortung. Es fühlte sich an, als hätte ihn sein Vater an diesen Ort gekettet. Tief in seinem Inneren war Freddy wütend. Wütend auf seinen Vater, der ihm diese Bürde in Form eines millionenschweren Erbes aufgeladen hatte.
Sein Vater wusste, dass Freddy lieber gemalt hätte. Freddys Traum war es immer gewesen, durch die Welt zu reisen und mit seinen Karikaturen den Menschen – vor allem Kindern – ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Er hatte ein besonderes Talent: Er konnte auf seinen Portraits ihren Charakter einfangen, ohne sie wirklich zu kennen. Die Kinder rannten stolz mit seinen Zeichnungen zu ihren Eltern, und von weitem sah Freddy, wie sie lachten und die Liebe füreinander spürten. Das brachte sein Herz zum Springen.
Das war sein Traum: Mit seiner Kunst Menschen glücklich machen. Nach dem Kunststudium war er durch Europa gereist und hatte seine Staffelei überall dort aufgestellt, wo er willkommen gewesen war. Menschen versammelten sich um ihn, während er malte. Er war so tief in seiner Arbeit versunken, dass er alles um sich herum vergaß. Erst wenn er fertig war, hob er den Kopf und sah die strahlenden Gesichter. DAS war das Leben, das er liebte. Er war frei, verbunden und zutiefst dankbar für sein Leben. Damals.
Dann erreichte ihn die Nachricht. Sein Vater war an einem Herzinfarkt gestorben. Nur wenige Stunden nach dem Anruf war Freddy auf dem Weg nach Hause. Raus aus Barcelona, rein in eine Realität, die er nie wollte. In diesen Stunden fühlte er sich zerrissen – zwischen tiefer Trauer und aufsteigender Wut. Trauer, weil er seinen Vater verloren hatte. Wut, weil er wusste, dass ihm jetzt die Reitanlage gehören würde. Sein Vater hatte alles in dieses Gut gesteckt. Wie hätte Freddy dieses Erben ausschlagen können? Was für ein Sohn wäre er gewesen, wenn er sein eigenes Glück über das Vermächtnis seines Vaters gestellt hätte?
Aber heute, mit 41 Jahren, war er sich nicht mehr sicher, was damals sein Herz mehr gebrochen hatte: Der Tod seines Vaters oder das Ende seiner Freiheit.
Oft fühlte es sich an, als seien an diesem Tag zwei Menschen gestorben. Sein Vater und er selbst. Seitdem war sein Leben eine einzige Routine. Aufstehen, arbeiten, essen, fernsehen, ins Bett gehen – und das Ganze von vorne. Früher hatte man ihn „Springins-Feld“ genannt, weil seine Kreativität so übersprudelte, dass er kaum zu bremsen war. Sein Vater hatte ihn oft ermahnt: „Junge, das Leben ist kein Ponyhof. Übernimm Verantwortung und stell etwas auf die Beine, worauf du stolz sein kannst!“
Freddy war stolz gewesen. Vor 17 Jahren, in Barcelona, hatte er das Leben gelebt, von dem er immer geträumt hatte. Aber heute? Heute funktionierte er nur noch.
Die Pferde liebte er immer noch. Gleichzeitig gab er ihnen die Schuld an seinem Dilemma. Er machte alles und jeden auf der Anlage für sein festgefahrenes Leben verantwortlich: die Tiere, die Angestellten, die Einsteller. „Ohne diese Anlage“, dachte er, „wäre ich ein glücklicher Künstler, irgendwo in der Sonne, mit einem Stift in der Hand.“
Stattdessen stand er jetzt in der Stallgasse, lauschte dem Kauen der Pferde und fragte sich zum wiederholten Mal, was er ändern könnte, um all das wirklich zu genießen. Er fühlte sich leer. Nur seine Wut blieb – immer präsent, immer kurz davor, überzukochen.
Gegenüber den Pferden konnte er sich noch beherrschen. Manchmal sprach er mit ihnen, wenn sie unter sich waren, und es schien, als verstünden sie ihn besser als jeder Mensch. Bei ihnen konnte er verletzlich und traurig sein, ohne sich zu verstecken. Aber die Menschen? Die bekamen nur die harte Schale zu sehen. Seine Enttäuschung vom Leben zeigte sich in Form von Dominanz, seine Wut als Ungerechtigkeit und Unfreundlichkeit. Würde er sich in diesem Zustand selbst mögen? Niemals. Wenn er sich begegnen würde, würde er weglaufen. So schnell wie möglich.
Ach, wenn er das doch nur könnte: einfach weglaufen. Vor sich selbst, vor der Anlage, vor diesem vergurkten Leben. Was nützte all das Geld, wenn er sich wie in einem Käfig fühlte? Was brachte ihm die Anerkennung von außen, wenn er innerlich zerrissen war?
Es wurde Zeit, aus diesem Leben auszusteigen – zumindest für ein paar Minuten. Freddy schnappte sich sein Handy und begann planlos durch Instagram und Facebook zu scrollen, in der Hoffnung, sich irgendwie abzulenken. Was ihm entgegenschlug, waren Menschen, die genau das taten, was sie glücklich machte: reisen, malen und ihre Kunstwerke stolz in die Kamera halten. Freddy seufzte. Diese Künstler waren nicht reich, das sah man ihnen an. Aber ihre Augen strahlten genauso hell wie ihre Bilder.
Er fragte sich, wann er das letzte Mal so gestrahlt hatte. Vermutlich als Menschen noch mit Nokia-Handys rumliefen und „Snake“ spielten.
Ein Anruf riss ihn aus seinen selbstauferlegten Mitleidsminuten. Sebastian, sein treuer Mitarbeiter seit der ersten Stunde, meldete sich. „Chef, ich bräuchte mal deinen Rat …“ Freddy seufzte. Ein Rat? Von ihm? Gerade fühlte er sich eher wie jemand, der selbst einen Rat gebrauchen konnte – oder gleich ein ganzes Buch voll kluger Ratschläge. Am besten mit dem Titel: „Wie man aufhört, sein eigenes Leben gegen die Wand zu fahren.“
Sebastian
Sebastian hasste es wirklich, Freddy um Rat zu fragen. Jedes Mal, wenn er es tat, wusste er schon genau, wie das Gespräch ablaufen würde: Freddy würde sich sofort einen Grund suchen, sich aufzuregen. Vielleicht kämen ein paar genervte Sätze wie „Das hättest du doch selbst wissen müssen“ oder „Warum kommst du immer zu mir mit deinen Problemen?“ – und dann, ohne Vorwarnung, würde er einfach auflegen.
Wenn er es sich hätte aussuchen können, hätte Sebastian alle Entscheidungen lieber mit Lea besprochen. Sie war das Herzstück des Hofes, der Ruhepol inmitten des oft chaotischen Betriebs.
Lea hatte eine natürliche Gabe, Menschen und Tieren gleichermaßen Ruhe und Sicherheit zu geben. Sie strahlte eine tiefe Güte aus, die sich auf alles und jeden übertrug, mit einer Einfühlsamkeit, die selten war. Egal, ob es um ein verängstigtes Pferd oder einen aufgebrachten Mitarbeiter ging – Lea wusste immer, wie sie die Situation entschärfen konnte. Sie hörte zu, wirklich zu, und sprach dann mit einer ruhigen, respektvollen Art, die das Gegenüber stets aufrichtete. In Sebastians Augen war sie die perfekte Chefin für den ganzen Hof, ihr fehlte nur ein Funken mehr Selbstbewusstsein. Sie hatte das Potenzial, den Laden zu rocken und alle glücklich zu machen – das wusste er. Doch stattdessen war es Freddy, der die Fäden in der Hand hielt, alles an sich riss und selten bereit war, Verantwortung abzugeben.
Vielleicht tat er das aus Angst zu versagen. Vielleicht war es aber auch ein Gefühl der Verpflichtung gegenüber seinem verstorbenen Vater, Fred Senior, der ihm diese riesige, millionenschwere Reitanlage hinterlassen hatte. Was als großzügiges Erbe gedacht war, hatte sich für Freddy als schwere Bürde entpuppt. Man konnte sehen, wie überfordert er war, wie ihn die Verantwortung erdrückte.
Er lief über den Hof wie jemand, der alles kontrollieren musste, ohne wirklich mit den Dingen verbunden zu sein. Er liebte diesen Ort nicht – er existierte einfach darin. Er führte ihn weiter, weil es eben von ihm erwartet wurde, nicht, weil es seine Leidenschaft war.
Doch manchmal, in seltenen, fast unscheinbaren Momenten, sah Sebastian etwas anderes in Freddy. Für einen kurzen Augenblick schien Freddy dann weich zu werden, als würde er in eine andere Welt abtauchen, weit weg von all der Verantwortung und dem Druck. In diesen flüchtigen Momenten spürte Sebastian Freddys Sehnsucht nach Freiheit – nach einem Leben jenseits der Mauern des Hofes. Diese Augenblicke veränderten Freddy komplett. Es war, als ob seine Aura – wie man es so nennt – aufleuchtete, und Sebastian erkannte in ihm den Menschen, der er vielleicht sein könnte, wenn er sich selbst die Freiheit erlauben würde.
Sebastian musste bei diesem Gedanken oft schmunzeln. Vor einem halben Jahr hätte er sich wahrscheinlich kaputtgelacht, wenn ihm jemand erzählt hätte, dass das Wort „Aura“ ein fester Bestandteil seines Vokabulars werden würde. Aura? Früher gab es für ihn nur zwei Dinge im Leben: seine Arbeit als Pferdewirt und die ausschweifenden Partys am Wochenende. Das war’s. Aber dann kam der Unfall.
Plötzlich wurde aus dem alten Sebastian jemand, der nicht mehr nur an das Nächste und Greifbare dachte, sondern über tiefere Dinge nachdachte – über Auren, über Liebe, über das Leben und alles, was danach kam.
Was ihm wirklich wichtig war, erkannte Sebastian erst, als alles fast vorbei war. Der genaue Ablauf des Unfalls blieb für ihn glücklicherweise in Nebel gehüllt, wie ein vergessenes Detail, das man nicht unbedingt wieder ans Licht zerren will. Alles, was er wusste, hatte er von den Zeugen erfahren. Es war ein Freitagabend gewesen, und er war auf dem Weg zu einer Club-Eröffnung. Wie immer war er spät dran – das war nicht neu. Aber trotz der Eile blieb er vorsichtig, konzentriert.
Sebastian hatte seine Prinzipien, eine eiserne Regel, die er nie brach: „Niemals andere in Gefahr bringen.“ Das war sein Mantra, besonders im Straßenverkehr.
Doch der Fahrer, der ihm auf der Gegenfahrbahn entgegenkam, hatte offenbar andere Prioritäten. Ohne ersichtlichen Grund wechselte er plötzlich die Spur, hielt direkt auf Sebastian zu. Alles ging blitzschnell. In einem Reflex, schneller als er denken konnte, riss Sebastian das Lenkrad herum. Hätte er auch nur eine Sekunde gezögert, wäre es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, und niemand hätte überlebt. Stattdessen überschlug sich Sebastians Wagen mehrmals und kam erst vor einem Baum zum Stehen. Der andere Fahrer verschwand spurlos in die Nacht, als wäre nichts geschehen, und ließ Sebastian in einem Schrotthaufen aus Metall zurück.
Von außen betrachtet war das Auto kaum mehr als ein zerdrückter Haufen Blech, eine tödliche Falle. Aber von innen? Für Sebastian fühlte es sich nicht so an. Im Gegenteil – es war das friedlichste Erlebnis seines Lebens. Kein Schmerz, keine Angst, keine Panik. Nur Ruhe. Er hatte den Unfall nicht überlebt – zumindest nicht im klassischen Sinn. Er verließ seinen Körper, als wäre es das Natürlichste der Welt.
Plötzlich war alles in warmes Licht getaucht, und er fühlte sich so unbeschwert, als wäre er gar nicht mehr in seinem Körper gefangen. Als er auf sich selbst herabblickte, sah er diesen Typen da unten, eingeklemmt zwischen Lenkrad und Sitz. Und das Seltsamste daran: Er empfand nichts für diesen Mann, der einmal er selbst gewesen war. „Wer ist das?“, fragte er sich. Der Körper, der da unten lag, schien ihm so fremd, so unbedeutend. Nichts an ihm erinnerte an das, was er in diesem Moment war oder fühlte.
Dann, wie aus dem Nichts, richtete sich sein Blick nach oben. Was er sah, raubte ihm den Atem – oder hätte ihm den Atem geraubt, wenn er noch einen Körper gehabt hätte. Ein unendliches Universum breitete sich vor ihm aus: dunkel und tief, doch übersät mit Millionen von funkelnden Lichtpunkten, die wie Sterne in der Ferne leuchteten. Ein sanfter, unsichtbarer Magnet zog ihn in diese Weite, eine Kraft, der er nicht widerstehen konnte – und auch nicht wollte. Das Universum, das sich vor ihm öffnete, war keine leere, kalte Unendlichkeit, sondern ein Ort voller Wärme und Vertrautheit. Es fühlte sich an wie Heimkommen, als sei er endlich dort angekommen, wo er immer hingehörte.
Er wollte den Mann im Auto einfach hinter sich lassen, ihn vergessen und sich in diese leuchtende Weite fallen lassen. Es war besser als alles, was er je erlebt hatte. Besser als jede Party, besser als jede durchfeierte Nacht mit lauter Musik und flackernden Lichtern. Kein DJ auf der Welt hätte diesen Beat toppen können.
Was er spürte, war Liebe. Aber nicht die Art von Liebe, die er bis dahin kannte. Es war eine allumfassende, bedingungslose Liebe – frei von Erwartungen, frei von Urteilen. Es war wie der süßeste Rausch, der ihn durchflutete und alles andere bedeutungslos machte.
Mit jeder Faser seines Seins wusste er: Hier wollte er bleiben. Für immer.
Als er an sich hinunterschaute, stellte er fest, dass da nichts war. Kein Körper, kein physisches Selbst. Nur dieses Gefühl der Liebe, das alles durchdrang, das ihn wie eine warme Decke einhüllte und jede Sorge, jede Angst auslöschte. Gott, war das krass! Wo auch immer er war, es war der ultimative Höhepunkt seines Lebens. Und in diesem Moment war ihm klar: Er wollte nie wieder zurück in die Welt, in der er sich so oft verloren gefühlt hatte. Alles, was ihm je wichtig gewesen war, schien im Vergleich zu diesem Augenblick klein und nichtig.
Hatte ihm jemand etwas in den Drink gemixt? Das hier konnte doch nicht real sein, oder? Vielleicht stand er gerade in Wirklichkeit an der Bar, kippte nicht den nächsten Tequila wie sonst, sondern kippte einfach mal um? Wäre nicht das erste Mal in dieser Woche. Aber tief in sich wusste er, dass das nicht der Fall war. Dieses Gefühl hier, das er gerade erlebte, war anders – ganz anders. Es fühlte sich so echt an, intensiver als irgendetwas, das er jemals erfahren hatte.
Er sah sich um, und alles in ihm sagte, dass das hier kein Zufall war. Es war das komplette Gegenteil von dem, was und wer er sonst war. Keine Hektik, kein inneres Chaos, keine zermürbenden Gedanken, die ständig kreisten und ihm den Schlaf raubten. Hier fühlte er sich … richtig. Nicht nur gut.
Freiheit. Aber nicht die Art von Freiheit, die er sonst kannte. Nicht das „Wo ist die nächste Party?“-Frei, nicht die oberflächliche Freiheit, die nur ein kurzes High war und am nächsten Morgen immer Enttäuschung nach sich zog. Nein, das hier war anders. Es war eine tiefe, innere Freiheit, die ihm das Gefühl gab, als wäre alles, was er jemals geglaubt hatte, plötzlich unwichtig. Hier gab es keine Urteile, keine Bewertungen, keine alten Geschichten, die sich ständig wie ein schiefes Lied in seinem Kopf wiederholten und nicht mehr aufhörten zu spielen.
Hier zählte nur das JETZT. Kein Gestern, kein Morgen, keine Sorgen um das, was war oder sein könnte. Nur dieses unendliche Jetzt. Und das Gefühl, das ihn umhüllte? Es war, als hätte jemand die schweren Ketten seines Geistes zerschlagen.
Je länger er in diesem Zustand verweilte, desto weniger dachte er nach – und das war vielleicht das Krasseste daran. Sein Kopf war still. Kein Gedankenkreisen, kein Kopfkino, das ihn sonst immer fest im Griff hatte. Alles, was blieb, war dieses reine, unverfälschte Fühlen.
Das war die Ruhe, von der alle immer sprachen, die er aber nie geglaubt hatte, jemals finden zu können. Diese Stille, die kein Verstummen war, sondern eine tiefe, alles durchdringende Ruhe. Hier gab es keine Sorgen, keinen Mangel, keine Angst vor der Zukunft oder Reue über die Vergangenheit. Nur dieses Gefühl, dass alles gut war. Nicht „wird gut sein“, sondern „ist gut“. Und er war nicht allein – das spürte er mit jeder Faser seines Seins.
Er war nie wirklich allein gewesen, das wurde ihm klar. Es war, als würde er sich an etwas Uraltes, tief Verwurzeltes erinnern, etwas, das lange vor seiner Geburt existiert hatte. Dieses Gefühl war so vertraut, als hätte er es schon immer gekannt, aber nie richtig verstanden. Es fühlte sich an, als wäre er schon einmal hier gewesen – als würde er nach Hause kommen, nach einer langen Reise.
Und dann dämmerte es ihm langsam: Es war nicht das Gefühl von Schutz, das ihn hier durchdrang. Es war das Gefühl der Zugehörigkeit. Er war nicht hier, um beschützt zu werden, weil Schutz hier nicht nötig war. Alles, was er fühlte, war, dass er hierhergehörte – zu etwas Größerem, das keinen Anfang und kein Ende hatte. Ein unendlicher Kreislauf, mit einem festen Platz für ihn.
Er war zuhause.
Obwohl niemand zu sehen war, fühlte er sie alle. Die, die er geliebt und verloren hatte. Die Leichtigkeit seiner Oma, die ihm immer ein Gefühl von Geborgenheit gegeben hatte. Die Energie seines ersten Hundes, der ihn bedingungslos geliebt hatte. Und die tiefe, unzertrennliche Verbundenheit zu seinem Vater. Sie waren alle hier, in dieser friedlichen, stillen Unendlichkeit. Krass. Es brauchte keine Worte. Es war, als würden sie auf einer anderen Ebene kommunizieren – durch reine Gefühle. Alles floss ineinander, ohne Trennlinien, ohne Mauern.
Die Energie seines Vaters durchströmte ihn wie ein warmer Strom, und er spürte, dass sie immer miteinander verbunden waren – nicht durch Worte, sondern durch Liebe. Diese Liebe war das verbindende Element, das sie alle hier vereinte. Sie sagte ihm, dass sie nie wirklich weg gewesen waren. Es gab kein Ende, nur Übergänge. Alles war unendlich.
Hier, in dieser Weite, gab es keine Trauer, keine Verluste, keine Angst vor dem, was kommen könnte. Alles war Liebe. Diese Liebe war die Sprache, durch die sie alle miteinander kommunizierten. Sie sagte ihm, dass niemand jemals wirklich verloren ging. Es gab keinen Abschied, nur ein Weiterleben in einer anderen Form – einer Form, die frei von Schmerz und frei von Trennung war.
Doch plötzlich – zack! – war es, als griff eine unsichtbare Hand nach ihm. Der Sog kam plötzlich, heftig, unaufhaltsam. Etwas zog mit einer Kraft an ihm, die er nicht ignorieren konnte.
„Nein! Das ist die falsche Richtung!“, wollte er schreien, doch seine Stimme versagte. Kein Laut kam über seine Lippen. Alles, was er fühlte, war dieser gewaltige Zug, der ihn aus dem warmen, friedlichen Licht herausriss, in das er gerade so tief hineingesunken war. „Ich will nicht weg!“, dachte er verzweifelt, „ich will hierbleiben!“
Es war ein innerer Aufschrei, der aus den tiefsten Schichten seines Seins ertönte. Um keinen Preis der Welt wollte er diesen Ort verlassen. Es war perfekt hier – der Ort, an dem alles Sinn ergab, wo alle Last von ihm abgefallen war. Wen würde es überhaupt kümmern, wenn er blieb? Die Pferde vielleicht – sie verstanden ihn, hörten ihm zu, auch wenn er nie ein Wort sagte.
Aber seine sogenannten „Freunde“? Die Partykumpels, die er jedes Wochenende traf? Die würden vielleicht ein, zwei Wochen trauern, ein paar sentimentale Nachrichten in ihre WhatsApp-Gruppe schreiben, und dann? Dann würden sie seinen Tod als Vorwand für den nächsten Drink nehmen. Ein paar Shots auf ihn, und die Welt würde sich weiterdrehen.
Nicht, dass sie ihn nicht mochten – aber echte Freundschaft? Das war es nicht. Es war eher wie eine ständige Verabredung zum Feiern. Nichts, was tiefer ging.
Doch der Sog ließ nicht nach – im Gegenteil. Er wurde immer stärker, immer heftiger, wie ein unsichtbarer Wirbelsturm, der ihn unaufhaltsam weiter wegzog. Etwas Gewaltiges riss ihn von diesem Ort fort – gegen seinen Willen. Er stemmte sich mit aller Kraft dagegen, versuchte sich an das Licht, an den Frieden festzuklammern – aber es half nichts. Der Sog zog ihn in die Dunkelheit. Und plötzlich – BÄM! – war alles laut. Viel zu laut.
Im nächsten Moment schlug er die Augen auf. Grelles Licht blendete ihn. Er kniff die Augen zusammen, blinzelte – sah eine weiße Wand, dann Menschen, dann Gerätschaften. „Welcome home“, hörte er eine Stimme sagen, doch innerlich schrie er vor Enttäuschung. „Echt jetzt? No, no, no! Das kann doch nicht wahr sein!“
Er wollte nicht hier sein! Er wollte zurück in den Frieden, in die Stille, in dieses unbeschreibliche Gefühl der Glückseligkeit. Alles in ihm sträubte sich gegen diese Realität – gegen die sterile Helligkeit, das Piepsen der Maschinen.
Er schloss die Augen, als könnte er so die Wirklichkeit ausblenden. „Vielleicht ist das alles nur ein schlechter Traum“, dachte er hoffnungsvoll. „Vielleicht wache ich gleich auf und bin wieder dort, wo ich hingehöre. Dort, wo alles leichter und wunderbar sinnvoll war.“
Er blieb still liegen, wagte kaum zu atmen, aus Angst, diese Illusion zu zerstören.
Dann spürte er etwas. Eine sanfte Berührung an seiner Hand. Sie durchzuckte ihn – wie ein Blitz aus der Vergangenheit oder aus einem Traum.
„Vielleicht bin ich doch wieder oben?“ Gedanken jagten durch seinen Kopf. Vorsichtig öffnete er die Augen, blinzelte gegen das grelle Licht, und sah in zwei wunderschöne, tiefbraune Augen. War es möglich? Ein Hauch von Glückseligkeit durchströmte ihn. Das musste sie sein! Die Liebe seines Lebens!
Natürlich, jetzt ergab alles Sinn. Der Unfall, der Sog, dieses Zurückkehren – es war alles Teil einer größeren Geschichte. Das hier war der Anfang einer Liebesgeschichte, von der er nie geglaubt hatte, dass er sie erleben würde. Die Art von Geschichte, die man später seinen Enkeln erzählt, wenn man in einem Schaukelstuhl sitzt und auf ein langes, erfülltes Leben zurückblickt.
Er war nie ein Romantiker gewesen, aber wenn DAS der Grund war, dass er zurückgekommen war, dann würde er sich mit der Realität abfinden. Ja, das konnte er akzeptieren.
Mit einem kleinen Lächeln öffnete er die Augen ein Stück weiter, bereit, sein Schicksal anzunehmen. Er war bereit für diese Liebesgeschichte, für den Moment, der alles verändern würde.
„Meine Güte, du kannst deiner alten Mutter doch nicht so einen Schrecken einjagen!“, hörte er die Worte aus dem zu den Augen gehörenden Mund purzeln. Sebastian versuchte, die Fassung zu bewahren.
Ihre Augen glänzten vor Erleichterung, und sie griff sofort nach seiner Hand, als wollte sie sich vergewissern, dass er wirklich hier war, dass es kein Traum war. Er versuchte, ein Lächeln aufzusetzen, sich über ihre Freude zu freuen – immerhin war er ja zurückgekommen, nicht wahr? Aber tief in sich spürte er nur eine überwältigende Enttäuschung. Wie sollte er ihr bloß erklären, dass er gar nicht hier sein wollte? Dass er in jenem Paralleluniversum, in das er kurz entglitten war, etwas gefunden hatte, das so viel größer, so viel erfüllender war, als alles, was dieses Leben jemals bieten konnte?
Sie würde es nicht verstehen. Keiner würde das. Wie könnte sie auch? Für sie war es eine glückliche Fügung des Schicksals, dass er überlebt hatte – während es für ihn ein grausames Missverständnis war. Also tat er das Nächstbeste: Er lehnte sich zurück, schloss die Augen und tat so, als würde er wieder schlafen. Die Erschöpfung war ihm ins Gesicht geschrieben, und sie ließ ihn in Ruhe.
Er brauchte Zeit. Zeit, um das alles zu verarbeiten, um irgendwie mit dieser verrückten Rückkehr ins „echte“ Leben klarzukommen. Ein Leben, das sich plötzlich so klein, so leer anfühlte im Vergleich zu dem unendlichen Frieden, den er gerade noch erlebt hatte.
Als er das nächste Mal die Augen öffnete, war er allein. Zum Glück. Er hätte wirklich nicht die Kraft gehabt, so zu tun, als sei er begeistert, dass er einen Herzstillstand überlebt hatte. Alles fühlte sich schwer und bedeutungslos an.
Er ließ alles noch einmal Revue passieren. Sein bisheriges Leben? Wenn er ehrlich war, ein ziemlicher Witz. Was hatte er erreicht? Es war, als hätte er die ganze Zeit nur die Tage abgespult, die Zeit gefüllt, ohne wirklichen Sinn. Partys, Arbeit, dann wieder Partys – ein ewiger Kreislauf aus Oberflächlichkeiten. Die einzigen Momente, in denen er etwas Tieferes gespürt hatte, waren die Stunden mit den Pferden gewesen. Sie waren der einzige wirkliche Anker in seinem Leben, auch wenn er das nie wirklich zugelassen hatte.
Pferde hatten eine besondere Gabe – sie durchschauten ihn, sahen ihn so, wie er wirklich war, ohne Masken. Sie waren die Brücke zu sich selbst, auch wenn er das nicht immer hatte wahrhaben wollen.
Durch sie hatte er sich oft gespürt, hatte für kurze Momente diese tiefere Verbindung zu sich selbst gefunden. Aber gleichzeitig hatte er sich immer wieder dagegen gewehrt. Denn den Schmerz, den all das in ihm auslöste, wollte er nicht ertragen. Den Schmerz darüber, dass er so viel Zeit vergeudet hatte, sich selbst belogen und in einer Welt gelebt hatte, die ihn nur ablenkte. Er hatte sich in oberflächlichen Vergnügungen verloren, weil es einfacher war, als sich dem Schmerz der Wahrheit zu stellen.
Doch jetzt konnte er sich dieser Wahrheit nicht länger entziehen. Wie würden die Pferde ihn wohl jetzt empfangen? Würden sie spüren, dass er „oben“ gewesen war? Dass er sich verändert hatte? Natürlich würden sie das. Sie spürten jede Nuance, jede noch so kleine Veränderung in ihm.
Jedes Mal, wenn er gestresst gewesen war oder voller Zweifel, hatten sie ihn ignoriert – so, als ob sie ihm eine klare Botschaft senden wollten: „Komm zu dir selbst zurück, dann kommen wir zu dir.“ Aber wenn er in Frieden war, wirklich bei sich, kamen sie zu ihm – schnaubend, mit weichen, sanften Bewegungen, die ihm signalisierten: „Jetzt bist du bereit.“
Sie reagierten auf jede Schwingung seiner Stimmung. Pferde waren nicht nur Tiere; sie waren Spiegel, Lehrer. Sie reflektierten alles, was er in sich trug – ob er es wollte oder nicht. Stets wussten sie schon Bescheid. Sogar über Dinge, die man selbst noch nicht wusste. Sie sahen durch die Fassade hindurch, ohne zu urteilen, nur mit diesem tiefen, unerschütterlichen Wissen, dass alles seinen Platz und seine Bedeutung hat.
Sebastians Gedanken schweiften ab – zurück in diese andere Welt, die sich ihm direkt nach dem Unfall gezeigt hatte. Er konnte sie nicht sehen wie einen Ort, aber er wusste genau, wie es sich dort angefühlt hatte. Plötzlich war alles ruhig gewesen, kein Druck, keine Angst, keine Last auf seinen Schultern. Stattdessen hatte er eine Klarheit empfunden, die ihn überrascht hatte, als hätte jemand den Lärm seines bisherigen Lebens einfach ausgeschaltet. Dieses Gefühl war ihm bis heute so gegenwärtig, als wäre es gerade eben erst passiert, und doch lag es gleichzeitig weit weg, unerreichbar. Wie etwas, das man mit ausgestreckter Hand beinahe berührt – und dann doch verliert.
Es war, als hätte er eine Wahrheit berührt, die ihm zuvor nie zugänglich gewesen war. Eine Wahrheit, die ihm gezeigt hatte, dass das Leben so viel mehr war als nur dieser ständige Kampf, der Stress, die endlosen Sorgen, die er sich immer gemacht hatte. „Glückseligkeit“, dachte er. „Das ist es, was wir alle sind, aber wir vergessen es ständig.“
Ein Vibrieren riss ihn aus seinen Gedanken – sein Handy, das er achtlos in der Hand gehalten hatte. Er blickte hinunter auf das Display und sah den Namen: Freddy. Natürlich. „Zurück in die Realität“, dachte er und rollte mit den Augen. Der Frieden, den er gerade noch so tief gespürt hatte, zerplatzte wie eine Seifenblase. Ein Seufzen entwich ihm.
„Man kann wohl nicht immer im Himmel schweben“, dachte er und wischte den Anruf einfach weg.
Freddy würde sich schon wieder melden, wahrscheinlich mit einer weiteren Beschwerde oder einer endlosen Liste von Problemen, die er selbst verursachte und die niemand lösen konnte – zumindest nicht zu Freddys Zufriedenheit. Sebastian war zwar durch den Unfall vor einem halben Jahr zu einem anderen Menschen geworden, aber heilig war er nicht. Und Liebe und Verbundenheit hin oder her, Freddy machte ihn wahnsinnig!
Diese permanente Unzufriedenheit, dieses ständige Nörgeln an allem und jedem. „Warum verändert er nichts?“, fragte sich Sebastian immer wieder. Freddy machte allen das Leben schwer, und das Schlimmste daran war, dass es ihm selbst nicht einmal auffiel.
Warum übergab er den Hof nicht einfach an Lea? Sie war der Fels in der Brandung, diejenige, die diese ganze Reitanlage mit ihrem sanften Wesen zusammenhielt. Sie würde sich ein Loch in den Bauch freuen, wenn sie endlich das Sagen hätte. Sie war nicht nur in der Lage, die Reitanlage zu führen – sie würde es auch mit Herzblut tun. Doch Freddy? Er hielt krampfhaft an allem fest, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und wenn irgendetwas nicht in sein begrenztes Weltbild passte, tat er es ab.
Besonders, wenn es um Dinge ging, die er als „Esoterik-Quatsch“ bezeichnete. Wenn Sebastian ihm nur erzählen könnte, was er erlebt hatte – die Erfahrung, die er „oben“ gemacht hatte. Aber er wusste, Freddy würde ihn nur auslachen.
Er konnte seine Erfahrungen nicht mit einem Mann teilen, der so verbittert und verschlossen war. Und Sebastian wollte diese tiefen Einsichten, die sein Leben verändert hatten, nicht durch Spott entwerten lassen. Also tat er, was er immer tat, wenn die Welt ihm zu viel wurde: Er ging zu den Pferden. Sie würden ihm zuhören, wie sie es immer taten – ohne Worte, ohne Urteil.
Er trat in den Stall und atmete den vertrauten Duft von Heu und Pferden ein. Die beiden Stuten Chessy und Granja schauten ihn mit ihren sanften Augen an. Sebastian lächelte. Zu ihnen sprach er oft das aus, was er niemandem sonst sagen konnte. Sie verstanden ihn. Vielleicht nicht in Worten, aber auf einer tieferen, intuitiven Ebene.
„Wisst ihr“, sagte er leise, „die Menschen suchen ihr Glück permanent im Außen. Sie rennen durch ihr Leben, immer auf der Suche nach etwas, das sie erfüllt. Aber sie verstehen nicht, dass alles, was sie brauchen, bereits in ihnen ist.“
Er strich Chessy sanft über die Nüstern, während er sprach. „Es ist so tragisch. Sie suchen nach Gründen in der Vergangenheit, um sich schlecht zu fühlen. Sie erschaffen sich Ängste für die Zukunft und denken, das sei die Realität. Dabei sind sie es selbst, die ihr eigenes Gefängnis bauen. Jeder Mensch ist die reine Glückseligkeit, aber niemand erkennt es, weil sie alle mit Filtern aus der Vergangenheit, Erfahrungen, Erwartungen und Bewertungen durchs Leben gehen.“
Er schüttelte den Kopf, fast traurig über diese Erkenntnis, die für ihn jetzt so klar war, die aber für so viele andere verborgen blieb. „Aber ihr wisst das, nicht wahr?“ Er sprach nun direkt zu den Pferden. „Ihr seid nicht wie die Menschen. Ihr lebt im Jetzt, ohne all diese Filter. Ihr fühlt einfach, was ist.“
Chessy schnaubte leise, als würde sie ihm zustimmen, und Granja trat einen Schritt näher und legte ihren Kopf sanft gegen seine Schulter. „Ja, auch ich bin Glückseligkeit“, sagte er, während er an sich hinunterblickte, als wollte er sich selbst daran erinnern. Er spürte die Ruhe und den Frieden, die er im Stall immer fand – die Verbindung zu etwas Größerem.
Er hob den Kopf und sah Lea am Ende der Stallgasse. Sie war wie immer bei der Arbeit, ruhig und fokussiert. Auch sie, das wusste er, war Glückseligkeit, auch wenn sie es vielleicht noch nicht so klar erkannte wie er. „Die Menschen müssen aufhören, im Außen nach etwas zu suchen, das sie im Inneren bereits haben“, flüsterte er fast. „Wenn sie nur erkennen würden, dass alles bereits in ihnen ist. Es wäre so einfach.“
Er fühlte eine tiefe Dankbarkeit in sich aufsteigen – für das Wissen, das er jetzt hatte, für die zweite Chance, die ihm gegeben worden war. „Ich bin Glückseligkeit“, sagte er leise und spürte, wie diese Erkenntnis ihn durchdrang.
Frauke
Frauke Kasten hatte es weit gebracht. Sie war die unangefochtene Nummer eins unter den Life-Coaches in Deutschland – und das wussten alle, die in dieser Welt unterwegs waren. Ihre Vorträge waren ausgebucht, ihre Bücher standen an der Spitze der Bestsellerlisten, und ihre Ansichten über persönliche Weiterentwicklung, Erfolg und Selbstfindung inspirierten Tausende. Sie war nicht nur eine Expertin – sie war eine Art vertraute Ratgeberin für Menschen, die sich verändern wollten.
Ihr Leben spiegelte diesen Erfolg wider, doch nicht auf eine aufdringliche oder überhebliche Weise. Frauke lebte in einem stilvollen Penthouse mit einem atemberaubenden Blick über die Stadt – ihr persönliches Reich, in dem sie Ruhe und Inspiration fand. In der Tiefgarage standen zwei Autos, die sie abwechselnd nutzte, um gelegentlich auf ihre Lieblingsinsel zu fahren.
Dort hatte sie ein gemütliches Haus – ihren Rückzugsort, an dem sie sich inmitten der Natur erholen konnte, wenn sie es mal ruhiger angehen lassen wollte. Doch diese Ruhe gönnte sie sich selten. Frauke war eine Frau, die sich ständig weiterentwickelte, die immer neue Ziele verfolgte.
Zu ihrem Leben gehörten auch zwei liebevolle Hunde, die sie regelmäßig auf langen Strandspaziergängen begleiteten, und natürlich ihre Pferde, die auf einem idyllischen Gestüt lebten. Frauke genoss ihre Arbeit, aber auch die kleinen Freuden des Lebens. Anerkennung bekam sie von allen Seiten – von Kollegen, Prominenten und ihren Klienten.
Und das Wichtigste: Frauke war gesund und ausgeglichen – keine Burnouts, keine Anzeichen von Erschöpfung, die man vielleicht bei jemandem erwartet hätte, der so viel erreicht hatte. „Was will man mehr?“, fragte sie oft augenzwinkernd, wenn das Gespräch auf ihren Lebensstil kam.
Aber selbst Frauke, die so viel erreicht hatte, spürte irgendwann, dass da etwas fehlte. Klar, einen Partner hätte sie sich gewünscht. „Das steht wohl noch nicht auf meinem Seelenplan“, sagte sie oft mit einem trockenen Lächeln, wenn Freunde sie danach fragten. Sie war gut darin, das mit Humor zu nehmen und nicht weiter darüber nachzudenken.
Doch dann passierte etwas, dass sie aus ihrer gewohnten Routine herausriss.
Es war ein Morgen wie jeder andere. Sie wachte auf, bereit, einen weiteren erfolgreichen Tag zu beginnen – doch etwas war anders. Sie spürte plötzlich eine innere Leere, die sie nicht erklären konnte. Es fühlte sich an, als wäre ein Teil von ihr verschwunden, den sie nie richtig bemerkt hatte.
Frauke ging ins Bad, wusch sich das Gesicht wie jeden Morgen mit Eiswasser, nahm eines der kleinen Handtücher aus ägyptischer Baumwolle und trocknete sich die kalten Tropfen von Nase und Kinn. Dann fiel ihr Blick in den Spiegel über dem Waschbecken und eine Frage schoss ihr ins Bewusstsein: War das wirklich schon alles? In ihr meldete sich eine Sehnsucht, die über Karriere und äußere Erfolge hinausging. Eine leise, aber unüberhörbare Frage nach etwas Größerem. Weshalb war sie tatsächlich hier? Wofür war sie geboren? Ihr Beruf erfüllte sie, ja. Doch tief in ihr blieb diese Unruhe, dieses nagende Gefühl, dass da noch mehr auf sie wartete. Mehr als Titel, mehr als Leistung, mehr als das Funktionieren im Alltag. Und genau dieses „Mehr“ ließ sie nicht los.
Dieser Moment der Unsicherheit war kein Zufall. Ihre Seele Avanti hatte lange darauf hingearbeitet. Avanti wusste, dass Frauke irgendwann diesen Punkt erreichen musste – den Punkt, an dem äußerer Erfolg allein nicht mehr ausreichte. Frauke musste tiefer gehen, musste eine Verbindung zu ihrem inneren Selbst finden, um den nächsten Schritt in ihrer spirituellen Entwicklung zu machen. Und dafür brauchte es diese Leere, dieses nagende Gefühl, dass etwas nicht stimmte.
Frauke, die immer so stark und selbstsicher war, musste sich dieser inneren Unruhe stellen. Und so kam es, dass nur eine Woche nach diesem schicksalhaften Morgen alles anders wurde. Die Leere, die sie verspürt hatte, öffnete eine Tür zu einer neuen Welt – einer Welt, die sie bisher für „Hokuspokus“ gehalten hatte: die Welt der Jenseitskontakte.
Natürlich war Frauke immer offen für Spiritualität gewesen. Schließlich sprach sie in ihren Coachings oft über Intuition, Selbstheilung und die innere Kraft des Geistes. Aber Jenseitskontakte? Das war eine Grenze, die sie bisher nie überschritten hatte. Sie hatte solche Dinge immer für „zu esoterisch“ gehalten.
Klar, sie hatte schon von Medien gehört, die behaupteten, mit Verstorbenen zu kommunizieren, aber sie hatte nie daran geglaubt – bis zu dem Moment, als sie es selbst erlebte.
Es geschah während eines spirituellen Retreats, das sie spontan gebucht hatte, um herauszufinden, woher diese Leere kam. Während einer Meditationssitzung spürte Frauke plötzlich eine seltsame Präsenz. Eine Energie, die sie nicht erklären konnte. Und bevor sie es richtig einordnen konnte, sprach sie Worte aus, die nicht ihre eigenen waren.