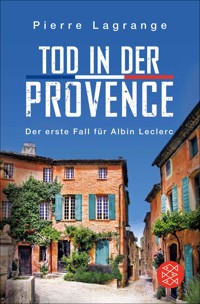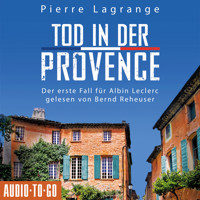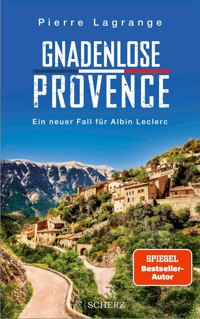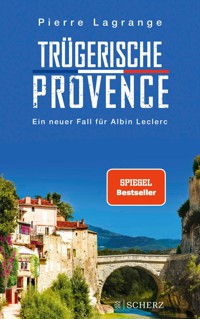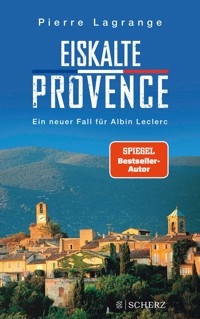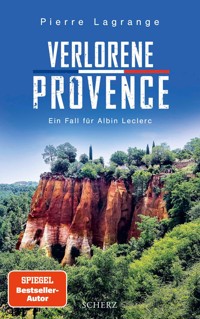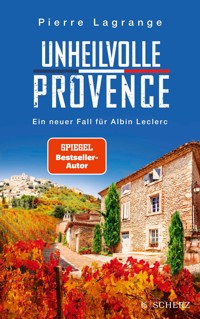
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissaire Leclerc
- Sprache: Deutsch
Ein unheilvoller Herbst erwartet die Provence – der neunte Band der Provence-Krimi-Reihe von Bestseller-Autor Pierre Lagrange Weinernte in der herbstlichen Provence – und zwischen den Reben brennt ein Feuer, in dem ein Mensch zu Tode kommt. Die Ermittler Castel und Theroux sind ratlos. Auch Ex-Commissaire Albin Leclerc steht vor einem Rätsel, das mysteriöser wird, als weitere Menschen nach mittelalterlichen Methoden ermordet werden. Die Spur führt erst zu einer Ausstellung mit apokryphen Schriften im Papstpalast von Avignon, und später zu einem geheimnisvollen Buch, das seit Jahrhunderten als verschollen gilt. Je näher Albin der Antwort kommt, desto größer ist die Gefahr, selbst zum Opfer einer mysteriösen Jagd zu werden … Ex-Commissaire Albin Leclerc ermittelt in der Provence: Band 1: Tod in der Provence Band 2: Blutrote Provence Band 3: Mörderische Provence Band 4: Schatten der Provence Band 5: Düstere Provence Band 6: Eiskalte Provence Band 7: Trügerische Provence Band 8: Gnadenlose Provence Band 9: Unheilvolle Provence
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Pierre Lagrange
Unheilvolle Provence
Über dieses Buch
Inmitten eines Weinfeldes brennt zur Erntezeit in der Provence ein Feuer – und wie sich herausstellt, auch ein Mann. Die Polizei von Carpentras ist geschockt, allen voran die Capitaines Caterine Castel und Alain Theroux. Das Opfer kann noch nicht identifiziert werden. Albin Leclerc bekommt Wind von dem Vorfall, denn die Hinrichtung ereignete sich auf den Äckern eines Weingutes, an dem sein Freund Matteo als Investor gerade Anteile erworben hat. Matteo ist außer sich vor Wut, denn er vermutet einen politischen Angriff. Albins Interesse ist sofort geweckt – noch mehr, als schließlich bekannt wird, um wen es sich bei dem Toten handelt …
Ex-Commissaire Albin Leclerc ermittelt in der Provence – die Provence-Krimi-Reihe.
Band 1: Tod in der Provence
Band 2: Blutrote Provence
Band 3: Mörderische Provence
Band 4: Schatten der Provence
Band 5: Düstere Provence
Band 6: Eiskalte Provence
Band 7: Trügerische Provence
Band 8: Gnadenlose Provence
Band 9: Unheilvolle Provence
Band 10: Bedrohliche Provence (im Frühjahr 2024)
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Pierre Lagrange ist das Pseudonym eines bekannten deutschen Autors, der bereits zahlreiche Krimis und Thriller veröffentlicht hat. In der Gegend von Avignon führte seine Mutter ein kleines Hotel auf einem alten Landgut, das berühmt für seine provenzalische Küche war. Vor dieser malerischen Kulisse lässt der Autor seinen liebenswerten Commissaire Albin Leclerc gemeinsam mit seinem Mops Tyson ermitteln.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
Epilog
1
Jerusalem, 27. September 1142
Niemand, dachte Bertrand de Lacoste, durfte dieses Buch jemals in die Finger bekommen. Höchstens die Eingeweihten. Die höchsten Kreise. Und nicht einmal die dürften es lesen. Es müsste in den finstersten und geheimsten Abgründen für alle Ewigkeit versteckt bleiben.
Er wickelte das kaum verzierte Buch in eine unauffällige Flickendecke, steckte es dann in eine schlichte Kiste, die er abschloss, und packte die Kiste wiederum in eine größere, in der sich diverse Papiere befanden, die in Kürze in die Provence verschifft werden sollten. Draußen hallte das Geräusch von Hämmern und Sägen über den Tempelberg, der an diesem Morgen von einer gnadenlosen Sonne bestrahlt wurde. Es liefen noch einige Restarbeiten am Westflügel der Al-Aqsa-Moschee. König Balduin II. hatte sie den »Armen Rittern Christi und des Tempels von Salomon zu Jerusalem« zur Verfügung gestellt. Bertrand gehörte dem Templerorden schon seit einigen Jahren an.
Er seufzte, schloss dann die Kiste, klopfte mit den Fingerknöcheln auf das Holz und bekreuzigte sich. Es war seiner Meinung nach schlimm, dass das Buch überhaupt existierte. Die beiden Schreiber, die das Original transkribiert hatten, waren bei der Arbeit fast verrückt geworden und hatten fortlaufend gebetet. Unter Androhung von harten Strafen war ihnen Stillschweigen abgerungen worden. Aber sie waren Ordensbrüder. Von daher musste man sich keine Sorgen machen.
Die Entscheidung, den Inhalt der uralten Papyri zu sichern, hatte der Großmeister Robert de Craon selbst getroffen. Er hatte gerade erst durchgesetzt, dass die Regeln der Templer ins Französische übersetzt wurden, damit die nicht Latein sprechenden Ritter den Kodex lesen konnten. Darin hieß es auch, dass niemand im Orden nach seinem eigenen Willen kämpfen oder ruhen, sondern sich dem Befehl des Meisters unterwerfen solle, um dem Wort des Herrn nachzueifern, das besagt: »Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern dessen, der mich gesandt hat.« Folglich spielte es keine Rolle, ob Bertrand de Lacoste die Abschrift für einen Fehler hielt. Die Entscheidung war an höherer Stelle getroffen worden. Er hatte sich dem zu beugen.
Wenigstens hatte Bertrand de Lacoste durchgesetzt, dass die Abschrift nicht in Französisch oder Latein verfasst worden war – um sicherzustellen, dass niemand außerhalb des Ordens jemals in der Lage wäre, den Inhalt des Buches zu lesen. Über alles andere hatte der Großmeister nicht debattiert. Und eines musste man ihm lassen, dachte Bertrand und blickte aus dem Fenster: Seine Entscheidung war durchaus eine salomonische gewesen.
Robert de Craon hatte gesagt: »Wäre es nicht der Wunsch Gottes, würde es diese Papyri überhaupt nicht geben. Wir als seine Ritter werden den Willen des Herrn nicht hinterfragen, sondern ihn schützen, denn nicht ohne Grund sind diese Schriftrollen zu uns gelangt. Also werden wir sie einerseits für alle Ewigkeit sichern, damit sie niemals in die falschen Hände gelangen. Gleichzeitig werden wir gewährleisten, dass der Inhalt in unserem Gewahrsam überdauert, und ihn außer Landes schaffen.«
Und genau das würde nun geschehen. Die Templer verfügten über ein weitverzweigtes Netzwerk. Der Orden war einerseits gegründet worden, um den Heiligen Berg zu schützen, auf dem der Tempel Salomons und später der Tempel des Herodes gestanden hatte. Auf dessen Überresten war die Moschee kurz nach der Fertigstellung des Felsendoms gebaut worden. Die wesentliche Aufgabe des Ordens war aber der Schutz der Pilger nach Jerusalem. Gleichzeitig finanzierten die Einkünfte aus den Komtureien in Europa den Kampf im Heiligen Land, weswegen das Geld von dort regelmäßig in die Schatzkammern nach Outremer, nach Übersee, transportiert werden musste. Gelegentlich verliehen die Templer Geld, denn der Orden war sehr reich, und wie sich herausstellte, war mit dem Verleihen noch mehr Geld zu verdienen, das wiederum für den Kampf in Palästina zur Verfügung stand.
Der Reichtum der Templer war überall im Heiligen Land bekannt – und die Tatsache, dass es sich bei dem Ritterorden um einen geistlichen handelte, sozusagen um Mönche mit Schwertern und einem großen Interesse an Wissen und Weisheit. Da sie auf dem Tempelberg schalten und walten konnten, wie sie wollten, und ohnehin mit Bauarbeiten beschäftigt waren, wurde die heilige Stätte ausgiebig erkundet. Die Bundeslade sollte hier versteckt sein – und vieles mehr. Alles, was die Ritter dabei fanden, sicherten und archivierten sie und kauften außerdem an, was ihnen im Heiligen Land an außergewöhnlichen Dingen angeboten wurde.
So war es gekommen, dass an einem Wochenanfang vor drei Jahren ein unscheinbarer Mann um Einlass gebeten hatte, was nicht allzu leicht war. Dennoch hatte er sich durchgesetzt und schließlich bei Bertrand de Lacoste und Hugo de Avignon vorgesprochen. Der kleine Mann trug schlichte Kleidung und hatte einen Bart. Er stellte sich als Landwirt vor und war vier Tage lang nach Jerusalem gereist. Er hatte seinen Esel dabei, der mit diversen Taschen bepackt war, und diese Taschen waren wiederum mit länglichen Gefäßen gefüllt, in denen sich Schriftrollen befanden – uralte Papyri und Pergamente sowie einige Tontafeln. Der Mann erklärte, dass einer seiner Hirten sie in Höhlen gefunden habe und er überhaupt nichts damit anfangen könne. Gleichwohl sei er der Meinung, dass die Schriftrollen sehr alt seien und womöglich von Interesse, weswegen er sie zum Kauf anbiete.
Hugo de Avignon galt als ein an der Geschichte des Orients interessierter Ordensbruder. Wann immer es ihm möglich war, ritt er aus und besuchte Ruinen und uralte Städte. Außer Latein sprach er fließend Griechisch und hatte sich von Eingeweihten aus Ägypten und Palästina in noch viel ältere Sprachen einweisen lassen, sogar in Zeichenschriften. Deswegen erkannte er auf den Tontafeln eine Keilschrift aus den Zeiten der babylonischen oder persischen Großreiche, während die erstaunlich gut erhaltenen Papyri und Pergamente wiederum in Altgriechisch verfasst worden waren. Hugo de Avignon hatte Bertrand de Lacoste einen bedeutungsvollen Blick zugeworfen, und Bertrand hatte nicht lange gezögert. Der kleine Mann hatte daraufhin die Satteltaschen geleert, sie anschließend mit einigen Säckchen voller Goldmünzen wieder gefüllt und war mit einem seligen Lächeln von dannen gezogen.
Hugo hatte zwei weitere sachkundige Ordensbrüder hinzugezogen, um sich die Schriften und Tontafeln genauer anzusehen. Er war davon überzeugt, dass es sich um alttestamentarische Texte handelte und die Tontafeln die Originale sein könnten, auf denen die mitgelieferten Abschriften auf Pergament und Papyrus basierten.
Bertrand erinnerte sich noch gut an den Abend, als er am Fenster stand und in den Sternenhimmel blickte. Er hörte schnelle Schritte in der Halle. Dann hämmerte es an der Tür. Noch bevor er den Besucher hereinbitten konnte, wurde die Tür schon aufgerissen. Einen Augenblick später stand Hugo de Avignon im Raum. Sein Gesicht war vom Licht der kleinen Fackel erhellt, die er in seiner Rechten trug. Nur ein einziges Mal in seinem Leben hatte Bertrand de Lacoste einen solchen Blick gesehen – damals in den Augen seines Knappen, als sie unweit der Stadt eine Stelle in einer Schlucht aufgesucht hatten, in der Räuber zwei Handvoll Pilger getötet hatten, deren zerstückelte, von Tieren ausgeweidete Leichen in der Sonne verwesten.
»Ich weiß, was es ist«, hatte de Avignon mit heiserer Stimme geflüstert und sich mit der freien Hand bekreuzigt. Er hatte es Bertrand erzählt, woraufhin sich beide entschlossen hatten, unverzüglich mit dem Großmeister zu reden.
Drei Jahre hatte es nun gedauert, die Texte ins Lateinische zu übersetzen und das Lateinische wiederum in die Geheimschrift zu codieren, die die Templer für hochsensible Dokumente nach einem von Hugo de Avignon ersonnenen System verwendeten. Die lateinischen Übersetzungen waren im Anschluss an die Transkription verbrannt worden. Die Originale waren tief in den von zahllosen Gängen und Höhlen durchzogenen Tempelberg unterhalb der Moschee gebracht und dort in einer mit Felsen verschlossenen Kammer versteckt worden, damit sie niemand finden würde.
Jetzt drehte sich Bertrand herum, als zwei Ritter hereinkamen. Er zeigte auf die Kiste, und die Ritter wiederum bedeuteten vier Knappen, die Kiste auf den Wagen zu laden, der draußen hielt. Er würde rund drei Tage bis zur Küste nach Aschdod benötigen, wo es einen von einer Kreuzfahrerburg gesicherten Hafen gab. Von dort aus würde ein kleines Schiff die Kiste entlang der Küste zum weitaus größeren Hafen nach Akkon bringen, wo sie mitsamt anderen Gütern verladen und nach Marseille gebracht werden sollte. Von dort aus ging es tiefer in das Land nach Arles, dann nach Avignon und von dort aus in eine der gut gesicherten Festungen des Ordens.
Wenig später setzte sich der Karren in Bewegung. Die Ritter in der weißen Kleidung mit dem großen roten Tatzenkreuz eskortierten ihn vom Platz vor der Moschee hinab in die Straßen von Jerusalem.
Sie eskortierten das Buch, das es niemals hätte geben dürfen, dachte Bertrand de Lacoste und zitterte trotz der unerträglichen Hitze.
2
Heute
Michel Rival traf ein weiterer Schlag zwischen die Schulterblätter. Er stöhnte auf, stolperte, blieb dann mit der Schuhspitze in einer Ackerfurche hängen und stürzte. Rival war sowieso nicht mehr gut zu Fuß. Das lag am Alter und seiner verkalkten Hüfte. Meistens nutzte er einen Gehstock. Daher hatte er früher als Professor an der literaturwissenschaftlichen Fakultät der Uni einen Spitznamen gehabt: Ahab. Wie Captain Ahab in Melvilles »Moby Dick«, der mit seinem Holzbein über das Deck ging, worauf man bei jedem Schritt ein pochendes Geräusch hörte. Genauso klang es, wenn Rival den Stock auf dem Holzboden der Bibliothek aufsetzte und seinem persönlichen weißen Wal nachjagte: dem geheimen Buch, dem er so nahe gekommen war wie nie jemand vor ihm.
Rival fiel auf den Rücken, öffnete die Augen und blickte in den schwarzen Himmel. Der wirkte zerborsten, was am gesprungenen Glas seiner Brille lag. Er war außerdem voller Sterne. Eine klare Herbstnacht in der Provence. Vielleicht die letzte, die Rival erleben würde. Sehr wahrscheinlich sogar die letzte.
Im nächsten Moment wurde er vom Licht der Taschenlampe geblendet, mit deren Knauf er wie mit einem Schlagstock über das Weinfeld getrieben worden war. Außerdem wusste Rival, dass eine Waffe auf ihn gerichtet wurde. Dieselbe, deren Lauf auf seinen Kopf zielte, als er vorhin nach dem Klingeln die Tür seiner Wohnung in Pernes geöffnet hatte.
Instinktiv wollte Michel Rival die Hände schützend von sich strecken. Aber sie waren mit Kabelbindern auf seinem Rücken zusammengebunden. Er schluchzte auf.
»Bitte«, keuchte er und kroch rücklings von dem Angreifer fort, bohrte die Hacken seiner Schuhe in die trockene Erde, schob sich mit dem längst schmutzigen Tweedsakko über die Krume, als wolle er sich unter einem der Rebstöcke verstecken. »Bitte, nicht, ich weiß nicht mehr, ich kann Ihnen nicht mehr sagen als …«
Der Rest seiner Worte ging in Sprudeln und Husten unter. Eine Flüssigkeit wurde über ihn geschüttet. Sie klatschte in Rivals Gesicht und betäubte ihn mit ihrem Gestank. Es war Benzin. Gurgelnd und glucksend leerte sich der Kanister, wurde dann zur Seite geworfen.
»Wiederholen Sie es bitte«, sagte die Stimme. »Fassen Sie es für mich noch einmal zusammen.«
»Wozu soll das gut sein, wozu …«
Rival blinzelte.
»Zusammenfassen«, herrschte ihn die Stimme an.
Rival zitterte wie Espenlaub, denn ihm war klar, warum man einen Menschen mit Benzin übergoss.
Er hatte keine andere Wahl, als noch einmal zu wiederholen, was er vorhin in seiner Wohnung bereits gesagt hatte und ein weiteres Mal, als ihm mit Kabelbindern die Hände auf den Rücken gefesselt, er unter Vorhalten der Waffe in ein Auto gezwungen und dann wieder herausgezerrt und über den nächtlichen Acker getrieben worden war.
Dennoch verstand er beim besten Willen nicht, was man von ihm wollte, denn in Kürze wäre sowieso der größte Teil seiner Forschungen öffentlich geworden. Rival war als Redner zu einer großen Ausstellung in Avignon eingeladen worden. Die Schau drehte sich um besondere Texte und Bücher und trug den Titel: »Königreich der Himmel«. Es war weltweit eine der größten Ausstellungen ihrer Art mit biblischen Schriften, uralten Papyri und vielem mehr. Angedockt daran waren wissenschaftliche Vorträge und Symposien zum Thema, und Prof. Dr. Dr. Michel Rival als einer der in Frankreich führenden Experten für alte apokryphe Texte hätte dort über verlorene und verloren geglaubte Schriften des Alten Testaments gesprochen. »Jenseits des Kanons: Die Eschatologie in der Terra Incognita apokalyptischer Apokryphen« lautete der Titel seines Vortrags, und er hatte in der Fachwelt bereits für viel Interesse gesorgt, denn Rival hatte angedeutet, dass er über spektakuläre Forschungsergebnisse sprechen werde.
Tja, aber das tat er nun nicht in Avignon, sondern, wie ein hilfloser Käfer auf dem Rücken liegend und mit Benzin übergossen, in einem nächtlichen Weinfeld, das kurz vor der Lese stand.
»Und das wissen Sie alles – woher genau?«, fragte die Stimme.
Rival hustete und zwang sich, nicht durch die Nase zu atmen. »Aus meinen Forschungen!«, rief er. »Aus Büchern, Texten, wissenschaftlichen Arbeiten, Überlieferungen! Ich weiß es von Berichten und von der Quelle, die ich aufgetan habe! Aber das habe ich Ihnen doch schon alles gesagt!«
»Quelle?«
»Natürlich!«
»Monsieur Rival, deswegen ist es gut, dass wir uns noch einmal unterhalten, denn von der Quelle haben Sie bisher noch nichts gesagt.«
Rival war irritiert. »Nicht?«
»Nein. Manchmal vergisst man etwas in der Aufregung. Deswegen sind Wiederholungen sinnvoll. Das kennen Sie doch sicher auch aus der Universität. Warum haben Sie die Quelle nicht genannt? Wollen Sie jemanden schützen?«
»Ich? Nein, ich … Es spielt keine Rolle, nur lassen Sie mich bitte gehen. Tun Sie mir nichts, ich flehe Sie an.«
»Was also ist Ihre Quelle?«
Rival erklärte es.
»Und welche Rolle spielt diese Quelle?«
Rival antwortete auch darauf.
»Sehen Sie, so war unsere Zusammenarbeit am Ende doch noch fruchtbar. Das hilft mir weiter.«
»Dann kann ich jetzt gehen?«
Rival sah, wie ein Feuerzeug aufflammte. »Ich fürchte«, sagte die Stimme, »das wird leider nicht möglich sein.«
3
Laurent Fournier leerte sein letztes Glas Rotwein und klopfte allen noch mal auf die Schulter. Dann verabschiedete er sich von der kleinen Fête du Vin und schlenderte mit Schlagseite zum Parkplatz an der Stadtmauer. Die Kirchturmuhr von Pernes-les-Fontaines schlug gerade Mitternacht.
»Fête« war natürlich ein viel zu großes Wort für den kleinen Umtrunk. Einige Winzer waren zum Petanque gekommen, um sich zu entspannen. Dazu hatten sie ein paar Kisten mitgebracht wie jedes Jahr – wenn man so wollte, war das der informelle Start der Weinlese in der Gegend. In wenigen Tagen, also Mitte September, würde auf den meisten Feldern die Lese erst so richtig beginnen. Auf manchen war sie schon längst im Gang, denn wegen der Hitze im Sommer konnte und musste zum Teil vorzeitig gelesen werden. Der Start hing vom jeweiligen Reifegrad der Trauben und damit von der Lage ab. Auf den Tag genau konnte man ihn daher nie bestimmen. Aber überall waren bereits Helfer eingetroffen und die maschinellen Erntegeräte geölt und geschmiert. Wie zu vernehmen war, sollte der aktuelle Jahrgang sehr vielversprechend werden, von daher war die Vorfreude groß und die Motivation hoch.
Der letzte Jahrgang, das musste Fournier sagen, war allerdings auch nicht von schlechten Eltern. Er hatte ziemlich einen sitzen davon, und eigentlich sollte er deswegen auf keinen Fall auf seinem Moped fahren, zumal ohne Helm. Aber meine Güte, laufen wollte er ja nun auch nicht nach Hause, so wie er torkelte. Beim Fahren würde er wenigstens sitzen und könnte sich am Lenker festhalten. Außerdem war es Nacht und die Luft angenehm. Bis er zurück in Venasque wäre, wäre er wieder frisch im Kopf, und Nicole könnte das Nudelholz in der Schublade lassen. Also: sinngemäß. Sie ging ja nicht wirklich damit auf ihn los, wenngleich es jedes Mal Ärger gab, wenn er betrunken nach Hause kam. Das geschah in letzter Zeit häufiger, seit die Druckerei ihn in den Vorruhestand geschickt hatte. Inzwischen hatte sie Insolvenz angemeldet und war schließlich von einem größeren Konzern übernommen worden. Eigentlich ein Wunder, dass der kleine Betrieb so lange überlebt hatte. Die Branche war so gut wie tot. Dem Vernehmen nach wurden dort nun Waschmittelkartons bedruckt.
Wollte man das? Damit sein Leben verbringen? Hatte Laurent dazu das Handwerk gelernt? Nein, hatte er nicht.
Trotzdem fehlte ihm eine Aufgabe. Nicole hatte noch fünf Jahre bis zur Rente und bis dahin im Supermarkt an der Kasse jede Menge zu tun. Aber Laurent, der hatte nur noch Boulespielen, Spazierengehen, Rauchen und Rotwein. Wenn eine dieser vier Säulen wegbrechen würde, dann würde sein Leben zwangsläufig in eine gewaltige Schieflage geraten. Und das wusste auch Nicole.
Laurent Fournier klappte den Ständer des Mopeds ein, nahm auf dem Sitz Platz und drehte den Zündschlüssel herum. Knatternd sprang der Motor an. Das Licht flammte auf. Dann fuhr er los.
Er nahm die Strecke über St. Didier, weil sie einerseits die kürzeste war und weil er andererseits davon ausging, dass ihn kein Polizeiauto anhalten würde. Außerdem war hier zu dieser Uhrzeit sowieso kaum Verkehr, so dass er problemlos die gesamte Fahrbahnbreite für sich beanspruchen konnte. Was er dann auch tat, allerdings eher unfreiwillig, denn mit einem betrunkenen Fahrer schlingerte das Moped reichlich.
Laurent konzentrierte sich darauf, in der Mitte der Straße zu bleiben. Das war sicherer, als rechts am Rand zu fahren. Nur ein Schlenker – und schon würde er im Straßengraben landen. Im Licht der Scheinwerfer fokussierte er den Blick auf die Fahrbahn. Wenn ihm jemand entgegenkam, würde er das bestimmt rechtzeitig bemerken.
Der Fahrtwind war angenehm. Zum Glück war es abends und nachts nicht mehr so heiß wie noch im Juli und im August.
Diesen Sommer hatte sich die Provence in einen Glutofen verwandelt. Flüsse waren ausgetrocknet, Brunnen versiegt. Mochte sein, dass es sich um Folgen des Klimawandels handelte. Andererseits hatte er schon viele unerträglich heiße Sommer erlebt. Eben hatten sie beim Petanque noch über das Wetter debattiert. Die Trockenheit und alles und dass man noch nie so früh mit der Weinlese begonnen habe wie dieses Jahr. Aber besser als die Frostperiode davor, die Hitze habe viele Schädlinge plattgemacht, weswegen mit höheren Erträgen zu rechnen sei. Der Regen kürzlich habe gutgetan und die Reife regelrecht beschleunigt. Nicht auszudenken, wenn die Hitze weiter angehalten hätte. Dazu die gerade gefällte Erlaubnis nach Jahren der Verhandlung, dass die Appellation Gigondas nun auch Weißwein produzieren dürfe und was das bedeute und ob es überhaupt sinnvoll sei.
Laurent hatte zu der Fachsimpelei meist nur genickt oder den Kopf geschüttelt. Ihm kam es eher auf das finale Produkt an und dass er dafür nicht viel bezahlen musste – wie zum Beispiel heute, wo es gar nichts gekostet hatte.
Er durchquerte das menschenleere St. Didier. Das Motorengeräusch hallte unnatürlich laut durch den kleinen Ort. Schließlich bog er auf die Straße nach Venasque ein und befand sich nach wenigen Minuten wieder mitten in der Vegetation, die hier im Wesentlichen aus Obstbaum- und Olivenplantagen und Weinfeldern bestand. Darüber spannte sich ein schwarzer Himmel voller Sterne.
Und ein orangefarbenes Flackern, das Laurent links in der Ferne wahrnahm. Fackelte da jemand nachts verbotenerweise Baumschnitt ab? Mochte sein. Denn das war wegen der Dürre verboten. Nur ein bisschen Funkenflug – und schon hatte man einen Flächenbrand entfacht. Da gab es scharfe Richtlinien, auch für den Aufenthalt in den Wäldern. Dort brauchte bloß jemand eine Flasche wegwerfen, die Sonne brach das Licht wie in einer Lupe, bündelte es, und schon war das Feuer nicht mehr weit.
Laurent blinzelte. Das sah aber verdammt groß aus. Das war kein kleines Feuerchen. Je näher er kam, desto deutlicher konnte er sehen, was dort los war. Das war ein Feuer inmitten eines Weinfeldes, oder?
Er stoppte das Mofa am Anfang eines Wirtschaftsweges. Mann, er sollte dort hingehen und den Burschen, die da etwas abfackelten, in den Hintern treten. Leider hatte er kein Handy dabei. Sonst würde er sofort die Polizei rufen oder die Feuerwehr. Er ließ das Ding meist zu Hause liegen. Hatte er noch nie gebraucht. Wer sollte ihn auch schon anrufen und wen er? Na ja, in diesem Augenblick wäre es durchaus hilfreich gewesen.
Sah tatsächlich aus, als brannte dort Baumschnitt zwischen den Reben mitten im Feld. Oder die Weinstöcke selbst. Verdammt, er sollte sich endlich eine Brille zulegen. Aber da waren diese Geräusche. Nein, das waren keine Reben, das musste junges Holz sein, das krachte, pfiff und jaulte. Kam von den Harzen, oder … Oder lief dort jemand mit einer großen Fackel auf dem Acker herum?
Laurent stellte den Motor ab, hörte genau hin. Sah genau hin.
Mit wachsendem Entsetzen begriff er, dass die Geräusche nicht von den Ästen oder Harzen stammten. Er verstand außerdem, dass es kein Holzstoß war, der da in Flammen stand. Denn der würde sich wohl kaum hin und her bewegen. Es hantierte dort auch niemand mit einer Holzfackel.
Die Fackel, begriff Laurent, der vor Schreck das Gleichgewicht verlor und mit dem Moped in den Straßengraben stürzte, war ein Mensch, der schreiend hin und her lief.
4
An diesem Morgen roch Albin den Herbst zum ersten Mal in diesem Jahr. Es war zwar noch sehr warm, aber es lag in der Luft, dass sich der Sommer seinem Ende näherte und bald die Blätter fallen würden. Dann färbte sich die gesamte Provence für ein paar Wochen in so satten Farben, als hätten sich alle Impressionisten miteinander verschworen und verabredet, nur die wärmsten Töne auf ihren Paletten aufzutragen und damit die Natur zu tünchen.
Erste braune Blätter lagen auf den Wegen. Der Wind war frisch. Es duftete schwach nach Erde. Immer wieder musste er an den Straßen Traktoren mit Anhängern ausweichen, die randvoll mit Weintrauben gefüllt waren. Auf manchen Feldern sah er die großen Erntemaschinen, die die Lese automatisch vornahmen. Ein einzelner dieser Kolosse ersetzte die Arbeit von sechzig Menschen. Auf anderen Feldern wurde nach wie vor von Hand gearbeitet. Dort sah man massenweise Pflücker, die bereits vor einigen Tagen oder Wochen aus ganz Frankreich und dem Rest Europas angereist waren, um sich bei der Ernte einen krummen Rücken zu holen und etwas Geld zu verdienen.
Manche waren darunter, die sogar Geld dafür bezahlten, in den Weinbergen und auf den Weinfeldern zu arbeiten. Das waren Touristen, Weinenthusiasten, die es großartig fanden, mittendrin zu sein und an der Entstehung der Endprodukte teilhaben zu können, die sie später verköstigten.
Das sollte Albin mal einfallen, dachte er und steckte sich im Gehen eine Gitanes an. Tyson trottete vor ihm her. Der Mops kannte den Weg der morgendlichen Gassirunde genauso auswendig wie Albin. Sie änderten ihre Routen selten. Manchmal kam es Albin in den Sinn, dass er doch lieber in Richtung Süden gehen wollte, an anderen Tagen eher nach Westen.
Kleine Abwechslungen von der Routine taten gut. Albin brauchte das. Er war seit einiger Zeit pensionierter Commissaire, und ihm wurde sehr schnell langweilig. Natürlich – immer wieder war er in der Vergangenheit bei Ermittlungen in Kriminalfällen beteiligt gewesen. Aber wenn man mal ehrlich war, dann auch nur deswegen, weil er sich selbst stets ins Spiel gebracht hatte. Wenn er darauf warten würde, dass man ihn als Polizeiberater hinzurief – da könnte er wohl bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf dem Sofa hocken.
Seine Kollegen hatten ihm sogar den Mops zum Ruhestand geschenkt, damit er etwas zu tun hatte und niemandem mehr auf die Nerven ging. Vielleicht auch, um sich etwas über Albin lustig zu machen – er, der weißhaarige Mann vom Format eines Kleiderschranks, und der winzige Hund mit ebenso zerknautschtem Gesicht wie der Besitzer.
Tysons Präsenz hatte aber nicht verhindert, dass Albin den Kollegen auch weiterhin auf die Nerven ging. Er konnte einfach nicht anders. Die Polizeiarbeit war stets sein Lebensinhalt gewesen, und seine Gedanken kreisten nach wie vor darum. Er konnte nicht einfach einen An-/Aus-Knopf drücken. Er hatte es ja versucht. Aber wenn er nur eine halbe Stunde lang allein zu Hause tatenlos auf der Terrasse hockte, wurde er bereits nervös, musste aufstehen und sich mit irgendetwas beschäftigen. Er war im aktiven Dienst wie ein TGV in voller Fahrt gewesen, den man nicht einfach auf einem Abstellgleis vor einen Prellbock knallen lassen konnte. Ein Zug wie der Leclerc-Express ließ sich nicht ausbremsen, man konnte allenfalls den Fuß vom Gas nehmen und musste ihn ausrollen lassen – falls man Loks denn überhaupt so steuerte.
Diese Zeit zum Verringern des Tempos nahm sich Albin, denn die Alternative wäre … TGV, volle Fahrt, Rammbock, Unglück – eine simple Gleichung.
Albin kickte eine herabgefallene Feige vor sich her und paffte Rauchschwaden in den kobaltblauen Himmel, der mit dicken weißen Wolken betupft war. Das Licht war satter als an anderen Tagen, das Grün noch grüner, und seine Frau Veronique hatte gestern die ersten herbstlichen Dekoartikel für ihr Blumengeschäft in Carpentras ausgepackt.
Seine Frau.
Das klang immer noch ungewöhnlich. Sie hatten in der kleinen Kirche von Venasque geheiratet. Die Hochzeitsreise hatte sie nach Martinique geführt. Veronique war etwas jünger als Albin, sah aber bedeutend jünger aus. Ihre Augen hatten noch nie das Grauen gesehen, nicht in die tiefsten menschlichen Abgründe oder in den Lauf einer Pistole oder eines Gewehrs geblickt.
Kein Wunder, dass Albin die eine oder andere Falte mehr im Gesicht trug. Dennoch war er der Meinung, dass Veronique über exzellente Gene verfügen musste, denn sie tat wirklich nur das Nötigste für ihre Haut und übertrieb es weder mit Cremes noch mit Schminke. Ihre beiden Töchter und die Enkelkinder dürften sich glücklich schätzen, wenn sie diese Anlagen erben.
Und was Albin anging – na ja, er hoffte, dass seine eigene Tochter Manon und seine Enkelin Clara so wenig wie möglich von ihm erbten. In jedem Fall verfügten Manon und Clara über einen ähnlichen Dickschädel wie Albin. Clara, die gerade in die Schule gekommen war, deutlich mehr als ihre Mutter. Äußerlich hatten beide nicht viel von Albin, der schon früh weiße Haare bekommen hatte. Manon hatte nicht eine graue Strähne, sondern dieselben kräftigen schwarzen Haare wie ihre Mutter Inés und auch deren dunkle Augen, die stets ein wenig traurig wirkten.
Clara hatte beides geerbt. Wenn man sie und Manon nebeneinander sah, lag auf der Hand: Das sind Mutter und Tochter. Und wenn man Inés, die nach der Scheidung vor mehr als zwanzig Jahren wieder ihren Mädchennamen angenommen hatte, danebenstellte, würde man sofort erkennen, wer die Oma war. Wann hatte Albin seine Ex das letzte Mal gesehen? Damals in Paris, als er vor einigen Jahren aus guten Gründen Manons Mann Gilles verdroschen hatte?
Einige Minuten später erreichten Albin und Tyson den Ortskern und spazierten die Platanenallee entlang. Albin ließ einen Lastwagen passieren, der dem Aufdruck nach den Supermarkt mit Gemüse beliefern würde. Vor zwei Tagen hatte Albin in den Auslagen die ersten weihnachtlichen Backwaren und Naschereien entdeckt. Anfang September! Bei knapp unter dreißig Grad! Aber es war ja jedes Jahr das gleiche Spiel. Sogar im Internet machten sie einen mit Weihnachten verrückt. Manon hatte Albin erzählt, dass Spotify ihr bereits Weihnachtsplaylists vorschlug.
»Was ist denn Spotify nun wieder?«, hatte Albin gefragt.
»Das ist eine App, auf der du rund um die Uhr kostenlos Musik hören kannst«, war Manons Erklärung.
»Und wer bezahlt die Künstler?«
»Spotify?«
»Aber wenn es doch kostenlos ist?«
»Ich weiß nicht so genau.«
»Eine CD hat früher zwanzig Euro gekostet. Davon hat ein Musiker einen Teil erhalten. Wie kommen die heute an ihr Geld, wenn im Internet alles umsonst ist?«
»Es wird schon Wege geben.«
»Vermutlich gibt es deutlich mehr Wege, auf denen die Industrie an ihr Geld gelangt. Am Ende, Manon, sind die großen Firmen immer die Gewinner und saugen uns und die Kreativen aus wie Moskitos.«
Manon hatte gestutzt. »Du klingst ja wie ein alter Linker.«
»Im Zweifel lieber links als rechts. Wobei mir Politik bekanntlich gleichgültig ist. Ich weiß nur, dass es irgendwo einen Fehler im System geben muss, wenn CDs früher zwanzig Euro gekostet haben und man die Musik jetzt komplett kostenfrei anhören kann. Diese Spotify-Leute werden sich dumm und dämlich auf Kosten der Musiker verdienen. Allerdings muss doch irgendwer dafür bezahlen. Wie soll das funktionieren, wenn es umsonst ist?«
»Papa, die berühmten Musiker werden schon irgendwie an ihr Geld gelangen. Sie leben ja nach wie vor in Villen und fahren Ferraris.«
»Und was ist mit den nicht so berühmten?«
Manon hatte mit den Augen gerollt, das Thema gewechselt, und Albin hatte nur gedacht, dass die Welt doch jeden Tag ein Stück verrückter und unerklärbarer wurde.
Schließlich überquerten Albin und Tyson die Straße. Nach wenigen Schritten waren sie am Café du Midi, wo sich Albin auf dem kleinen Platz davor an den Bistrotisch setzte, an dem er immer saß. Von hier aus hatte er stets einen guten Blick auf die Straße und auf Veroniques Blumenladen schräg gegenüber, und er bekam sofort mit, wenn ein Polizeiwagen anhielt und die Besatzung ausstieg, um sich einen Kaffee oder Cappuccino to go abzuholen, was regelmäßig geschah.
Wobei »Café« eine hochtrabende Bezeichnung für das Midi war. Vielmehr handelte es sich um eine Mischung aus Bar Tabac und kleiner Kaffeebar, in der man auch Erfrischungsgetränke oder Eis kaufen konnte, Gebäck oder Sandwiches. Die rote Markise war längst von der Sonne ausgeblichen. Im Inneren herrschte stets Halbdunkel. Die Wände waren mit Bilderrahmen gepflastert, die alte Zeitungsausschnitte von Boxkämpfen oder von der Tour de France zeigten. Der prominent hinter dem Tresen aufgehängte Rahmen fasste jedoch ein signiertes Porträt von Marine le Pen ein, die im letzten Präsidentschaftswahlkampf den Vorsitz der inzwischen in Rassemblement National umbenannten Partei Front National abgegeben und stattdessen die Fraktionsführung in der Nationalversammlung übernommen hatte. Die Rechten waren drittstärkste politische Kraft im Parlament. Im Süden waren sie seit Jahren in vielen Wahlbezirken ungeschlagen, stellten jede Menge Bürgermeister und weitere Ämter.
Einer von Marine le Pens glühenden Verehrern kam gerade die drei Treppenstufen vom Café herab. Er hielt ein Tablett in der Hand, auf dem eine Tasse mit frischem Kaffee und eine Schale mit klarem Wasser standen. Der Mann war wenig jünger als Albin, aber deutlich kleiner. Unter seinem verwaschenen Polohemd spannte sich ein Bauch, der kaum preisgab, dass Matteo einmal ein sehr guter Amateurboxer gewesen war. Die uralte Jeans saß ihm tief auf den Hüften.
Matteo machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Wortlos stellte er Albin den Kaffee hin und Tyson die Wasserschale, zog dann einen alten Putzlappen aus der Hintertasche seiner Hose und wischte damit beiläufig über den Tisch.
Albin steckte sich eine weitere Zigarette an, trank einen Schluck Kaffee und sparte sich dieses Mal eine Bemerkung über dessen miese Qualität, obwohl es nach seiner Meinung der beste Kaffee war, den man im Vaucluse bekommen konnte.
Stattdessen sagte er: »Kein Wunder, dass hier nie Gäste sitzen, wenn der Wirt beim Servieren ein solches Gesicht zieht.«
»Pah«, machte Matteo und verscheuchte eine träge Wespe. »Hast du es denn noch nicht gehört?«
Albin paffte und zuckte mit den Schultern.
»Das gibt’s doch nicht. Wer hat denn den kurzen Draht zur Polizei? Schaust du auch mal in die Onlinemedien?«
Albin zuckte erneut mit den Schultern. Nein, tat er nicht. Er bevorzugte Printprodukte. Allerdings sollte er sich dem Wandel der Zeiten ein wenig anpassen. Die Onlinemedien waren schlicht und ergreifend schneller. So wie das Radio die Zeitungen eingeholt hatte, war es längst mit der Verbreitung von Nachrichten im Internet, und daran würde niemand mehr rütteln können.
»Auf der Domaine la Fontaine hat es gestern Nacht gebrannt«, erklärte Matteo und seufzte. »Mitten auf einem Feld. Es wurden jede Menge Reben beschädigt. Dazu kommt, dass nun die Ursache untersucht wird und dort alles abgesperrt ist, was natürlich die Ernte beeinträchtigt.«
»Nichts davon gehört«, erwiderte Albin und trank etwas Kaffee. »Und warum besorgt dich das?«
»Weil es ausgerechnet auf der Domaine gebrannt hat, an der ich Anteile erworben habe, und somit trifft es mein persönliches Vermögen.«
Stimmt, dachte Albin. Matteo hatte kürzlich darüber räsoniert, dass man heutzutage sein Geld nirgends mehr vernünftig anlegen konnte, weswegen er in ein Weingut investiert hatte. Dazu hatte er etwas vom »Blut unseres Landes« gefaselt und dass auf der Domaine keine Ausländer arbeiten würden, sondern ausschließlich Franzosen, weswegen sein Geld dann ja gewissermaßen im Lande bleibe.
»Ist denn großer Schaden entstanden?«
»Ich konnte mich noch nicht persönlich darüber informieren. Aber sicherlich wird es nicht unerheblich sein. Das war sowieso Brandstiftung, wenn du mich fragst. Es brennt doch nicht einfach so mitten auf einem Feld? Da hat sicher jemand gezündelt. Es würde mich nicht wundern, wenn das ein linksfaschistischer Angriff ist. Auf der Domaine arbeiten ausschließlich Franzosen, und der Besitzer ist einer unserer Abgeordneten. Dazu ich als Investor …«
»Hat der Besitzer finanzielle Probleme?«, fragte Albin und zog an der Zigarette.
»Warum?«
»Weil er doch offenbar Personen gesucht hat, die sich an seinem Betrieb finanziell beteiligen.«
Matteo blähte die Backen. »Also, bitte. Hat Microsoft finanzielle Sorgen, wenn ich Aktien von denen kaufe? Oder Air France? Das steht doch in keinerlei Zusammenhang.«
Albin machte eine »Kann sein, kann aber auch nicht sein«-Geste.
Matteo lehnte sich über den Tisch und stützte sich mit den Händen darauf ab. »Monsieur le Commissaire …«
»Ex-Commissaire.«
»Ich habe mir die Bücher zeigen lassen und kann dir versichern, dass der Betrieb auf soliden Beinen steht. Da gibt es keine finanziellen Sorgen und keine Probleme. Die Domaine will erweitern, technische Neuerungen anschaffen. Davon habe ich gehört, weil ich dort Kunde bin und Wein für das Café kaufe. Der Besitzer wollte Kredite aufnehmen, und ich habe ihm vorgeschlagen: Wie wäre es mit einer Beteiligung an deinem Betrieb, und statt Zinsen bei der Bank zu bezahlen, beteiligst du mich am Umsatz und gibst mir Vergünstigungen beim Ankauf deiner Produkte? Würde der Betrieb schlecht laufen und eine Investition wäre nicht lukrativ, hätte ich mich ja wohl kaum für eine Umsatzbeteiligung interessiert.«
»Verstehe«, sagte Albin und leerte den Kaffee. »Das ist die Domaine …«
»… in Richtung Pernes. Jawohl, mein Herr. Ich würde mir das Debakel ja ansehen und mich vor Ort über den Schaden unterrichten lassen. Aber im Gegensatz zu manchen Pensionären habe ich zu arbeiten und ein Geschäft zu führen, das jetzt noch mehr Umsatz abwerfen muss, da es einen direkten Anschlag auf mein Vermögen gegeben hat!«
»Weißt du«, erwiderte Albin, löschte die Zigarette und stand auf, »da ich gerade nichts Besseres zu tun habe, fahre ich mal kurz vorbei und sehe mir den Fall vor Ort etwas genauer an.«
»Als mein Abgesandter, oder wie meinst du das? Oder weil es dich persönlich interessiert?«
»Nicht als Abgesandter, meine Güte. Eher als fachlicher Begutachter«, sagte Albin. »Ich lasse es mir sogar von dir bezahlen, damit du es von der Steuer absetzen kannst und deinen Umsatz verbesserst. Meine Bezahlung für den Job ist dieser Kaffee.«
Matteo schürzte die Lippen, schien kurz darüber nachzudenken, ob sich das für ihn rechnete oder nicht.
»Deal«, sagte er dann.
5
Castel blickte in den Himmel und zog die Ray Ban aus der Brusttasche ihres Jeanshemds, das sie offen über einem T-Shirt trug. Sie setzte die Sonnenbrille auf und sah sich dann weiter um.
In der Seitentasche ihrer khakifarbenen Cargohose summte das Handy. Sie zog es hervor und sah, dass eine Nachricht eingegangen war. Im Moment nicht so wichtig. Sie würde sich später darum kümmern. Dann ließ sie den Blick ein weiteres Mal über das Weinfeld streifen.
Schwer zu schätzen, aber es mussten sicherlich sechzig Rebstöcke Schaden durch das Feuer genommen haben. Die Flammen hatten in der Mitte des Feldes eine Fläche von der Größe eines halben Fußballplatzes vernichtet. Das passierte nicht einfach so aus dem Nichts. Man konnte sicher von Brandstiftung ausgehen, weswegen sie und Theroux hier waren, der nur wenige Meter weiter am Wirtschaftsweg mit dem Eigentümer stand, der wild gestikulierend auf ihn einredete.
Auf Anhieb nahm Cat an, dass jemand Brandbeschleuniger verwendet haben musste. Das war die einfachste Erklärung, und die einfachen Erklärungen waren oft die besten und zutreffendsten.
Die Feuerwehr war noch in der Nacht vom Bereitschaftsdienst alarmiert worden, nachdem ein anonymer Anrufer das Feuer bei der Polizei gemeldet hatte. Die Einsatzkräfte hatten den Brand gelöscht, und eine Streifenwagenbesatzung hatte das Areal weiträumig mit Absperrband gesichert. Inzwischen war der Löschtrupp wieder abgerückt. Der Besitzer des Feldes war verständigt worden. Vom Feuer hatte er nach seinen eigenen Worten nichts mitbekommen, weil seine Domaine an anderer Stelle lag, etwa zwei Kilometer von hier entfernt.
Castel und Theroux waren eben erst eingetroffen und hatten sich bislang nur ein vages Bild von der Lage machen können. Das betraf vor allem die Beschreibungen des anonymen Anrufers über seine Beobachtungen. Dass jemand brennend in dem Feld hin und her gelaufen sei. Nach Einschätzung des Bereitschaftsdienstes war der Anrufer sehr aufgeregt gewesen und habe betrunken geklungen. Falls an seinen Beschreibungen etwas dran war, hätte es sich mit seiner Anonymität natürlich schnell erledigt, und die Polizei würde sich einen Gerichtsbeschluss besorgen, um den Anrufer zu ermitteln und zu befragen.
Aber noch war nichts klar. Die Streifenpolizisten hatten die Brandfläche zwar in Augenschein genommen, aber nicht im Detail, um keine Spuren zu verwischen beziehungsweise das Areal nicht mit den eigenen zu kontaminieren. Jedenfalls hatten sie oberflächlich nichts feststellen können außer verbrannter Erde, verbrannten Rebstöcken und einem großen, dampfenden Durcheinander. Von menschlichen Spuren hatten sie nichts gesehen und deswegen lieber das Areal abgesperrt und auf das spätere Eintreffen der Kriminalpolizei und der Spurensicherung gewartet, die sich sowieso alles ansehen und dann die weiteren Schritte einleiten würden. Jetzt parkten sie mit dem Streifenwagen am Eingang des Wirtschaftsweges, der ebenfalls von den Löschfahrzeugen in Mitleidenschaft gezogen worden war, neben einem Jeep der Feuerwehr, die das Areal zur Brandwache unter Beobachtung hielt: Manchmal entwickelten sich aus einzelnen Glutnestern neue Feuer.
Castel warf nochmals einen Blick zu Theroux, der nach wie vor mit dem aufgeregten Besitzer der Domaine la Fontaine debattierte. Er hieß François Mueller – ein rundlicher Mann in grauer Latzhose mit hochrotem Kopf, was an der Aufregung, zu viel Sonne, zu hohem Blutdruck oder einer Mischung aus allem liegen mochte. Castel machte mit dem Kopf eine Geste zu Theroux, die ihm bedeuten sollte, dass sie sich jetzt das Weinfeld genauer ansehen würde. Theroux antwortete mit einem Nicken, bevor er sich wieder dem Wortschwall von Mueller widmete.
Castel setzte sich in Bewegung. Die Luft roch nach Feuer und Asche. Die Erde war nass. Überall standen Pfützen. Die Reifen der Löschfahrzeuge hatten tiefe Furchen in die Erde gegraben und außerdem einige Rebstöcke beschädigt, denn die Einsatzkräfte hatten rund hundert Meter vordringen müssen, um an den Brand zu gelangen. So weit konnte kein Schlauch spritzen.
Sie wollte gerade unter der Absperrung mit rot-weiß gestreiftem Flatterband hindurchtauchen, als ihr ein silberner SUV auffiel, der an der Straße rechts ranfuhr und dort stoppte.
Castel wusste, wem der Wagen gehörte.
Sie hielt in der Bewegung inne, gab ein leises Seufzen von sich und entschied sich, noch einen Moment abzuwarten, bevor sie hin- und herlaufen müsste, denn es war ziemlich klar, was in den nächsten Minuten geschehen würde.
Zunächst sah sie einen großen, weißhaarigen Mann, der ausstieg, um den SUV herumging, den Kofferraum öffnete, seinen Hund heraushob und anleinte. Er sah sich kurz um, orientierte sich, dann ging er weiter und hob kurz die Hand in Richtung Theroux, der in Richtung des Mannes zu schimpfen schien und gestikulierte, was der Mann jedoch ignorierte. Wenige Momente später redete er mit den Streifenpolizisten und der Feuerwehr, zog irgendetwas aus der Hosentasche und hielt es ihnen vor die Nase, deutete dann in Richtung von Castel. Die Polizisten sahen sich zu ihr um, und sie erwiderte die fragenden Blicke mit einer abwinkenden »Schon gut«-Geste. Daraufhin setzte sich der Mann wieder in Bewegung und stand etwa eine Minute später vor Castel, die sich jedoch zunächst hinhockte und den kleinen Hund ausgiebig begrüßte.
Tyson freute sich fast ein Bein ab. Er war kürzlich für knapp zwei Wochen bei Castel in Pension gewesen, während die Leclercs zur Hochzeitsreise auf Martinique weilten. Er hatte sich blendend mit Mila verstanden. Mila war das schwarze Mopsmädchen, das Castels Lebensgefährten Jean Villeneuve gehörte, der Kunsthistoriker war und im Musée Granet in Aix-en-Provence arbeitete. Außerdem hatten Tyson und Mila, als Castel einmal nicht achtsam gewesen war …
Schwamm drüber. Besser, im Moment nicht drüber nachdenken.
»Hallo, Albin«, sagte Castel im Aufstehen.
»Castel«, erwiderte Albin trocken und nickte ihr zu. »Ich hörte von dem Brand, kam zufällig hier vorbei, weil ich gerade nach Avignon zum Einkaufen fahren wollte, und …«
»Avignon liegt in einer ganz anderen Richtung.«