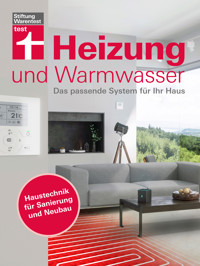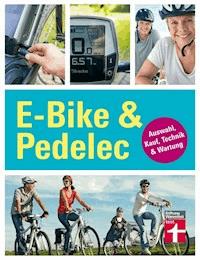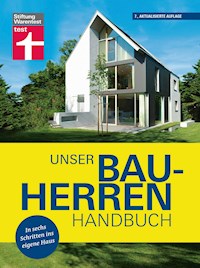
Unser Bauherren-Handbuch: Mit jedem Kapitel dem Traum vom Eigenheim ein Stück näher kommen - Wohnwünsche - Finanzierung - Grundstück- und Haussuche - Bauplanung E-Book
Karl-Gerhard Haas
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In sechs Schritten ins neue Zuhause Sie planen ein Haus neu zu bauen oder die Sanierung, Renovierung oder Modernisierung eines Hauses? Das eigene Haus ist eine große Investition und es gilt vor der Umsetzung vieles zu Bedenken und zu Planen. Dieses Handbuch führt Sie erfolgreich durch Ihr Bauvorhaben. Der Traum vom Eigenheim ist damit zum Greifen nah. In einer Schritt-für-Schritt-Anleitung leitet dieses Buch durch den gesamten Bauprozess. Von der Grundstückssuche und dem Einholen von Baugenehmigungen bis zu detailierten Informationen zur Haustechnik und zur Nachhaltigkeit von Baustoffen. - Den Wunschkatalog erstellen: Wie und wo Sie in Zukunft wohnen und leben wollen - Bestandsaufnahme: Was Sie sich – realistisch kalkuliert – finanziell auf Dauer leisten können - Die Finanzierung aufstellen: Ein maßgeschneidertes Konzept entwickeln und Förderungen ausschöpfen - Grundstück- und Haussuche: Die verschiedenen Wege zum eigenen Haus - Wer ist wer beim Bauen: Ihre Vertragspartner und die rechtlich sichere Beauftragung - Das Haus planen und umsetzen: Vorbereitung und Praxistipps für eine erfolgreiche Bauphase
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 832
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UnserBauherren-Handbuch
Karl-Gerhard Haas • Rüdiger Krisch • Karsten Meurer • Nadine Oberhuber
Inhaltsverzeichnis
SCHRITT 1
Die Wunschliste fürs Traumhaus
Bedarfsgerechte Hausplanung
Planung – was heißt das eigentlich?
Wo wollen Sie leben?
Wie groß soll es werden ?
Wohnwünsche konkret formulieren
Schreiben Sie Ihr eigenes „Drehbuch”!
Wie lässt sich der Raumbedarf realisieren ?
Die Wohnräume
Auf welchem Grundstück wollen Sie bauen?
Grundrisstypen
Flexibilität, Variabilität, typologische Nachhaltigkeit
Raumplanung hilft, Kosten zu sparen
Energiesparendes Bauen
Ökologisches Bauen
Erwartungen an den Wohnkomfort
Selbst bauen oder kaufen?
Bauen auf eigenem Grundstück
Neubaukauf vom Bauträger
Gebrauchtes Haus umbauen?
Fertigungsmethoden im Vergleich
Energie- und Umweltkonzepte
Heiztechnik
Warmwasseraufbereitung
Energiequellen
Heizen mit Rauchabzug
Fossile Brennstoffe
Wärmepumpen
Thermische Solaranlagen
Selbst Strom erzeugen
Wasser sparsam nutzen
Wie nachhaltig sind Bau- und Dämmstoffe ?
Teiche
Bauwerksbegrünungen
Gesetzliche Vorschriften
SCHRITT 2
Bestandsaufnahme: Was können wir stemmen?
Eigenkapital – Fundament der Finanzierung
Eigenkapital für Nebenkosten
Was gehört zum Eigenkapital?
Risiken vermeiden
Förderungen und Eigenkapitalersatz
Beispielrechnung: Eigenkapital
Das Einkommen – Ihr monatliches Budget
Belastungsgrenzen realistisch einschätzen
Ermittlung des verfügbaren Haushaltseinkommens
Einkommen eines durchschnittlichen Haushalts
Lebensführung überprüfen
Der Kredit – und die Grenze für Ihre Gesamtkosten
Der Alleinlebende
Die Doppelverdiener
Paar mit Alleinverdiener
Sonderfall: Metropolenkäufer
Eine Nummer kleiner?
Die 5 häufigsten Fallen bei der Finanzplanung
SCHRITT 3
Die Finanzierung aufstellen
Finanzierung für Selbstnutzer
Das Eigenkapital
Der Zins
Die Laufzeit
Der Mix macht´s: Welche Finanzierungstöpfe lassen sich nutzen?
Finanzierung für Selbstnutzer mit Mieteinheit
Das Hypotheken- oder Annuitätendarlehen
Wer bietet solche Darlehen an?
Wovon hängt der Zinssatz ab?
Für welchen Anbieter soll ich mich im Zweifel entscheiden?
Spezialfall: Das Volltilgerdarlehen
Taktieren bei der Abschnittsfinanzierung
Der Erstkredit
Ein Ausblick: Die Anschlussfinanzierung
Die Prolongation
Neue Kreditgeber – die Umschuldung
Das Forwarddarlehen
Prioritäten setzen – Strategien entwickeln
Die Zinsstrategie – wie Sie möglichst wenig Zinsen zahlen
Die Tilgungsstrategie – die Schulden schneller loswerden
Ihre Raten – wie hoch soll die monatliche Belastung sein?
Was Wohn-Riester-Darlehen bringen
Sie haben schon einen Riester-Vertrag
Neu abschließen: das Wohn-Riester-Darlehen
Steuern in der Rentenphase
Förderungen und Steuererleichterungen
Immer interessant: KfW-Darlehen
Unterstützung von Bundesländern, Kommunen und Kirchen
Weitere geldwerte Vorteile vom Staat
Die 5 häufigsten Fehler bei der Finanzierung
Versicherungen rund ums Eigenheim: Welche sind nötig?
Rohbauversicherung – unbedingt
Wohngebäudeversicherung – unbedingt
Haftpflicht – unbedingt
Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung – empfehlenswert für Öltankbesitzer
Bauhelferversicherung – wichtig
Elementarschadenversicherung – falls nötig
Risikolebensversicherung – wäre gut
Hausratversicherung – empfehlenswert
Restschuldversicherung – kann man machen, muss man aber nicht
Glasbruch- und Umzugstransportversicherung – ist unnötig
Banken und Behörden rechtzeitig einbeziehen:
Hausbank oder spezialisierte Kreditvermittler?
Individuelles Finanzierungsangebot
Baufinanzierungsvermittler: Kosten und Leistung
Kreditzusage und Kaufvertrag
SCHRITT 4
Grundstück- und Haussuche
Wie finde ich ein Grundstück?
Die Beauftragung eines Maklers
Der Maklervertrag
Fälligkeit der Maklerprovision
Arten der Beauftragung des Maklers
Das Verwirken des Maklerlohns
Widerruf von Maklerverträgen
Das Grundstück
Grundstück und öffentliches Baurecht
Grundstückseigentum
Bebaute Grundstücke
Der Grundstückskaufvertrag
Der Notar
Grundstückserwerb durch Zwangsversteigerung
Der Erbpachtvertrag
SCHRITT 5
Die Beauftragung der am Bau Beteiligten
Das Fundament – Landesbauordnungen und ihre Anwender
Anforderungen an das Bauprodukt
Anforderungen an die Bauweise
Die Bauvorlageberechtigung
Architekten- und Ingenieurgesetze
Bauen mit dem Architekten
Wie finde ich den richtigen Architekten?
Was erwartet mich, wenn ich einen Architekten beauftrage?
Vertrauen als Grundvoraussetzung
Akteure beim Architektenhaus
Projektsteuerer und Baubetreuer
Behördliche Bauleiter und Sicherheitsbeauftragte
Fachplaner und Fachingenieure
Gutachter und weitere Fachplaner
Bodengutachter
Energieberater
Fachplaner Thermische Bauphysik
Gutachter für Gebäudeschäden
Gutachter Flora und Fauna
Betreuer der Baugruppe
Die Beauftragung der Bauunternehmer im Wege der Einzelvergabe
Generalübernehmer, Fertighausanbieter, Bauträger
Generalübernehmer und -unternehmer
Der Fertighausanbieter
Der Bauträger
Besonderheiten von Verträgen mit den Baubeteiligten
Werkvertrag und ähnliche Verträge
Wann ist ein Vertrag geschlossen?
Widerrufsrechte nach der Verbraucherschutzrichtlinie
Wer ist Verbraucher?
Die Verträge bei der Einzelvergabe
Honorarberechnung nach HOAI
Die Vereinbarung über die Baukosten
Die Vereinbarung von Vertragsterminen
Nebenpflichten im Architektenvertrag
Die Abnahme der Planungsleistungen
Abschlagsrechnungen und Schlussrechnungen
Der Umgang mit Mängeln
Das Urheberrecht des Architekten
Die Haftpflichtversicherung der Architekten und Ingenieure
Die Kündigung des Planervertrags
Die Verträge mit den Bauunternehmen
Die VOB/B
Abschlagszahlungen
Sicherheitsleistungen
Die Abnahme im Bauvertrag
Umgang mit Mängeln
Im Falle des Rechtsstreits
Die vorzeitige Beendigung des Bauvertrags
Sonderfall: Insolvenz eines Unternehmens
Verträge mit dem Generalüber- und -unternehmer
Die Leistungsbeschreibung im Verbraucherbauvertrag
Die Vergütung der Leistungen
Der Bauträgervertrag
Leistungsbeschreibung, Leistungsinhalt und Bezahlung
Besitzübergabe
Die Bauherrengemeinschaft oder Baugruppe
Einschaltung eines Baubetreuers
Vorteil des Bauens mit der Baugemeinschaft
Vereinbarungen mit dem Nachbarn
Zustimmung des Nachbarn
Doppelhaushälften
Zustand der Nachbargebäude
Vom Baubeginn bis zur Bauabnahme
Bauphase mit dem Fertighaushersteller
Bauphase mit dem Generalunternehmer und -übernehmer
Bauphase mit dem Architekten
Der Bau, die Kosten und die Informationspflicht des Architekten
Die Bauüberwachung
Fertigstellung und Abnahme
Der Abschluss der Baumaßnahme
SCHRITT 6
Den Bau planen
Das öffentliche Baurecht
Das Baugesetzbuch BauGB
Der Flächennutzungsplan
Der Bebauungsplan
Das Baugenehmigungsverfahren
Antragsteller und Entwurfsverfasser
Baurechtsbehörde und Bauvoranfrage
Der Bauantrag
Baugenehmigung und Baufreigabe
Baurealisierung
Der Rohbau
Bauteile
Bauweisen
Die Gewerke am Rohbau
Der Ausbau
Haustechnik heute und morgen
Hausanschluss und Hauptstromversorgung
Standard im Neubau: Der Mehrspartenanschluss
Fließend Warm- und Kaltwasser
Welcher Wasseranschluss wo ?
Regenwasser im Haushalt
Kanalisation
Telefon und Internet
LTE/5G
TV-Breitbandkabel – nehmen oder verzichten?
Elektrizität – aber sicher
Anschluss an die Fundamenterde
Blitzschutz
Überspannungsschutz
Schutz vor Stromschlag
Schutz vor durch Strom ausgelösten Bränden
Störsicherer Aufbau des Stromnetzes im Haus
Zukunftssichere Elektroinstallation
Das Wichtigste: sorgfältige Planung
Licht
Die Küche – ohne Strom geht nichts
Anschlüsse fürs Computernetzwerk und Telefon
Radio, Fernsehen, Unterhaltung
Die richtige Dachantenne
Satelliten-TV und -Radio
Unterhaltung aus dem Internet
IP-TV
Heimkino
Das intelligente Haus
Funk oder Kabel?
Was soll die Technik können?
Die wichtigsten Haussteuerungssysteme im Überblick
Türöffner/-sprechanlagen
Alarmanlagen
Heizungssteuerung
Lichttechnik
Lampen und Leuchten – das Ende eines langen Miteinanders?
Leuchtmittel – die wichtigsten technischen Daten im Überblick
Die Platzierung macht den Unterschied
Außen- und Nebenanlagen
Hauseingang und Wege zur Straße
Garage, Carport, Stellplatz
Wohin mit den Mülltonnen?
Die Terrasse
Umgang mit Oberflächenwasser
Einzäunung
Der Hausgarten
ANHANG
Service
Glossar
Checklisten für die Bauzeit
Planung
Im Dialog mit anderen Beteiligten
Ihre Liste für Baustellenbesuche
Generelle Ratschläge für alle Gewerke
Rohbaugewerke
Ausbaugewerke
Außenanlagen
Fertigstellung und Übergabe
Stichwortverzeichnis
SCHRITT 1:DIE WUNSCHLISTE FÜRS TRAUMHAUS
Das eigene Wohnhaus ist meist die mit Abstand größte Investition, die eine Familie jemals tätigt – aber nicht nur das: Vor dem Bauen muss man über viele Aspekte seines Lebens nachdenken und sich über Wünsche und Pläne für die Zukunft klar werden.
Bedarfsgerechte Hausplanung
Selbst bauen oder kaufen?
Energie und Umweltkonzepte
Bedarfsgerechte Hausplanung: In diesem Kapitel wollen wir Ihnen dabei helfen, Ihr Raumprogramm und Ihren Platzbedarf genauer zu definieren, aber auch Ihre nicht objektiven Ideen in Worten oder Bildern auszudrücken.
WAS ERFAHRE ICH?
Planung – was heißt das eigentlich?
Wo wollen Sie leben?
Wie groß soll es werden?
Wohnwünsche konkret formulieren
Schreiben Sie Ihr eigenes „Drehbuch”!
Wie lässt sich der Raumbedarf realisieren?
Die Wohnräume
Auf welchem Grundstück wollen Sie bauen?
Grundrisstypen
Flexibilität, Variabilität, typologische Nachhaltigkeit
Raumplanung hilft, Kosten zu sparen
Energiesparendes Bauen
Ökologisches Bauen
Erwartungen an den Wohnkomfort
Die Festlegung der Rahmenbedingungen sollte mit der Analyse der jetzigen Wohnsituation beginnen, geht weiter mit der Frage nach Veränderungsbedarf und endet mit der Suche nach ganz subjektiven Szenarien für die Nutzung des neuen Hauses. Mit diesen Schritten erarbeiten Sie die objektiven Grundlagen für den folgenden Planungsprozess, formulieren aber auch Ihre Wünsche und auch Träume, die sich in Zahlen nicht ausdrücken lassen.
Planung – was heißt das eigentlich?
Sie wollen ein Haus bauen, das Lebensraum für Ihre Familie bieten soll. Sicherlich haben Sie schon erste wichtige Entscheidungen getroffen, sich beispielsweise überlegt, in welchem Ort und welchem Gebiet Sie künftig wohnen wollen. Vielleicht haben Sie auch schon nach einem Grundstück gesucht oder bereits eines erworben (siehe „Grundstück- und Haussucfhe“).
Nun soll die nächste Phase beginnen, und wichtige Überlegungen stehen an. Die wichtigste fragt nach dem Endergebnis: Wie soll das Haus geschnitten und aufgeteilt sein, wie soll es aussehen? Aber um dies beantworten zu können, müssen Sie zunächst einmal ermitteln, was Sie wirklich brauchen und konsistent formulieren, was Sie sich wünschen.
Sodann müssen Sie prüfen, ob diese Anforderungen und Wünsche mit der finanziellen Realität – dem Ihnen zur Verfügung stehenden Budget – zusammenpassen (siehe „Bestandsaufnahme: Was können wir stemmen?“ und „Die Finanzierung aufstellen“).
Und wenn Sie diese Frage positiv beantwortet haben, können Sie sich den passenden Planungspartner oder Hausanbieter suchen und mit ihm in die konkrete Planung einsteigen (siehe „Die Beauftragung der am Bau Beteiligten“). Bei allen diesen Schritten unterstützt Sie dieses Buch mit Informationen, Ratschlägen und nützlichen Arbeitshilfen.
Für die meisten Bauherren ist die Planung die angenehmste Phase des Hausbaus, denn hier geht es noch nicht um den – nicht selten mit lästigen Problemen behafteten – Alltag auf der Baustelle, sondern um die Formulierung von Wünschen und die Suche nach dem räumlichen Rahmen für deren Erfüllung. Auf diese Monate können Sie sich daher freuen, denn sie werden sicherlich sowohl kurzweilig sein als auch Anlässe für viele konstruktive und zukunftsorientierte Gedankengänge geben. Eine solide Planung schafft zudem Sicherheit.
EIN WICHTIGER RATSCHLAG ZU BEGINN:
Lassen Sie sich und Ihren Beratern ausreichend Zeit für diese wichtige Phase und vermeiden Sie es, Entscheidungen unter Zeitdruck zu treffen – der doch meistens selbst gemacht ist. Die Festlegungen, die Sie in dieser Phase treffen, werden Ihr Leben für eine lange Zeit prägen, da sollten Sie nichts überstürzen. Zudem werden Sie viele Fragen zunächst ausführlich in der Familie diskutieren und sich die Folgen klar machen müssen, bevor Sie eine Auswahl treffen. Dies fällt umso leichter, je klarer die Kriterien formuliert sind. Dabei hilft Ihnen das folgende Kapitel.
Auch wenn Ihr Haus im Vergleich zu Rathäusern oder Flughäfen ein relativ kleines Projekt ist, stellt seine Planung doch einen komplexen Vorgang dar, in dem vieles mit vielem zusammenhängt. Manche Auswahl fußt auf zuvor getroffenen Entscheidungen, und manche am Anfang gesetzte Vorgabe bestimmt den ganzen Entwurfsprozess. Diese Wechselwirkungen erläutern wir Ihnen im Folgenden und zeigen Wege auf, wie klare Vorgaben zu zielorientierten Entscheidungen führen können.
Traumhafte Lage mit tollem Ausblick in die Natur … aber wie sieht es hier mit den täglichen Wegstrecken für die Familie aus ?
Wo wollen Sie leben?
Diese Frage müssen Sie vor dem Hintergrund Ihrer familiären und vor allem beruflichen Situation beantworten, denn der künftige Wohnort hat einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung Ihres Alltags. Manche Familie, die sich in ein schönes Grundstück auf dem Land verliebt hatte, war später zutiefst unglücklich über die weiten Wege zur Arbeit, zum Einkauf und zu Freizeitangeboten aller Art.
GRUNDSTÜCKSSUCHE
Die zentrale Voraussetzung zum Hausbau ist, dass man ein Grundstück dafür hat, daher müssen Sie sich möglichst früh auf die Suche machen. Und doch ist dieser erste Schritt schwer von den folgenden Überlegungen zu trennen, denn eine gewisse Vorstellung davon, wie groß das Haus einmal werden und welche Anforderungen es erfüllen soll, brauchen Sie bereits für die Definition der Kriterien für die Grundstückssuche – und dann für die Beurteilung der Grundstücke, die Sie finden oder die Ihnen angeboten werden. Wir haben der Grundstücksuche deshalb ein eigenes Kapitel gewidmet, siehe Seite 182 ff. Beschäftigen Sie sich daher durchaus parallel mit der Grundstückssuche, der Bedarfsermittlung und der Formulierung Ihrer Vorstellungen.
Weite Wege führen immer zu einem hohen Zeitbedarf fürs Pendeln und die alltäglichen Verrichtungen. Hinzu kommen erhebliche Kosten für die Mobilität, deren Entwicklung in den letzten Jahren nur eine Richtung kannte: nach oben. Ein weiterer finanziell sehr bedeutsamer Umstand liegt darin, dass ein Haus sich umso leichter und zu höheren Preisen weiterverkaufen lässt, je besser es verkehrstechnisch erschlossen ist.
Dieser Aspekt betrifft nicht nur die arbeitenden Familienmitglieder, sondern auch Kinder, wenn deren liebste Freizeitbeschäftigungen schwer – oder nur mit Hilfe der Eltern – erreichbar sind. Größere Kinder legen Wert auf Unabhängigkeit und wollen ihr Leben zunehmend selbst gestalten. Die individuelle Mobilität gewinnt also auch hier an Bedeutung.
Unter „Lage“ ist nicht nur zu verstehen, in welcher Umgebung das Haus steht, sondern auch, wie gut es in Bezug auf die örtlichen Gegebenheiten ausgerichtet ist. Hier sind die Nutz- und Wirtschaftsräume zur dunkleren und lauteren Straßenseite ausgerichtet, die Wohnräume sind heller, ruhiger und bieten einen schönen Blick ins Grüne.
Wie steht es um die VERKEHRSANBINDUNG des potenziellen Wohnorts, sowohl ans Straßennetz als auch an den öffentlichen Verkehr?
Verfügt der Ort über die EINKAUFSMÖGLICHKEITEN,DIENSTLEISTER und FREIZEITANGEBOTE, die Sie schon jetzt gerne und häufig nutzen und auf deren Nähe Sie weiterhin Wert legen?
Ist die Gegend gut versorgt mit SCHNELLEM INTERNET? Dies spielt schon in der Freizeit eine immer größere Rolle und kann umso wichtiger werden, wenn Sie (auch nur manchmal) von daheim aus arbeiten wollen.
WAS MUSS IHR KÜNFTIGES WOHNUMFELD BIETEN?
Wenn Sie potenzielle Wohnorte oder Quartiere in die engere Wahl genommen haben, lohnt sich ein Blick auf die nähere Umgebung der Quartiere, in denen Bauplätze verfügbar sind.
Wenn Sie Kinder im schulpflichtigen Alter haben, spielen zweifellos die Verfügbarkeit verschiedener SCHULFORMEN AM WOHNORT und deren Erreichbarkeit auf kurzen, sicher begehbaren Wegen von Ihrem Grundstück aus eine wichtige Rolle.
SPIELPLÄTZE, SPORTANLAGEN und -vereine, ein Park oder die freie Landschaft für erholsame Spaziergänge sollten ebenfalls in der Nähe zugänglich sein.
Wichtig ist darüber hinaus die Entfernung zu EINKAUFSMÖGLICHKEITEN, insbesondere für Dinge des täglichen Bedarfs. Wenn Sie einen gut sortierten Lebensmittelladen in erreichbarer Nähe haben, sparen Sie im Alltag viel Zeit und Kosten und reduzieren die Umweltbelastung.
Wie groß soll es werden ?
Um erfolgreich planen zu können, müssen Sie sich zunächst genau darüber klar werden, was Sie brauchen und was Sie wollen. Die Unterscheidung geschieht bewusst, denn Ihr Bedarf und Ihre Wünsche sind zwei unterschiedliche Themen. Beginnen Sie die Planung Ihres zukünftigen Hauses also am besten mit einer gründlichen Betrachtung Ihrer derzeitigen Wohnsituation. Im Vergleich dazu wird es Ihnen am leichtesten fallen, die notwendigen Veränderungen und Verbesserungen zu erkennen und zu formulieren.
WAS GEHÖRT ZUR WOHNFLÄCHE?
Gebäudeteil
Wird die Fläche angerechnet?
Keller und Waschküchen
Nein
Abstellräume und Kellerersatzräume außerhalb der Wohnung
Nein
Abstellräume innerhalb der Wohnung (zum Beispiel Hauswirtschaftsraum)
Ja
Garagen
Nein
Wohnräume, Küche, Bad und WC
Ja
Flur
Ja
Abgetrenntes Treppenhaus
Nein
Unbeheizter Wintergarten
Zu 50 %
Beheizter Wintergarten
Ja
Balkon oder Terrasse
In der Regel zu 25 %1
Dachschrägen oder andere Raumteile mit Höhen unter 2 m, etwa unter Treppen: Grundfläche unter 1 m Höhe Grundfläche zwischen 1 und 2 m Höhe
Nein Zu 50 %
Schornsteine, Vormauerungen, Pfeiler und Säulen, die höher als 1,50 m sind und deren Grundfläche mehr als 0,1 m2 beträgt
Nein
1) In Ausnahmefällen, zum Beispiel bei besonders guter Ausstattung oder Lage auch zu 50 %; bei besonders schlechter Lage auch weniger als 25 %. Hinweis: Angaben zur Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung.
Beginnen Sie mit einer SACHLICHEN AUF LISTUNG DER RÄUME, in denen Sie derzeit wohnen. Wie werden sie genutzt, in welche Richtung sind sie orientiert, vor allem aber: Wie groß sind sie?
Notieren Sie nicht nur die Anzahl der Quadratmeter, sondern auch die Länge, Breite und Höhe der Räume: Diese Informationen können Ihnen bei den nächsten Schritten – vor allem der genauen Formulierung Ihrer Wünsche – noch nützlich sein.
ERMITTLUNG DES RAUMBEDARFS
Sie können die ermittelten Informationen in die Tabelle „Ermittlung des Raumbedarfs“ auf Seite 14 bei „Derzeitige Wohnung“ eintragen.
Fahren Sie fort mit den STÄRKEN Ihrer jetzigen Wohnung. Was gefällt Ihnen besonders? Was wollen Sie auch künftig so haben? Vielleicht sind Sie ja mit der Lage und dem Schnitt der Zimmer durchaus zufrieden, brauchen nur mehr Platz? Oder legt die Organisation der Räume eine ganz andere Nutzung nahe als die, in der Sie sich Ihr künftiges Leben vorstellen? Listen Sie möglichst alle Eigenschaften der aktuellen Wohnsituation auf, die Sie positiv bewerten. Auch dafür können Sie die Tabelle „Ermittlung des Raumbedarfs“ bei den „Anmerkungen“ nutzen.
Anschließend beschäftigen Sie sich mit den SCHWÄCHEN UND MÄNGELN der jetzigen Wohnung. Was soll sich künftig an Ihrer Wohnsituation ändern? Vielleicht sind diese Schwächen ja der Grund, warum Sie ein Haus bauen wollen? Dann müsste es recht einfach sein, sie selbst zu formulieren. Ansonsten können Sie die folgenden Fragen nutzen, um Ihre aktuelle Situation genau zu analysieren.
Denken Sie beim Auflisten der Plus- und Minuspunkte Ihrer Wohnung nicht nur an die Größe und den Zuschnitt der Räume, sondern auch an die folgenden Eigenschaften:
Wie sind die Räume zu den Himmelsrichtungen ausgerichtet? Wichtig ist hier vor allem der SONNENLAUF.
In welchem Verhältnis stehen die Räume zum jeweiligen Außenraum? Das betrifft die Anordnung und Größe der Fenster sowie Art und Funktionalität des SONNENSCHUTZES und der Abdunklung.
Wie sind die BÄDER und die KÜCHE ausgestattet? Hier geht es um Anzahl und Eigenschaften der Sanitärgegenstände sowie der Küchenmöbel und -geräte.
Welche MATERIALIEN, Oberflächen und Farben finden sich in Ihrer Wohnung? Gefallen Ihnen diese oder wünschen Sie sich andere?
Der nächste Schritt besteht darin, aus der Analyse der bestehenden Situation mit ihren Qualitäten und Defiziten den BEDARF FÜR DAS NEUE HAUS zu ermitteln.
Beginnen wir zunächst mit den objektiven Kriterien, die sich zunächst relativ einfach formulieren lassen – aber später anhand der „harten Fakten“ wie zum Beispiel dem verfügbaren Budget auf ihre Machbarkeit hin geprüft werden müssen.
Machen Sie auf der Grundlage der Bestandsanalyse eine Liste der konkreten Defizite, die Sie durch den Bau des neuen Haus beseitigen wollen.
Wünschen Sie sich für bestimmte bereits jetzt vorhandene Räume im neuen Haus MEHR FLÄCHE, als Ihnen derzeit zur Verfügung steht? Wenn ja: wie viel mehr?
Brauchen Sie ZUSÄTZLICHE WOHNRÄUME für die Familie oder einzelne Personen? Wenn ja: Wie wollen Sie diese nutzen, und wer soll sie vorwiegend nutzen?
Haben Sie Ideen für ERWEITERTE NUTZUNGSOPTIONEN an das neue Haus? In den folgenden Kapiteln sind einige Gedanken hierzu ausführlich beschrieben, zum Beispiel Anforderungen an Barrierefreiheit (für altersgerechtes Wohnen), Flexibilität der Grundrisse für Nutzungsänderungen ohne vorherigen Umbauten, Aufteilbarkeit in mehrere Einheiten (gegebenenfalls mit gemeinschaftlich nutzbaren Bereichen) …
Schließlich: Haben Sie zusätzlichen BEDARF FÜR NEBENRÄUME, die Sie in Ihrer jetzigen Wohnung vermissen? Für welche Nutzungen sollen sich diese Räume eignen? Beispiele hierfür finden Sie ab Seite 18.
Wenn Sie Ihre Antworten auf diese Fragen in die Tabelle „Ermittlung des Raumbedarfs“ (siehe Seite 14) eintragen, lässt sich daraus in der Spalte „Wunschhaus“ ganz einfach eine erste überschlägige Flächenberechnung für das neue Haus erstellen.
FAMILIENPLANUNG
Es ist kaum zu vermeiden, sich im Rahmen der Bedarfsermittlung auch einige sehr persönliche Fragen zu stellen, die nicht nur individuelle Vorlieben beleuchten, sondern darüber hinaus auch sehr grundsätzliche Vorstellungen vom künftigen Leben formulieren. Scheuen Sie sich nicht, die folgenden Fragen offen in der Partnerschaft und – sofern schon Kinder da sind – in der Familie zu diskutieren, denn sie betreffen alle Mitglieder des Haushalts.
Sollen im neuen Haus KINDER wohnen? Wenn ja: wie viele? Vielleicht haben Sie bereits ein Kind oder mehrere Kinder – dann sollten Sie darüber nachdenken, ob weitere Kinder erwünscht oder geplant sind, da sich dies sehr direkt auf das Raumprogramm auswirkt.
Haben Sie oft GÄSTE ? Wenn ja: Übernachten diese häufig bei Ihnen, vielleicht auch für längere Zeitabschnitte? Oder war dies bisher aufgrund von Mangel an Platz oder Zimmern nicht möglich, Sie wollen es aber künftig möglich machen?
Wäre es möglich, dass Sie später Ihren ELTERN oder anderen VERWANDTEN anbieten wollen, dass sie bei Ihnen wohnen? Wenn ja: Könnte dies bereits zu einem Zeitpunkt passieren, wenn Ihre Kinder noch im Haus sind, oder genügt es, diese Option erst nach dem Auszug der Kinder zu eröffnen? In beiden Fällen müssen Sie sich überlegen, wie viel Platz und wie viel Unabhängigkeit die Wohnung für die ältere Generation haben soll.
Diese Fragen gehen schon sehr tief in die Lebensplanung hinein und sind daher auch recht intim. Da Ihr künftiges Haus aber den Rahmen für Ihr künftiges Leben abstecken wird, sollten Sie sich diesen Themen stellen und zumindest versuchen, dazu Vorstellungen zu formulieren – auch wenn sich manches davon zukünftig als nicht umsetzbar erweisen sollte.
Wohnwünsche konkret formulieren
Bis hierher haben Sie sich mit Ihrem Bedarf beschäftigt. Nun soll es um Ihre Wünsche gehen. Klingt einfach? Täuschen Sie sich nicht!
Versuchen Sie doch einmal, sich selbst beim „Wohnen“ zu beobachten. Betrachten Sie Ihren Alltag und überlegen Sie, wie Sie ihn in Ihrer Wohnung verbringen. Was soll sich daran im neuen Haus ändern? Dabei geht es explizit um Ihr ganz persönliches Empfinden und um den atmosphärischen Bereich! Viele tägliche Verrichtungen haben sich so sehr eingespielt, dass wir uns nur noch mit Mühe und gezieltem Nachdenken klar machen können, dass sie auch ganz anders gehen würden. Dennoch lohnt sich dieser Aufwand, da Sie mit dem neuen Haus die heimische Umgebung und den räumlichen Rahmen Ihres Alltags auf Jahrzehnte hin vorgeben.
Als Beispiel für derartige Überlegungen sei der Umgang mit dem KOCHEN erwähnt, der sich sehr direkt auf die Gestaltung der Küche und des Essbereichs auswirkt.
Gibt es bei Ihnen eine klare Grenze zwischen KOCHEN UND ESSEN ? Wenn ja, sollte die Küche vom Esszimmer durch eine Tür getrennt sein und maximal einen kleinen Tisch für den kurzen Snack im kleinen Kreis enthalten.
Dürfen GÄSTE, die zum Essen eingeladen sind, am Kochen teilhaben oder zumindest in die Küche (einschließlich der Folgeerscheinungen der Essenszubereitung …) hineinschauen? Wenn Sie diese Frage mit ja beantworten, sind Sie wahrscheinlich der Typ für einen offenen Wohn-/Essbereich, wo die beiden Nutzungen im selben Raum untergebracht sind.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob Sie gemeinsam oder einzeln oder in kleinen Gruppen FRÜHSTÜCKEN, ob Sie dabei üblicherweise in Eile sind oder sich dafür Zeit lassen und welchen räumlichen Rahmen Sie dafür bevorzugen.
WICHTIG: Lassen Sie sich beim Nachdenken über Ihre Wohnwünsche möglichst nicht von Gewohnheiten oder Konventionen leiten – und schon gar nicht davon, was Ihre Eltern oder Freunde für schick halten. Vielleicht haben Sie ja einen offenen Wohn-/Essbereich, haben sich aber am freien Blick auf das „Küchenchaos“ insgeheim immer gestört?
Ähnliche Überlegungen können Sie für die Bereiche des Hauses anstellen, in denen Sie schlafen und arbeiten wollen, sowie für den Lebensraum Ihrer Kinder.
Soll der SCHLAFBEREICH weit weg (und akustisch abgeschieden) vom Wohnbereich sein, oder wollen Sie eigentlich gerne im Schlafraum zumindest andeutungsweise mitbekommen, was die Familie so macht? Dies hat Auswirkungen auf die Lage Ihres Schlafraums.
Stellen Sie sich den Ort, an dem Sie ZU HAUSE ARBEITEN, eher als Teil des Familienbereichs vor, oder soll auch er möglichst abgeschieden gelegen sein? Soll er vielleicht sogar einen eigenen Zugang haben, falls Sie bei der Arbeit Personen empfangen, die Sie nicht am Familienleben teilhaben lassen wollen?
Wie nah oder weit entfernt vom Familienbereich wollen Sie den Lebensraum Ihrer KINDER anordnen? So lange die Kinder klein sind, ist eine räumliche Nähe meist erwünscht, weil sie die Aufsicht erleichtert. Ältere Kinder sind hingegen gerne weit weg von den Eltern, weil sie Kontrolle als störend empfinden und auch gerne mal laut Musik machen oder hören …
Ihre Überlegungen sollten nicht am Hauseingang oder der Terrassentür enden, sondern auch den Freiraum vor, neben und hinter dem Haus einbeziehen (siehe dazu „Außen- und Nebenanlagen“, Seite 373). Dabei könnten sich – je nach den spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks – zum Beispiel folgende Fragen stellen:
Haben Sie spezielle Nutzungswünsche an den VORBEREICH zwischen Straße und Hauseingang? Wollen Sie dort Ihr Auto und Ihre Fahrräder parken und brauchen Sie Platz für Mülltonnen und Recyclingbehälter? Wenn ja: Soll dort auch die Möglbichkeit bestehen, die Fahrzeuge zu pflegen und zu reparieren? Oder könnte der Vorgarten auch ein Aufenthaltsbereich sein, in dem Sie mit Ihren Nachbarn auf einer Bank sitzen oder mit den Kindern Ballspiele machen können?
Wie wollen Sie Ihren GARTEN neben und hinter dem Haus vorrangig nutzen? Freuen Sie sich vor allem auf einen Spiel- und Erholungsraum im Grünen – und wenn ja: Wollen Sie diesen mit Gästen teilen oder lieber im kleinen Kreis der Familie genießen? Was wäre dafür jeweils erforderlich? Oder wollen Sie im Garten auch den Anbau gesunder Lebensmittel betreiben? Haben Sie ein Hobby, mit dem Sie sich bei passendem Wetter auch im Garten beschäftigen wollen?
Diese subjektiven Themen sind für die meisten Bauherren und Bauherrinnen erheblich schwerer zu greifen und zu benennen als die zuerst genannten objektiven Kriterien. Dennoch sollten Sie es versuchen, denn daraus können Planerinnen und Planer wichtige Inspirationen ziehen, durch die sie das neue Haus wirklich zu Ihrem Haus machen können.
Planen Sie Raum für gesellige Momente!
DENKEN SIE NICHT NUR AN DEN ALLTAG!
Sie sollten sich schon in dieser frühen Phase zusätzlich zur Formulierung Ihrer Wünsche für den räumlichen Rahmen Ihres Wohnens im Alltag gründliche Gedanken über die Frage machen, ob und wie Sie Ihr neues Haus über das gewohnte tägliche Leben hinaus nutzen wollen. Wenn Sie dazu schon konkrete Vorstellungen haben, sollten Sie diese möglichst klar formulieren (siehe Tabelle auf Seite 14) – das hilft sowohl bei der Schärfung der eigenen Gedanken als auch bei den Gesprächen mit den Planern des künftigen Hauses. Als Anregungen haben wir hier einige Aspekte aufgelistet.
Jede Familie hat einen ganz eigenen Umgang mit FESTEN UND GÄSTEN. Bleiben Sie lieber im kleinen Kreis unter sich, oder führen Sie ein offenes Haus, in dem Verwandte und Freunde ein- und ausgehen? Oder würden Sie gerne viel gastfreundlicher leben, können das nur im Moment nicht tun aufgrund der Größe und Beschaffenheit Ihrer aktuellen Wohnung? Sowohl das Feiern von Festen als auch die Bewirtung und Beherbergung von Hausgästen stellen Anforderungen an die Planung des Hauses, insbesondere an die Größe der Wohnräume (wie viele Gäste sollen bei einem Fest dort Platz finden?) und die Anzahl der Individualräume (soll es ein eigenes Gästezimmer geben?). Planen Sie Gartenfeste und wünschen sich dafür Flächen und Infrastruktur (wie Grillstationen) im Garten oder am Übergang zwischen Haus und Garten?
Eine vollständige oder teilweise Verlagerung der ERWERBSARBEIT in die eigenen vier Wände ist vor allem für Beschäftigte in Bürotätigkeiten – und mit Einschränkungen für handwerkliche Beschäftigungen – möglich. Das Home Office ist einerseits umstritten, vor allem, weil es die sozialen Kontakte mit dem Kollegenkreis, mit Kunden und Geschäftspartnern einschränkt und somit zu Vereinsamung führen kann. Andererseits kann es viel Zeit (die sonst für die Wege zur und von der Arbeit benötigt wird) einsparen und die Organisation des Alltags sehr erleichtern, insbesondere für Familien mit kleineren Kindern, die in Betreuungseinrichtungen gehen und von dort abgeholt werden müssen. Die Corona-Pandemie hat dieser Form des Arbeitens einen ordentlichen Schub verliehen, und es steht zu erwarten, dass Home Office zumindest an einem oder zwei Tagen in der Woche auch in Zukunft für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Option bleiben wird. Vielleicht haben Sie ja selbst während der Corona-Pandemie am Küchentisch oder vom Sofa aus oder sogar im Keller oder Dachboden gearbeitet, weil Ihre derzeitige Wohnung keinen abgeschlossenen Arbeitsraum bietet? Falls Home Office für Sie zukünftig eine Möglichkeit ist, muss dies bei der Planung berücksichtigt werden, zum Beispiel in Form eines eigenen Arbeitszimmers oder eines abtrennbaren Bereichs in einem anderen Raum.
Schreiben Sie Ihr eigenes „Drehbuch”!
Wie lassen sich Ihre Wünsche an Ihr neues Heim in eine sinnvolle Form bringen und später in konkrete Planungen ummünzen? Im Folgenden wollen wir Ihnen eine Vorgehensweise vorstellen, mit deren Hilfe Sie Ihre Bedürfnisse in eine Art Lastenheft für das neue Haus übersetzen können:
Wir nennen sie die „DREHBUCHMETHODE”. Bei Anwendung dieser Methode schreiben Sie im ersten Schritt gewissermaßen ein Drehbuch aus verschiedenen Szenen für bestimmte Anlässe, die in Ihrem neuen Haus stattfinden, und überlegen sich dann im zweiten Schritt, welche Auswirkungen diese „Szenen” für den Entwurf Ihres neuen Hauses haben könnten.
Manche Anlässe liegen insofern auf der Hand, als sie in fast allen Familien entweder regelmäßig (wie jährlich wiederkehrende Feste) oder zumindest gelegentlich (Einladungen zum Essen) begangen werden:
Die Familie feiert gemeinsam wichtige religiös verwurzelte FESTE im Jahr wie Weihnachten, Ostern, Yom Kippur, Purim oder das Opferfest (und wenn wir schon inklusiv sind, dann doch auch Fastenbrechen im Ramadan usw.).
Sie sind Gastgeber eines FAMILIENTREFFENS mit Ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern, Kindern, Cousins und Cousinen …
Sie feiern KINDERGEBURTSTAG mit vielen Freunden Ihrer Kinder oder begehen besondere Anlässe für Kinder (Sternsinger, Fasching, Halloween …)
Sie laden Freunde zum ESSEN ein.
Sie veranstalten einen HEIMKINOABEND oder schauen sich Sportübertragungen gerne gemeinsam mit einigen Freunden an.
Sie feiern ein Fest mit Familie und Freunden im GARTEN.
Andere Szenen sind vielleicht spezifisch für Ihr besonderes Familienleben. Um diesen Gelegenheiten auf die Spur zu kommen, können Sie Ihren Kalender des vergangenen Jahres nochmals durchgehen und die besonderen Tage vor Ihr geistiges Auge holen. Wahrscheinlich denken Sie bei dieser kleinen Reise in die Vergangenheit spontan an die Qualitäten und Defizite, die Ihre derzeitige Wohnung bei diesen Anlässen hatte, oder Sie erinnern sich an Räumlichkeiten in Häusern und Wohnungen Ihrer Verwandten und Freunde, in denen Sie besondere Stunden und Tage verbracht haben, und deren Stärken und Schwächen zum jeweils gegebenen Anlass.
Sodann stellen Sie sich die Frage, welche Eigenschaften Ihr künftiges Haus haben soll, damit diese besonderen Anlässe den jeweils bestmöglichen räumlichen Rahmen erhalten können. Scheuen Sie sich nicht, den „idealen” Ablauf und die „perfekten” räumlichen Bedingungen für jeden Anlass zu notieren, auch wenn diese sich wahrscheinlich nicht zu hundert Prozent werden umsetzen lassen. Schließlich können Sie diese Vorstellungen in die Tabelle auf Seite 14 eintragen – sie werden dann zusammen mit der quantitativen Ermittlung zu einer Handreichung für Ihren Planer bzw. Ihre Planerin, aus der diese hoffentlich gute Schlüsse ziehen können, wie Sie sich Ihr künftiges Haus vorstellen.
Lassen Sie uns dieses Drehbuch an einem Beispiel durcharbeiten, das fast alle Familien kennen und alljährlich erleben: der gemeinsamen WEIHNACHTSFEIER. Diese stellt hohe Anforderungen an die räumliche Umgebung, wenn sowohl viele Menschen zu Besuch kommen und besondere Objekte (wie der Weihnachtsbaum, die Krippe und ähnliches) Platz finden müssen. In dem Drehbuch für dieses Fest stellen sich unter anderem folgende Fragen:
Die Festgesellschaft ist viel größer als Ihre Kernfamilie, weil Großeltern und Geschwister mit Ihren Partnern und Kindern zu Besuch kommen. Wie bringen Sie die vielen Leute zum Essen an Tischen unter? Brauchen Sie dafür einen erweiterbaren Esstisch, oder wird ein weiterer Tisch aufgestellt, an dem zum Beispiel die Kinder sitzen können? Wo soll und kann dieser Tisch stehen?
Der geschmückte Tannenbaum ist ein wichtiger Teil jedes Weihnachtsfests. Wo soll er stehen? Lässt sich dafür eine Position mit größerer Raumhöhe schaffen, damit Sie künftig endlich den stattlichen Baum besorgen können, von dem Sie schon immer geträumt haben? Dann sollte an dieser Stelle möglichst kein Teppichboden verlegt sein, denn auch wenn Sie anstelle von Wachskerzen elektrische Lichterketten verwenden, verliert der Baum doch seine Nadeln. Daher freuen Sie sich dort später über einen wischbaren Untergrund.
Haben Sie genug Raum, damit die ganze Gruppe sich um den Baum versammeln kann? Es kommt nicht in erster Linie auf die Anzahl verfügbarer Sitzmöbel an, denn Kinder lümmeln gerne auf dem Boden herum. Ist das Klavier in Hörweite, damit Sie mit Kindern oder Gästen mit Begleitung Lieder singen können?
Insgesamt soll das Drehbuch Ihnen dabei helfen, nach erfolgter Ermittlung des objektiven Bedarfs auch die subjektiven Qualitäten, die Sie sich in Ihrem künftigen Haus wünschen, so konkret wie möglich zu formulieren. Bei der Form sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt: Schreiben Sie einen Text, machen Sie ein Mood-Board aus Fotos und Zeitungsausschnitten, oder nehmen Sie mit Ihrer Familie eine Audio-Datei auf. Wie auch immer Sie Ihr Drehbuch dokumentieren, wird es dem Planer bei seiner Arbeit sicherlich nützlich sein.
Wie lässt sich der Raumbedarf realisieren ?
Das einzeln auf seinem Grundstück gebaute Haus ist nicht der einzige Gebäudetyp, in dem Sie sich den Traum vom Wohnen auf der eigenen Parzelle und in den eigenen vier Wänden erfüllen können. In Zeiten steigender Grundstückspreise müssen sich kostenbewusste Bauwillige nach günstigeren Alternativen auf kleineren Grundstücken umsehen. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten vor und erläutern ihre Vor- und Nachteile.
FREISTEHENDE HÄUSER (EINZELHAUS OHNE / MIT ELW)
Das auf seinem Grundstück frei stehende Haus ist zweifellos das Idealbild der meisten Menschen, die den Bau eines Einfamilienhauses vorhaben. Der eigenständige Baukörper ohne „Nachbaranschluss“ symbolisiert besonders klar die Definition und Abgrenzung des eigenen Eigentums und Einflussbereichs: „Hier kann ich unbeeinflusst von anderen tun und lassen, was ich will.“ Der Garten als Abstandsfläche definiert seine Grenzen und stellt sie unmissverständlich dar. Allerdings muss das Einzelhaus nicht unbedingt ein Einfamilienhaus sein. Im Folgenden gehen wir auch auf die Abtrennbarkeit von Wohnungen und auf das Thema Einliegerwohnung ein.
Viele Menschen träumen vom freistehenden Haus mit Grundstück, aber es gibt auch günstigere und flächensparende Alternativen.
Beim Architektenhaus hat man die größten Freiheiten bei Planung und der Raumaufteilung.
GEREIHTE HÄUSER (DOPPEL-, REIHEN- UND KETTENHAUS)
In Zeiten steigender Bodenpreise kann sich bei Weitem nicht mehr jeder Bauwillige einen Bauplatz für ein freistehendes Haus leisten. Der Kompromiss ist oft eine Doppelhaushälfte oder ein Reihenendhaus, das mit einer Wand an die benachbarte Hauseinheit angebaut ist, oder ein Reihenmittelhaus, das auf zwei Seiten an die benachbarten Häuser anschließt. Diese Bauformen kommen mit erheblich weniger Baugrund aus, weisen aber Einschränkungen hinsichtlich der Nutzbarkeit und Privatsphäre der Gärten auf.
INTROVERTIERTE HÄUSER (ATRIUMHAUS)
Es gibt auch Haustypen, bei denen die Lage und Orientierung des Grundstücks keine große Rolle spielen, weil sie introvertiert und „auf sich selbst bezogen“ sind: zum Beispiel durch die Gruppierung um einen oder mehrere Innenhöfe (Atrien). So kann man nötigenfalls auch eine unerwünschte Umgebung ausblenden. Solche Atrium- und Winkelhäuser lassen sich auch gezielt aneinanderschieben und zu hohen Dichten gruppieren. Sie sollten aber nicht mehr als zweigeschossig sein, da nur dann die Besonnung der Hofbereiche und die Belichtung der Innenräume ausreichend ist.
GESTAPELTE TYPEN
Insbesondere an Orten mit hohen Grundstückspreisen kann es sinnvoll sein, sich auch über alternative Bauformen zu informieren, die bestimmte Eigenschaften des Einfamilienhauses in den Geschosswohnungsbau übertragen. So gibt es inzwischen viele Beispiele für mehrgeschossige Wohnanlagen, die gewissermaßen als „gestapelte” Reihenhäuser angelegt sind und deren obere Einheiten ihre Gärten auf den Dächern der darunter gelegenen Einheiten haben.
Ein grundlegender Nachteil dieser Bauformen ist natürlich das Fehlen des eigenen Grundstücks und – damit untrennbar verbunden – der Möglichkeit, bestimmte Entscheidungen ohne Einbeziehung anderer treffen zu können. Eigentümer dieser Wohnungen sind immer auch Teil einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) nach Wohnungseigentumsgesetz, die auf ihren (jährlich mindestens einmal anberaumten) Versammlungen die Entscheidungen über Instandhaltung, Verteilung der Nebenkosten etc. gemeinsam trifft.
Die Wohnräume
Wenige Räume werden von verschiedenen Menschen so unterschiedlich genutzt wie Wohnräume. Heute findet der MEDIENKONSUM, der früher eine zentrale Nutzung von Wohnräumen darstellte, meist individuell und mittels tragbarer Geräte statt, daher haben sich in vielen Familien die gemeinschaftlichen Aktivitäten in den Essbereich verlagert – nicht wenige Wohnungen kommen inzwischen ganz ohne ein „klassisches” Wohnzimmer aus.
Insofern lohnt es sich, im Vorfeld ausführlich darüber nachzudenken, wie Sie Ihren Wohnbereich nutzen wollen. Von der Nutzung hängt auch ab, welche MÖBEL neben den Sitzgelegenheiten im Wohnbereich vorhanden sein sollten. Brauchen Sie noch Regale für Bücher, Musik-CDs und DVDs, oder soll die Wand frei bleiben als Projektionsfläche? Soll ein Klavier oder gar ein Flügel Platz finden – und wenn ja: Wie viel Raum soll in dessen Umgebung für weitere Musizierende verfügbar sein? Für Gemeinschaft und Kommunikation ist eine gute BELICHTUNG durch Fenster wünschenswert, wenn Sie den Raum häufig tagsüber nutzen. Haben Sie hingegen vor allem am Abend Gäste, spielt das keine so große Rolle. Möchten Sie den Wohnraum vorrangig als Heimkino nutzen, erweist sich Tageslicht als eher störend und muss durch angemessene ABDUNKLUNG (mittels Vorhängen oder außenliegendem Sonnenschutz) herausgehalten werden.
Ein wichtiges Qualitätskriterium für den Wohnbereich im Einfamilienhaus ist die VERBINDUNG ZUM GARTEN. Fast immer ist der Garten aus dem Haus durch den Wohn- und Essbereich zugänglich, dadurch steht er allen Hausbewohnern gleichermaßen zur Verfügung. Ob der Übergang besser vom Wohnraum oder aus dem Ess- und Küchenbereich erfolgt, hängt von den Nutzungspräferenzen der Bewohner ab: Die meisten Familien essen gerne im Freien, wann immer das Wetter dies ermöglicht – dafür sind kurze Wege und direkte Verbindungen von der Terrasse in die Küche sinnvoll. In manchen Grundrissdispositionen (und besonders gut bei Häusern, die für Hanggrundstücke geplant werden) ist es auch möglich, verschiedene Bereiche des Gartens aus verschieden genutzten Räumen zu erschließen, zum Beispiel die gemeinschaftliche Familienterrasse vom Essplatz aus, eine Spielwiese von den Kinderzimmern und ein eher ruhiger Rückzugsbereich von dem Arbeitsraum oder dem Schlafzimmer der Erwachsenen aus.
Der zentrale Ort für das Familienleben ist und bleibt der ESSTISCH. Dort findet auch jenseits des traditionellen „Wohnens” Gemeinschaft statt. Hier versammelt man sich zum Essen, aber auch zum Beispiel zu Brettspielen und zu Gesprächen. Auch die Arbeit hat auf dem Esstisch ihren Platz: Kinder machen dort Hausaufgaben, und auch die Laptops der Erwachsenen sind (dank WLAN) oft dort zu finden.
Klassische Reihenhauszeile. Die persönliche Ungestörtheit endet hier spätestens im Gartenbereich.
Das Atriumhaus ist um einen abgeschirmten Hof- oder Gartenbereich herum angeordnet.
Daher sind Esstische oft ziemlich groß und brauchen mit den Stühlen entsprechend viel Raum. Dann kann man dort noch dann essen, wenn parallel dazu andere Dinge gemacht werden. Auch sollte der Essbereich reichliche Möglichkeiten zur Ablage und Lagerung von Geschirr, Besteck und Utensilien bieten, damit diese nicht immer aus der Küche dorthin getragen werden müssen.
Es versteht sich von selbst, dass der Esstisch in der Nähe der Küche stehen sollte. Weniger allgemeingültig ist die Empfehlung, dass ein Esstisch viel natürliches Licht haben, also nicht weit entfernt von den Außenwänden in der Dunkelzone des Hauses stehen sollte. Da er regelmäßig und häufig über den ganzen Tag genutzt wird, ist das Tageslicht hier viel wichtiger als im Wohnbereich, der üblicherweise eher am Abend frequentiert wird.
KÜCHEN UND WIRTSCHAFTSRÄUME
Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein war die Küche für viele Familien der zentrale Wohnraum. Der Bedeutungswandel der Küche hin zum nutzungsoptimierten und auf die Mindestgröße geschrumpften Funktionsraum begann in den 1920er Jahren und prägte bis in die 1980er Jahre den Wohnungsbau.
Seitdem hat die Wertschätzung der Küche auch als Wohnraum wieder zugenommen. Als Wohnküche oder integriert in einen offenen Wohn-Ess-Bereich spielt die Küche im heutigen Familienleben wieder eine zentrale Rolle, die weit über ihre reine Funktion der Essenaufbewahrung und Nahrungszubereitung hinausgeht: Hier wird nicht mehr alleine, sondern auch in Gesellschaft gekocht und auch gegessen, hier trifft man sich am Kühlschrank oder an der Kaffeemaschine, die Kinder machen Hausaufgaben am Küchentisch … Kurz: Hier findet ganz informell ein großer Teil des familiären Alltags und des gemeinschaftlichen Lebens statt.
Was muss bei der PLATZIERUNG DER KÜCHE IM GRUNDRISS beachtet werden? Die Küche sollte in der Nähe eines Hauseingangs liegen, damit die eingekauften Lebensmittel auf kurzem Weg an ihre Lagerorte (und Orte der Kühlung) gebracht werden können. Noch wichtiger ist die Nähe zum Esstisch, auf dem die Produkte aus der Küche angerichtet und verspeist werden. Auch in den Garten oder auf die Terrasse sollte es nicht allzu weit sein, denn auch dort essen und trinken wir gerne gemeinsam.
In alten Häusern findet sich oft angrenzend an die Küche ein KLEINER VORRATSRAUM, der als Speisekammer bezeichnet wird. Er wurde früher bewusst an die Außenwand des Hauses und bevorzugt an der Nordseite angeordnet, damit er auch im Sommer kühl bleibt und als Zwischenstufe zwischen Kühlschrank und geheiztem Innenraum für die Lagerung verderblicher Lebensmittel genutzt werden kann. Aufgrund der heutigen Anforderungen an die Wärmedämmung der Gebäudehülle lassen sich Speisekammern in diesem Sinn gar nicht mehr realisieren. Trotzdem kann ein solcher Abstellraum für haltbare Lebensmittel, Getränke und Utensilien aller Art auch dann überlegenswert sein, wenn er nicht nennenswert kühler ist als der Rest der Wohnung.
VOR- UND NACHTEILE VERSCHIEDENER GEBÄUDETYPEN
Es kann auch sinnvoll sein, die für weitere Hausarbeit wie Wäschepflege erforderlichen Arbeitsflächen und Hausgeräte (Waschmaschine und ggf. Wäschetrockner) nicht im Keller, sondern in der Nähe der Küche anzuordnen. Dann sind die Wege kurz und die Hausarbeiten können effizient erledigt werden. Solche HAUSWIRTSCHAFTSRÄUME sollten schon in einem frühen Planungsstadium ähnlich bewusst geplant werden wie die Küche selbst, da auch hier die Anschlüsse für Wasser und Strom am richtigen Ort sitzen müssen. Dort können auch alltägliche Haushaltshelfer wie Besen, Staubsauger, Leitern und ähnliches, die in der Küche meist keinen Platz finden, gut in möglichst raumhohen Schränken verstaut werden. Wenn möglich, sollte man im Hauswirtschaftsraum neben dem erforderlichen (möglichst großen) Spülbecken für größere Reinigungsaktivitäten einen Bodeneinlauf einplanen. Sofern er vom Wohnbereich hinreichend abgetrennt ist (nach Möglichkeit durch eine oder – besser – mehrere Türen) oder / und auf einem anderen Geschoss liegt, können hier auch Bestandteile der haustechnischen Anlage wie Heizbrenner, Warmwasserspeicher und Sicherungskästen ihren sinnvollen Platz finden.
BÄDER
Ähnlich wie die Küche entwickelt sich auch das Bad immer weiter vom nutzungsoptimierten, auf die Mindestgröße geschrumpften Funktionsraum hin zum Wohlfühlbereich, der neben der grundlegenden Körperpflege auch Angebote für die sogenannte Wellness macht. Nicht selten finden sich im Bad neben den üblichen Sanitärgegenständen auch Fitnessgeräte oder große Topfpflanzen.
Da Bäder aufgrund ihrer Ausrüstung (mit Sanitärgegenständen) und der Oberflächen (Fliesen) relativ teure Räume sind, ist ihre Anzahl und Ausstattung stark abhängig vom für den Hausbau verfügbaren Budget. Neben dem ZENTRALEN BAD sollte jedes Haus zumindest ein räumlich unabhängiges WC FÜR BESUCHER haben, und wenn Kinder im Haus wohnen oder/und regelmäßig Gäste zu Besuch kommen, empfiehlt sich darüber hinaus ein WEITERER SANITÄRRAUM MIT EINER DUSCHE. Wenn der Hausbau unter finanziellem Druck steht, kann es auch eine Option sein, im Grundriss Räume vorzusehen, die später noch als weitere Bäder oder Duschräume ausgebaut werden können. Damit dieser spätere Ausbau nicht unnötig teuer wird, sollten die Leitungen allerdings schon im ersten Bauabschnitt zu diesem Raum hin verlegt werden.
KOSTEN SPAREN DURCH ANORDNUNG UND AUSSTATTUNG
Im Sinne des kosteneffizienten Bauens sollten Sanitärräume aller Art (neben Bädern auch Küchen, Hauswirtschaftsräume und ähnliche) im RÄUMLICHEM VERBUND (nah beieinander) angeordnet sein – vor allem in den verschiedenen Geschossen am selben Platz, sprich: über- und untereinander. Dies verkürzt die Leitungslängen und macht zudem auch die spätere Wartung einfacher.
Bei der Planung der Bäder Ihres Hauses empfehlen wir, dass zumindest ein Sanitärraum (im Erdgeschoss) die räumlichen Anforderungen an eine BARRIEREFREIE NUTZUNG bieten sollte. Sie müssen dieses Bad nicht von Anfang mit allen Gegenständen ausstatten, die es mit Rollstuhl und Rollator benutzbar macht, aber eine spätere Nachrüstung dieser Ausstattung sollte möglich sein. Daraus entsteht zwar ein zusätzlicher Platzbedarf (vor allem für Bewegungsflächen), der aber zusätzliche Stellflächen für Möbel bietet und eine räumliche Großzügigkeit zur Folge hat.
Auf welchem Grundstück wollen Sie bauen?
Zur Beantwortung dieser Frage sollten Sie zunächst die folgenden Abschnitte lesen und sich zu den dort formulierten Themen Gedanken machen. Damit erarbeiten Sie sich die qualitativen Kriterien der Grundstückssuche.
POSITION UND ORIENTIERUNG
Die ersten zentralen Setzungen im Entwurfsprozess legen die Position des Hauses im Grundstück und die Orientierung der Wohnbereiche im Verhältnis zum Garten fest. In Abhängigkeit vom Zuschnitt, der Höhenentwicklung und der Zugänglichkeit und Zufahrbarkeit des Grundstücks müssen Sie auswählen, wo das Haus stehen und in welche Richtung es sich vorrangig orientieren soll. Aus dieser Entscheidung ergibt sich, wo im Haus die wichtigen Wohn- und Aufenthaltsbereiche angeordnet werden.
Oft wird diese Entscheidung bereits von der Größe, dem geometrischen Zuschnitt des Grundstücks und von örtlichen baurechtlichen Vorschriften vorbestimmt. Während Ihnen auf einem großen Grundstück viele Optionen für die Anordnung und baukörperliche Gestaltung des Hauses zur Verfügung stehen, haben Sie auf einem kleinen Grundstück buchstäblich weniger Spielraum: Auf einem schmalen Bauplatz bleibt beispielsweise meist nur Platz für ein schmales Haus. Da heute die meisten Grundstücke relativ klein sind, sollten Sie mit den daraus folgenden Einschränkungen rechnen und sie schon bei der Auswahl des Grundstücks in Betracht ziehen.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist meist der für das Grundstück geltende BEBAUUNGSPLAN (siehe Seite 274), der innerhalb des Grundstücks einen kleineren Bereich festsetzt, innerhalb dessen das Haus gebaut werden muss. Dieser Bereich wird als „Baufenster” bezeichnet. Auch die Standorte von Garagen und Nebenanlagen wie Gartenhütten sind darin manchmal verbindlich vorgegeben. Die Vorgaben orientieren sich üblicherweise an der Lage des Grundstücks zur Straße und des sich daraus ergebenden Erschließungssituation: das „Baufenster” liegt meist nahe der Straße, der Garten von dieser abgewandt auf der ruhigen Seite des Grundstücks.
Sofern sie nicht im Bebauungsplan vorgegeben ist, hängt die Positionierung des Hauses auf dem Grundstück von mehreren Faktoren ab, die miteinander betrachtet und gegeneinander abgewogen werden müssen:
ZUGANG UND ZUFAHRT: Um einen möglichst kurzen Zugangsweg und eine platzsparende Zufahrt zu erreichen, ist es auch ohne diesbezügliche Vorgaben des Planungsrechts meist sinnvoll, den Eingang des Hauses zur Straße hin auszurichten und auch die Garage nahe an der Straße anzuordnen. Der Garten liegt dann (von der Straße aus gesehen) hinter dem Haus und somit auf der ruhigen Seite. Wenn allerdings die Straße auf der „guten” Seite des Grundstücks (im Süden, Südwesten oder Westen) verläuft, kann es durchaus sinnvoll sein, den Garten zwischen Garage und Haus anzuordnen, um das Haus möglichst weit von der Straße abzusetzen.
BESONNUNG
Ein besonders wichtiges Kriterium für die Planung des Hauses und die Anordnung der Räume ist die Ausrichtung zu den HIMMELSRICHTUNGEN. Wie bereits erwähnt, sollten Sie sich darüber nach Möglichkeit schon bei der Auswahl des Grundstücks Gedanken machen, da der Zuschnitt von Grundstück und Baufenster und die Vorgaben des Bebauungsplans meist die Entscheidung für Ausrichtung und Orientierung des Hauses vorbestimmen.
Früher war es üblich, dass Schlafräume nach Osten liegen, damit die Morgensonne die Menschen weckt und munter macht. Wohnräume waren hingegen nach Süden und Westen orientiert, weil man sich dort eher nachmittags und abends aufhält. Grundsätzlich gilt dies bis heute – allerdings kann es für bestimmte Nutzungsmuster durchaus sinnvoll sein, diese Konvention gezielt zu durchbrechen – zum Beispiel falls man nicht zu den üblichen Kernzeiten tagsüber arbeitet. Wenn die einzelnen Aufenthaltsräume in ihrer Nutzung nicht durch Größe, Zuschnitt oder Installation eindeutig vorbestimmt sind, lässt sich diese Zuordnung auch nachträglich ändern – siehe „Flexible Grundrisse“.
OSTEN: Nach dem Aufgang im Osten steht die Sonne zunächst noch flach am Himmel, ihre Strahlen können durch Fenster tief ins Hausinnere vordringen. Es war daher lange üblich, Küchen sowie Schlaf- und Kinderzimmer nach Osten auszurichten, da diese oft morgens genutzt werden und die Ostsonne beim Wachwerden hilft. In Abhängigkeit von persönlichen Vorlieben dürfte dies auch heute noch sinnvoll sein.
SONNENSTAND IM JAHRESVERLAUF
Im Sommer steht die Mittagssonne erheblich höher als im Winter. Die Illustration stellt beispielhaft die Sonnenstände für Frankfurt am Main zu den Zeitpunkten der SOMMERSONNENWENDE (21. Juni), der Tag- und Nachtgleiche und der WINTERSONNENWENDE (21. Dezember) dar. Die Sonne geht morgens im Osten auf und steht zunächst sehr niedrig am Himmel. Ihre Strahlen treffen dann flach auf die Erde und können daher durch Fenster tief in Räume eindringen. Über Mittag steht die Sonne im Süden steil am Himmel und kann durch Dachvorsprünge aus dem Haus ferngehalten werden. Nachmittags sinkt die Sonne kontinuierlich ab, bevor sie im Westen untergeht. Die tief stehende Abendsonne kann wiederum weit in die Räume eindringen und wird in ihrer Kraft oft unterschätzt.
SÜDEN: gilt allgemein als die optimale Himmelsrichtung für die Ausrichtung von Aufenthaltsräumen, weil Südseiten im Tagesverlauf am längsten direktes Sonnenlicht bekommen. Allerdings ist diese großzügige Besonnung beschränkt auf die Stunden rund um die Mittagszeit – morgens sind Südseiten noch nicht, abends nicht mehr direkt besonnt. Insofern betrifft die positive Bewertung der Südorientierung vor allem Räume, die tatsächlich tagsüber genutzt werden. Wer sein Haus berufsbedingt im Alltag vor allem morgens und abends bewohnt, dem mag die Morgen- und Abendsonne letztlich wichtiger sein als die mittägliche Südsonne. Südorientierte Räume eignen sich daher in der Nutzung von Familien besonders gut für Wohnräume und Kinderzimmer. Im Süden ist der Sonneneinfallswinkel im Lauf der Jahreszeiten besonders unterschiedlich: In Dortmund etwa steht die Sonne im Sommer mittags 62° hoch am Himmel, im Winter sind es nur 19°. Daher kommt dem Sonnen- und Blendschutz auf Südseiten eine besondere Bedeutung zu, da die kräftige Mittagssonne einerseits im Sommer leicht zur Überhitzung der Räume führen, andererseits im Winter unerwünschte Blendungen hervorrufen kann. Der Schutz vor sommerlicher Überhitzung lässt sich durch großzügige Dachüberstände gut erreichen, winterlicher Blendschutz kann auch mit innenliegenden Vorhängen gewährleistet werden.
WESTEN: Die Westsonne steht zwar am Nachmittag tief am Himmel und scheint dadurch flach ins Haus, man sollte allerdings ihre Kraft nicht unterschätzen und daher auf Westseiten möglichst nicht auf außenliegenden Sonnenschutz verzichten (siehe Seite 313). Nach Westen sollte man Räume orientieren, die hauptsächlich am Nachmittag und Abend genutzt werden, also Wohnräume, Essplätze und gegebenenfalls Arbeitsräume.
NORDEN: Selbst Nordseiten erhalten direktes Sonnenlicht, allerdings nur im Hochsommer in den Wochen vor und nach der Sommersonnenwende früh am Morgen sowie spätabends. Den größten Teil des Jahres muss man nicht damit rechnen, dass direkte Sonnenstrahlen von Norden ins Haus einfallen. Sonnenschutz ist daher überflüssig, Blendschutz kein allzu wichtiges Thema. In Wohnhäusern ist es sinnvoll, Bibliotheken und auch Wände, an denen Kunstwerke hängen sollen, nicht dem direkten Sonnenlicht auszusetzen. Auch für Arbeitsplätze und Küchen kann die Ausrichtung nach Norden günstig sein, sofern dort eine direkte Besonnung nicht ausdrücklich gewünscht ist.
Sie sollten alle diese historisch entstandenen Konventionen aber hinterfragen, insbesondere dann, wenn Sie nicht zur genannten Gruppe gehören und Vorlieben oder Tagesabläufe haben, die sich von der Mehrheit unterscheiden. Überlegen Sie genau, welchen Teil des Hauses Sie zu welcher Tageszeit zu nutzen gedenken – und ob Ihnen dafür direktes Sonnenlicht erwünscht oder eher lästig ist. Wenn Sie beispielsweise einen späteren Arbeitsrhythmus bevorzugen und daher Ihre freie Zeit eher an den Vormittagen im Haus verbringen wollen, kann es sinnvoll sein, den Wohnbereich des Hauses in Richtung Osten oder Südosten auszurichten, damit er am Morgen und am Vormittag von der Sonne beschienen wird.
Auch sollten Sie im Blick haben, dass sich Ihre Nutzung über die Jahre ändern wird: Vielleicht gehen Sie künftig zu ganz anderen Tageszeiten zur Arbeit – und irgendwann auch gar nicht mehr – und wünschen sich die Morgenoder Abendsonne dann für andere Nutzungsbereiche? Da es schwierig ist, sich alle möglichen Szenarien im Vorfeld vorzustellen, ist dies ein starkes Argument für eine gewisse Flexibilität und Nutzungsneutralität des Grundrisses. So stellen Sie sicher, dass die Räumlichkeiten wandlungsfähig bleiben.
VOR- UND NACHTEILE VON MEHRGESCHOSSIGER BAUWEISE
Kriterium
Vorteil
Nachteil
Grundstücksgröße
Kleinerer „Fußabdruck“ ermöglicht Realisierung auf kleinerem Grundstück
Kleineres Grundstück bedeutet in der Regel weniger Nutzfläche im Garten
Baukörper
Kompakte Baukörper: günstig hinsichtlich Wärmedämmung und Baukosten
Weniger Dachfläche zur Anbringung von Kollektoren
Kosten
Insgesamt kostengünstig durch kleineres Grundstück, kompakten Baukörper und platzsparende Erschließung
Treppen als Bauteile relativ kostspielig
Erschließung
Platzsparende Erschließung über Treppen
Barrierefreie Ausführung nur durch mechanische Hilfsmittel (Treppenlifter, Aufzug) erreichbar, daher mäßig geeignet für ältere und gehbehinderte Bewohner/innen
DIE AUSSICHTEN
Falls das Grundstück einen Blick in die Ferne ermöglicht, sollte dies bei der Anordnung und Ausrichtung des Hauses ebenfalls berücksichtigt werden. Ideal ist eine Aussicht in eine besonnte Himmelsrichtung, aber auch ein Ausblick nach Norden kann sehr reizvoll sein. Bedenken Sie: Die Aussicht ist eine zentrale Eigenschaft des Grundstücks, insbesondere dann, wenn Sie nicht verändert oder verstellt werden kann. Wird die Aussicht angemessen in den Entwurf einbezogen, hebt das nicht nur die Individualität und Lebensqualität Ihres Hauses, sondern auch dessen Wert.
Oft ist die Aussicht nicht vom Gelände aus, sondern erst in den Obergeschossen erlebbar: im Zweifelsfall sollten Sie oder Ihr Planer mit Hilfe einer Leiter oder eines kleinen Gerüsts prüfen, ob sich von oben ein Blick ergibt – und wenn ja, wo dieser sich am besten ins Haus „einfangen” lässt.
DIE NACHBARBEBAUUNG
Schließlich spielt auch die benachbarte Bebauung eine Rolle für die Position und Ausrichtung des Hauses. Nachbarhäuser und zugehörige bauliche Anlagen wie Garagen, Schuppen, Zäune oder Stützmauern und auch Vegetation wie Bäume oder Hecken können Ihrem Haus künftig die Aussicht nehmen und nicht nur Ihren Garten, sondern im Extremfall auch Ihr künftiges Haus selbst verschatten. Dies muss man im Blick haben, wenn man im eigenen Entwurf die Nutzungen verteilt. Sofern die umgebenden Gebäude zu Beginn Ihres Planungsprozesses noch nicht vorhanden sind, lohnt sich ein Blick in den Bebauungsplan, um die Lage und Höhe der künftigen Nachbarhäuser einschätzen zu können. Dort oder auf dem Stadtplan lässt sich auch das Verhältnis Ihres Grundstücks zu öffentlichem Grün, zu nahegelegenen Fußwegen und zur öffentlichen Infrastruktur wie Bushaltestellen, Kindergärten etc. erkennen.
GESCHOSSIGKEIT
Die zur Bebauung vorgesehenen Grundstücke werden über die Jahre immer kleiner. Dies folgt einerseits aus politischen Vorgaben gegen den Flächenverbrauch, andererseits aus dem zunehmenden Kostendruck für Bauherren. Daher ist es heute nur noch auf wenigen Grundstücken möglich, das gewünschte Raumprogramm komplett ebenerdig auf einem Geschoss unterzubringen. Die meisten Einfamilienhäuser werden derzeit zweigeschossig errichtet, auf kleinen Grundstücken in städtischen Lagen sind immer öfter auch dreigeschossige Häuser zu finden.
MEHRGESCHOSSIGE HÄUSER haben einerseits den Nachteil, dass Barrierefreiheit nicht per se gegeben und nur durch erheblichen technischen Mehraufwand erreichbar ist. Andererseits ist neben dem eigenen Garten oft gerade das Wohnen auf mehreren Geschossen eine Qualität, die das Einfamilienhaus als Bauform aus den anderen Wohnformen heraushebt.
Die Dachform prägt den Charakter des Hauses ganz entscheidend, wobei der früher ungenutzte Dachboden weitgehend verschwunden ist.
VERSCHIEDENE DACHFORMEN
So zeigt sich gerade in der dreidimensionalen Ausarbeitung oft die besondere Qualität von Einfamilienhäusern: Dies kann einerseits in der Gestaltung der Erschließungselemente (meistens Treppen), andererseits auch in der vertikalen Verbindung von Wohnbereichen über Lufträume, Galerien, Lichthöfe, Zwischenebenen oder ähnliche räumliche Elemente erzielt werden. Zudem lässt sich durch die sinnvolle Verteilung der Räume auf verschiedene Ebenen auch die erwünschte Abgrenzung von Wohnbereichen für Eltern und Kinder umsetzen.
Die Vor- und Nachteile der mehrgeschossigen Bauweise sind in der Tabelle „Vor- und Nachteile …“ auf Seite 26 zusammengefasst.
Eine besondere Form der mehrgeschossigen Häuser sind sogenannte SPLIT-LEVEL-TYPEN, in denen die Räume durch halb- oder drittelgeschossige Höhenversätze so auf den Ebenen verteilt werden können, dass eine kontinuierliche Raumfolge mit reizvollen Blickbezügen entsteht.
DACHFORMEN
Kaum ein Bauteil prägt die Gestalt des Hauses so sehr wie sein Dach. Theoretisch ist die Bandbreite der möglichen oberen Abschlüsse für Ihr Haus fast grenzenlos: Statt sie textlich zu beschreiben, haben wir Ihnen die im Einfamilienhausbau gängigen Dachformen links vergleichend aufgezeichnet.
Allerdings ist die Auswahl der Dachformen meist entweder durch den Bebauungsplan vorgegeben oder – in Gebieten ohne gültigen Bebauungsplan – durch den Grundsatz der Einfügung in die umgebende Bebauung eng begrenzt (siehe dazu Seite 275).
Die gängigsten Dachformen für Einfamilienhäuser sind derzeit bei den geneigten Dächern das SATTEL- und das WALMDACH. Daneben stehen das FLACHDACH und das zunehmend beliebte PULTDACH. Auch wenn die Auswahl der Dachform stark vom persönlichen Geschmack abhängt, haben wir in der Tabelle rechts einige sachliche Vor- und Nachteile der verschiedenen Dachformen zusammengestellt.
GAUBEN VERSUS DACHFLÄCHENFENSTER: Ein wichtiges Kriterium für die Nutzung von Dachräumen ist deren natürliche Belichtung. Lässt sich diese nicht in ausreichender Weise über die Fenster der senkrechten Wände sicherstellen, müssen in die Dachfläche Öffnungen eingeschnitten werden. Dafür gibt es mehrere grundsätzliche Möglichkeiten:
DACHGAUBEN UND QUERHÄUSER sind die traditionelle Methode zur Belichtung von Dachräumen. Sie haben einerseits den Vorteil, dass die darin verbauten Fenster senkrecht angeordnet sind und somit auch im geöffneten Zustand nicht direkt dem Regen ausgesetzt sind, andererseits erweitern sie durch ihren Zuschnitt das Raumangebot. Gauben sind allerdings nur bei relativ stark geneigten Dächern (25 Grad oder steiler) und auch nur bei relativ niedrigen Kniestockhöhen bis maximal ein Meter (gemessen im Innenraum) sinnvoll einsetzbar, weil sonst aufgrund der Dachgeometrie die Fensterbrüstungen zu hoch werden.
DACHEINSCHNITTE sind gewissermaßen umgekehrte Gauben, die als Terrassen in das Dach eingeschnitten werden. So kann der dahinterliegenden Raum dreiseitig belichtet werden. Sie können gestalterisch sehr verträglich in Dachflächen integriert werden, sind aber bautechnisch aufgrund der anspruchsvollen Entwässerung relativ aufwändig. Sie sind weitgehend unabhängig von der Höhe des Kniestocks anwendbar.
DACHFLÄCHENFENSTER sind durch konstante Innovation der Hersteller inzwischen technisch sehr ausgereift und können mit vielen zusätzlichen Funktionen aufgewertet werden. Das reicht unter anderem von außenliegendem Sonnenschutz bis zu ausklappbaren Balkonen. Sie sind vom Raumgefühl her nicht so großzügig wie Gauben, ermöglichen aber auch eine ausreichende Belichtung von Räumen mit hohen Kniestöcken sowie unter flach geneigten Dächern.
VOR- UND NACHTEILE VON DACHFORMEN
KELLER ODER EXTERNER ABSTELLRAUM
Eine weitere grundlegende Entscheidung beim Hausbau betrifft die Unterbringung von Abstellflächen und Nebenräumen für die haustechnischen Komponenten, die Lagerung von Brennstoffen und ähnliches. Die traditionelle Lösung ist der Bau eines Kellers unter dem gesamten Haus, auf dem das Haus auch statisch zum Stehen kommt. Allerdings ist eine Unterkellerung des gesamten Hauses erfahrungsgemäß deutlich größer als unbedingt erforderlich. Selbstverständlich kann man die „überzählige“ Fläche sinnvoll nutzen, zum Beispiel für Hobbyräume – sofern man sie sich leisten kann.
Auf Hanggrundstücken lässt sich die Kellerfläche üblicherweise besser optimieren, indem nur der hangseitige Teil des Hauses unterkellert wird (Teilunterkellerung).
Wenn Sie überlegen, ganz auf den Keller zu verzichten (vielleicht aus Kostengründen), müssen Sie sich über Alternativen Gedanken machen. Diese können darin bestehen, dass Sie Nebenräume in den oberirdischen Geschossen (zum Beispiel in sonst schlecht nutzbaren Bereichen der Dachgeschosse unter den Dachschrägen) einplanen. Denkbar ist auch der Bau eines Schuppens auf dem Grundstück (zum Beispiel im Verbund mit Garage oder Carport – Näheres hierzu ab Seite 374), der allerdings die nutzbare Gartenfläche einschränkt und im Gegensatz zum Keller für die Lagerung von Lebensmitteln, Papier oder Wertsachen nur bedingt geeignet ist.
Grundrisstypen
Bevor nun die ersten Skizzen zum Grundriss Ihres Hauses entstehen, haben Sie im Rahmen Ihrer Bedarfsermittlung schon viele Szenarien Ihres Alltags und der besonderen Anlässe Revue passieren lassen und über viele Kriterien nachgedacht, die Sie bei der Suche nach dem räumlichen Rahmen für Ihr künftiges Familienleben im Auge behalten wollen.
So wie kein Haus die ganz perfekte Umgebung für jeden Tag des Lebens sein kann, wird auch jeder Entwurf in der Menge Ihrer formulierten Vorstellungen jeweils eigene Prioritäten setzen müssen. Ihre Aufgabe ist es, diese Prioritäten zu hinterfragen – nicht nur dort, wo sie sich im Entwurf äußern, sondern auch in Ihrem eigenen Wertesystem. Nicht selten verschieben sich Vorlieben und Wünsche in ihrer Wertigkeit im Verlauf eines Planungsprozesses so grundlegend, dass man vom Ergebnis nicht mehr auf die erste Aufgabenbeschreibung schließen kann – und doch sind alle Beteiligten zufrieden. Erhalten Sie sich möglichst lange die Offenheit, auch unerwartete Vorschläge ernst zu nehmen und sich buchstäblich dort hineinzudenken. Vielleicht schlägt Ihr Planer Ihnen eine Lösung vor, die Ihnen nie in den Sinn gekommen wäre, aber Ihre Wünsche trotzdem weitestgehend erfüllt?
Insbesondere der GEMEINSAME WOHNBEREICH, in dem die Gemeinschaft der Familie ihren Raum findet, bedarf sehr früh der Klärung. In vielen Familien sind der Esstisch und die Küche die zentralen Treffpunkte, in denen die Aktivitäten sich überlagern und Gemeinschaft stattfindet – ist das auch bei Ihnen so? Welchen Stellenwert haben gemeinsames Kochen und Essen? Und: Was verstehen Sie eigentlich unter „Wohnen”? Das kann vieles bedeuten, vom Brettspiel am Esstisch über das gemeinsame Ansehen von Filmen im Heimkino bis zum Mittagschlaf auf dem Sofa. Wer nutzt vorrangig welche Räume, und wie sind diese Räume im Haus angeordnet?
Eine wichtige Setzung, die früh im Entwurfsprozess zu treffen ist, betrifft die AUFTEILUNG DER NUTZUNGSBEREICHE. Wünschen Sie sich einen gemeinsamen Bereich für alle Mitglieder der Familie, wo sich zwangsläufig alle Wege kreuzen und Gemeinschaft gar nicht vermeiden lässt? Im Sinne eines Marktplatzes, auf dem alle Gassen sich treffen und der als Ort der Kommunikation und des geselligen Miteinanders dient? Zu welchen Zeiten und Gelegenheiten wird das gesellige Miteinander gestaltet und wann ist eher Rückzug angesagt?
Sollen alle Hausbewohner das Haus über einen Eingang betreten, sich durch einen fließenden Wohnbereich – vielleicht mit einer offenen Treppe – auf die Rückzugsräume verteilen? Oder wollen Sie ganz gezielt bestimmte Bereiche klar vom Rest des Hauses abtrennen, um wechselseitige Störungen möglichst weitgehend zu vermeiden? Die Analogie hierzu wären zwei Dörfer mit einem Fluss dazwischen. Eine Abtrennung kommt vor allem für die Arbeitsräume und die Bereiche der Kinder in Betracht und kann durch einen unabhängigen Zugang von außen gestärkt werden. Eine solche Anordnung schützt die Privatsphäre der dort verorteten Räume – wenn auch auf Kosten der Gemeinschaft – und ermöglicht potenziell auch eine (spätere) getrennte Nutzung beider Bereiche. Denken Sie bei diesen Entscheidungen immer nicht nur an Ihre derzeitige Situation, sondern stellen Sie sich erwartbare Veränderungen über den Lauf der nächsten Jahre und Jahrzehnte vor.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die erwähnten Räume und Nutzungen in Einfamilienhäusern zu ordnen und zu verteilen. Damit Sie unterschiedliche Varianten in Erwägung ziehen können, wollen wir im Folgenden einige Typen von Grundrissen und Schnitten darstellen und ihre Anwendungsgebiete sowie ihre Vor- und Nachteile beschreiben.
OFFENE GRUNDRISSE
Offene Grundrisse mit ineinander übergehenden Wohnbereichen legen den Schwerpunkt auf die gemeinschaftlich genutzten Flächen, was bei begrenzter Größe allerdings auf Kosten der Rückzugsräume einzelner Bewohner geht. Die Wohnbereiche können zwar höchst attraktiv gestaltet werden, zu prüfen ist dann allerdings, ob die verbleibende Fläche und Qualität der Individualräume noch ausreichend sind.
Ein Grundriss mit an einem Flur aufgereihten Räumen (Mitte) und ein komplett offener Grundriss (rechts).
GRUNDRISSE MIT FLUREN
Man spricht von EINSEITIG ORIENTIERTEN GRUNDRISSEN, wenn entlang des Flurs nur auf einer Seite (üblicherweise der Gartenseite des Hauses) Wohnräume und Individualräume angeordnet sind, auf der anderen Seite hingegen Nebenräume wie Bäder, Wirtschaftsräume und manchmal auch die Treppe. Diese Grundrisse eignen sich besonders gut für Grundstücke, die entweder zu einer Seite hin besondere Qualitäten – zum Beispiel eine besonders schöne Aussichtslage – aufweisen oder von einer anderen Seite besonders belastet sind, zum Beispiel durch Verkehrsgeräusche. Die einseitige Anordnung der Aufenthaltsräume ermöglicht sowohl eine optimale Nutzung von bestimmten Qualitäten des Grundstücks als auch eine konsequente Abschirmung von ebensolchen Nachteilen. Dieser Grundrisstyp eignet sich aber gleichzeitig nur für relativ geringe Gebäudetiefen und erzeugt üblicherweise deutlich langgezogene Baukörper, die sich besonders gut für schmale Grundstücke mit eingeschränkter Bebauungstiefe eignen. Im Verhältnis zur Wohnfläche ergeben sich dadurch zwangsläufig relativ großflächige – somit teure – Gebäudehüllen.
Man sollte versuchen, entweder leistungsfähige, funktional genau definierte beziehungsweise variable, oder aber neutrale, flexible Grundrisse zu wählen.
Besonders häufig finden sich in Einfamilienhäusern ZWEISEITIG ORIENTIERTE GRUNDRISSE