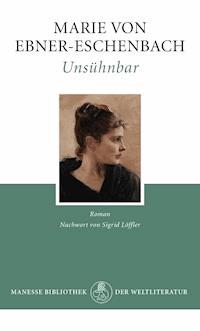
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zu jung, um die beste Partie Wiens abzulehnen; zu leidenschaftlich, um dem Seitensprung mit dem heimlichen Schwarm zu widerstehen; zu aufrichtig, um der Scheinmoral nicht offen die Stirn zu bieten: Maria von Wolfsberg ist gleichermaßen sympathische Heldin wie tragisches Opfer von «Unsühnbar». Im Bemühen, sich von Schuld zu befreien, entgleitet ihr das Leben und läuft auf eine Katastrophe zu …
Ein schillerndes Figurenensemble, sprühende Dialoge und Seitenhiebe auf die Bigotterie des im Niedergang befindlichen österreichischen Adels machen diesen Ehebruchsroman - erschienen fünf Jahre vor «Effi Briest» - zu einer Leseentdeckung. Eindrucksvoll unterstreicht er den Rang Ebner-Eschenbachs als herausragende Autorin des deutschsprachigen Realismus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
MARIE VONEBNER-ESCHENBACH
Unsühnbar
Roman
Nachwort von Sigrid Löffler
manesse verlag
zürich
1
Die Vorstellung des «Fidelio»1 war zu Ende; das Publikum strömte aus dem Opernhause und zerstreute sich rasch nach allen Richtungen. Seit vierundzwanzig Stunden fiel Schnee, emsig, unablässig, in großen Flocken; er lag schwer auf den Dächern, verschleierte die Lichter in den Lampen, machte die Mühe der Wege ausschaufelnden Arbeiter fast vergeblich. Geräuschlos rollten die Equipagen vor; in Pelze gehüllte Männer und Frauen stiegen in weich gepolsterte Wagen. Ein paar Ladendiener hoben ihre sommerlich gekleideten Schönen in einen Komfortable2 mit zerbrochenen Fenstern. Wie der Wind sauste ein Fiaker nach dem andern davon. Den Hut auf dem Ohr, den Schnurrbart gewichst, saßen die Eigentümer des «feschen Zeugels3» etwas vorgebeugt auf ihrem Bock, in jeder Hand einen Zügel; und die Pferde griffen aus und gaben her an Lebenskraft, was sie geben konnten, um grüne Majoratsherrchen4, hochgeborene Reiteroffiziere und Sportsleute so geschwind als möglich zum Spiel in den Jockey-Club zu bringen. An den Rand der Straße gedrängt, rumpelten dicht besetzte Gesellschaftswagen, von abgejagten Mähren geschleppt, von schlaftrunkenen Kutschern regiert, den Vororten zu. Solide Bürgersfamilien gingen wohlverwahrt, mit geschärftem Appetit – man wird so hungrig im Theater – nach Hause, wo ein kräftiges Abendessen sie erwartete, oder begaben sich in ein Restaurant.
Gemächlich, trotz des bösen Wetters, schlenderten einige Infanterieoffiziere dem nächsten Kaffeehause zu. Ein kleines Fähnlein, aber tatendurstig und eroberungssicher. Sie sprachen von den eleganten Damen in den Logen und von den Tänzerinnen und den Pferden anderer. Ein «Einjährig-Freiwilliger», der Sohn eines geadelten Bankiers, der sich ihnen angeschlossen hatte, sagte mit Vorliebe: «Wir Kavaliere» und «Wir vom Turf5». Dass sein Sessel im väterlichen Kontor das einzige Rösslein war, auf dessen Rücken er es je zu einem Gefühl der Sicherheit gebracht, verschwieg er.
Die Herren wurden von einer jungen Lehrerin überholt, die eiligen Schrittes die Wanderung nach ihrer Wohnung angetreten hatte. Ihr Mantel war fadenscheinig, aber sie fror nicht; ihr Weg war weit und einsam, doch ihr bangte nicht. Sie schwelgte im Nachgenuss der Wonne, die ihrem kunstverständigen Sinn eben geboten worden. Es gab doch auch in ihrem schweren, harten Dasein Stunden der herrlichsten Erhebung. Die Kraft, die sie aus ihnen geschöpft, sollte lange vorhalten. Wer das Manna für die Seele auf Kosten des täglichen Brotes erwerben muss, kann sich dieser holden Labung nicht oft erfreuen.
In der Opernstraße war eine Arbeiterabteilung mit dem Aufrichten einer Schneepyramide beschäftigt, als ein Brougham6, mit Rassepferden bespannt, im feierlichen Trabe vorbeikam. Die Flammen eines Gaskandelabers erleuchteten einen Augenblick das Innere des Wagens. Zwei Damen saßen darin, die eine alt und von kränklichem Aussehen, in dunklem Capuchon7 und Überwurfe, die andere sehr jung, sehr schön, barhäuptig, mit klassischem Profil, ihre Gefährtin um Kopfeshöhe überragend.
«Ho!», rief der dicke Pferdelenker in lässig warnendem Tone den Straßenkehrern zu, und alle zogen sich zurück – nur einer nicht. Der sprang vor, sah mit spöttischer Vertraulichkeit zu dem Kutscher hinauf und zwang ihn auszuweichen, was dieser tat, ohne den Kopf zu wenden, während der Diener neben ihm murmelte: «Wieder zurück aus Amerika und – Gassenkehrer? Gibt’s denn dort keine solche Anstellung?»
«Gibt’s gewiss», lautete die Antwort, «damit is ihm aber nit gedient. Will uns hier aufpassen und Skandal machen, der Lump.» –
Diese Bezeichnung galt einem schlank- und hochgewachsenen Burschen mit blassem Gesicht, eingefallenen Wangen und großen, dunkelbraunen Augen. Er trug zerlumpte Kleider; ein kleiner, durchlöcherter Hut, den er ins Genick zurückgeschoben hatte, ließ die Stirn und die, trotz der Verkommenheit, die sie ausdrückten, noch hübschen Züge frei. Mit frechem Behagen pflanzte er sich im Lampenscheine auf, und die junge Dame, die den Kopf ans Wagenfenster neigte, unverschämt anstarrend, präsentierte er vor ihr den Besen wie ein Gewehr.
Die Equipage fuhr davon, die Arbeiter lachten: «Schaut’s den Wolfi an!» Und Wolfi, den Zornigen spielend, rief: «Dumme Bagage, was lacht’s? – Was hab ich getan? … Militärische Ehren erwiesen. Wem? – der Gräfin Maria Wolfsberg, meiner – meiner lieben Verwandten.» Die so Bezeichnete hatte bei der Gebärde des Tagelöhners keine Miene verzogen, doch verfärbte sie sich ein wenig und sagte mit beklommener Stimme zu ihrer Begleiterin: «Tante Dolph, hast du den Menschen gesehen? Im zerrissenen Sommerrock, mit geplatzten Schuhen bei dieser Kälte …»
«Oh, meine Liebe, der hat seinen Schnaps im Leibe, dem ist wärmer als mir», erwiderte die Tante fröstelnd.
«Hast du auch gesehen, was er getan hat?»
«Ja, ja – ein Spaßvogel.»
«Das ist kein Spaßvogel – das ist ein Feind, der uns hasst.»
Die Gräfin unterbrach sie: «Hör auf. Du bist nervös. Dazu hat man in deinem Alter noch kein Recht. Ein Betrunkener erlaubt sich einen Scherz – was weiter. Man sieht es, wenn es einen unterhält, sieht es nicht, wenn es einen verdrießt – darüber nachdenken ist krankhaft.»
Maria schwieg. Sie ließ sich nicht gern in einen Streit mit ihrer Tante ein, weil sie regelmäßig den Kürzeren zog. Die Tante war klug und schlagfertig; ihr Bruder, Graf Wolfsberg, nannte sie sogar weise und verehrte in der um viele Jahre älteren Schwester seine Vertraute, Ratgeberin und Freundin. Sie hingegen liebte auf Erden nichts als ihn. Kränklich von Jugend an und sehr unabhängigen Sinnes, hatte sie niemals einen Beruf zur Ehe in sich verspürt und die zahlreichen Bewerber um ihre unscheinbare Persönlichkeit und um ihr glänzendes Vermögen einen nach dem andern ohne Seelenkampf abgewiesen. Gräfin Adolphine oder Dolph, wie sie in der Familie genannt wurde, lebte lange Zeit auf ihrem Gute der Pflege ihrer Rheumatismen und ihres Vermögens, das sie, bedeutend vermehrt, ihrem Bruder zu hinterlassen gedachte. Als dieser Witwer wurde, brachte sie ihm, seiner Bitte nachgebend, ein großes Opfer. Sie verzichtete auf ihre Selbstständigkeit im eigenen Haushalte und machte sich zur Leiterin des seinen. Da die Zeit kam, Maria in die Welt zu führen, tat sie noch mehr: Sie entsagte der ihr notwendigen Bequemlichkeit und Ruhe und durchwachte manche Nacht auf dem Balle, den schmerzenden Kopf mit Diamanten bedeckt und so unvorteilhaft aussehend im großen Staat, dass nicht einmal ihre Kammerfrau es wagte, sie zu bewundern. Dabei langweilte sie sich grausam, langweilte sich sogar, wenn sie die andern durch ihren scharfen und sprudelnden Witz vortrefflich unterhielt. «Glücklicher Bertrand de Born8», sagte sie, «dem doch die Hälfte seines Geistes nötig war. Ich wäre froh, wenn ich nur für ein Zehntel des meinen Abnehmer fände!»
Zu Hause angelangt, zog sich die Gräfin in ihre Gemächer zurück, während Maria in den Salon ihrer Wohnung trat. Jeden Abend erwartete sie hier einen verehrten Gast – ihren Vater. Es geschah fast nie umsonst. So wenig Zeit das hohe Staatsamt, das er bekleidete, und die Genusssucht, der nachzugeben er selbstverständlich fand, ihm übrig ließen: Die Stunde, mit der Maria ihren Tag beschloss, wusste er für sie frei zu halten.
Sie ließ sich jetzt den Theatermantel von ihrer Kammerzofe abnehmen und begann sogleich den Tee zu bereiten, zu dem alle Anstalten auf einem Tischchen neben dem Etablissement getroffen waren.
Maria widmete ihrer Beschäftigung die größte Sorgfalt. Mit dem Vorsetzen einer Tasse Tees hatte sie alle kindlichen Pflichten erfüllt, die ihr Vater ihr auferlegte. Es wäre ihr heißer Wunsch gewesen, etwas für ihn tun, ihm etwas sein zu können; aber sie fühlte wohl, dass die Ahnung eines solchen Ehrgeizes im Herzen seiner Tochter ihn lachen gemacht hätte. Er wollte sie heiter und glücklich sehen, und wenn sie seine Fragen: «Hast du dich unterhalten? – Freut dich dies? – Freut dich jenes?» mit Ja beantwortet hatte, dann wich der strenge Ernst, der gewöhnlich auf seinem Antlitz lag. Dank seiner Großmut hatte sie ihre Wohnung in ein kleines Museum verwandeln können; fiel es ihr aber ein, bei der Betrachtung eines Bildes, einer Bronze etwas von ihren neu erworbenen Kenntnissen in der Kunstgeschichte durchblicken zu lassen, dann wurde seine Miene so spöttisch, dass Maria verwirrt schwieg und sich beschämend albern vorkam. Und der kostbare Blüthner9, mit dem er sie jüngst überrascht und der dort in der Ecke stand, eingehüllt in weiche, indische Gewebe, noch hatte sie seinem Spender nichts anderes darauf vorspielen dürfen als Operettenarien und Tanzmusik. Sie war nicht leicht abzuschrecken gewesen, hatte immer einen Übergang gefunden aus dem Trivialen ins Schöne, aus dem Zerstreuenden ins Erhebende – aber nach den ersten Takten schon wurde das gefürchtete «Gute Nacht, Maria» gesprochen, und der Graf war aus dem Zimmer verschwunden. In solchen Fällen pflegte sie sich nicht zu unterbrechen; es hätte ihn, der sich in seinem Hause gegen Rücksichtnahme wehrte wie ein anderer gegen Rücksichtslosigkeit, sehr verdrossen. Nun blieb Maria in seiner Gegenwart bei dem Vortrage von Arietten und Walzern. Die Musik, die ihrem Geschmack entsprach, übte sie aus vor dem Bilde ihrer Mutter, das lebensgroß an der Wand über dem Piano hing. Du hättest deine Freude an mir gehabt, sprach sie in Gedanken zu ihr. «Du hättest gewusst, dass ich nur zu wollen brauche, um eine Künstlerin zu werden. Aber ich werde nicht wollen, ich darf nicht. Unsereins darf so etwas nicht. Hättest du das auch gefunden?»
Ihr Blick haftete voll inniger Begeisterung auf dem edlen Angesicht, dem das ihre so ähnlich sah. Es war dasselbe reine Oval, dieselbe von kleinen Locken der reichen, aschblonden Haare beschattete Stirn. Sie bildete zwei kaum sichtbare Hügel über den feinen Brauen, den etwas tief liegenden blaugrauen Augen. Es war derselbe Schnitt der schlanken Nase, der leicht geschwellten Lippen und dieselbe wahrhaft königliche Gestalt. Aber ein anderer Geist offenbarte sich in jedem der beiden schönen Wesen. Marias ganze Erscheinung bekundete Entschlossenheit, Seelenstärke, Klarheit. Die Verstorbene hingegen hatte einen Ausdruck von eigentümlicher Schwermut und hilfloser Schüchternheit. Das Bild, aus dem sie unvergänglich jung und lieblich herabsah, war in ihrem achtzehnten Jahr, dem ersten Jahre ihrer Ehe, gemalt worden. Es stellte sie dar in einem weißen Spitzenkleide, mit bloßem Halse, mit nachlässig herabhängenden Armen, eine weiße, kaum aufgeblühte Rose in der Hand. Den Kopf leicht vorgeneigt, schien sie traumverloren zu lauschen. Maria besann sich noch, sie so gesehen zu haben im Konzert, in der Oper und auch, wenn der Vater oder sie zu ihr sprachen.
Aber diese freudigen Erinnerungen an die Mutter lagen fern, und jene, die sich an eine spätere Zeit knüpften, waren unsäglich traurig. Die Gräfin, von einer Gemütskrankheit ergriffen, war langsam hingesiecht. Immer teilnahmsloser, immer schattenhafter wandelte sie stundenlang im Sommer durch den Garten, im Winter durch die Zimmer und durch die Gänge, blieb manchmal horchend an einer Tür stehen, machte eine Gebärde des Entsetzens und trat ihre Wanderungen stumm und rastlos wieder an.
Die ersten Symptome des Leidens sollten durch einen heftigen Schrecken hervorgerufen worden sein, dessen Veranlassung niemand in Marias Umgebung kennen wollte. Sie zweifelte nicht, dass ein Geheimnis da verborgen liege, und ließ nicht nach in ihrem leidenschaftlichen Eifer, es zu entdecken. Ganz besonders wurde ihre ehemalige Kinderfrau, die mit unbegrenzter und sklavischer Liebe an ihr hing, mit Fragen von ihr bestürmt.
«Sag es mir, Lisette, geh, sag es mir», hatte sie einst gefleht und, so geizig sie mit ihren Zärtlichkeiten war, ihren Arm um den Hals der Getreuen geschlungen. «Wenn du mich lieb hast, sagst du’s gleich, in dieser Minute … Wenn du es nicht sagst, dann weiß ich, dass dir nichts an mir liegt.»
Lisette sank in sich zusammen. Ratlos und verzweifelt starrten ihre grauen Augen ins Leere, ihre Wangen wurden fahl, ihre Lippen bebten. «Wäre ich doch tot», jammerte sie, «dass mich das Kind nicht mehr fragen könnte.»
– Tot? – Maria trat weg von ihr und senkte den Kopf.
Lisette hatte sich den Tod gewünscht. Sie, die nicht von ihm reden hören konnte, die in jedem, der ihn nur nannte, ihren Feind sah, die das Leben als das höchste aller Güter schätzte, noch so viel von ihm erwartete, die tanzen wollte auf der Hochzeit Marias und Kinder des Kindes heranziehen, alle – und wenn ihrer zwölfe wären! … Lisette hatte sich den Tod gewünscht!
Das junge Mädchen war tief ergriffen und musste Tränen niederkämpfen, um laut und vernehmlich sagen zu können: «Ich werde dich nie wieder fragen.»
Maria hatte Wort gehalten. – Seitdem waren sechs Jahre vergangen.
2
Der Vorhang des Nebenzimmers war mit leiser Hand zurückgeschoben worden, Lisette erschien am Eingang und ihre sanfte, unterwürfige Stimme sprach: «Marie, Kind, darf ich herein?»
«Du bist noch auf?», lautete die vorwurfsvolle Erwiderung, und Lisette entschuldigte sich: «Hatte schon Nacht gemacht, schon längst. Aber du weißt, dass ich nicht einschlafen kann, bevor ich deinen Wagen ins Haus rollen höre.»
«Wie lächerlich», versetzte Maria, wandte sich ab und nahm Platz in einem Fauteuil.
Lisette stützte, näher tretend, den Arm auf dessen Lehne. «Kann früher nicht einschlafen. Und dann muss die Klara kommen und mir berichten – weh ihr, wenn sie das einmal versäumen würde! – sie ist da und lustig und guter Dinge. Heute jedoch höre ich: Sie hat traurig ausgesehen …»
«Spionage!», fiel ihr Maria ins Wort.
«Nenn’s, wie du willst, das ist mir gleich; nur glaube nicht, dass du daran etwas ändern kannst. – Also traurig ist das Kind? Ja, ja, ich seh’s.» Ihr Ton wurde tief schmerzlich, in ihrem kleinen, spitznasigen Gesichte malte sich eine peinvolle Bangigkeit. «Was ist denn geschehen?»
«Ach, Lisette, ich bitte dich, mach keine Geschichten. Was soll mir geschehen sein? – Ich bin verstimmt, ja, aber aus einem Grunde, der dir keine Sorgen machen wird.»
«Wollen erst sehen. – Sprich, mein Vogerl, sprich, damit ich beruhigt zu Bett gehen kann.»
Maria erhob den Kopf und sah der Dienerin, die sich zu ihr herabneigte, fest und streng in die Augen: «Die Menschen, die eine eiskalte Nacht wie diese im Freien zubringen und hungernd und frierend die Straßen fegen werden – die tun mir leid.»
Lisette bäumte sich lachend zurück. «Nein, das Kind! – Nein, das ist zu arg. Die Leute, die Gott danken für den Schnee, den er vom Himmel fallen lässt, damit sie Arbeit kriegen, die sich nichts anderes wünschen als Arbeit, von klein auf nichts anderes gewohnt sind als Arbeit, die bedauerst du!» Sie wurde in dem Lobgesang, den sie nun auf Marias «goldenes Engelsherz» zu erheben begann, unterbrochen.
Im Hofe, nach dem die Fenster der Komtessenwohnung gingen, war es laut geworden. Pferdegetrappel ließ sich hören, die Portiersglocke gab das Herrenzeichen.
Lisette verabschiedete sich, und Maria ging ihrem Vater bis an die Schwelle entgegen; sie begrüßten einander mit einem Händedruck.
«Guten Morgen und guten Abend», sprach Maria. «Ich wollte nachmittags einen Augenblick zu dir, aber Walter sagte, du habest Besuch.»
«Dornach war bei mir und blieb so lange, dass ich kaum Zeit gehabt habe, Toilette zu machen zum Diner.»
«Bei?»
«Bei Fürstin Alma.»
«War’s schön?»
«Kannst dir’s denken. Dreißig Personen, dreißig Grade und dreißig Gänge.»
«Du übertreibst, wie immer, wenn es sich um ein Fest bei Alma handelt. Sie kann tun oder lassen, was sie will, du tadelst alles. Und ich weiß, wie peinlich ihr das ist und wie großen Wert sie auf dein Urteil legt.»
Mit diesen Worten stellte Maria eine Tasse Tee vor den Grafen hin, der sich in einen Lehnstuhl neben dem Tische niedergelassen hatte. Er warf einen seltsamen, fast drohenden Blick auf sie, senkte ihn aber rasch, als er in den Zügen seiner Tochter der völligsten Unbefangenheit begegnete.
Wolfsberg galt noch jetzt, da er sich in der zweiten Hälfte der vierzig befand, für einen den Frauen gefährlichen Mann. Er war mittelgroß, von schlanker und geschmeidiger Gestalt, ein berühmter Reiter und Jäger. Einer gewissen kühlen und würdevollen Zurückhaltung in seinem Wesen verdankte er den Ruf großer Verlässlichkeit, der ihm zahlreiche Freunde erwarb. Seine Erziehung hatte er, früh verwaist, in Deutschland, bei Verwandten seiner verstorbenen Mutter, im Sinne des Wortes – genossen. Mit einer außerordentlichen Bildungsfähigkeit begabt, war er mühelos ein guter Student gewesen, und es blieb auch später sein Ehrgeiz, jeden seiner Erfolge für einen spielend errungenen gelten zu lassen. «Ich nehme das Leben nicht ernst», sagte er oft und machte dazu eine beinah finstere Miene.
Eines aber gab es in diesem Leben, das er dennoch ernst nahm, und das war seine Tochter und das Glück, das er ihr bereiten wollte in Gegenwart und Zukunft.
«Maria», begann er, «es hat sich heute jemand bei mir um die Erlaubnis beworben, unser Haus besuchen zu dürfen. Du wirst wohl erraten wer?»
Sie lächelte ihn freudig an: «Felix Tessin.»
«Tessin? – Du scherzest.»
«Es war nicht meine Absicht», erwiderte Maria und senkte bestürzt die Augen.
«Wie? Du könntest glauben, dass ich Tessin angehört hätte, wenn er mir mit einer solchen Zumutung gekommen wäre?»
«Warum nicht?», fragte sie zögernd, und ihr Vater antwortete mit der offenbaren Absicht, sich nicht in Erörterungen einzulassen: «Du solltest wissen, was ich von ihm halte.»
«Nun, recht viel. – Ein so geistvoller, begabter Mensch, dem du selbst eine schöne Zukunft voraussagst.»
«Das heißt, ich glaube, dass er so ziemlich alles erreichen dürfte, was er anstrebt. Er ist ehrgeizig und klug, jagt hohen, aber nicht unerreichbaren Zielen nach und kann umso leichter ankommen, da er sich wenig Skrupel macht in der Wahl seiner Mittel.»
«Vater!»
«Nun?»
«Das wäre ja schrecklich.»
Er zuckte die Achseln. «Tessin hält sich gewiss, wie heutzutage so mancher, für einen, der jenseits von Gut und Böse steht. Ein so ungewöhnlicher Mensch, so bezaubernd in seiner dunklen Manfred-Schönheit10, so verwöhnt von den Frauen.» Der Graf sprach gelassen und spöttisch, ohne dass es im Geringsten schien, als ob er seine Tochter beobachte, und las doch in ihren bewegten Zügen, was ihn peinlich überraschte – dass er ein wenig spät kam mit seiner Warnung. Es galt mehr als einen flüchtigen Eindruck verwischen, es galt eine Empfindung entwurzeln, wehtun. Den Ellbogen auf den Tisch und die Hand an Stirn und Wange gestützt, fuhr er ernsthaft fort: «Wenn Tessin nicht ein Verwandter – der Freundin deiner Mutter», wollte er sagen, brachte es aber nicht über die Lippen, «der Fürstin Alma wäre, hätte ich verhütet, dass er dir vorgestellt werde. Indessen hat sie es mir schwer genug gemacht, ihn, außer bei offiziellen Empfängen, von denen ich einen Botschaftsrat nicht ausschließen kann, von meinem Hause fernzuhalten. Die gute Fürstin wird eine Schwäche für ihn nicht los; sie vergisst nie, dass sie sein Jugendtraum gewesen, seine erste und letzte ideale Liebe.»
«Vor ihrer Verheiratung; ich habe davon gehört.»
«Vorher – nachher. Was hätte er darum gegeben, an der Stelle seines älteren Vetters, des Fürsten Tessin, zu sein, der die Braut heimführte. – Es dauerte eine Weile, bis er das zwecklose Schmachten sattbekam und eine praktische Richtung im Leben und in der Liebe einschlug. Und heute können seine Huldigungen ein junges Mädchen nicht mehr stolz machen. Sie teilt sich darein mit Persönlichkeiten, mit denen sie gewiss nichts gemein haben möchte.»
«Zum Beispiel?», fragte Maria erstickten Tones, und ihr Vater spöttelte: «Nein wirklich, ich bekomme Respekt vor den Komtessensoireen. Man klatscht ja dort nicht mehr, kümmert sich nicht mehr um das Tun und Lassen der jungen Herren. Schade um ihre schönsten dummen Streiche, sie machen keinen Effekt. Was wissen denn die Komtessen, wenn sie nichts wissen von Mademoiselle Nicolette, dem Stern der ersten Quadrille?»
Maria war sehr blass gewesen, jetzt färbten sich ihre Wangen: «Doch – sie wissen viel und schwatzen noch mehr von ihr und vom Grafen … Ich höre aber nicht zu, wenn jemandem übel nachgeredet wird … du hast mich das gelehrt.» Sie versuchte einen scherzenden Ton anzunehmen, es gelang ihr nicht, es war zu schwer. Sie hätte weinen und schluchzen mögen.
Der Graf sah es, und es tat ihm leid; von einer schwächlichen Regung jedoch hielt er sich frei. Es musste sein, mit dieser Neigung musste sie fertig werden. Auch ohne den entscheidenden Grund, der ihr unbekannt bleiben musste, würde Wolfsberg eine Heirat zwischen Maria und dem leichtfertigen Tessin nie gestattet haben. Und so versetzte er: «Die üble Nachrede trifft auch manchmal das Richtige.»
Ein schwerer Seufzer stieg aus der Brust Marias. «Du tust ihm vielleicht Unrecht», wagte sie einzuwenden.
«Er ist unwahr und gewissenlos – unterbrich mich nicht – ich spreche von jener Gewissenlosigkeit, die sich von der des Falschspielers oder des Diebes unterscheidet wie das Ungreifbare vom Greifbaren … Genug.» Er wandte sich ihr plötzlich zu und sah sie an: «Du hast schlecht geraten. Der mich bat, ihm Gelegenheit zu geben, von dir gekannt zu werden – denn dich zu kennen behauptet er –, ist Hermann Dornach.»
Sie biss sich auf die Lippen. «Welche Ehre! Und was hast du ihm geantwortet?»
«Dass ich mit dir reden und ihm dann Bescheid geben will. Er wird bejahend lauten, wenn du Rücksicht nimmst auf das, was ich wünsche. Du verbindest dich damit zu nichts. Ich verlange nur: Beobachte ihn, prüfe dich. Er wird deine Achtung gewinnen, aber die Sympathie allein gibt den Ausschlag, und – da stehen wir an der Grenze unseres freien Willens. Der Verstand sagt, der klare Blick sieht, hier ist ein Mensch, so vortrefflich, dass eine brave Frau mit ihm glücklich werden muss. Es ist kaum anders möglich, als dass ihre Freundschaft und Hochschätzung für ihn sich allmählich zur Liebe und Begeisterung steigert. Und dort ist ein anderer, an dessen Seite sie Enttäuschung auf Enttäuschung zu erwarten hat. Sie wird gewarnt, ahnt wohl selbst etwas davon – was hilft’s? – Ein dunkler Instinkt bleibt der Herr. Das Echte lässt sie gleichgültig, und unwiderstehlich fühlt sie sich zum Falschen hingezogen.»
«Unwiderstehlich?» Trotz und Zorn funkelten aus Marias Blicken. «Wenn du das auf mich anwendest, kennst du mich nicht.»
«Hoho!», sprach er, sehr zufrieden mit dem hervorgebrachten Eindruck. «Da bleibt mir nichts übrig, als mich zu entschuldigen. Aber das möchte ich wissen – ob du nie ausgelacht worden bist, wenn du die Verteidigung Mademoiselle Nicolettes und ihres Gönners übernahmst?» – Er ersparte ihr die Antwort, die sie mühsam vorzubringen suchte. «Und dann, warum hast du gesagt: ‹Welche Ehre!›, als ich dir die Botschaft Dornachs bestellte?»
«Weil alle Welt es dafür ansehen würde. Es ist ja unglaublich, wie sie es mit ihm treiben. Die Papas und Mamas machen dem jungen Manne den Hof … Oh, wenn sie ihm die Töchter buchstäblich an den Kopf werfen könnten – da sähe man Komtessen fliegen! … Und die überbieten noch die Taktlosigkeit der Eltern ihm und seinem zweiten Ich, seiner Mutter, gegenüber … Ich schäme mich für die anderen … Das alles ist so empörend und für Dornach so demütigend, weil es so unpersönlich ist und nur seinem Rang und seinem Reichtum gilt.»
Sie ereiferte sich und sprach mit einer Heftigkeit, die außer Verhältnis zu deren scheinbarem Grunde stand.
Peinlich berührt, lenkte der Graf das Gespräch ab und brachte es erst später auf den Freier zurück, der, wie es bei ihm feststand, sein Schwiegersohn werden sollte.
Als er sie verlassen hatte, ging Maria zu Bette und konnte zum ersten Male in ihrem Leben nicht sogleich einschlafen. Jedes Wort über Tessin, das ihr Vater gesprochen, klang schmerzhaft in ihrer Seele nach. Die Erinnerung an alles wurde lebendig, das Maria ein tolles Geschwätz genannt und dem sie ihr Ohr verschlossen hatte. Nun aber wusste sie, diejenigen, die von ihr der Verleumdung angeklagt worden, die hatten recht, und ihr Vater hatte recht und sie allein unrecht mit ihrer törichten Glaubensseligkeit, mit ihrer übel angebrachten Bewunderung Tessins, mit ihrem Stolz auf sein ritterliches Werben … Guter Gott, das war so unpersönlich wie die dem Grafen Dornach dargebrachten Huldigungen. Ein ehrgeiziger Diplomat, ein praktischer Mann hatte gewünscht, der Schwiegersohn des Grafen Wolfsberg zu werden und die dazu unerlässlichen Schritte mit liebenswürdiger Formengewandtheit unternommen … Das Herz war bei dem Geschäft nicht im Spiele – wäre auch nicht zu vergeben gewesen, es befand sich bereits in anderweitigem Besitz.
Ein Schwall von neuen Empfindungen brach über Maria herein. Sie war die Beute von etwas Fremdartigem und Unschönem, dem sie sich entreißen wollte, und wollen konnte sie noch, das sollte ihr Vater sehen – ihr Vater und noch ein anderer …
Ihre Lider wurden schwer und schlossen sich. Ein Augenblick der Betäubung, dann fuhr sie auf …
Ob sie jetzt wusste, was es heißt: hassen? … Nein, nein … sie fühlte nur ein tiefes Bedauern, wie wenn ihr ein Herrliches und Schönes, an dem ihr das Herz gehangen, verunstaltet worden wäre. Er, den sie hoch über alle Menschen gestellt, unwahr und gewissenlos?
Sie hörte noch vom Turme der nächsten Kirche zwei Uhr schlagen, dann schlief sie ein und träumte, Tessin trete als Schneeschaufler verkleidet an ihr Bett, präsentiere mit dem Besen und engagiere sie zum Kotillon. Sie folgte ihm durch den Ballsaal und schämte sich ihrer Nachttoilette und ihrer nackten Füße. Auch ihres Tänzers schämte sie sich, der in einem fort grinste und der wirkliche Schneeschaufler war. Und wie sie ihn jetzt so recht ins Auge fasste, entdeckte sie etwas Merkwürdiges. Der zerlumpte Mensch erinnerte an ihren Vater, er hatte wie jener die breite Stirn, die dichten, zusammengewachsenen Brauen.
Maria neigte sich zu ihm und sprach: «Beim ersten Blick ist mir etwas an Ihnen aufgefallen – ich wusste nur nicht gleich, was es war …»
Sie erwachte, lächelnd über diesen Traum und mit unglaublich leichtem Herzen für ein junges Mädchen, dem eben eine erste Illusion zerstört worden. «Es ist aus», dachte sie, «ich hätte nicht geglaubt, dass man so schnell mit einem Gefühl fertig werden kann, das doch wie Neigung ausgesehen hat … Nein, nicht nur ausgesehen! … Die anderen wollen belogen sein – warum aber mich selbst belügen? … Ich habe ihn geliebt, innig und heiß.»
Und aufschluchzend drückte sie ihr tränenüberströmtes Gesicht in das Kissen.
3
Am nächsten Tage machte Hermann Dornach seinen ersten Besuch; er wurde für morgen zu Tische geladen und brachte einige Abende im Familienkreise zu. Gräfin Dolph fand ihn charmant und unglaublich gescheit für einen Majoratsherrn. Sie rechnete es ihm hoch an, dass er mit ihr, der bösen Zunge, die den meisten Scheu einflößte, so rasch vertraut wurde. «Einfach die Folge seines guten Gewissens», erklärte sie. «Eine Anklage gegen ihn wäre ein Schuss ins Blaue. Der sieht ruhig zu, wie ich meine Pfeile spitze; er gehört nicht zu den Leuten, denen vor mir graut.»
Und wirklich schwand in ihrer Gegenwart die leise Befangenheit, die bei einem Manne, den zu verwöhnen alle Welt wetteiferte, für den Laien so befremdlich und dem Herzenskundigen eine Bürgschaft echten Seelenadels war.
Man sagte, diese Befangenheit sei die Folge der übertriebenen Strenge, mit der er unter der Leitung seiner Mutter erzogen worden. Die Gräfin hatte ein Gegengift anwenden wollen gegen die Kriecherei der Parasiten, des Beamtenheeres, der Dienerschaft und gegen die grenzenlose Nachsicht eines schwachen und kränklichen Vaters für sein einziges Kind. Aber die Dosis war zu stark gewesen und hatte nicht nur keine Selbstüberhebung aufkommen lassen, sondern auch kein rechtes Selbstvertrauen. Die Gräfin sah den begangenen Fehler ein und suchte ihn noch beizeiten gutzumachen. Sie hatte nach dem Tode des Grafen die Vormundschaft über Hermann, die sie tatsächlich immer geführt, auch formell angetreten, und schenkte nun dem achtzehnjährigen Jüngling uneingeschränkte Freiheit. Ein kleiner Missbrauch der mütterlichen Gnadengabe wäre leicht verziehen gewesen, kam aber nicht vor. Hermann besuchte landwirtschaftliche Schulen in Deutschland und England, jagte Löwen in Nubien und Elefanten in Indien, diente einige Jahre in einem eleganten Kavallerieregiment und widmete sich später der Verwaltung seiner Güter.
Er war dreiunddreißig Jahre alt geworden, ohne in die Lage gekommen zu sein, andere Schulden als die seiner Freunde bezahlen zu müssen, ohne ein Mädchen verführt, ohne den Ruf einer Frau gefährdet zu haben. Und doch kochte das Blut in seinen Adern so heiß wie in denen irgendeines seiner Alters- und Standesgenossen, und doch hatte er in seinen wenigen Liebesverhältnissen mehr echte und wahrhafte Empfindung ausgegeben als sie alle zusammengenommen in ihren zahllosen Zirkus- und Halbweltsabenteuern. Übrigens erschienen ihm seine ernsthaftesten Schwärmereien und Leidenschaften nur wie Spielereien von der Zeit an, in der er Maria kennenlernte.
Es geschah auf einem Balle, den er aus Gehorsam gegen seine Mutter besucht hatte. Er kam ja überhaupt nur aus Gehorsam zu ihr nach Wien, um dort in die große Welt zu gehen, wo er kein Vergnügen fand und wo die Bemühungen um seine Gunst ihn anekelten.
Tante Dolph war Zeuge seiner ersten Begegnung mit Maria und dann selbst der Gegenstand seiner eifrigsten und ehrfurchtsvollsten Aufmerksamkeiten gewesen. Sie erinnerte sich plötzlich ihrer Jugendfreundschaft mit Gräfin Agathe Dornach und machte ihr einen Besuch, der bald erwidert wurde. Die alten Damen sagten zueinander: «Liebes Kind», und jede hatte das Gefühl ihrer Überlegenheit über die gute Bekannte von einst, mit der sie später auseinandergekommen war wegen völlig verschiedener Anschauungen und gleich schroffer Unduldsamkeit. Agathe berühmte sich, eine orthodoxe Katholikin zu sein; Dolph, ganz ungläubig, ließ nicht gelten, dass ein vernünftiger Mensch fromm sein könne, es wäre denn ein Dienstbote, ein Bauer oder ein Prinz. Agathe fürchtete für Dolphs ewiges Heil, diese fürchtete Agathens Bekehrungsversuche, die stets in der Behauptung gipfelten, die Skepsis entstehe aus der Halbbildung, und weiter als bis zu einer solchen brächten Frauen es nicht. Ob sich diese Gegensätze zwischen den beiden Damen im Laufe der Jahre gemildert oder verschärft, danach wurde jetzt nicht gefragt und das Berühren heikler Punkte sorgfältig vermieden. Der Graf, ein Konversationskünstler ohnegleichen, half spielend über ein paar Abendstunden hinweg; das Gespräch, das er beherrschte, wurde lebhafter geführt als das zwischen den jungen Leuten am Teetisch nebenan. Maria war schweigsam, Hermann nicht beredt. Er sagte aber dennoch viel, denn jeder seiner Blicke enthielt eine glühende Erklärung der innigsten Liebe.
Eines Tages nun geschah es, dass Gräfin Dornach sich bei Maria anmelden ließ und mit einer Miene eintrat, als ob sie die Schlüssel des Himmels zu überreichen hätte. In würdevoll gelassener Weise brachte sie im Auftrage Hermanns die Anfrage vor, ob er um Marias Hand werben dürfe.
«Dein Jawort würde ihn beseligen», schloss sie, «und du kannst es ihm getrost geben. Ich schmeichle niemandem, am wenigsten mir selbst in meinem Sohne. Mein Urteil über ihn ist das eines jeden Unparteiischen und lautet: Es gibt keinen vernünftigeren Menschen, keinen besseren, keinen edleren.»
Sie hielt inne, sie wartete auf eine Erwiderung; da keine erfolgte, fuhr sie fort: «Wenn deine Mutter lebte, würde ich mich zuerst an sie gewendet haben, und sie wäre es, die jetzt zu dir spräche. Nimm an, dass es durch meinen Mund geschieht.»
Maria senkte die Augen, ihre Lippen zitterten, aber sie schwieg.
«Ein sicheres Glück bietet sich uns im Leben selten. Dem, der es einmal abgewiesen hat, wird es schwerlich wiederkehren», fuhr die Gräfin nach einer Pause noch kälter und förmlicher als früher fort. «Indessen hast du recht, zu erwägen. Dein Zögern gefällt mir; es beweist, dass du den Ernst des Schrittes kennst, den andre junge Mädchen oft so leichtsinnig unternehmen. Ich habe Vertrauen zu dir. Wenn ich deine Einwilligung, deine einfache Einwilligung mit nach Hause nehme, so enthält sie für mich alle heiligsten Schwüre, die ein ehrliches Mädchen ihrem zukünftigen Gatten nur irgend leisten kann.»
«Jawohl, das enthielte sie auch … Ich bitte Sie –»
«Wieder: Sie! Bleibe ich dir denn fremd?» –
«Ich bitte dich, sage dem Grafen Hermann – –», eine unaussprechliche Bangigkeit bemächtigte sich ihrer; sie blickte in das marmorblasse Gesicht der Gräfin: – «So lieblos wie die Tante» – dachte sie.
«Nun, was sag ich ihm?»
«Dass ich heute abends – Ihr kommt ja doch? – selbst mit ihm sprechen werde.»
Sie küsste der Gräfin, die sich ziemlich enttäuscht erhob, die Hand und begleitete sie bis zur Treppe.
In ihr Zimmer zurückgekehrt, schritt sie lange in hoher Erregung auf und ab und quälte sich mit der Frage: «Warum will ich’s tun? – Ist mein Grund nicht ein verwerflicher? …» Und dann setzte sie sich ans Klavier und spielte und wurde allmählich ruhiger. Und dann kam Tante Dolph und las ein Telegramm von Wilhelm Dornach vor, einem Bekannten aus uralter Zeit, dessen Existenz sie längst vergessen hatte. Auf ein Gerücht hin, das in seine ländliche Einsamkeit gedrungen war, schickte der gute, dumme Mensch ihr seine Glückwünsche zur Verlobung ihrer Nichte mit seinem Vetter.
Die Gräfin lachte über die Eile des armen Teufels, seine geheuchelte Freude an den Tag zu legen. Als nächster Anwärter auf das Majorat konnte der ganz unbegüterte und mit einer zahlreichen Familie gestrafte Mann doch nichts andres gewünscht haben, als dass sein Vetter ledig bleibe. Ein indiskreter Wunsch, ja, aber der natürlichste von der Welt. Sie nahm Platz auf der Chaiselongue mit dem Rücken gegen das Bild ihrer verstorbenen Schwägerin, das anzusehen sie überhaupt vermied, klagte über Kopfschmerzen und rieb die eingefallenen Schläfen mit Kölnerwasser. Sie war leidend und in gereizter Stimmung. Sogar als sie ihr jetziges Lieblingsthema anschlug, das Lob Hermanns, geschah es mit einer Beimischung von Spott.
«Heil der Frau, die er heimführt!», rief sie aus. «Ihre Ehe wird friedlich sein wie jede, in der nur ein Wille herrscht.»
Sie beantwortete den erstaunten Blick Marias mit der Frage, ob denn Hermann nicht von seiner Kindheit an gelernt habe, sich einer Weiberregierung zu fügen? … Wie albern müsste doch die Frau sein, die es nicht verstände, einen so vortrefflichen Elementarunterricht als Grundlage zu weiterer Ausbildung zu benützen! Gute Lehren, wie das anzufangen sei, kamen nun in Fülle. Ernst gemeinte wie spaßhafte, und alles mit Beispielen erläutert. Man sehe das Ehepaar Heinburg. Im Anfang war er ein Spieler und brachte die Nächte im Klub zu, während sie daheimsaß und weinte. Das hat sich nach und nach geändert – durch ihr Verdienst! Jetzt spielt sie, und er weint.
«Und deine Freundin Emmy, die sich zum Altar schleppen ließ wie ein Lamm zur Schlachtbank und in ihrer Ehe einen so guten, sicheren Hafen gefunden hat, von dem aus sie allerlei abenteuerliche Fahrten unternehmen kann in die stürmische See!»
Ein Klopfen an der Tür ließ sich hören, und Fräulein Nullinger, die Gesellschafterin Gräfin Dolphs, schlüpfte herein. Sie wurde von der Gebieterin «Nulle» genannt, was sie empörte, und litt infolge ihres aufregenden Dienstes an Nervosität. Obwohl sie jetzt nur die harmlose Meldung zu machen hatte, dass die Schneiderin gekommen sei und gesagt habe, sie könne nicht lange warten, zuckte es dabei krampfhaft um ihren Mund.
«Schon gut, setzen Sie sich», erwiderte Dolph und fuhr fort, Freund und Feind durch die Hechel zu ziehen. Sie nannte viele Namen ganz flüchtig und obenhin; an dem, der ihn trug jedoch, blieb ein Makel hangen, oder er wurde mit einer Lächerlichkeit behaftet.
Maria hörte ihr heute aufmerksamer zu als sonst und dachte: «Sie hat wohl recht. Was soll auch an den übrigen Menschen sein, wenn Tessin nichts taugt?»
Und Gräfin Dolph, wie ein echter Schauspieler, den schon die Teilnahme eines einzigen Zuhörers begeistert, übertraf sich selbst in ihrer fragwürdigen Kunst und geriet in den kleinen Witz- und Bosheitsrausch, der ihr so gesund war. Ihr Gesicht, das, wie sie selbst sagte, eine Karikatur der schönen Züge ihres Bruders war, belebte sich, und ihre Kopfschmerzen verschwanden.
Fräulein Nullinger verlor endlich die Geduld und erhob sich, noch um eine Schattierung höher gefärbt als gewöhnlich. «Ich werde der Schneiderin sagen», sprach sie, «dass Frau Gräfin jetzt lästern müssen und keine Zeit für sie haben.»
Dolph lachte. «Ach was, mein Lästern: ein gerader Kerl, der gleich Farbe bekennt. Aber das Ihre! … Wenn Sie anfangen: Ich hab den oder die recht gern, das ist, wie wenn ein Reiter sein Pferd zusammennimmt, bevor er ihm eins hinaufgibt.»
Sie ging in munterster Laune, war auch später bei Tisch heiter und anscheinend ganz wohl. Am Abend jedoch stellten sich plötzlich ihre Kopfschmerzen wieder ein und zwangen die Leidende, ihr Zimmer aufzusuchen, kurz bevor Hermann und seine Mutter gemeldet wurden. Ausnahmsweise hatte Wolfsberg zu Hause gespeist und nachmittags im Salon den Damen Gesellschaft geleistet. Er empfing die Gräfin mit tausend Entschuldigungen seiner Schwester, die sehr zur Unzeit unwohl geworden; Agathe äußerte ihre Teilnahme mit ganz besonderer Wärme und ersuchte den Grafen, sie zu ihrer Freundin zu geleiten, was alsbald geschah.
Die jungen Leute blieben allein. –
Beiden stieg die Röte in die Wangen. Ihm schien die Gelegenheit zu einer entscheidenden Unterredung plump und ungeschickt geboten; ihrer bemächtigte sich ein peinliches Gefühl, halb Empörung, halb Bangigkeit. Regungslos stand sie da, hatte die Brauen zusammengezogen und blickte ins Feuer des Kamins. Nach einer Pause, die, je länger sie dauerte, desto schwerer zu unterbrechen war, begann Hermann bewegt und zagend: «Meine Mutter hat mit Ihnen gesprochen, Gräfin … Sie kennen die kühne Frage, die ich so vermessen bin, an Sie zu stellen. Die leiseste Hoffnung auf eine bejahende Antwort würde mich beglücken … Darf ich sie fassen?»
Maria schwieg, aber sie wandte sich ein wenig und blickte ihn von der Seite so fremd an, als ob sie ihn heute zum ersten Male sähe. Sein Äußeres war ungemein gewinnend, sie musste es gestehen. Verstand, Güte, Geradheit sprachen aus seinem hübschen Gesicht, leuchteten aus seinen treuherzigen Augen. Er trug einen kleinen Schnurr- und Backenbart, die reichen braunen Haare waren kurz geschnitten und ließen die edel geformte Stirn und die Schläfen frei. Seine Gestalt hatte etwas Festes, Kräftiges, und doch fehlte es ihr nicht an männlicher Anmut.
«Antworten Sie mir», sagte er.
Und sie, «der Held» im Kreise ihrer jungen Freundinnen, die Unerschrockene, die ja mit sich selbst im Reinen und fest entschlossen war, ihre Hand in die des ungeliebten Freiers zu legen, flüsterte nun bestürzt: «Ich weiß nicht … ich weiß nicht» –
Ihre Verzagtheit ergriff und rührte ihn; er machte sich Vorwürfe, er hatte zu früh gefragt, er hätte dem Drängen seiner Mutter nicht nachgeben, sich von dem Entgegenkommen des Grafen nicht verleiten lassen sollen. Nun bemühte er sich, seine Übereilung gutzumachen: «Sie sind noch unentschieden», nahm er wieder das Wort, «ich sehe es und finde es begreiflich. – Überlegen Sie, prüfen Sie mich streng und lange. Ich mache es Ihnen nicht schwer – in meiner Seele gibt es keine Abgründe …»
«Mein Gott, nein», sprach Maria, «das ist nicht … nein, nein» – – und zwei Worte, Anfang und Ende ihrer jungen Weisheit, kamen fast unhörbar über ihre Lippen … Worte ihres Vaters, die er seiner gelehrigen Schülerin eingeprägt hatte: «Nur ruhig!» – Dereinst, als sie sich in Verzweiflung über die Leiche ihrer Mutter geworfen … Und viel später, auf der Jagd, als ihr scheuendes Pferd dem Mühlstrom zugerast … Und dann auf ihrem ersten Ball, als sie, von übermütiger Fröhlichkeit ergriffen, so laut gelacht, so toll getanzt, immer hatte sein eindringliches: «Nur ruhig!» sie zur Besinnung gebracht.
Auch in diesem Augenblick erinnerte sie sich der väterlichen Mahnung nicht umsonst und vermochte ihren abgebrochenen Reden mit einem Scheine von Gelassenheit hinzuzufügen: «Sie irren – ich bin entschlossen.»
«Wozu? … Nein?»
«Ja.»





























