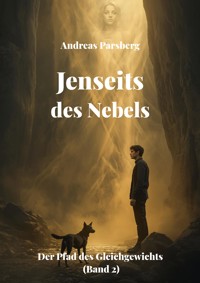4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Pfad des Gleichgewichts
- Sprache: Deutsch
Karim weiß, dass es Wege gibt, die tiefer führen als die Unterwelt. Und dass nicht jeder Abstieg mit einer Rückkehr endet. Als sich die Spuren eines uralten Konflikts verdichten, wird Karim erneut gezwungen, den Pfad des Gleichgewichts zu betreten, diesmal ohne Schutz, ohne Gewissheit und ohne die Illusion, unversehrt daraus hervorzugehen. Was als Suche beginnt, wird zu einem Abstieg unter Mauern, Gesetze und Moral, in Zonen, in denen Dämonen herrschen, Rituale Leben kosten und jede Entscheidung Narben hinterlässt. Während Karim einem Feind gegenübersteht, der nicht nur Körper, sondern Willen bricht, gerät Selma in die Gewalt jener Mächte, die das Gleichgewicht längst als Werkzeug missbrauchen. Gefangenschaft, Folter und Verlust reißen Wunden, die sich nicht schließen lassen, und zwingen Karim zu einem Schwur, dessen Preis weit über Rache hinausgeht. Zwischen brennenden Burgen, unterirdischen Fluchtwegen und der gnadenlosen Ordnung dämonischer Herrscher wird klar: Das Gleichgewicht ist kein Zustand. Es ist eine Last. Und manchmal verlangt es mehr als Mut. Es verlangt, dass man bleibt, wo andere zerbrechen. Band 4 führt die mythische Fantasy-Saga konsequent weiter – düsterer, persönlicher und unnachgiebiger als zuvor. Ein Roman über Schuld und Verantwortung, über Opfer, die nicht rückgängig zu machen sind, und über den Moment, in dem ein Mensch erkennt, dass der wahre Kampf erst beginnt, wenn es keinen sicheren Boden mehr gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Andreas Parsberg
Unter der schwarzen Erde
Der Pfad des Gleichgewichts (Band 4)
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Impressum neobooks
1
Dutzende winziger Zwerge tobten unter ihrer Schädeldecke und malträtierten sie mit ebenso kleinen Hämmern, als hätten sie dort drinnen einen Takt gefunden, der nur aus Schmerz bestand. Jeder Schlag pochte bis hinter die Augen, zog Linien aus heißem Druck durch Stirn und Schläfen und ließ die Welt in kurzen, üblen Wellen schwimmen. Eine Stimme drang wie aus unendlicher Ferne an ihre Ohren, dazwischen Rauschen, Lücken, ein dumpfer Klangteppich, auf dem keine Silbe Halt fand. Irgendetwas tätschelte unablässig ihre Wangen, nicht grob, eher hartnäckig, als wolle jemand sie wachreiben, ohne sich die Mühe zu machen, sanft zu sein. Als das Gefühl allzu lästig wurde, schlug sie benommen die Augen auf.
Ihr unsteter Blick irrte durch diffuses Zwielicht, das keine klare Form zuließ. Die Konturen lagen nicht still, sie schienen zu flimmern, als wäre die Luft selbst unsicher. Überall nisteten Schatten, schwer und dicht, als hätten sie sich in Ecken und Fugen gesetzt, und in jedem dieser dunklen Nester hätte sich jemand verborgen halten können. Geisterhaftes Flüstern wehte ihr aus dem Dunkeln entgegen, mal nur ein Hauch, mal so deutlich, dass Selma im nächsten Moment wieder daran zweifelte, ob es wirklich da gewesen war oder nur ihr schmerzender Kopf, der Geräusche erfand.
Langsam konnte sie ihre Umgebung betrachten. Sie lag in einem unbekannten Zimmer, das an eine alte Hütte in den Bergen erinnerte, an diese gedrungenen, wettergegerbten Unterstände, die man eher fühlt als sieht. Die Decke und die Wände bestanden aus altertümlich wirkendem Holz, dunkel, rau, mit breiten Bohlen, die an manchen Stellen schief saßen, als hätten sie sich im Laufe vieler Jahre verschoben. Die Maserungen zeichneten sich im Zwielicht wie dunkle Adern ab. Alles wirkte schlicht, abgenutzt, funktional, und gleichzeitig so fremd, dass ihr Magen sich zusammenzog.
Selma biss sich in die Lippe. Der kurze, scharfe Schmerz bewies ihr, dass sie keineswegs träumte, dass dies keine flüchtige Szene war, die sich gleich in Nebel auflösen würde. Sie schluckte trocken. Ihr Mund fühlte sich an, als hätte sie Sand darin, und ihre Zunge klebte am Gaumen. Sie ließ den Blick durch das merkwürdige Zimmer schweifen, nahm jede Ecke wie eine Frage wahr, die sie noch nicht beantworten konnte.
Dort neben der Tür, am Rand des Dunkels, war da nicht eine Bewegung zu sehen gewesen? Nur ein winziges Verrutschen, ein Schatten, der nicht dahin gehörte. Stand da nicht eine Gestalt?
Selma hielt den Atem an, blinzelte, zwang ihre Augen zur Ruhe. Dann trat die Gestalt einen Schritt vor und löste sich aus der Dunkelheit, als hätte sie sich dort die ganze Zeit verborgen gehalten. Vom diffusen Licht umschmeichelt, stand der Unbekannte nur wenige Schritte von ihrem Bett entfernt, reglos, auf eine Art reglos, die nicht beruhigte, sondern warnte.
Und dann erkannte Selma den Mann wieder. Es lag an dem Kinnbart, der das Gesicht kantiger machte, und an den eingefallenen Wangen, die ihm etwas Strenges, Abweisendes gaben. Es war der Sechzigjährige, der sie am Vortag von dem Teich verjagt hatte. Das Wiedererkennen traf sie wie ein kurzer Schlag in den Magen.
„Wenn Sie sich wieder besser fühlen“, sagte der Fremde mit einer rasselnden Stimme, die klang, als würde sie aus rauem Stein kommen, „dann kommen Sie in die Kapelle. Ich muss Ihnen etwas zeigen und werde auf Sie warten.“
Mehr nicht. Kein weiteres Wort, kein Ansatz einer Erklärung, kein Blick, der um Erlaubnis bat. Als sie sich im Bett aufrichtete, drehte sich der Mann auch schon um und verließ mit gespenstischer Lautlosigkeit die Holzhütte. Keine hastigen Schritte, kein Zögern, nur dieses leise Verschwinden, als sei er nie da gewesen.
Selma saß wie gelähmt in ihrem Bett. Das Hämmern ihres Herzens musste im ganzen Haus zu hören sein, so laut kam es ihr vor, als schlüge es gegen die Wände. Tief gruben sich ihre Fingernägel in die Handballen. Der Schmerz war klein, aber er brachte sie halbwegs zur Besinnung, gab ihr etwas Greifbares in einer Situation, die sich anfühlte wie ein falscher Film.
Sie wollte rufen, etwas sagen, irgendeinen Satz, der die Kontrolle zurückholte. Aber es blieb beim Versuch, bei Luft, die ohne Stimme aus ihr herausströmte. Erst im zweiten Anlauf schaffte sie es, einen leisen Ruf hervorzubringen, der sofort vom Holz verschluckt wurde, als sei selbst die Hütte nicht bereit, ihn weiterzutragen. Es verstrichen noch etliche Sekunden, bis sie sich aufraffen konnte, das Bett zu verlassen. Ihre Beine fühlten sich schwer an, als hätten sie vergessen, dass sie ihr gehörten.
Sie zitterte leicht vor Kälte. Ihr Mund war trocken, der Körper klebrig vom kalten Schweiß, und in ihren Ohren schmerzte das Rauschen ihres Blutes wie ein zu lautes Meer. Jeder Atemzug stieß an einen inneren Widerstand, als müsse sie sich das Wachen erst wieder erarbeiten.
Die Luft im Raum kam ihr stickig und heiß vor, als hätte das Holz die Wärme festgehalten und nie wieder hergegeben. Daher beschloss sie, ein Fenster zu öffnen. Sie bewegte sich vorsichtig, als sei jeder Schritt eine Probe, und erreichte schließlich das Fenster. Der Riegel gab nach. Als sie öffnete, strömte frische Luft herein, kühl und feucht. Sie schlug ihr ins Gesicht, und mit dieser Luft kam neue Energie in ihren Körper, ein kleines, aber spürbares Aufrichten. Der Kopf blieb schwer, doch sie fühlte sich besser, einen Hauch klarer.
Plötzlich zuckte sie zusammen.
Sie erkannte den Fremden, der hinter einem Busch hervortrat und nach rechts schritt. Nur ein Moment, eine Silhouette zwischen Zweigen, aber eindeutig genug, um ihr die Richtung zu zeigen, bevor er wieder aus dem Blickfeld war.
Tausend Fragen rasten durch Selmas Geist. Und sie war nicht in der Lage, auch nur eine einzige davon zu beantworten. Aber drei rückten beständig in den Vordergrund.
Wo war Labolas?
Was war geschehen?
Wer hatte sie versorgt und hierhergebracht?
Es musste einfach etwas geschehen! Selma war fest entschlossen, die Sache in die Hand zu nehmen, und verließ die Blockhütte. Vorsichtig schlich sie zu den Büschen, bei denen sie den Fremden zuletzt gesehen hatte. Der Boden unter ihren Schritten fühlte sich uneben an, und das Zwielicht machte jeden Umriss zweideutig.
Im düsteren Licht fand sie einen schmalen Weg, der in den Wald zu führen schien. Sie folgte dem Pfad, bis sich dieser zu einer kleinen Lichtung verbreiterte. Dort erkannte sie ein kleines hölzernes Gebäude, das annähernd einer Kapelle ähnelte. Es stand still und dunkel da, als hätte es sich zwischen die Bäume geklemmt, um nicht gesehen zu werden.
Wie in Trance betrat sie die Lichtung. Jetzt gab es kein Zurück mehr, sie würde Nägel mit Köpfen machen. Sie wollte wissen, woran sie war, wollte den Nebel aus ihrem Kopf schlagen, indem sie der Realität ins Gesicht sah.
Der kleinen Kapelle war eine schmale Veranda vorgelagert. Selma betrat sie. Das Holz ächzte unter ihrem Gewicht, und dieses Ächzen klang in der Stille viel zu laut, als hätte sie damit etwas geweckt.
„Hallo? Wo sind Sie?“, rief sie, bemüht, ihrer Stimme einen festen Klang zu verleihen.
Nichts rührte sich. Mit angehaltenem Atem näherte sich Selma der niedrigen Eingangstür. Sie legte ihre Hand auf die rostige Klinke, spürte die raue Kälte des Metalls, drückte sie nach unten. Die Tür war nicht verschlossen. Selma öffnete sie zögernd und trat ein.
In dem Raum war es finster, nicht eine einzige Kerze oder Lampe brannte. Die Dunkelheit lag wie ein Tuch über allem. Vorn vor dem Altar stand auf einem flachen Podest ein Sarg. Er war verschlossen. Offenbar bereitete der Totengräber ein neues Begräbnis vor. Der Anblick traf Selma unerwartet, als wäre der Tod hier nicht nur ein Gedanke, sondern ein Möbelstück.
Selma blickte sich um.
„Hallo?“, rief sie leise. Ihre Stimme klang wie ein Pistolenschuss durch die Stille.
Dann hörte sie das Geräusch der schlurfenden Schritte. Eine Tür in der Nische neben dem Altar öffnete sich quietschend, langsam, als wolle sie den Klang auskosten. Der Alte mit dem Kinnbart tauchte im Türrahmen auf.
„Ah, Sie haben sich aber schnell erholt“, sagte er leise. Seine Stimme klang belegt. Er nahm die qualmende Zigarre aus dem Mund und kam näher, ohne Eile, als wäre alles hier selbstverständlich.
„Wer sind Sie?“, fragte Selma mit einem unangenehmen Gefühl im Bauch, das sich festsetzte und nicht weichen wollte.
„Ich bin Alkéos Tsirgiotis, der Pastor von Nea Pendeli.“
Er reichte Selma die mit pergamentartiger, faltiger Haut überzogene rechte Hand, und das Licht schlug sich matt auf den Adern und Flecken, die das Alter hinterlassen hatte.
„Ein Pastor?“
„Sie sind kein Mitglied der Katholischen Kirche, oder?“
„Nein.“
„Nobody is perfect.“
„Wie?“
„Egal. Ich muss Ihnen etwas zeigen.“
„Mal langsam! Zuerst erklären Sie mir, wie ich hierhergekommen bin!“
„Sie wurden am Waldrand niedergeschlagen.“
„Von Ihnen?“
„Nein!“, antwortete der Pastor. „Ich habe es aus der Ferne beobachtet. Es war eine Frau!“
„Eine Frau?“
„Ja. Ich habe laut gerufen und bin zu Ihnen geeilt. Als ich Sie erreichte, war die Frau verschwunden und Sie lagen bewusstlos auf dem Boden.“
„Und weiter?“
„Ich habe Sie in mein Haus getragen und bin, während Sie bewusstlos waren, auf den Friedhof gegangen. Und da habe ich es entdeckt.“
„Was?“
„Das will ich Ihnen zeigen, kommen Sie mit.“
Sie verließen die Kapelle. Der Pastor wandte sich nach links. Wortlos ging er zu einem hinter einer dichten Buschgruppe stehenden Schuppen, in dem Schaufel, Rechen und anderes Werkzeug aufbewahrt wurden. Die Lattentür war nur eingehängt, nicht abgeschlossen.
Selma stand schräg hinter dem Pastor, beobachtete jede seiner Bewegungen, während er einen angerosteten Schubkarren aus der hintersten Ecke holte, zwei Schaufeln in den Karren warf und dann wieder hervorkam. An der Bretterwand hing außer Rechen und mehreren sauber geputzten Gießkannen auch eine Sichel. Das Metall schimmerte stumpf im schwachen Licht, und Selma spürte, wie sich etwas in ihr zusammenzog, ohne dass sie sagen konnte, warum.
„Was haben Sie vor?“, wollte die verblüffte Selma wissen.
„Ich habe nachgedacht.“
„Über was?“
„Über die Frau, die Sie am Waldrand niedergeschlagen hat. Ich kannte die Frau, konnte mich aber nicht erinnern. Dann habe ich sie am Friedhof wiedererkannt.“
„Die Unbekannte ist auf den Friedhof geflüchtet?“
„Fast, ja. Ich habe die Frau vor einigen Monaten beerdigt. Am Grabstein hängt ein Bild der Toten, darauf habe ich sie wiedererkannt. Kommen Sie.“
Der Pastor ließ die Tür des Schuppens offen, als er mit Selma auf den Friedhof ging. Die ausgewählte Grabstätte befand sich etwa zehn Meter von der Friedhofsmauer entfernt.
„Das Grab ist unberührt, aber es war eindeutig die Frau, die auf dem Bild zu sehen ist.“
Der Pastor zeigte auf eine gerahmte Fotografie, die am Grabstein befestigt worden war.
„Kennen Sie diese Frau?“
„Nein. Aber wie kann eine Tote mich niederschlagen?“
„Gute Frage“, antwortete der Pastor. „Genau das werden wir herausfinden.“
Der Mann verstand es, mit der Schaufel umzugehen. Stolz erklärte er, während er den feuchten, schweren Boden aufgrub, dass sechzig Prozent aller Gräber auf diesem Friedhof von ihm ausgehoben worden waren. Die Erde klebte an der Schaufel, fiel in dumpfen Klumpen zur Seite, und jeder Stich ließ den Geruch von Nässe und Verfall aufsteigen.
Selma war von den vergangenen Ereignissen noch überfordert. Sie stand da, sah zu, hörte den Pastor reden und überlegte, wie es kam, dass sie auf einem Friedhof stand, als wäre das ein Satz, den man nicht mehr rückgängig machen konnte. Außer der Stimme des Kirchenmannes, die hin und wieder einmal aufklang, außer den Geräuschen, die die grabende Schaufel verursachte, war es völlig still.
Einmal wandte Selma sich um, weil es ihr so vorkam, als hätte sie Schritte gehört.
„War das eben nichts gewesen, Pastor?“
Sie ließ den Blick schweifen. Es war schon dämmrig, und sie nahm die abseitsstehenden Bäume und Buschreihen, die schwarzen Grabsteine nur wie eine einzige Mauer wahr, eine dunkle Kulisse ohne Tiefe.
„Unsinn. Um diese Uhrzeit kommt niemand auf den Friedhof.“
Der Pastor grub weiter. Er kam verhältnismäßig schnell voran. Er gönnte sich kaum eine Verschnaufpause. Dann schimmerte der dunkle, von der Feuchtigkeit und von der Flora der Erde schon angegriffene Holzsarg durch die Erde.
„Gleich werden wir sehen, ob ich mit meiner Vermutung recht habe.“
„Sie haben eine Vermutung, Pastor?“
„Ja, leider ist das nicht der erste Fall.“
„Was meinen Sie damit?“
„Ich werde es Ihnen in Ruhe erzählen, aber zuerst möchte ich eine Bestätigung meiner Ahnung bekommen.“
Der Pastor stieg vorsichtig in die Grube hinab. Mit der Schaufel legte er den Sargdeckel frei. Dann schob er die Kante der Schaufel unter den Deckel und schob ihn knarrend nach oben.
Selmas Gesicht zeigte die innere Anspannung, unter der sie stand.
Der Deckel rutschte zur Seite. Selma starrte in den geöffneten Sarg und erblickte die bereits in Verwesung übergegangene Leiche. Von der toten Frau war nicht mehr viel zu erkennen. Ein kalter Schauer rieselte ihr über den Rücken, als sie daran dachte, dass der Pastor behauptet hatte, die tote Frau erst vor Kurzem gesehen zu haben.
Der Pastor war in diesen Sekunden offensichtlich genauso benommen wie sie selbst.
„Das ist nicht möglich“, hauchte er und starrte auf die angeschimmelte Leiche. „Ich habe sie selbst eingesargt. Die Frau wurde mit ihrem Kopf beerdigt. Diese Leiche aber ... hat keinen ...“
Ernst und verschlossen stieg Selma in die Grube hinab. Sie kam auf Höhe des Pastors zu stehen und beugte sich nach vorn, als suche sie etwas Bestimmtes in dem Sarg.
Diese Bewegung rettete ihr das Leben!
Etwas zischte durch die Luft. Es hörte sich an, als würde ein Landwirt eine Sichel führen.
Sichel? Die Assoziation in Selmas Gehirn und ihre Reaktion waren eins.
Sie warf sich nach vorn und sprang über den Sarg hinweg.
Den Pastor erwischte es.
Die Sichel trennte seinen Kopf vom Rumpf ab. Sekundenlang stand der Pastor ohne Kopf auf der gleichen Stelle. Dann stürzte sein Körper dumpf nach vorn und legte sich quer über den angeschimmelten Sarg. Sein Kopf rollte über den Sand und blieb am oberen Sargende in einer Erdmulde liegen.
Sekundenlang war Selma wie gelähmt.
Ihre Sinne begriffen das Ungeheuerliche, das unerwartet über sie hereingebrochen war.
Sie drehte sich blitzschnell auf die Seite, um ihrem geheimnisvollen Gegner nicht mehr den Rücken zu bieten.
Sie sah die schattengleiche Gestalt in der Grube, die Sichel schwingend, die offensichtlich aus dem Schuppen hinter der Andachtskapelle stammte. Auf den ersten Blick war nicht zu erkennen, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelte. Der schlanke Körper und die eindeutig vorhandene weibliche Oberweite zeugten von einer Frau, die Augen und Gesichtszüge sahen eindeutig männlich aus.
Jedenfalls war es das hässlichste menschliche Wesen, das Selma je zu Gesicht bekommen hatte.
Es trug einen dunklen, an mehreren Seiten aufgeschlitzten Umhang. Die nackten Arme waren bis zu den Handrücken dicht behaart, und Selma glaubte in diesem Augenblick des Entsetzens und der Furcht zu erkennen, dass die Hände ungleich waren, die Finger der rechten Hand waren dicker, kräftiger und dichter behaart als die der linken.
Der Schädel der Fremden war kahl, das harte, mit zahlreichen Warzen bedeckte Gesicht hässlich und verzerrt.
Selma versuchte, auf die Beine zu kommen, und wollte der Mörderin mit der Sichel keine Gelegenheit geben, auch ihr den Garaus zu machen. Mit fiebernden Fingern suchte sie nach ihrer Pistole, bis sie erkannte, dass sie diese nicht einstecken hatte.
Wie ein Blitz stieß die messerscharfe Sichel neben ihr herab und verfehlte sie im Augenblick des Hochkommens nur um Haaresbreite.
Selma, deren Sinne und Reaktionen in tausend Gefahren des Bürgerkrieges geschult und geschärft waren, behielt auch in dieser Sekunde eiskaltes Blut.
Sie handelte instinktiv und von dem Antrieb beseelt, ihr eigenes Leben zu erhalten.
Noch ehe die unheimliche Gegnerin dazu kam, die Sichel aus dem weichen, feuchten Boden herauszuziehen und zu einem weiteren Schlag auszuholen, griff Selma nach dem glatten, grauen Stiel. Sie packte gerade zu, als die Unheimliche mit dem kahlen Schädel und dem entstellten Gesicht die Sichel hochriss.
Selma nutzte den Schwung der anderen voll aus. Sie wirbelte die Unheimliche förmlich herum. Die Frau kam auf dem Boden ins Rutschen, verlor den Halt und ließ in ihrer Überraschung das obere Stielende los.
Selma ergriff sofort ihre Chance. Es kam ihr darauf an, die Gegnerin festzunageln und herauszufinden, woher diese kam und was sie von ihr wollte.
Selma drehte den Stiel der Sichel blitzschnell herum. Es lag nicht in der Absicht von ihr, die fremde Frau zu töten oder zu verletzten. Sie wollte die Angreiferin lediglich kampfunfähig machen. Doch das merkwürdige weibliche Wesen erkannte die Situation. Es war eine Sekunde schneller, als Selma gehofft hatte. Die Frau kam auf die Beine. Dabei löste sich der breite Gürtel, den die Fremde um das dunkle Gewand geschlungen hatte. Ein breiter Spalt entstand, und die helle, nackte Haut kam zum Vorschein.
Selma musste schlucken. Der große Busen, der unter dem schmuddeligen Hemd durchschimmerte, bewies nochmals, dass ihre Gegnerin eine Frau war.
Die Wendigkeit, mit der die unheimliche Frau auf die Beine kam, überraschte Selma. Auf allen vieren kroch sie die Grube hoch und schien plötzlich jegliches Interesse an einer weiteren Auseinandersetzung verloren zu haben.
Die Fremde eilte in der Dämmerung davon. Selma sah sie zwischen den schmalen Wegen hinter aufragenden Grabsteinen verschwinden.
Sie nahm die Verfolgung auf. Es setzte sie in Erstaunen, dass die verhältnismäßig grobschlächtige Frau sich so schnell bewegen konnte. Selma holte nur langsam auf.
Die Fremde erreichte das Friedhofstor. Für zehn Sekunden verlor Selma die Frau aus den Augen, dann hörte sie, wie hinter der Friedhofsmauer ein Motor ansprang.
Selma erreichte das Tor und sah gerade noch den dunkelblauen Wagen davonfahren. Sie blickte sich hektisch um. Nur wenige Meter entfernt, stand ein alter gelber Kleinwagen.
Sie rannte zum parkenden Auto und versuchte, die Tür zu öffnen. Natürlich war der Wagen abgeschlossen. Selma bückte sich, ergriff einen Stein und schlug das Fenster ein. Sie öffnete die Tür und hatte in wenigen Sekunden das Auto kurzgeschlossen. Dankbar erinnerte sie sich an die Zeit, als sie mit dem älteren Bruder in Syrien diese Technik erlernt hatte.
Sie legte den Rückwärtsgang ein und wendete den gelben Kleinwagen. Mit fiebernden Blicken sah sie den dunklen Wagen in der Ferne zwischen den hügelansteigenden Feldern und Äckern verschwinden, ein schwarzer Schemen, der mit den tiefhängenden Regenwolken eins zu werden schien.
Selma beschleunigte und raste los. Die Straße war leer. Von dem dunklen Gefährt war weit und breit nichts mehr zu sehen. Doch es konnte nur in diese Richtung gefahren sein.
Drei Minuten später sah sie vor sich die verwaschenen Umrisse des dunklen Wagens. Selma holte langsam, aber beständig auf. Sie schob sich immer näher heran. Die unheimliche Frau vor ihr fuhr ohne Scheinwerfer.
An der nächsten Abzweigung bog der Wagen nach rechts ab. Selma folgte und las im Vorbeifahren, dass dieser Weg zum Nationalpark führte. Die Straße war nicht befestigt und mehr ein breiter, sandiger Pfad, auf dem die Bauern mit ihren Fuhrwerken und Traktoren fuhren, um die abgelegenen Wiesen und Felder zu erreichen.
Sie passierte ein einsames Bauernhaus, klein und halb zerfallen, das schon lange Zeit nicht mehr bewohnt war.
Der Weg wurde schmaler. Selma konnte nur noch im Schritttempo fahren. Mehr als einmal verlor sie den dunklen Wagen, den sie verfolgte, aus den Augen. Doch dann sah sie ihn wieder zwischen einem Acker hinter einer weit ausgedehnten Wiese auftauchen. Doch ehe sie die Wegbiegung geschafft hatte, war der dunkle Wagen verschwunden.
Selma konnte nur noch der deutlich erkennbaren Reifenspur folgen. Doch dann brach diese Spur abrupt ab. Sie bog nach links und führte genau über ein brachliegendes Feld.
Selma hielt an und blickte sich nach allen Seiten um. Dann fuhr sie langsam über das Feld. Es stieg sanft an. Immer wieder warf sie einen Blick umher. Es gab hier zahlreiche Baum- und Buschgruppen, die so dicht beisammenstanden, dass man in dieser Dämmerung ohne Schwierigkeiten einen dort abgestellten Wagen übersehen konnte.
Doch es gab keinen Hinweis, dass die unheimliche Frau sich in der Nähe aufhielt und nur darauf wartete, dass Selma an ihr vorbeifuhr.
Dann erreichte sie eine Weggabelung. Zwei schmale Pfade führten in den düsteren Wald. Auf keinem Weg zeigte sich auch nur die geringste Autospur.
Sie hielt an und schaltete den Motor aus. Die Scheinwerfer erloschen. War es der geheimnisvollen Fremden tatsächlich gelungen, sie abzuhängen?
Selma stieg aus. Sie wollte nicht aufgeben. Es gab hier nicht viele Chancen, einfach ungesehen zu verschwinden. Erneut ärgerte sich Selma, dass sie ihre Pistole nicht dabeihatte. Dann überlegte sie, ob die Waffe überhaupt bei der unheimlichen Fremden eine Wirkung erzielen würde.
Aber sie brauchte etwas. Also bückte sie sich und ergriff einen armstarken Knüppel, den sie neben einer Baumwurzel fand. Langsam entfernte sie sich Schritt für Schritt von dem gelben Kleinwagen. Sie stieg den sanft ansteigenden Hügel hinauf. Ein schmaler Weg führte hier oben von einem Pfad ab, der genau in den Wald lief.
Sie wollte schon diesen Pfad gehen, als sie etwas wahrnahm, was sie zusammenzucken ließ.
Etwa fünfhundert Meter von ihr entfernt auf einem Hügel, der jedoch tiefer lag als der, auf dem sie stand, entdeckte sie das abgelegene, stille und finstere Haus. Es war in der Dunkelheit zwischen den massigen Bäumen kaum zu erkennen.
Selma schluckte.
Sie ging den Weg nach unten und musste dann wieder aufwärts gehen, um sich dem Haus zu nähern. Nichts wies darauf hin, dass hier jemand wohnte, obwohl das Haus sicher noch bewohnbar war. Auf den ersten Blick jedenfalls erweckte es diesen Eindruck.
Selma näherte sich dem Haus von der Seite. Das große, schwere Holztor war weit geöffnet. Sie warf einen Blick in den Schuppen und ihr Herz blieb fast stehen. Der dunkle Wagen! Dort stand er. In der Eile hatte die unheimliche Frau nicht mehr die Zeit gefunden, die Schuppentür zu verriegeln.
Selma hielt sich dicht an die Schuppenwand gepresst, als sie sich jetzt dem Vordereingang des Hauses näherte. Sie war auf der richtigen Spur und durfte sich jetzt keinen Fehler mehr erlauben.
Ihr Blick wanderte die raue, düstere Hauswand hoch. Nicht ein Fenster war zu sehen. Alle waren mit Läden verschlossen. Und einige hatte man sogar vernagelt. Sie tastete nach dem eisernen, vom Regen feuchten Geländer, das die schmale, ausgetretene Steintreppe flankierte. Kurz darauf stand sie vor der Haustür. Es gab keine Klingel und von dem ehemaligen Klopfer waren nur noch die dicken Messingschrauben vorhanden.
Selma drückte die eiserne Türklinke herunter. Ihre Muskeln und Sehnen spannten sich, als sie erkannte, dass die Tür nicht verschlossen war. Ihr durch den Bürgerkrieg ausgeprägtes Misstrauen erwachte. Doch zwei Sekunden später war sie bereit zu glauben, dass ein Verdacht unbegründet war. Sie untersuchte Schloss und Riegel genau und stellte fest, dass die Tür in der Tat nicht mehr abzuschließen war. Das Schloss war völlig durchgerostet.
Sie stieß die Tür zunächst nur spaltbreit auf, konnte dabei nicht verhindern, dass die Scharniere laut quietschten. Staub und feiner Sand fielen auf sie herab. In der linken oberen Türecke entdeckte sie ein großes Spinnennetz. Offenbar war dieser Eingang schon lange nicht mehr benutzt worden. Diente dieses alte, baufällige Haus der geheimnisvollen Frau etwa als Unterschlupf?
Sie stieß die Tür vollends auf. Mit aufmerksamen Augen starrte sie in den finsteren, sehr langen Korridor, sah die Umrisse eines wuchtigen, alten Schrankes und eines mannshohen Keramikkerzenständers unmittelbar neben dem Treppenaufgang, der nach oben führte.
Selma ging vorsichtig. Sie achtete auf jeden Winkel, auf jeden Schatten und ließ die Tür weit offenstehen. Keine drei Schritte von ihr entfernt, befand sich eine geschlossene Türe. Sie hielt den Knüppel schlagbereit und drückte die Klinke herab. In der Düsternis sah sie die Umrisse eines Zimmers mit einem breiten Bett, einem Schrank und einem Nachttisch. Unter dem verhangenen Fenster stand ein altmodischer Tisch, dem ein Bein fehlte. Davor stand ein klappriger und verschlissener Polsterstuhl.
Selma ging zwei Schritte hinein, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass unmöglich jemand hinter der Tür stehen konnte. Sie wollte nichts unbesehen lassen.
Es ging alles blitzschnell!
Wie mit einem Pistolenknall schlug die Tür hinter ihr zu, noch ehe sie begriff, wie es eigentlich dazu kommen konnte.
Selma riss und zerrte vergeblich an der Klinke. Die schwere Holztür saß wie angegossen. Dem ersten Schreck folgte logisches Überlegen.
Es war stockfinster in dem Raum, ein Lichtschalter war offensichtlich nicht vorhanden. Sie tastete sich von der Tür ab an der Wand entlang. Schließlich waren Fenster in diesem Zimmer. Sie brauchte nur die Fensterläden aufzustoßen.
Sie wanderte rundum, tastete sich um das Bett, erreichte den Schrank, ging von hier aus die Wand entlang und kam wieder an der Tür an. Dann begriff sie das Ungeheuerliche.
Die Fenster waren zugemauert!
Da fühlte sie, wie eiskalte Angst ihren Nacken emporkroch.
2
„Aber wie konnte das möglich sein?“, fragte Karim und starrte den Kommissar voller Entsetzen an.
„Das ist gegen die Natur!“
„Sind Sie sicher, dass die Verletzungen von Nikiforos so schwer waren?“
Laskari sah ihn an, als wäre diese Frage eine Beleidigung für seinen Verstand. Sein Gesicht war noch immer von der Anspannung der letzten Stunden gezeichnet, und doch lag in seinem Blick etwas Hartnäckiges, etwas Stures, das Karim inzwischen kannte: Wenn Laskari einmal an einer Spur festhielt, dann musste man ihn eher brechen als umstimmen.
„Er hätte unmöglich das Krankenhaus verlassen können“, antwortete Laskari. „Der Arzt teilte mir mit, dass Nikiforos bewusstlos auf der Intensivstation gelegen hatte, als er ihn zuletzt sah.“
Karim schluckte, und es fühlte sich an, als würde der trockene Kloß in seinem Hals an einer Kante hängen bleiben. In seinem Kopf versuchten sich Logik und Angst gegenseitig zu verdrängen, doch keine von beiden gewann.
„Aber wie konnte er dann heimlich flüchten?“
Laskari hob die Schultern, eine kleine, wütende Bewegung, als würde ihm schon diese Tatsache die Nerven zerschneiden.
„Das verstehe ich auch nicht. Nun haben wir ein weiteres ungelöstes Problem. Wir müssen das Schwert und Nikiforos suchen.“
„Und wo beginnen wir mit unser Suche?“, erkundigte sich Karim und blickte den Kommissar neugierig an, obwohl es in ihm eher brannte als neugierig war.
„Wir müssen warten. Ich habe eine Menge Spione in der Stadt. Ein flüchtender Schwerverletzter in einem Krankenhausnachthemd sollte auffallen, selbst in Athen.“
Karim verzog das Gesicht. Warten. Dieses Wort schmeckte nach Stillstand, nach Ohnmacht, nach dem Gefühl, dass andere die Zeit bestimmten.
„Warten ist aber nicht meine Stärke.“
Laskari schnaubte, als hätte er genau diese Antwort erwartet, und für einen Moment blitzte etwas wie schiefes Amüsement durch seine Strenge.
„Kommen Sie, ich lade Sie zu einem Cappuccino ein“, sagte Laskari.
Sie steuerten das kleine Café an, das auf der anderen Straßenseite lag. Es war eines dieser unscheinbaren Lokale, wie sie in Athen zwischen grauen Fassaden und müden Schaufenstern überleben: ein paar Tische, ein paar Stühle, eine Glasfront, dahinter das gedämpfte Licht und der Geruch nach Kaffee, der sich wie ein Versprechen anfühlte, obwohl er nichts lösen konnte.
Aber sie kamen nicht mehr dazu, irgendetwas zu bestellen. Ein Polizist erschien unter der Tür, gerade, als sie Platz nehmen wollten. Laskari winkte den Mann heran, kurz, scharf, ohne Höflichkeit.
„Was gibt´s?“
Der Polizist trat näher, sichtlich außer Atem, als hätte er den ganzen Weg hergerannt, und sprach so schnell, dass die Worte förmlich übereinander stolperten.
„Ein Anruf ist in der Zentrale eingegangen. Ein entsetzter Nachbar hat gemeldet, dass ein Mann in einem Nachthemd mit einem Schwert aus einem Haus gestürmt war.“
Laskari sprang auf, als hätte ihn jemand an einer Schnur hochgezogen. Der Stuhl scharrte hart über den Boden.
„Welche Adresse?“
Der Polizist gab entsprechend Auskunft. Der Kommissar nickte einmal, knapp, und in diesem Nicken lag alles: Entscheidung, Richtung, keine Diskussion.
„Das ist doch ganz in der Nähe. Also, worauf warten wir noch.“
Sie eilten aus dem Café und sprangen in einen wartenden Streifenwagen. Der Fahrer drehte sich halb um, die Hand schon an den Schaltern.
„Wir sind in drei oder vier Minuten da“, sagte der Fahrer. „Soll ich die Sirene einschalten?“
„Unterstehen Sie sich!“, schnauzte Laskari. „Ich möchte Nikiforos nicht noch im letzten Augenblick warnen und verlieren.“
Der Wagen setzte sich in Bewegung, und Karim spürte, wie sich die Stadt um ihn herum verwandelte: eben noch Alltag, nun plötzlich Jagdgebiet. Laskari rutschte unruhig auf seinem Sitz hin und her, als könne er die Zeit durch reine Ungeduld schneller machen.
Kurz darauf erreichten sie die angegebene Adresse. Die Hausnummer, die der anonyme Anrufer genannt hatte, lag nur noch hundert Meter vor ihnen.
Aber zwischen dem Polizeiwagen und dem Gebäude schienen Hunderte von Menschen die Straße zu blockieren. Ein dichter, aufgeregter Pulk, Köpfe dicht an Köpfen, Stimmen, die sich überschlugen, Hände, die gestikulierten. Laskari ließ den Fahrer anhalten, sprang mit einem Satz aus dem Wagen und eilte auf die Menschenmenge zu.
Es war gar nicht so leicht, sich einen Weg durch die dichtstehenden Passanten zu bahnen. Die Luft war voller Atem, Parfum, Schweiß, neugieriger Erregung. Menschen standen auf Zehenspitzen, drängten, schoben, wollten sehen, wollten wissen, wollten erzählen.
Laskari machte rücksichtslos von seinen Ellbogen und Knien Gebrauch. Er schob sich durch die Menge, als wäre jeder Körper nur ein Hindernis, das man beiseite drückt. Sie zogen eine Kette von Verwünschungen und Flüchen hinter sich her, und Karim bekam mehr als einen Rippenstoß als Antwort auf die Grobheiten des Kommissars. Aber er ignorierte die wütenden Blicke und Äußerungen. Dort vorne war irgendetwas passiert. Und dieses Irgendetwas zog ihn wie ein Magnet.
Karims schlimmste Befürchtungen schienen noch übertroffen zu werden, als sich die Menge endlich vor ihnen teilte. Ein kurzer Blick genügte vollauf, um ihm zu zeigen, was passiert war.