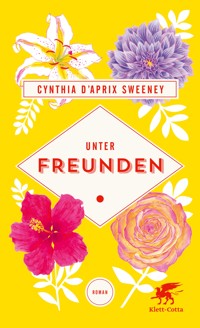
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Perfekte Paare, glückliche Familien, dramatische Rollen und schöne Orte. Und dann kommt Cynthia D'Aprix Sweeney und kratzt mit leichter Hand und scharfem Blick an den heilen Fassaden. Ein großes Lesevergnügen!« Dora Heldt Flora Mancini ist seit über zwanzig Jahren glücklich verheiratet. Doch alles, was sie über sich selbst, ihre Ehe und ihre beste Freundin Margot zu wissen glaubt, wird auf den Kopf gestellt, als sie den lange verlorenen Ehering ihres Mannes wohlverwahrt in der eigenen Garage findet. Zufall? Unwahrscheinlich. Ein hinreißend humorvoller und warmherziger Roman über ein lang gehütetes Geheimnis, das Freundschaften und Beziehungen durcheinanderwirbelt. Flora und Julian hatten es nicht immer leicht. In New York mussten die Schauspieler ihr mühsam verdientes Geld zusammenkratzen, um ihre kleine Familie und Julians Theaterensemble über Wasser zu halten. Als in der glitzernden Filmwelt von Los Angeles sichere Jobs und die Wiedervereinigung mit Floras bester Freundin Margot winken, greifen sie zu. Und tatsächlich erlaubt ihnen ihr neuer Lebensentwurf, einen Gang runterzuschalten und ihrer Tochter entspannt beim Aufwachsen zuzusehen. Doch dann findet Flora am Abend von Rubys Highschool-Abschluss den Ehering ihres Mannes – jenen Ring, den Julian angeblich vor Jahren an einem Sommertag beim Schwimmen verloren hat. Floras Sicherheiten geraten ins Wanken. Wurde ihr neues Leben auf einer Lüge erbaut? Bestsellerautorin Cynthia Sweeney erzählt mit großem Einfühlungsvermögen und Humor von den Herausforderungen lebenslanger Beziehungen und ihrer großen Kraft. -
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cynthia D’Aprix Sweeney
Unter Freunden
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Nicolai von Schweder-Schreiner
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Good Company«
im Verlag HarperCollins, New York
© 2021 Cynthia D’Aprix Sweeney
Für die deutsche Ausgabe
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Abbildung von © Matthias Holz, Hamburg
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98448-4
E-Book: ISBN 978-3-608-11703-5
Für Mike, wie alles andere auch
Eins
Flora hatte nicht nach dem Ring gesucht, als sie ihn fand. Sie stöberte gerade in einem alten Aktenschrank in der Garage nach einem Foto aus dem Sommer, als Ruby fünf war, das war dreizehn Jahre her. Lange Jahre? Kurze? Beides, je nachdem, wie sie es betrachtete. Flora war mit dem Gedanken an das Foto aufgewacht, und sie wusste, dass es irgendwo im Haus sein musste. Es war von einer hässlichen braunen Kühlschranktür in Greenwich Village an eine noch hässlichere braune Kühlschranktür in Los Angeles gewandert (»Wie kann es sein, dass wir ans andere Ende des Landes ziehen und wieder einen braunen Kühlschrank haben?«, hatte sie Julian gefragt), bis der zweite hässliche Kühlschrank an einem Augustmorgen seinen letzten Atemzug tat und durch einen neuen ersetzt wurde, der schicker und aus Edelstahl war und an dem keine Magnete hielten. Sie hatte das Bild daraufhin an eine Pinnwand gehängt, in dem kleinen Wintergarten, den sie »das Büro« nannten, aber da die Ränder sich irgendwann wölbten, war es in einer Schublade gelandet, wo es sicher war vor dem Zahn der Zeit und der unerbittlichen kalifornischen Sonne. Als Flora vor ein paar Jahren die Sprecherrolle der frechen Löwin Leona in der Zeichentrickserie Griffith bekam, hatte sie sämtliche Schubladen ausgeräumt, und dann hatten Julian und sie »das Büro« in »das Studio« verwandelt, damit sie ihre Stimme auch zu Hause aufnehmen konnte. Wo war das ganze Zeug aus den Schubladen bloß geblieben? Sie würde nie ein Foto wegwerfen, vor allem nicht dieses.
»Haben wir nicht schon einen Haufen Geschenke für Ruby?«, fragte Julian, während er in seinem Nachttisch wühlte. Er wollte helfen, verursachte aber im Grunde nur noch mehr Chaos. Ihre Tochter feierte an diesem Abend ihren Highschool-Abschluss, und Flora wollte das Foto einrahmen und ihr schenken. Als kleine Überraschung.
»Das meiste davon können wir eigentlich mal wegschmeißen«, sagte Flora, als sie den Kram betrachtete, den Julian aus der Schublade holte und aufs Bett legte: Lesebrillen, veraltete Computerkabel, leere Aspirinflaschen, ein paar zerfledderte Drehbücher. Er würde ihren Vorschlag wie immer überhören. Nach zwanzig Jahren Ehe waren die Grenzen gezogen, es gab Orte, an denen Flora ihrem Ordnungsdrang nachkommen durfte, und andere, die sie zu ignorieren lernte.
»Hey! Die kann Ruby bestimmt gut gebrauchen.« Julian hielt ein dickes Bündel Euroscheine hoch, aufgerollt und mit einem Gummiband zusammengehalten. Ende des Monats würde Ruby mit der Familie ihres Freundes nach Spanien fliegen und danach Flora und Julian in Upstate New York treffen, in dem Haus in Stoneham, das auf dem Bild von früher zu sehen war.
»Ich wünschte, wir könnten das Foto diesen Sommer noch mal machen«, sagte Flora. »Dafür müssten nur David und Margot kommen.« Zufrieden mit seinem Fund warf Julian das Geldbündel auf Floras Bettseite. Vor drei Jahren hatten sie sich vor der Wechselstube am Flughafen Charles de Gaulle gestritten, ob sie die Euros in Dollar zurücktauschen sollten. Flora erinnerte sich noch genau daran. Es war grauenhaft heiß im Terminal, offenbar gab es ein Problem mit der Klimaanlage. Sie waren alle drei müde und gereizt nach der tagelangen Völlerei – Käse und Baguette, fast jeden Abend Foie Gras, Croissants, Schokolade, Wein. Die fünfzehnjährige Ruby hatte schlechte Laune. »Ich bin nicht undankbar. Ich hab nur gesagt, dass die Pariser ziemlich snobby sind dafür, dass nicht mal ihre Klimaanlagen funktionieren. Na und?«
Ruby hatte die Hitze schon als Baby nicht gut vertragen. Die ersten Sommer in Greenwich Village waren ein Albtraum. Ruby wollte nicht auf dem Spielplatz bleiben, sie wollte keine Mütze tragen, ihre Wangen waren knallrot, und zwischen den fleischigen Babyschenkeln brannte ein Hitzeausschlag.
»Können wir bitte nächstes Jahr im Juli an den Strand fahren? Irgendwohin, wo es Klimaanlagen gibt? Wo meine Klamotten nicht schon mittags völlig durchgeschwitzt sind?« Sie hatte den Arm gehoben und genervt auf den Schweißfleck unter ihrer Achsel gezeigt. »Die Bluse kann ich wegschmeißen, Mom. Die ist nagelneu, so eine Silhouette finde ich nirgends in Los Angeles, und jetzt ist sie ruiniert.«
»Okay, okay.« Julian hatte Ruby beschwichtigend die Hand auf die Schulter gelegt. »Lass uns erst mal was Kaltes zu trinken holen.« Dann hatte er Flora zugezwinkert, als Zeichen, dass sie auf derselben Seite waren. In dem Moment war ihnen beiden bewusst, dass Ruby wie Margot klang. Silhouette, snobby – das war definitiv nicht Rubys Vokabular.
Dass Ruby Floras beste Freundin so gern mochte, um nicht zu sagen vergötterte, war erst mal gut. Und es war auch kein Wunder, dass Margot, die keine Kinder hatte, und Ruby, das Einzelkind, sich so super verstanden. Besagte ruinierte Bluse war ein Geschenk von Margot gewesen, aus einer kleinen Boutique im 6. Arrondissement, in die Flora nie einen Fuß gesetzt hätte. Zu teuer. Zu einschüchternd. Sie hatte deswegen am Abend zuvor beim Essen in einem kleinen Bistro eine leicht gereizte Diskussion mit Margot geführt, wahrscheinlich waren sie ein bisschen zu betrunken und ein bisschen zu laut gewesen. Margot und ihr Mann David waren nachmittags mit Ruby losgezogen und beladen mit Einkaufstaschen zurückgekommen. Ruby strahlte, war bestens gelaunt und beschwerte sich ausnahmsweise mal nicht über die Hitze.
»Das ist zu viel«, hatte Flora gesagt, als Ruby eine Tasche nach der anderen öffnete und ihre Ausbeute vorzeigte – die hauchdünne rosa Bluse, ein Paar weiße Gladiatorsandalen, die Flora grauenhaft fand, ein schwarzes Halstuch mit kleinen Totenköpfen von irgendeinem Topdesigner, eine Wildleder-Fransen-Handtasche. »Ist so was gerade angesagt?«, fragte Flora, während sie mit den Fingern über das braune Wildleder fuhr. »Mom«, sagte Ruby. »Natürlich.«
Alles beeindruckend. Alles teuer. Flora war sauer, dass Ruby die Sachen alle einfach so angenommen hatte, wobei sie auch wusste, wie stur Margot sein konnte und wie sie einen mit ihrer Großzügigkeit förmlich erschlug: Hier! Nimm das, na los, nimm! Manchmal konnte man ihr einfach nicht widerstehen.
»Ist doch nicht der Rede wert«, hatte Margot abgewunken und die Taschen unter den vollgepackten Tisch gestellt. »War alles im Angebot.« David zuckte mit den Schultern, was so viel hieß wie: Wenn Margot etwas will …
Flora war schon die Ferienwohnung unangenehm gewesen. Wie immer, wenn sie mit Margot und David verreisten, übernahmen die beiden einen Großteil der Kosten. Auf gar keinen Fall betrug Floras und Julians »Hälfte« – die durchaus annehmbare Summe, die Margot ihnen als ihren Anteil nannte – 50 Prozent der Miete dieser atemberaubenden, riesigen Wohnung in der Nähe des Jardin du Luxembourg. »Vielleicht hat sie die auch für ihre ›Meilen‹ bekommen«, meinte Julian beim Auspacken. Margot hatte darauf bestanden, die Flugtickets zu übernehmen, sie müsse noch ihre Meilen aufbrauchen.
An jenem Tag auf dem Pariser Flughafen hatte Flora nicht die Energie gehabt, mit Julian darüber zu streiten, ob sie das Geld eintauschen sollten, das sie eigentlich gut für die Taxifahrt vom LAX nach Hause gebrauchen konnten oder um abends noch Essen zu holen. Sie wollte einfach ihren Frieden. Nach Hause. Die Aufmerksamkeit ihrer Tochter. Denn wenn man mal ehrlich war, hatte Flora vor allem deswegen gereizt auf die Kleiderkäufe reagiert, weil Ruby zehn Tage lang an Margots Lippen gehangen, ihre Gesten und ihren Tonfall imitiert und sie eines Abends – aus Spaß, vielleicht aber auch nicht ganz unpassend? – ma autre mère genannt hatte.
Flora ging nach unten und goss sich einen Kaffee ein, dazu, auf Rubys Rat, Mandelmilch statt Sahne. (»Sorry, Mom, aber in deinem Alter sind Milchprodukte Gift.«)
Sie sah aus dem Wohnzimmerfenster. Es war noch früh, die Sonne ging gerade erst hinter der Skyline von Downtown auf und färbte den Himmel in ein wässriges Monet-Blau. Anfang Juni in Los Angeles. Der sogenannte June Gloom. Eine dichte Wolkenschicht lag über den Häusern am Hügel, die Gegend sah aus wie das versteckte Dorf in einem Märchen.
Julian nahm seinen Rucksack und die Autoschlüssel und gab Flora einen Abschiedskuss. Sein letzter Drehtag vor der Sommerpause. Sie hatte sich noch immer nicht an das längere Haar und die buschigen Koteletten gewöhnt, die er sich für seine Rolle als Cop im New York der 1970er hatte stehen lassen. Der gute Cop natürlich, der Korruption und Vertuschung aufdeckte. Julian war fast immer der Gute, er hatte einfach das Gesicht dafür. Seine Serie war gerade verlängert worden, und zum ersten Mal in ihrem gesamten Eheleben hatten sie beide attraktive Engagements, neue Staffeln in Planung und fast zwei Monate frei, ohne sich Sorgen machen zu müssen, was der Rest des Jahres arbeitstechnisch bringen würde. Julian zog Flora zu sich ran und flüsterte ihr ins Ohr: »Tony, Tony, komm mal rüber. Ich hab’s verloren und find’s nicht wieder.« Das alte Gebet an den heiligen Antonius, das ihre Mutter immer in voller Lautstärke aufsagte, wenn etwas verloren ging, als würde er über ihr wohnen und bei Bedarf kurz runterkommen, um nach ihrer Lesebrille oder einem Handschuh zu suchen.
Obwohl Flora inzwischen weder zum heiligen Antonius noch sonst irgendwem betete, hatte sie in solchen Fällen ihre kleinen abergläubischen Rituale. Zum Beispiel mit dem Daumen über den Ehering ihrer Mutter zu streichen, ein schlichter Weißgoldring, den sie an der rechten Hand trug, seit ihre Mutter gestorben war. Das tat sie auch jetzt. Eine kleine, beruhigende Geste.
Wo konnte das Foto bloß sein? Plötzlich fiel ihr etwas ein. Als aus dem Büro das Studio wurde, hatte Flora einen Haufen Ordner und Papiere in die Garage gebracht, hauptsächlich in den großen Aktenschrank, den Julian und sie vor vielen Jahren in der 23rd Street entdeckt hatten, als es dort noch jede Menge Bürobedarfsläden gab. Flora war gerade schwanger, und eigentlich suchten sie nach Möbeln für das Kinderzimmer.
»Der ist perfekt«, hatte Julian gesagt, als er vor dem weißen Metallschrank stand.
»Fürs Kinderzimmer?«
»Immerhin ist er weiß.«
Flora protestierte. Sie hatten ein altes Gitterbett und einen Wickeltisch, und jetzt wollte sie etwas Neues kaufen, einen Schaukelstuhl, ein Bücherregal oder eine Spielzeugkiste. Das Zimmer war sowieso winzig, da konnten sie nicht auch noch einen Aktenschrank in die Ecke quetschen. Das war Anfang der Nullerjahre gewesen, bevor die Einrichtung des Kinderzimmers den guten Geschmack und die intellektuelle Stringenz der ganzen Familie widerspiegelte, vor dänischen Mobiles, Wandbildern von Märchenwäldern, kuratierten Bücherregalen und diesen kleinen quadratischen Lampen, die Sonne, Mond und Sterne auf die Wand projizieren.
Andererseits konnten sie den Schrank gut gebrauchen, er war praktisch und zugegebenermaßen eine gute Anschaffung gewesen. Ein Hingucker in Rubys »Kinderzimmer« und ständig in Benutzung. Flora und Julian waren mit ihm aus der gemütlichen Wohnung im West Village nach Los Angeles gezogen, wo er angesichts der Größe ihres ersten Hauses zu schrumpfen schien. Als sie dann das Haus in Los Feliz kauften, wanderte das gute Stück in die Garage, die sie sowieso nicht für das Auto brauchten, zumal es nie schneite und in den letzten Jahren auch kaum geregnet hatte.
Der Aktenschrank war ein Kompromiss aus der Anfangszeit ihrer Ehe, ein Ausgleich zwischen Julians Hamster-Mentalität und Floras Freude am Aussortieren. Das »Archiv« nannte Julian den Inhalt nur halb im Spaß. Halb im Spaß, weil er ihr mal gestanden hatte, als kleiner Junge seine Besitztümer geordnet und katalogisiert zu haben, da er sicher war, eines Tages berühmt zu werden. Das überraschte sie nicht, im Gegenteil, sie hatte dasselbe gedacht: Dass sie später mal Schauspielerin werden würde, was für sie ein gewisses Maß an Berühmtheit bedeutete, aber ihr war nie in den Sinn gekommen, irgendwann mal ihr Leben erzählen zu wollen.
Einmal hatte sie sich getraut, ihrer Mutter beim gemeinsamen Abwasch von ihrem Traum zu erzählen. Josephine hatte gelacht. »Jedes Mädchen denkt, dass es irgendwann ein Star wird.« Flora glaubte ihr nicht. Es konnte nicht sein, dass jedes Mädchen davon ausging – oder auch nur davon träumte –, später mal berühmt zu werden. Minnie Doolin mit ihrer Rotznase und den ausgeleierten Kniestrümpfen? Rosemary Castello, die in der Vierten von Schwester Demetrius vor der ganzen Klasse ausgeschimpft wurde, weil sie ihren BH ausgestopft hatte, und zwar mit bunten Kleenex, die man durch die weiße Schuluniform-Bluse sah? Das nahm Flora ihr nicht ab.
Dass Josephine geglaubt hatte, Josephine würde mal berühmt werden, war nicht nur verständlich, sondern gehörte zur Familiengeschichte und war die Anekdote, die sie am häufigsten aus ihrer Jugend erzählte. Das Vorsprechen, der Casting-Agent, der sie so toll fand und der unbedingt wollte, dass sie nach Los Angeles kam. »Sie wollten die nächste Elizabeth Taylor aus mir machen.« Unter den Teppich gekehrt wurden die Jahre, in denen sie – erfolglos – weiter für Broadway-Stücke, Radio- und Fernsehspots vorsprach. Wie sie Floras Vater heiratete und die Beziehung dann schnell in die Brüche ging. Die Wohnung, in der Flora aufwuchs, war eine Art Museum ihrer kurzen Theaterkarriere. Wenn man die kleine Zweizimmerwohnung über einer Bäckerei in Bay Ridge betrat, hätte man nie geahnt, dass Josephine nur vier Jahre als Schauspielerin gearbeitet hatte und fünfunddreißig als Telefonistin in einem Hotel.
»Okay, Fräulein Reich und Berühmt, versuch’s mal hiermit.« Floras Mutter hatte ihr den Spaghetti-Topf gereicht. »Dafür brauchst du den Spezialreiniger. Der muss glänzen, dass du dich drin spiegeln kannst.«
Im Rückblick fragte Flora sich, ob das der Klassiker war: Kleine Jungs, die berühmt werden wollten, katalogisierten gewissenhaft ihr Leben – ihr Archiv –, und kleinen Mädchen brachte man bei, mit welchem Spülmittel man am besten einen Topf sauber bekam.
• • •
Flora hasste die Garage. Über die Jahre hatten sich immer wieder Ratten dort eingenistet. Am liebsten tat sie so, als gäbe es die Garage gar nicht. Sie machte sich ein paar aufmunternde Gedanken über die Nachtaktivität von Nagetieren, nahm all ihren Mut zusammen und steuerte auf den freistehenden Bau am Ende der Einfahrt zu. Sie hob mit beiden Händen das schwere Tor an und horchte auf etwaige Lebenszeichen. Bei ihrem Einzug war das ganze Grundstück von Ratten befallen gewesen. Eine ältere Frau hatte dort seit Jahrzehnten gewohnt, und am Ende war sie zu schwach und krank, um sich noch darum zu kümmern. Bevor sie es kauften, war Flora jedes Mal bei ihren Morgenspaziergängen daran vorbeigelaufen. Es sah aus wie aus Grimms Märchen: leicht tudoresk, viel Fachwerk, hoher Schornstein und Bleiglasfenster. Es fühlte sich perfekt für sie drei an, aber verliebt hatte Flora sich vor allem in den außergewöhnlichen Garten. Zwei hoch aufragende Eukalyptusbäume, die schon viel länger als das Haus dort standen, flankierten einen kleinen Innenhof. Um den Rasen wuchsen die schönsten Obstbäume, die sie je gesehen hatte: Feige, Zitrone, Mandarine und Grapefruit. Wie auf einem Bibel-Farbdruck vom Paradies. Als sie das Grundstück das erste Mal sah, stockte ihr der Atem. Und so war es auch jetzt noch. Immer noch glaubte sie, ein fremdes Leben zu betreten, wenn sie nach draußen ging und die herbe Morgenluft roch, den Duft von Eukalyptus, und sah, wie die Spottdrosseln aus der wallenden Bougainvillea schossen und die kleinen Goldzeisige die Samen aus dem Rosmarin pickten.
Und dann waren da die Ratten. Die Früchte boten das ganze Jahr über genug Nahrung für sämtliche Nager aus der Nachbarschaft. Julian und sie hatten einen Zaun errichtet, das Gestrüpp gerodet, Fallen aufgestellt, Löcher in der Garage und im Haus gestopft und das pulsbeschleunigende braune Gewusel schon lange nicht mehr gesehen. Trotzdem fühlte sie sich unwohl. Zum Glück war alles ruhig.
Sie ging nach hinten durch zum Schrank und zog die oberste Schublade auf. Sie war proppenvoll mit Aktenmappen, alle aus der Anfangszeit von Good Company in New York. Ein Wurmloch, für das sie heute keine Zeit hatte, aber dem obersten Programmheft konnte Flora dann doch nicht widerstehen: Jason und Medea – eine Produktion, die Julian und sein Partner Ben in einem stillgelegten Schwimmbad in Williamsburg inszeniert hatten, eine Nacherzählung von Euripides’ Medea im heutigen Brooklyn. Auf dem Cover prangte eine Zeichnung – die Silhouette einer Frau mit einem kleinen Kind in einem blutigen T-Shirt auf dem Arm, nur das Blut war in Farbe. Sie fand das Bild furchtbar kalt und skrupellos. Die Kritiker waren begeistert gewesen – na gut, die Indie-Kritiker, von der Voice und von Time Out. Aber niemand hatte Tickets gekauft.
»Das Stück ist so traurig«, hatte Flora eines Abends zu dem enttäuschten Julian gesagt.
»Das Leben ist traurig«, hatte er sie angefahren.
In der zweiten Schublade Bücher über Theater und Schauspiel: Stanislawski, Hagen, Adler, Meisner, Strasberg. Julian hing keiner speziellen Theorie an, in der Beziehung war er Atheist mit der dazugehörigen Portion Bestimmtheit und Verachtung. Er hasste Personenkulte. Er fand, Schauspieler sollten sich an das halten, was funktionierte.
Sie nahm sich die dritte Schublade vor. Rubys sämtliche Schulunterlagen und Arbeitsberichte. Die Kunstprojekte, die Flora aufbewahrt hatte. Früher musste sie den Rucksack und die Spielkiste ausräumen, wenn Ruby schlief, und den Müll noch am selben Abend auf die Straße stellen. Sollte Ruby am nächsten Morgen den Mülleimer aufmachen und etwas von sich darin entdecken – eine kaputte Puppe, eine Zeichnung, einen Rechtschreibtest –, war sie jedes Mal traurig und wütend. »Du willst meine Valentinskarten wegschmeißen?«, fragte sie eines Junimorgens, nachdem Flora versucht hatte, etwas Ordnung in ihre Schultasche zu bringen. »Und meine Valentinsherzen?« Gegen Ende des Schuljahrs hatten die Herzen sich meistens in Staub aufgelöst, aber Ruby tat so, als wollte Flora seltene Bücher oder edle Pralinen wegwerfen.
Flora entschuldigte sich dann: »Oh, Schatz. Das wollte ich nicht. Zum Glück hast du aufgepasst.« Aber Ruby blieb den Rest des Tages über reserviert und passte wochenlang wie ein Luchs auf ihre Sachen auf. Sie vergaß nichts. »Wo ist das Papierschirmchen, das ich im Restaurant bekommen hab?« »Wo ist mein gelber Ball geblieben?« »Was hast du mit meinem Partyhut gemacht?«
Schließlich war Flora bei der letzten Schublade angekommen. Sie zog den roten Metallhocker von Ikea heran, den sie für Ruby gekauft hatten, als sie drei war, damit sie besser an den Küchentresen kam. Er war mit Farbe bespritzt und zerkratzt, aber noch stabil. Sie setzte sich und wühlte die Papiere durch. Ein Durcheinander von Umschlägen, keiner beschriftet. In einem steckten verblichene Rezepte, in einem anderen ein Stapel Postkarten aus diversen Museen und Kirchen, wahrscheinlich als Inspiration, für was, wusste sie nicht mehr – Bühnenbilder oder Kostüme vielleicht.
Unter den Ordnern lag ein großer brauner Umschlag, der Flora bekannt vorkam. Sie zog ihn raus und las in ihrer Handschrift: BEHALTEN. Ah, sie erinnerte sich! Ihre alten Fotos, die sie extra dort deponiert hatte. Als sie den Umschlag öffnete, lag das gesuchte Bild obenauf.
Die Aufnahme war auf dem Anwesen von Bens Familie in Upstate New York entstanden, während der Proben für eine Sommerproduktion, die sie neben ihrer Arbeit in Manhattan organisierten. Ben und Julian hatten Good Company zusammen gegründet, aber Ben hatte sich von Anfang an in den Kopf gesetzt, in Stoneham eine Open-Air-Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Als sie eines Abends im April nach diversen Bieren bei Flora und Julian im Wohnzimmer saßen, erzählte er ihnen von seiner Idee. Ein klassisches Stück, auf den Ort zugeschnitten, das nur an einem einzigen Abend aufgeführt würde. Keine Tickets, keine Kritiker. Eine Gelegenheit für alle, die im August keinen Job und kein Vorsprechen hatten, mal aus der Stadt rauszukommen und mit anzupacken, ohne sich von irgendwem reinreden zu lassen. Eine echte Gemeinschaftsproduktion.
»Ich weiß nicht«, sagte Julian. »Kommt mir ein bisschen viel vor.«
»Wenn’s nicht hinhaut, haut’s nicht hin. Einen Versuch ist es wert, oder?«
Was in jenem ersten Sommer in Stoneham als Spaß begann, als Experiment, wurde bald zu einer festen Tradition.
In dem Jahr, als das Foto entstand, hatte einer der Schauspieler die ganze verrückte Woche dokumentiert. Charlie war ein Bär von einem Mann und sehr schüchtern. Die Kamera um den Hals diente ihm offensichtlich als Schutzschild für seine Unsicherheit abseits der Bühne. Als Flora und Margot eines Abends auf der Treppe vor der Veranda saßen und Maiskolben für das »Familienessen« schälten, hatte er Julian und David vom Rasen geholt, sich Ruby geschnappt, die mit einem Geschirrhandtuch auf dem Kopf herumrannte und Prinzessin spielte, und versucht, sie alle auf den Stufen zu gruppieren.
Flora und Julian saßen auf der obersten, Margot und David direkt darunter. Flora hatte es gerade noch geschafft, Ruby neben sich zu platzieren, da sprang sie schon wieder hoch und setzte sich auf Margots Schoß. Rubys Fixierung auf Margot begann in jenem Sommer. Sie folgte ihr überallhin wie ein Entenküken seiner Ersatzmutter. Margot warf ihr einen entschuldigenden Blick zu. »Ist schon okay«, sagte Flora, was nicht stimmte. Julian rückte an sie heran, küsste sie auf die nackte Schulter und hakte sich bei ihr unter. »Hey!« Flora griff über Margots Schulter und tippte Ruby auf den Arm, ein letzter Versuch. »Willst du nicht auf Mamis Schoß sitzen?«
Ruby schüttelte den Kopf, nahm aber widerwillig Floras Hand. Während Charlie am Objektiv herumfummelte, wurde Ruby unruhig, also zählte Flora an ihren Fingern ab: »Dieses kleine Schweinchen ging auf den Markt, dieses kleine Schweinchen ging nach Hause.«
»Nein, Mama!«, rief Ruby und lachte. »Das macht man mit den Zehen.«
»Okay, Leute«, sagte Charlie endlich. »Alle mal hochschauen.«
Was sie wundersamerweise auch alle taten.
Flora und Julian hielten die Köpfe aneinander und lächelten direkt in die Kamera. Unter ihnen saß David leicht nach vorn gebeugt, ein großer Mann, bewusst gekrümmt, die eleganten Chirurgenhände vor sich gefaltet, das Gesicht halb Margot zugewandt, die sonnengebräunt, blond und strahlend die Finger vor Rubys Buddhabauch verschränkt hielt, das Kinn auf Rubys Kopf stützte und mit ihrem Lächeln die Kamera blendete. Rubys Beine mit den schmutzigen Knien steckten zwischen Margots längeren. Rubys Haare ein Wirrwarr aus Locken. Sie grinste scheu, ein Finger zog den Mundwinkel runter, den anderen Arm hielt sie ausgestreckt, ihre Hand umklammerte Floras, ein Verbindungsglied zwischen ihrer Mutter und Margot.
Sie sahen alle so zufrieden miteinander verstrickt aus, so reizend und jung. Eine Familie.
Flora steckte das Foto in die Tasche ihres Sweatshirts und genoss kurz ihren Triumph. Die Arbeitsteilung in ihrer Ehe, emotional, aber auch sonst, sah vor, dass Flora Verlorenes wiederfand. Sie war der heilige Antonius im Haus. Es machte sie stolz (und ärgerte Julian), wenn er etwas für verschwunden erklärte und sie es dann innerhalb von wenigen Minuten wiederfand, indem sie seinen wirren Gedankengängen folgte und herausfand, wo er tatsächlich gewesen war. Funktionierte so irgendwann jedes Paar? Dass man die Denkweisen des anderen so viel leichter erkannte als die eigenen?
Nach und nach legte sie die Ordner und Umschläge, die Notizbücher und die Stifte zurück in die Schubladen und beschloss, ein bisschen auszusortieren, solange Julian nicht danebenstand und unbedingt später selbst noch einen Blick auf die Sachen werfen wollte, was vermutlich nie passieren würde. Das war ein weiteres Fachgebiet von ihr, die Spreu vom Weizen zu trennen und sich selbst zur Richterin und Geschworenen über die Überbleibsel ihrer aller Vergangenheit zu ernennen; zu entscheiden, was jeder behielt und was wegkonnte. Ihr Mann und ihre Tochter waren einfach zu sentimental.
Flora warf einen Blick in die Notizbücher. Das kryptische Gekritzel war bestimmt nicht mehr wichtig. Müll. Sie testete die Filzstifte, die Hälfte davon ging nicht mehr. Sie nahm einen, der noch funktionierte, und schrieb die jeweiligen Bezeichnungen auf die Umschläge (Postkarten, Familienfotos, Theaterprogramme). Als sie von ganz hinten aus der Schublade ein altes Kuvert zog, rutschte etwas Helles, Glänzendes heraus und fiel zu Boden. Ein goldenes Funkeln auf dem rissigen Beton. Ein Ring.
Ein Ring?
Flora erkannte ihn sofort als Julians Ehering – einen von Julians Eheringen. Zu ihrem Verdruss verlor er sie ständig. Wie viele bisher? Mindestens drei. Meistens passierte es am Set oder im Theater, weil er ihn da abnehmen musste, wenn er nicht zur Rolle passte, und weil er so zerstreut war. Sie streifte den Ring über den Daumen. Einen in Reserve zu haben, konnte nicht schaden, zumal Julian seinen jetzigen bestimmt auch irgendwann verlieren würde.
Zurück in der Küche nahm sie ihn ab und sah ihn sich genauer an, und erst da stellte sie fest, dass der Ring eine Gravur hatte. Seltsam, der einzige Ring, den sie hatten gravieren lassen, war der erste, wer hatte danach noch Zeit für so was? Sie hielt Julians originalen Ehering in der Hand.
Ein mulmiges Gefühl stieg in ihr auf, ganz langsam und von weit unten. Es dauerte einige Augenblicke, bis ihr Verstand hinterherkam. Julian hatte den Ring in dem Sommer verloren, als das Foto entstanden war. Eines Nachmittags kam er kleinlaut bei ihr an. Er war im Teich schwimmen gewesen, und irgendwie musste er ihm da vom Finger gerutscht sein.
»Oh, na ja«, hatte Flora gesagt. »Dann müssen wir wohl einen neuen besorgen.« Sie wollte nicht, dass er sich deswegen noch schlechter fühlte, also zeigte sie ihm lieber nicht, wie ihr zumute war. Es brach ihr tatsächlich ein bisschen das Herz. Der Ring hatte ihr viel bedeutet, er war zwar viel zu teuer gewesen, aber auch wirklich wunderschön. Breit und flach mit zwei schmalen Milgrain-Bändern an den Rändern. Als sie ihn Julian an ihrem Hochzeitstag über den Finger gestreift und in sein wunderschönes Gesicht aufgeblickt hatte, dachte sie: Meiner.
Und jetzt lag der Ring hier in Floras Hand. Er hatte in einem Umschlag ganz unten im Aktenschrank in der Garage gesteckt.
Flora schwitzte anders als vorher, es war ein kalter Schweiß, trotz der Anstrengung und der Sonne, die inzwischen aufgegangen war. Sie hatte plötzlich das starke Verlangen, ihre Mutter anzurufen, die seit mehr als zehn Jahren tot war. Fast konnte sie Josephine neben sich fühlen, wie sie mit finsterem Blick auf den Ring starrte und entgeistert lospolterte: Flora. Was in Gottes Namen hat das zu bedeuten?
Zwei
Während Margot von diesem Mädchen interviewt wurde (Wie hieß sie noch? Maura? Molly?), saß am anderen Ende des Cafés ein wildfremder Mann und fotografierte sie unentwegt mit seinem Handy. Manche Leute versuchten ja, nicht aufzufallen, was selten gelang, da sie nicht nur schwer zu übersehen waren – die leicht zusammengesackte Haltung, der ungelenke Winkel, in dem sie das Handy hielten, die gespielte Lockerheit eines Teenagers, der etwas im Schilde führte –, sondern weil Margot, wie praktisch alle ihre Kollegen, soweit sie wusste, einen sechsten Sinn dafür hatte, wenn jemand sie erkannte, selbst wenn die Person hinter ihr in der Schlange oder draußen vor dem Restaurant oder auf der anderen Straßenseite stand. Manche Schauspieler behaupteten, es sei wie ein Kribbeln im Nacken oder in den Zehenspitzen. Manche, wusste Margot, freuten sich insgeheim wahnsinnig (Ich bin gesehen worden! Ich existiere!), obwohl sie sich erst mal beschwerten. Bei Margot war es eine unerklärliche Traurigkeit. Ob beim Einkaufen, im Restaurant, beim Wandern mit einer Freundin, plötzlich überkam sie eine seltsam düstere Stimmung, und sie dachte: Was stimmt hier nicht?
Es war immer eine Kamera. Jedes Mal. Und da inzwischen so gut wie jeder eine Kamera in der Hand hielt, kam sie sich ständig beobachtet vor, und die existentielle Traurigkeit wurde zu einem täglichen Kampf.
Was war das bloß für eine Welt. In der an einem ganz normalen Mittwochmorgen in einem kleinen Café in Larchmont jemand sie mit ihrem Glas Zitronenwasser fotografierte. Die Orte, an denen sie sich sicher, weil unsichtbar, fühlte, wurden immer weniger, und dieses Café war in all den Jahren, seit sie in Los Angeles lebte, einer davon gewesen. Unter anderem deswegen mieden David und sie die Westside – Beverly Hills, die Palisades, Santa Monica –, weil sich im Gegensatz zu ihrem Viertel dort alles so nach Hollywood anfühlte. Und obwohl Margot die TMZ-Busse mit den Touristen (noch) nicht wirklich störten, empfand sie dieses aktuelle Eindringen in ihre Privatsphäre als extrem unangenehm.
»Das muss echt nervig sein«, sagte das Mädchen, als Margot den Stuhl wegrückte, um nicht weiter fotografiert zu werden. Wie bei jedem Interview ließ Margot das, was sie eigentlich dachte (Nicht nerviger als mit dir reden zu müssen!), durch ihren Überlebensfilter laufen und erwiderte höflich: »Klar, manchmal ist es frustrierend, aber das gehört eben dazu, und, na ja, ich kann ja froh sein, dass sich jemand für mich interessiert.« Zartes Lachen, schüchternes Kopfeinziehen. Der Typ mit dem Handy hatte sich neu positioniert. Was hatte er mit all den Fotos vor? Sie jemandem schicken? Irgendwo posten? Einen Schrein bauen? Etwas Perverses?
Was war das bloß für eine Welt.
Margot saß hier, weil sie zur Originalbesetzung von Cedar gehörte, einer Krankenhausserie, deren neunte Staffel gerade zu Ende gedreht wurde. Sie spielte Dr. Cathryn Newhall – Dr. Cat –, eine, wie damals in der Rollenbeschreibung stand, »Kinderonkologin, die einen Kampf gegen den Krebs führt und sich nach Liebe sehnt«. Margots Vertrag sollte verlängert werden, und diesmal – diesmal wirklich, verdammt – würde sie darauf bestehen, die gleiche Gage zu bekommen wie ihr Serienpartner Charles Percy, alias Dr. Langford Walker, der zwei Jahre nach Margot zum Ensemble gestoßen war und trotzdem mehr verdiente als sie. Charles war Leiter der Chirurgie am fiktionalen Cedar General Hospital in der fiktionalen Stadt Cedar im Nordwesten der USA. Als Charles anfing, hatte Bess, die Erfinderin der Serie, noch ihre gesamte Aufmerksamkeit und Liebe hineingesteckt, hatte sie noch ihr »Baby« genannt, bevor sie ein echtes Baby bekam. Und bevor sie ihr Imperium aus Cedar-Spin-offs schuf: Willow, eine Serie über ein gerichtsmedizinisches Institut und die mit seiner Hilfe aufgeklärten Verbrechen, und Cypress, in deren Mittelpunkt die Unfallstation eines in einer größeren Stadt gelegenen Krankenhauses stand. »Cedar ist immer noch mein erstes Baby«, verkündete Bess gern, wenn sie am ersten Drehtag jeder neuen Staffel auftauchte, um vor der gesamten Besetzung und Crew ihre Motivationsrede zu halten. »Physisch bin ich vielleicht nicht die ganze Zeit anwesend, aber im Geiste bin ich bei euch, und … ich habe einen Haufen Spione.« Mit dem Satz erntete sie immer die Lacher der Neueinsteiger und ein innerliches Stöhnen der Veteranen, denn die Spione gab es wirklich.
»Charles ist ein echter Knüller«, hatte Bess ihr aufgeregt verkündet, nachdem er unterschrieben hatte. »Frisch vom Broadway. Tony-nominiert.«
Margot hatte darauf verzichtet, Bess daran zu erinnern, dass sie zwei Jahre zuvor für einen Drama-Desk-Award nominiert gewesen war und eine erfolgreiche Spielzeit am West End absolviert hatte. Bess hatte ein Gedächtnis wie ein Spatz und behielt immer nur das, was sie gerade brauchte. Abgesehen davon freute sich Margot darauf, mit Charles zusammenzuarbeiten. Sie waren sich in New York regelmäßig über den Weg gelaufen und hatten sogar schon mal zusammengearbeitet. Sie mochte ihn, außerdem verlieh er der Serie ein gewisses Prestige. Sie war froh, dass er ihren Geliebten spielte. Sie wollte nur genauso viel verdienen wie er.
»Jetzt ist der richtige Zeitpunkt«, hatte Margot erst letzte Woche zu Donna, ihrer Managerin, gesagt. Nach ein paar mittelmäßigen Staffeln in den vergangenen Jahren war die letzte für sie wieder relativ stark gewesen. Dr. Cat und Dr. Walker hatten ihren langgehegten Traum vom eigenen Kind wahrgemacht – Zwillinge per Leihmutter –, und Bess hatte Dr. Cat eine postnatale Depression ohne Geburt verschrieben. »Gibt es so was wirklich?«, hatte Margot gefragt.
»Allerdings, ich hatte es nämlich«, hatte Bess ihr feierlich erklärt. Klar. Aus Gründen, die Margot nie so recht verstand, spiegelten Dr. Cats Handlungsbögen normalerweise Bess’ Handlungsbögen im echten Leben wider. Wenn Bess sich verliebte, dann auch Dr. Cat. Wenn Bess nicht schwanger werden konnte, dann Dr. Cat auch nicht. Und wenn Bess eine Wochenbettdepression ohne Geburt hatte? Na, dann würde Margot alles geben und genau das spielen, obwohl sie nie schwanger gewesen war und nie ein Kind bekommen hatte und keins von beiden je auch nur eine Sekunde bereute.
»Wir müssen dich ins Rampenlicht stellen, Margot. Wir müssen Bess zeigen, wie viel Dr. Cat den Zuschauern noch bedeutet, und dann nennen wir unsere Bedingungen. Eine Emmy-Nominierung wäre natürlich genial«, hatte Donna wehmütig gesagt, denn die Zeiten waren für Cedar leider vorbei. Lange her waren die Sommermonate, als Margot den Sunset Boulevard runterfuhr und ihr Gesicht auf den riesigen Plakaten vor sich aufragen sah. Die Serie lief schon zu lange, sie war zu unmodern. Durchschnittliche Fernsehkost.
Hier saß sie jetzt also beim fünften Interview und erzählte von »Margots Lieblingsmomenten« – Szenen, Filmpartner, Handlungsstränge, Kostüme – aus neun Staffeln im Cedar General. Kein Detail schien zu banal, und um nicht dieselben Fragen wie alle anderen stellen zu müssen, wurden die Themen der Journalisten immer absurder. Erst heute Morgen hatte Margot ihrer Pressefrau Sylvia eine Beschreibung eines ihrer »Lieblingsgegenstände« geschickt, für einen Artikel, der weiß Gott wo erscheinen sollte.
Sie hatte sich für eine Kerze aus einer alten Apotheke in Florenz entschieden, die sie regelmäßig verschenkte, weil sie so hübsch war und nicht so penetrant roch. Sie duftet wie ein Sonntagmorgen in Italien, hatte sie geschrieben, wie frisch gerösteter Kaffee, Zitronenblüten und Pinienhaine. Sie beschrieb, wie sie als Teenager in den Sommerferien mit ihren Eltern auf den Laden gestoßen war und dass die Kerze sie an die magischen Monate in Italien auf dem Land erinnerte. Die Aufgabe hatte ihr ausnahmsweise Spaß gemacht. Aber dann schrieb Sylvia zurück, in der Zeitschrift würden die Lieblingsgegenstände sämtlicher Darsteller der Serie abgedruckt, und die Frau, die ihre kleine Schwester spielte, Kelsey Kennen, eine relativ neue Kollegin, bei der Margot sich Mühe gab, sie nicht zu hassen, hatte sich auch für eine Kerze entschieden, und Sorry!, aber Kelseys Kerze sei nicht nur günstiger – Gibst du tatsächlich siebzig Dollar für eine Kerze aus? –, sondern wurde außerdem von syrischen Flüchtlingen hergestellt, ob Margot bitte etwas anderes nehmen könne? Toll wäre, hatte Sylvia geschrieben, wenn es etwas aus einem Kriegsgebiet ist. Eine Handtasche vielleicht? Sandalen? Ich will dir natürlich nicht die Worte in den Mund legen.
Oder Schuhe aus meinem Schrank?, hatte Margot zurückgemailt.
Lol. Aber – mal im Ernst. Vielleicht etwas aus Bosnien? Das von einer Frau, die jede Woche Hunderte von Dollar ausgab, um sich die Haare föhnen zu lassen, und Bosnien nicht für eine Kiste Siebzig-Dollar-Kerzen auf der Landkarte finden würde.
Normalerweise lenkte Margot das Gespräch bei einem Interview immer auf dieselbe abgedroschene Geschichte: wie es war, im Fernsehen eine Ärztin zu spielen und gleichzeitig im wahren Leben mit einem Arzt verheiratet zu sein. Ein wenig amüsanter Zufall, den die Medien aber offenbar unendlich unterhaltsam fanden. Inzwischen kannte sie die Fragen alle: Ließ sie ihren Mann die Drehbücher lesen? Half er ihr beim Proben? Sah/mochte/respektierte er die Serie? Die Antworten konnte sie aus dem Effeff (längere Versionen von nein, nein, ja).
Aber dieses Mädchen (Mia!) hatte ihre Hausaufgaben gemacht, und sie war eine gute Interviewerin, die Margot immer wieder aus dem Gleichgewicht brachte, indem sie zwischen ihren schmeichelhaften Fragen einige tatsächlich interessante stellte. Sie hatte ein paar alte Sachen von ihr ausgegraben, unter anderem ihre erste New Yorker Fernsehserie, in der sie eine kluge, exzentrische, alleinstehende Frau Anfang dreißig – namens Margot – spielte, die sich nicht nach Liebe sehnte, geschweige denn nach einem Mittel gegen Krebs. Schöpfer und Regisseur waren jung und aufregend, aber die Serie sollte zwei Tage nach 9/11 anlaufen, woraus natürlich nichts wurde. Als sie dann ein paar Wochen später ausgestrahlt wurde, interessierte sie keinen mehr, und der unbeschwerte Blick auf Manhattan fühlte sich angesichts der jüngsten Ereignisse irgendwie falsch an. Damit erklärte sie sich jedenfalls, warum Margot nicht so gut ankam, selbst bei den Kritikern, die nach etwas Besserem, Intelligenterem als dem üblichen Sitcom-Einheitsbrei schrien. Ursprünglich sollten es zwölf Folgen werden, aber die Einschaltquoten waren so schlecht, dass die Serie nach sechs Folgen abgesetzt wurde. Die letzten bekamen dann nur die Beteiligten zu sehen. Anscheinend lagerten sie im Museum of Television and Radio.
»Ich frage mich, wie es sich angefühlt hat, in New York Theater zu spielen, dann Margot zu machen und schließlich eine Krankenhausserie wie Cedar. So gut sie auch sein mag«, sagte Mia (jung, aber aalglatt). »Es ist doch ein großer Unterschied zu Ihrer Arbeit in New York.«
Wie Tag und Nacht, hätte Margot am liebsten gesagt. Bevor sie Dr. Cathryn Newhall wurde, war ihre Arbeit interessant, intellektuell und anspruchsvoll, und Cedar war eine Soap – kurzweilig, lächerlich und sehr gut bezahlt. Sie sah die Figurenbeschreibung vor sich, als läge sie vor ihr auf dem Tisch: »Cathryn Newhall (Dr. Cat) ist hübsch (vorzugsweise katzenartig hübsch) und aufgeschlossen, die Kids lieben sie auf den ersten Blick. Genial, aber ein bisschen unzuverlässig; ob sie wohl heute daran gedacht hat, sich die Haare zu waschen?«
In erster Linie war Cedar der Anlass für David und sie, aus New York wegzugehen, was damals absolut notwendig erschien. Aber sie plauderte hier nicht mit einer Freundin. Das war ein Interview, und ihre Aufgabe bestand darin, sechzig bis neunzig Minuten lang interessant zu sein, ohne etwas wirklich Interessantes zu sagen.
Noch bevor sie Gelegenheit hatte, richtig loszulegen (hatten genug, wollten unser Leben ändern, Los Angeles lockte), unterbrach Mia sie, indem sie die Jensen-Sache erwähnte: »Ich weiß, dass Sie unter anderem hergezogen sind, weil Ihr Mann hier eine Schlaganfallklinik eröffnen wollte, aber ich bin auch auf die Geschichte einer Patientin gestoßen, die während einer OP gestorben ist. Abbie Jensen? Und da habe ich mich gefragt, ob das Ihre Entscheidung, aus New York wegzuziehen, mit beeinflusst hat.« (Nicht nur aalglatt, hinterhältig.) »Bestimmt ist das ein heikles Thema«, fuhr Mia fort, »aber ich dachte, mit etwas Abstand könnten Sie vielleicht darüber sprechen. Haben Sie noch Kontakt zu den Jensens?«
Jetzt fragte Margot sich doch, ob das Mädchen sie verarschen wollte, denn warum in aller Welt sollten sie noch Kontakt zu den Jensens haben? »Tut mir leid«, erwiderte sie mit einer sanften Stimme, die sie sich für die Szenen antrainiert hatte, in denen sie einer Familie mitteilen musste, dass die Testergebnisse nicht wie erhofft ausgefallen waren, »aber ich dachte, es ginge hier um meine Rolle in Cedar.«
Mia war so höflich, rot zu werden. »Ich habe über Ihre Zeit in New York recherchiert, und ich hatte das Gefühl, da könnte ein Zusammenhang bestehen.«
Margot saß mit unbewegt freundlicher Miene da und versuchte, sich vorzustellen, welcher Teil der »Recherchen« dieses Mädchen zu den Jensens geführt haben konnte. Das Krankenhaus hatte die Geschichte erfolgreich aus den Nachrichten rausgehalten, man hatte sich schnell geeinigt, und die Jensens wollten keine unnötige Aufmerksamkeit. Alles war besiegelt. Sie hielt Mias Blick stand. Sie hatte gelernt, wie man peinliches Schweigen ertrug, ein beliebter Journalisten-Trick, der bei ihr nie funktionierte. Sie hielt jedem stand. Es war kein fairer Kampf. Sie starrte Mia an. Sie war hübsch, blond, wahrscheinlich aus dem Mittleren Westen, die Nase ein bisschen zu flach, die Wangen ein bisschen zu breit. Fünfundzwanzig? Sechsundzwanzig? Kein Make-up, aber die Haut spiegelglatt. Sie pflegte ihre Haut, wie all die talentierten, hübschen – häufig beides – jungen Leute, die aus ihren Heimatstädtchen nach Los Angeles strömten, um dann festzustellen, dass die Menschen dort alle gleich aussahen. Margot ließ sich von Mias einstudierter Ungezwungenheit nicht täuschen – die absichtlich tiefere Stimme, die geweiteten Augen. Sie war gekleidet, wie es eine Entertainment-Journalistin in ihren Augen sein musste. Ein geblümtes, fließendes Kleid, das aus einem Revival von Unsere kleine Farm stammen könnte, geschnürte Lederstiefel, langer loser Zopf, Bomberjacke. Ein Kostüm. Margot sah Mia an und dachte: Ich kenne dich.
Der Kellner kam zu ihnen, und um Zeit zu gewinnen, stellte Margot einen Haufen unwichtige Fragen zur Speisekarte, obwohl sie während Interviews nie aß. Den Fehler hatte sie einmal begangen, vor Jahren, woraufhin der Reporter seinen Artikel mit Beschreibungen aufpeppte, wie sie »wie ein Waschbär« Stücke von ihrem Scone abbrach. Margot sah auf die Uhr, es war fast zwölf. »Ich nehme nicht an«, sagte sie, senkte die Stimme verschwörerisch und setzte ein breites Lächeln auf, »dass ich Sie zu einem Glas Wein überreden kann? Die haben hier einen ganz wunderbaren Gavi di Gavi.«
»Gavi?«, fragte Mia. Die Hand glitt an das schmale Kettchen um ihren Hals. Sie riss die Augen auf. »Was ist das?«
»Oh, ich lade Sie ein. Zwei Gläser«, sagte sie zu dem Kellner und, ganz gegen ihre Gewohnheit: »Stellen Sie uns doch bitte noch einen schönen Antipasti-Teller zusammen, ja?« Dann wandte sie sich wieder an Mia. »Wussten Sie, dass ich als Kind im Sommer immer in Italien war?«
• • •
»Der ist wirklich wunderbar«, sagte Mia und hob das zweite Glas an die Lippen. Der Wein hatte sie gelöst, und jetzt stellte Margot ihr die Fragen, über ihren Job, ihren Freund, den aufstrebenden Schauspieler, ihre Hoffnungen und Träume. »Ich würde so gern mal nach Italien«, erzählte sie Margot, während sie ihr Glas runterkippte.
»Das müssen Sie unbedingt«, antwortete Margot. »Ich gebe Ihnen meine persönliche Restaurantliste mit.« Und dann: »Hey, haben Sie heute Abend schon was vor? Im Hollywood ArcLight ist heute die Premiere vom neuen Clooney-Film, der in Italien spielt. Soll gut sein, hab ich gehört. Ich wollte eigentlich hin, muss jetzt aber eine Party für die Tochter meiner besten Freundin ausrichten. Wenn Sie Interesse haben, kann ich Sie und Ihren Freund auf die Liste setzen.«
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?« Mia stellte das Glas ein bisschen zu rasant ab. »Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Das wäre fantastisch. Sie sind wirklich unglaublich nett.«
Mission erfüllt. Margot hatte das Gespräch in eine andere Richtung gelenkt, ohne Mia die Munition zu liefern, über ihre mangelnde Gesprächsbereitschaft hinsichtlich der Jensen-Sache zu schreiben, denn so etwas konnte durchaus ein Eigenleben entwickeln. Erst las die nächste Reporterin davon, dann noch eine, und bald schon stand irgendwo ein ganzer Artikel, der die dunkle Vergangenheit ans Licht holte – ein Vorfall, der noch zehn Jahre später pikant genug für den bodenlosen Abgrund namens Unterhaltungsjournalismus war.
»Wow.« Margot sah auf die Uhr. »Es ist spät. Ich muss leider los.«
»Oh, Mist«, sagte Mia und griff nach ihrem Notizheft. »Ich hätte noch ein paar Fragen.«
»Eine schaff ich noch.«
»Okay«, meinte Mia erleichtert und warf einen Blick auf ihre Notizen. Sie blätterte in ihrem Moleskine, hielt inne, sah wieder zu Margot hoch und lächelte. »Okay. Letzte Frage. Irgendwas, was Sie bereuen?«
Sie sagte das einfach so daher, wie nur ein derart junger Mensch es konnte. Margot unterdrückte ein Lachen. Wo sollte sie anfangen? Sie wusste es nicht. Obwohl, eigentlich schon: Sie würde mit dem Morgen beginnen, an dem David seinen Schlaganfall hatte, als sie noch in der East 85th Street wohnten. Wie er frisch aus der Dusche in die Küche kam und sie die schimmeligen Himbeeren aussortierte und die guten in eine Schüssel legte. Seine Hände an ihrer Hüfte. »Nein«, erwiderte sie. Das Mädchen war so jung. So unbefleckt. So porenfrei. »Ich habe einen wunderbaren Mann, ich liebe meinen Job, mein Leben ist toll. Ich habe wirklich großes Glück.«
Nach dem Interview stand sie draußen und wusste nicht wohin. Sie hatte Hunger und ein bisschen Kopfschmerzen vom Wein. Sie könnte nach Hause gehen, aber heute Abend war Rubys Abschlussfeier und zu Hause alles voller Catering-Leute. Dazu noch der Florist. Sie könnte ein bisschen nach dem Rechten sehen, aufpassen, dass es nicht zu viel des Guten wurde, sonst würde Flora wieder – na ja, sagen würde sie nichts, aber sie kannte ja ihren Blick, den verkniffenen Mund, die durchgedrückten Schultern. Nicht mal ein kurzes Augenrollen würde sie sich verkneifen. In letzter Zeit ärgerte es Margot, weiterhin so tun zu müssen, als würde sie nicht anders mit Geld umgehen als Flora und Julian, zumal die finanzielle Kluft zwischen ihnen nicht mehr so groß war, seit Flora und Julian beide feste Engagements hatten.
Nach jahrelangen Jobs als Werbesprecherin hatte Flora jetzt eine Hauptrolle in Griffith, einer Musical-Zeichentrickserie, die in Los Angeles spielte, nur dass die Figuren – zum Teil gesprochen von der Crème de la Crème Hollywoods – Tiere waren, die entweder im Griffith Park lebten oder im angrenzenden Zoo. Nach der ersten Staffel hatte die Show die nötige Mundpropaganda bekommen und die Zusage für eine weitere Staffel. Margot hatte gestern die letzten Folgen nachgeholt. Flora war phänomenal als Leona, eine Löwin, die Probleme mit dem Älterwerden hatte, nicht mehr so gut aussah wie früher und sich Sorgen machte, dass ihre Gesangsstimme nachließ. Die Serie war lustig, düster und eigentlich für Erwachsene konzipiert – die Käfige im Zoo waren ein perfektes Symbol dafür, wie Schauspieler in Schubladen gesteckt und damit quasi eingesperrt wurden –, aber gleichzeitig auch bezaubernd und optimistisch.
Julian hatte inzwischen eine feste Rolle in seiner Polizeiserie. Er musste gutes Geld verdienen, und sie glaubte nicht, dass er Good Company noch mitfinanzierte. Wozu auch? Er war ja nie da.
Ihr war klar, dass Flora und Julian eingefleischte Gewohnheiten und andere Prioritäten hatten, aber warum musste es ihr deswegen peinlich sein, wenn sie zu Rubys Party Mini-Lobster-Rolls haben wollte? Am liebsten hätte sie ein Team aus ihrem Lieblingsrestaurant in Cape Cod eingeflogen und ein gutes altes Clam Bake am Strand organisiert. Aber dann hatte sie Floras Gesichtsausdruck gesehen, als sie ihr davon vorschwärmte. Picknicktische mit Wachspapier, auf denen das Essen verteilt lag: Muscheln, Hummer, Krebse, Mais, Kartoffeln, Töpfe mit zerlassener Butter, und alle bedienten sich mit den Händen. Letztendlich war es Rubys Party. Die Gäste waren ihre Freunde und Floras und Julians Freunde, also musste Margot eben eine Nummer runterschrauben. Burger (Kobe-Rindfleisch), Hot-Dogs (Wagyu), und mit den Mini-Lobster-Rolls musste Flora dann eben klarkommen.
Sie ging langsam und tat, als sähe sie sich die Schaufenster an. Womöglich saß Mia in ihrem Auto und beobachtete, wie sie sich nach dem Interview verhielt. Die Jensens. Eine ganze Weile lang hatte sie jeden Tag an die Jensens gedacht, sich gefragt, was sie zum Frühstück aßen, ob sie wieder arbeiteten, ob sie versuchen würden, noch mal ein Kind zu bekommen. An Feiertagen und Wochenenden hatte sie an sie gedacht, sich gefragt, ob sie weggezogen waren, in eine andere Stadt. Eine Zeitlang rechnete sie ständig damit, ihnen über den Weg zu laufen, weil es in New York die Regel zu sein schien, dass man vor allem Leuten begegnete, denen man auf keinen Fall begegnen wollte, doch dazu war es nicht gekommen. Manchmal verspürte sie den Drang, im Internet nach ihnen zu suchen, herauszufinden, wie sie jetzt lebten, aber sie hatte Angst, ein Fenster in die Dunkelheit zu öffnen und verschluckt zu werden, die Schatten zurückzuholen, die sich seit ihrem Umzug nach Los Angeles zurückgezogen hatten.
Sie schlenderte die Straße hinunter und betrat einen Buchladen, in den sie regelmäßig ging. Im Seitenflügel standen die Kunst- und Fotobände. Sie hatte Ruby zum Highschool-Abschluss eine Digitalkamera gekauft, weil sie sich für Fotografie interessierte und ein Künstlerauge besaß. Vielleicht fand sie noch ein schönes Buch für sie. Als sie die Tische durchstöberte, entdeckte sie vor dem Laden einen Mann, der sie beobachtete, seine Handykamera auf sie richtete und dann nachsah, ob die Fotos etwas geworden waren. Kameras. Sie entkam ihnen nicht. Sie drehte sich vom Fenster weg und wühlte in der Handtasche nach ihrem Handy, um Flora eine Nachricht zu schreiben. Aus dem Augenwinkel sah sie den bärtigen Mann seine Bilder einer Frau zeigen und dann in Richtung der echten Margot zeigen.
Was war das bloß für eine Welt.
Drei
Der Ring lag auf dem Küchentisch wie ein Stück Kryptonit. Flora starrte ihn an. Wie konnte er nur all die Jahre unbemerkt unter ihrem Dach gelegen haben? Wie konnte sie seine Hitze nicht gespürt, den Gestank des gebrochenen Schwurs nicht gerochen haben, denn warum sonst hätte Julian ihn verstecken sollen? Das verräterische Herz.
Als junges Mädchen hatte Flora versucht, Momente in ihrem Gedächtnis zu »fixieren«. Die Vorstellung, dass Jahre ihres Lebens vergingen und sie sich nur an Bruchstücke, an Sekunden würde erinnern können, ängstigte sie. Sie entwickelte einen Plan. Wenn sie von der Schule nach Hause ging, mit Freunden unterwegs war oder einfach nur am Schreibtisch saß, dachte sie: Das jetzt. Erinnere dich daran. Es ist 1978, 1981, 1993 und die Situation ist die: Du läufst bei glitzernder Weihnachtsbeleuchtung durch die Third Avenue in Bay Ridge; du sitzt im Fort Hamilton Park im Schatten der Verrazzano-Brücke unter einem Baum; Sonntagsessen, der Tisch biegt sich unter Schüsseln mit Spaghetti, überbackenen Auberginen und gefüllten Artischocken. In gewisser Hinsicht funktionierte das, aber das Besondere an dem Moment ging natürlich verloren – die Gerüche, die Geräusche, die Menschen, ihre Stimmung. Zurück blieb eine Handvoll Erinnerungen, darunter ihr eiserner Wille, sie heraufzubeschwören.
Aber dieser Moment? Den würde sie bestimmt nicht vergessen. Wie sollte sie den Ring in ihrer Hand verstehen? Sie hatte Lust auf Kaffee. Komisch, nach der einen morgendlichen Tasse trank sie eigentlich nie noch mehr Kaffee, davon wurde sie immer ganz zittrig. Während sie das Pulver aus dem Kühlschrank holte und in den Filter schüttete, wurde ihr bewusst, was sie da tat. Sie beschwor ihre Mutter und ihre Tanten, ihre Beschützerinnen, die alle längst tot waren. Die sicherste Methode, die Mancini-Schwestern auf sich aufmerksam zu machen – selbst im Jenseits – war Kaffee, in welcher Form auch immer: im Filter, frisch aufgebrüht, abgestanden und verbrannt, aufgewärmt in der Mikrowelle. Die Wohnung ihrer Mutter roch wie der Lebenszyklus einer Kanne Kaffee. Sie wusste nicht, wie sie das machten, diese Frauen. Sie lebten von Kaffee und Zigaretten und kochten den ganzen Tag Essen, das sie kaum anrührten. Sie aßen zwei Gabeln Pasta oder knabberten an einer Piccata Milanese, standen dabei am Herd und stocherten in den Kalbsschnitzeln, die in der gusseisernen Pfanne vor sich hin brutzelten. Sie aßen einen halben Cannolo und tunkten den Knust von einem Laib Brot in die Tomatensauce. Sie kosteten. Aber ihr Verlangen nach Kaffee und Zigaretten war unerschöpflich. Sie wollte sie um sich spüren, jetzt, wo …
Tja. Jetzt, wo was?





























