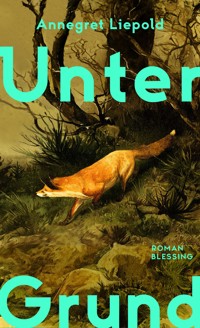
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo beginnt die Schuld?
Inmitten des Schweigens ihrer Familie hat Franka sich schon immer verloren gefühlt. Bereits ihre Großmutter, genannt die Fuchsin, hortete Geheimnisse wie die schwarzen Steine in ihrer Schürze. Als Franka mit Ende Zwanzig in die fränkische Provinz mit den Himmelsweihern und Spiegelkarpfen zurückfährt, sieht sie endlich hin: Wie das war in den Nullerjahren, als Deutschland Weltmeister im eigenen Land werden wollte. Als ihr Vater starb und sie in Patrick und Janna Gleichgesinnte fand, die Unsicherheit mit Krawall, Frustration mit Faustschlägen übertünchten. Als sie immer tiefer in die rechte Szene einstieg. Sie beginnt Fragen zu stellen und sucht nach einer Haltung zur Vergangenheit.
»Wie umgehen mit der Sehnsucht nach Zugehörigkeit, radikaler Wut und den blinden Flecken der eigenen Familie? Am Ende wird klar: Schweigen hat ein Verfallsdatum.« Börsenblatt
»Was auch heute in Deutschland mehr oder minder im Untergrund rumort, bringt Annegret Liepold mutig zur Sprache.« Abendzeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch:
Inmitten des Schweigens, das nicht erst seit dem Tod ihres Vaters die Familie dominiert, hat sich Franka schon immer verloren gefühlt. Bereits ihre Großmutter, genannt die Fuchsin, hortete Geheimnisse wie die schwarzen Steine in ihrer Schürze. Als Franka mit Ende Zwanzig in die fränkische Provinz mit den Himmelweihern und Spiegelkarpfen zurückfährt, sieht sie endlich hin: Wie das war in den Nullerjahren, als Deutschland Weltmeister im eigenen Land werden wollte. Als sie in Patrick und Janna Gleichgesinnte fand, die Unsicherheit mit Krawall, Frustration mit Faustschlägen übertünchten. Als sie immer tiefer in die rechte Szene einstieg. Sie beginnt, längst überfällige Fragen zu stellen, und sucht nach einer Haltung zur Vergangenheit.
Zur Autorin:
Annegret Liepold, geboren 1990 in Nürnberg, hat Komparatistik und Politikwissenschaften in München und Paris studiert. Für die Arbeit an ihrem Debüt Unter Grund erhielt sie zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen, u. a. das Literaturstipendium der Stadt München und die Einladung zur 15. Schreibwerkstatt der Jürgen-Ponto-Stiftung. 2022 war sie Finalistin des open mike.
Annegret Liepold
Unter Grund
ROMAN
Blessing
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Arbeit an diesem Buch wurde gefördert vom Stipendienprogramm des Freistaats Bayern Junge Kunst und neue Wege, durch den Leonhard und Ida Wolf-Gedächtnispreis der Stadt München und die Schreib-Residency der Monacensia im Hildebrandhaus.
Copyright © 2025 by Annegret Liepold
Copyright © 2025 by Karl Blessing Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Gaeb & Eggers
Redaktion: Friederike Arnold
Umschlaggestaltung: LNT-Design
Umschlagabbildung: Carl Friedrich Deiker, Fuchs auf der Pirsch, 19. Jh. (Ausschnitt), BillerAntik.de
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33050-7V006
www.blessing-verlag.de
Für J.
1
Noch könnte Franka umkehren und zurück ins Gerichtsgebäude gehen.
Barfuß sitzt sie auf einer Bank am U-Bahngleis Stiglmaierplatz, wartet bis die Kälte ihr in den Körper kriecht. Die einfahrende U-Bahn wirbelt ihre Haare auf. Ihr Handy klingelt. Die Türen öffnen sich, niemand steigt ein oder aus. »Vorsicht bei der Abfahrt«, sagt der U-Bahnfahrer trotzdem. Die Türen schließen sich, die U-Bahn fährt weiter. Auf dem Display drei entgangene Anrufe, zwei von HK, einer von Hannah.
Anstatt aufzustehen, schaltet sie das Handy aus. Ihr Körper fühlt sich so schwer an, dass sie das Gefühl hat, sich nie wieder bewegen zu können.
Jemand setzt sich neben sie. Franka blickt weiter starr auf den Boden.
»Hey«, sagt Hannah, »was ist denn los? Warum bist du weggerannt?«
Hannah wartet, aber Franka weiß nicht, was sie sagen soll. Was sie weiß, ist: Sie hätte nie zum Prozess gehen dürfen.
»Jaroš hat Zschäpe eine Nazischlampe genannt«, sagt sie stattdessen.
Hannah sieht sie verständnislos an. Franka sucht nach weiteren Worten, aber es fehlt ihr an allen. Jede Erklärung würde eine neue Erklärung verlangen. Wo soll sie anfangen, hier und jetzt an diesem zugigen U-Bahngleis, wo alle Fäden lose sind, und egal, an welchem sie zöge, immer nur ein weiterer einzelner Satz hervorkäme, der noch mehr Unverständnis bei Hannah hervorriefe.
»Und das findest du unangemessen?«
Franka schüttelt den Kopf. Wie sollte sie erklären, dass es nicht um Jaroš oder Zschäpe geht. Am besten wäre, sie würde sagen: Lass uns Leben tauschen, ich nehme deine Vergangenheit und du meine. Nur dann könnte Hannah verstehen, was los ist.
Am Morgen hatte Franka die Klasse am Eingang zum Oberlandesgericht um sich geschart. Die Schülerinnen trugen knappe Spaghettitops und kauten ausdruckslos Kaugummi, die Jungen rochen nach zu viel Deo.
»Gleich begegnen wir ’ner echten Mörderin!«, sagte Jaroš, der immer alles kommentieren musste.
»Halt’s Maul!«, herrschte ihn eines der Mädchen an.
Vielleicht wären sie lieber ins Kino gegangen, aber wie sie da vor ihr standen und sie mit großen Augen ansahen, wirkten sie fast interessiert. Sie stellte ihnen ihre Mitbewohnerin Hannah vor, die als Journalistin regelmäßig über den NSU-Prozess berichtete. Ihr Betreuungslehrer, Hans Koser, den die Schüler und Schülerinnen, und insgeheim auch sie, nur HK nannten, nickte ihr begeistert zu. Es war genau das Engagement, das er sich von seiner Referendarin wünschte.
»Der Prozess läuft seit 2013«, begann Hannah ihre Einführung, »mittlerweile sind wir also schon im vierten Verhandlungsjahr, genauer gesagt am 377. Verhandlungstag. Heute beginnen die Abschlussplädoyers, und man erwartet längst nicht mehr, dass neue Erkenntnisse ans Tageslicht kommen.«
»Warum das alles dann?«, fragte eine Schülerin.
»Weil es das Gesetz so vorschreibt. Aber auch aus Anstand und Respekt gegenüber den Opfern und deren Familien. Wir berichten regelmäßig über die Verhandlung, ich arbeite aber auch in einem Team, das den Prozess protokolliert. Im Protokoll versuchen wir, alles so genau wie möglich festzuhalten. Trotzdem sind das Prozessgeschehen, und das, was wir aufschreiben, zweierlei Dinge. So vieles, was nicht gesagt werden kann und sich der Mitschrift entzieht: Das Haspeln und Verstummen der Zeugen, all die verzweifelten Gesten der Angehörigen, die vielsagenden Blicke, die Verteidiger und Angeklagte untereinander austauschen. Es ist gut, dass ihr da seid und das alles selbst miterlebt«, sagte Hannah.
»Und warum, wenn ich fragen darf«, schaltete sich HK ein, »führen Sie als Journalisten überhaupt Protokoll? Das ist doch ungewöhnlich, oder?«
»Weil die Strafprozessordnung in Deutschland kein Wortprotokoll vorsieht, und auch keine Kameras im Gerichtssaal erlaubt sind. Es gibt natürlich ein Gerichtsprotokoll, aber in dem steht nicht wortwörtlich, was gesagt wird. Gerade bei diesem Prozess, einem der wichtigsten seit der Wiedervereinigung, ist es aber entscheidend, wirklich alles festzuhalten.«
Franka stand etwas abseits vom Schülerpulk und beobachtete, wie die Klasse an Hannahs Lippen hing. Hannahs Pathos war übertrieben, aber es wirkte. HK unterbrach Hannah immer wieder, um Fragen zu stellen, verhaspelte sich, ermahnte, wenn er nicht weiterwusste, die Schüler. Frankas Schuhe passten ihr nicht richtig, sie sollten ihr die Seriosität verleihen, die HK von ihr forderte. Sie spürte schon jetzt die Blasen, und trat unruhig von einem Bein aufs andere. Die Schüler trugen allesamt Sneaker, obwohl sie sich sonst sofort beschwerten, wenn sie über einen Kamm geschoren wurden. Sie wollten gleichbehandelt werden und doch voneinander verschieden sein. Gemocht wurde, wer es verstand, sich anzupassen und zugleich aus der Masse heraustrat. Hannah wusste sich diesen Spagat zunutze zu machen. Sie forderte die Einzelnen heraus, indem sie Sätze sagte wie »Das Schwarz-Weiß des Protokolls bietet viel zu wenig Raum für die Realität«. Dann holte sie alle mit einem Zwinkern wieder ins Boot, ganz so, als habe sie das Gesagte nur ironisch gemeint. Als HK nach einem wichtigen Dokument in seiner Tasche kramte, nutzte Hannah den Moment, um die Augen zu verdrehen und die Klasse zum Kichern zu bringen. Dann wiederum unterbrach sie die Heiterkeit scharf: »Ihr wisst, dass dieser Prozess stattfindet, weil zehn Menschen ermordet worden sind, neun davon aus rassistischen Motiven. Wenn ihr Scheiß machen wollt, bleibt lieber gleich draußen. Wir gehen jetzt durch den Sicherheitscheck. Innen sind Spinde, wo ihr eure Sachen verräumen könnt. Alles, auch die Handys. Seid leise auf der Besuchertribüne, wer die Verhandlung stört, fliegt raus.«
Hannah hat ihre Sachen im Gericht zurückgelassen. Die Verhandlungspause ist bald vorbei. Franka spürt ihre Ungeduld. Sie muss rechtzeitig zurück sein, um kein Detail zu verpassen. Über drei Jahre hat Zschäpe auf Anraten ihrer Anwälte im NSU-Prozess geschwiegen. Schweigt eine Angeklagte, darf das nicht gegen sie verwendet werden. Aber Schweigen hat ein Verfallsdatum. Als Franka im fensterlosen Gerichtssaal saß und auf Zschäpe hinunterblickte, war ihr das mit einem Schlag klar geworden. Kaum ist das Datum überschritten, beginnen die Worte in einem zu gären, wandeln sich nach und nach zu etwas Unberechenbarem. Hätte sie Hannah vor fünf Jahren von Janna und Patrick erzählt, gleich nachdem sie zu ihr in die WG gezogen war, hätte Hannah sie vielleicht einfach in den Arm genommen und gesagt: »Aber heute bist du eine andere.«
Doch sie hat das Verfallsdatum zu lange ignoriert, die Worte sind giftig geworden. Wenn sie jetzt den Mund öffnet, wird Hannah ihr vorwerfen, dass sie so lange geschwiegen hat, und ihre Freundschaft ist womöglich vorbei. Wenn sie weiterhin nichts sagt, auch.
Erst kürzlich gab es einen Moment, wo sie Hannah alles hätten beichten können. Eine Schulfreundin von Hannah war nach ihrer Trennung vorübergehend zu ihr mit ins Zimmer gezogen, und aus ein paar Tagen waren schnell zwei Wochen geworden. Ob Franka das Gleiche für alte Freunde machen würde,wollte Hannah von ihr wissen. Und ob sie noch Kontakt zu Leuten aus der Schulzeit hätte. Franka schüttelte den Kopf und hoffte, dass Hannah nicht weiter nachbohren würde. Aber natürlich bohrte Hannah nach: »Warum erzählst du eigentlich nie was von früher? So schlimm kann es doch nicht gewesen sein.«
»Weil es nichts zu erzählen gibt«, hatte Franka behauptet und sich schrecklich gefühlt. Noch nie hatte sie Hannah so direkt angelogen.
Es ist nur eine dünne Wand, die Frankas Leben und Hannahs Leben voneinander trennt. Wahrscheinlich hört Hannah das Schweigen jede Nacht im Nebenzimmer rumoren, fragt sich längst, was mit ihrer Mitbewohnerin nicht stimmt. Ihre Freundschaft ist nur zu retten, wenn sie Abstand voneinander gewinnen.
»Ich glaube, es ist besser, wenn ich ausziehe«, sagt Franka und möchte die Worte im gleichen Atemzug wieder zurücknehmen. Hannah sieht sie entsetzt an.
»Du willst was?!«
»Ausziehen«, sagt sie und versucht, ihrer bröckelnden Stimme Festigkeit zu geben.
»Du willst dir lieber in München eine neue Wohnung suchen, als endlich mit mir zu reden?! Bist du verrückt?«
Hannah ist aufgestanden. Sie wirkt verwirrt. Jetzt, denkt Franka, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um ihr alles zu beichten. Sie will den Mund öffnen, aber Hannah kommt ihr zuvor: »Ich muss zurück«, sagt sie, »ich muss über das hier erst mal nachdenken.« Sie dreht sich um, und Franka sieht zu, wie sie zum Ausgang eilt und auf der Rolltreppe verschwindet.
Hannah ist weg, und keine Entscheidung, die Franka in den letzten fünf Jahren getroffen hat, ergibt mehr Sinn. Warum lebt sie in München, obwohl sie Großstädte immer gehasst hat? Warum macht sie ein Referendariat, obwohl Schule der Ort ist, mit dem sie nur negative Gefühle verbindet? Warum hat sie überhaupt studiert, wo doch eigentlich klar war, dass sie der Arbeit als Lehrerin nicht gewachsen ist?
Die WG ist ihr Zuhause, und genau dorthin kann sie nicht zurück. Um die Traurigkeit in Schach zu halten, versucht sie, sich auf das zu konzentrieren, was da ist, studiert graue Kaugummiflecken auf grauen Fliesen, überlegt, wer womöglich schon alles hierhin gekotzt haben könnte. Als Zschäpe das jahrelange Schweigen nicht mehr aushielt, ist ihr ein Fehler unterlaufen: Sie hat gesprochen, um des Sprechens willen. Anstatt Antworten zu liefern, hat sie gemeinsam mit ihrem Anwalt verfasste Worthülsen vorgetragen, die die Angehörigen noch mehr vor den Kopf stießen. Anstatt die Taten aufzuklären, hat sie sich selbstmitleidig in Ausreden geflüchtet. Franka erinnert sich noch an Hannahs Wut, als sie beim Abendessen von Zschäpes enttäuschenden Aussagen erzählte, die nur eins zeigten: Dass sie nichts bereute. Wenn sie will, dass Hannah ihr verzeiht, dürfen die Worte, die sie ausspricht, nicht mehr giftig sein. Sie muss verstehen, was damals passiert ist, und zurückfahren, an den Ort, der sie ausgespuckt hat wie einen lästigen Kaugummi. Sie weiß nicht, was schlimmer ist: Dass nichts mehr so sein könnte, wie sie es in Erinnerung hat, oder dass alles noch genauso bedrückend ist wie damals.
Zurück in der WG packt Franka nur das Nötigste. Jedes Foto von Hannah und ihr, ob beim Grillen an der Isar oder rauchend auf dem Balkon, die nackten Beine lang über die Brüstung gestreckt, erinnert sie daran, was sie leichtfertig aufs Spiel gesetzt hat.
Sie muss daran denken, wie sie beim WG-Vorstellungsgespräch nicht von sich gesprochen hatte, sondern von den Kräutern, die sie auf dem Balkon anpflanzen würde. Warum sie eigentlich Lehramt studieren wolle, hakte Hannah ein, und Franka antwortete schnell: »Weil mir sonst nichts Besseres einfällt.« Später erzählte ihr Hannah, dass sie Franka wegen dieser ehrlichen Antwort sofort sympathisch gefunden habe. Dabei war die Antwort gar nicht ehrlich. Aber Franka hätte ja schlecht sagen können: Als Schülerin war ich ein Loser und jetzt will ich es anders machen. Wer würde schon mit einer Versagerin zusammenwohnen wollen, Hannah, die schon damals ganz genau gewusst hatte, dass sie Journalistin werden wollte, bestimmt nicht.
Franka sieht sich noch einmal in der Küche um, auf der Ablage stehen noch die Kaffeetassen vom Frühstück. Der Gedanke, dass sie wahrscheinlich bald nicht mehr hier mit Hannah wohnt, ist so beklemmend, dass sie wegwill, bevor ihr Entschluss zurückzufahren, ins Wanken kommt.
Nach zweieinhalb Stunden Zugfahrt wartet sie in Erlangen am Bahnhofsvorplatz auf den richtigen Überlandbus, der das Dorf, in dem sie aufgewachsen ist, mit anderen Dörfern tagein, tagaus wie Perlen auf einer langen Kette auffädelt. Der Vormittag im Gericht scheint in einem Paralleluniversum stattgefunden zu haben.
Durch die Scheiben des Busses blickt Franka auf das immer vertrauter werdende Idyll und empfindet keine Wehmut, nur Erleichterung, dass sich ihr Leben mittlerweile so weit davon entfernt abspielt. Entgegen ihrer Befürchtung hat sich auf den ersten Blick nichts verändert. Selbst die Fettflecken an den Busfenstern nicht, handgroße, trübe Stellen, wo erschöpfte Menschen nach einem langen Tag ihre fettigen Scheitel ans Fenster drücken.
Erst der Anblick der Fischweiher, die links und rechts der Bundesstraße auftauchen, ruft ein schiefes Gefühl von Geborgenheit in ihr wach, so wie ein kratziger Wollpullover, der zwar warmhält, aber einen juckenden Ausschlag auf der Haut hinterlässt. Sofort sehnt sie sich nach einem nächtlichen Spaziergang entlang der Weiher, wo sie mit niemandem konfrontiert sein wird außer mit sich selbst und dem auf- und abschwellenden Quaken der Frösche, das jetzt im Juli das Naturschutzgebiet am Rand des Dorfes zum Beben bringt. Die Weiher sind das Einzige, woran sich das Auge festhalten kann, alles andere ist austauschbar. Trotzdem kann Franka anhand des Zusammenspiels von Sonneneinfall und Wiesenton die Jahreszeit bestimmen. Noch sind die Gräser blassgrün, erst im Spätsommer wird der Ton satter. Im September, wenn sich ein R in den Monatsnamen geschlichen hat, beginnt die Karpfensaison, wächst die Vorfreude auf den ersten Fisch, die der salzig-fettige Geschmack der im schlammigen Untergrund wühlenden Weihersau nicht einlösen kann. Aber die Fischzucht hat Tradition, Tausende von Weiher liegen hier in der Flur verstreut, die Natur ist untrennbar mit dem Dorf verzahnt. »Das haben wir schon immer so gemacht«, war ein Satz der Fuchsin, gegen den es keine Widerrede gab. Sobald etwas zum Dorf gehörte, war es da, als sei es immer da gewesen, man fragte nicht nach der Geschichte, weil es keine Geschichte hatte. Als lebte man in einer ewigen Gegenwart. Franka weiß, sobald sie aussteigt, will sie sofort wieder weg, schon jetzt hat sie das Gefühl, nur ein paar Minuten und nicht fünf Jahre weg gewesen zu sein.
Sie erinnert sich noch an die SMS ihrer Mutter, die an einem Januarmorgen in ihren wenige Wochen alten WG-Alltag geplatzt war.
Die Fuchsin ist tot.
Vier Worte nur, doch Franka las die Nachricht ihrer Mutter wieder und wieder, bis das Display erlosch. Einen Moment lang lag sie wie betäubt da, dann stieg sie aus dem Bett und tappte durch das Halbdunkel des WG-Flurs in die Küche. Krümel auf dem Parkett, die sich in die Fußsohlen fraßen, die kalten Fliesen in der Küche, das Morgengrau an der Wand. Die Nacht hatte Farben und Formen geschluckt, flach hingen die Tassen am Regal, kaum hob sich der Kühlschrank von der Wand ab. Sie öffnete die Balkontür und verharrte im Türstock bis die kalte Morgenluft ihr ins Gesicht schlug, dann langsam den Körper hinabkroch, sie in einen kalten, festen Griff nahm. Mit der Frischluft kam die Traurigkeit und gegen die Traurigkeit lehnte sich Erleichterung. Die Fuchsin war tot. Es war endlich zu Ende.
Hannah erschien in der Küche, verschlafen, aber schon vollständig angezogen.
»Was machst du da draußen?«, fragte sie, öffnete den Kühlschrank, stand unschlüssig davor, holte dann ein Glas Marmelade heraus und schraubte den Deckel auf.
»Meine Großmutter ist gestorben«, sagte Franka.
»Oh«, sagte Hannah, »das tut mir leid. Die, die du vor Kurzem im Krankenhaus besucht hast? Ihr wart euch nah, oder?«
»Ja«, sagte Franka, »Aber es war auch kompliziert.«
»Mist«, sagte Hannah und meinte damit die Marmelade, die ihr beim Naschen von der Messerspitze auf die Bluse getropft war.
»Egal«, sagte Franka und meinte damit alles. Sie hatte keine Lust, Hannah von ihrer Großmutter zu erzählen, und noch weniger, darüber nachzudenken, dass sie für die Beerdigung womöglich zurückmusste. »Meine Großmutter hat sich schon lange nicht mehr an mich erinnern können.«
Die Fuchsin hatte sich an überhaupt nichts mehr erinnern können. Je vergesslicher sie geworden war, desto mehr Sachen trug sie mit sich herum, hob alles auf, was sie auf dem Boden fand, und steckte es in ihre geblümte Schürze: Haarklammern, Münzen, vor allem aber Steine, je dunkler desto besser. Die Fuchsin klapperte, wenn sie über die Straße ging und sich bückte. Ihr Leben lang war sie über diese eine Straße gegangen, die durch das Dorf führte, in dem sie aufgewachsen war. Sie hatte die Straße öfter überquert, als sie je hätte Steine tragen können.
Die Fuchsin wohnte auf der einen Seite der Dorfstraße und ihre Zwillingsschwester Magda auf der anderen. Als Kind war Franka zwischen den Häusern hin- und hergependelt, als wäre die Straße nur eine Treppe, die in die nächste Etage führte. Der Fuchsbau, in dem schon Frankas Vater geboren worden war, trug schwer an seinem Schleppdach, das die Grundmauern zusammenstauchte und das Fachwerkhaus kleiner wirken ließ, als es war. Im Vorgarten wuchsen Heckenrosen, deren Blattlausbefall die Fuchsin mit einer Sprühflasche voll Spülmittel bekämpfte. Im Inneren war es eng und dunkel, dafür im Sommer kühl. Die niedrige Küchendecke war vom Ruß des Küchenherds geschwärzt, die Wände von rostroten Flecken gesprenkelt, die sich vermehrten, sobald die Fuchsin mit der Fliegenklatsche eine der unzähligen Mücken erschlug. Am Morgen zündete die Fuchsin den Küchenherd mit alten Zeitungen und Spänen an, damit es im Haus warm wurde, dann machte sie Frühstück. Bei all dem sprach sie nicht. Franka beobachtete sie von der Küchenbank aus und aß ein Honigbrot. Vom Kirchturm erklang zu jeder Viertelstunde ein blechernes Läuten.
Obwohl die Fuchsin sparsam mit Worten gewesen war, hatte sie in den Tod nicht mehr viele mitnehmen können, die meisten waren schon zuvor verblasst: Vergessen müssen und vergessen wollen gingen bei der Fuchsin Hand in Hand. Obwohl das Alzheimermahlwerk die graue Hirnmasse erbarmungslos zerrieb, blieben die frühesten Windungen und hintersten Winkel unberührt. Die Kindheit und das Verdrängte glichen den Steinen in ihrer Schürze, die Mechanik biss sich daran die Zahnräder aus. Aus Stein war auch ihr Mädchenname. Sie sagte nicht »Marlene Zimmermann«, wenn man sie fragte, wie sie denn hieße, sondern antwortete »Leni«, dann Pause, dann schweres Atmen, dann »Fuchsberger«.
Füchse sind wendig und schlau, haben spitze Zähne, wache, katzenartige Augen, vor allem aber sind sie, so der Volksglaube, hinterhältig. Wie der Fuchs, der dem Raben den Käse aus dem Mund schmeichelt. Hüte dich vor Eitelkeit, sagen die, die nur die Fabel kennen. Hüte dich vor der Fuchsin, sagte das Dorf, denn uneitel zu sein, schützte vor der Fuchsin nicht. Eine Schwäche, die die Fuchsin früher oder später entdeckte, hatte jeder. Und die Fuchsin besaß die Schläue, diese zu ihren Gunsten zu verwenden. Die Schläue des Dorfes wiederum bestand darin, jedem den richtigen Namen zu geben, damit der Charakter dem Menschen hellsichtig vorauseilte. Leni hieß Fuchsin und ihre Zwillingsschwester Magda hieß Schwester.
»Schau, da laufen die Fuchsin und ihre Schwester«, sagte das Dorf.
Es ist nicht viel, was von der Fuchsin heute noch übrig ist, der Fuchsbau, ein Stück Wald und ein paar Weiher. In den Augen der Fuchsin trotzdem ein stolzes Lebenswerk. »Einen Wald und ein paar Himmelsweiher«, pflegte sie zu sagen, »damit hat man ausgesorgt«. Im Dorf nannte man die knietiefen Fischweiher so, weil sie sich nicht aus Quellen oder anderen Zuflüssen speisten, sondern auf die Gunst von oben, auf den Regen im Frühjahr und Herbst angewiesen waren. Die Weiher waren unterirdisch miteinander verkettet. Drei oder auch dreißig Weiher konnten eine Kette bilden. Alle zwei, drei Jahre wurden sie im Herbst abgelassen. Abfischen war leichter als Fischen, fast schon zu leicht. Die Tiere lagen im Schlamm und verfingen sich im zuvor ausgelegten Netz. Die, die zuletzt noch übrig waren, wurden mit Händen oder Keschern eingesammelt. Die Gummistiefel quietschten im Matsch, die Fische blieben stumm.
Seit fünf Jahren ist die Fuchsin jetzt tot, und vielleicht war ihr Tod nicht das Ende, wie Franka damals gedacht hatte, sondern überhaupt erst der Anfang. Sie ist das Zentrum gewesen, und seit sie unter der Erde liegt, beginnen die Dinge in Frankas Leben auszufransen.
Die Fuchsin hat nicht mehr mitbekommen, wie die Regenarmut dem Wald und den Himmelsweihern zusetzte, die Fichten vom Borkenkäferbefall marode wurden. Anstatt Ertrag abzuwerfen, wurde der Wald zur Last. Deshalb hatte Frankas Mutter die Fläche an einen Bauern verpachtet, der sich um das nutzlose Altholz und die Wiederaufforstung kümmerte, der die Weiher im Herbst abließ und aufpasste, dass sie nicht versandeten. Fünfzehn Jahre hielt das Arrangement, dann, vor Kurzem, wollte der Bauer den Grund kaufen.
Franka kamen Tränen vor Wut, als ihre Mutter den Verkauf nebenbei am Telefon erwähnt hatte. Sie weinte stumm, presste die Lippen aufeinander, wartete den Moment ab, in dem sie sich ein wenig beruhigt hatte, um dann mit heiserer Stimme zu sagen:
»Aber es ist mein Weiher. Die Fuchsin hat ihn Papa vermacht, und Papa hätte gewollt, dass ich mich kümmere.«
»Aber was willst du denn, du bist doch sowieso nicht mehr da!«, hatte ihre Mutter perplex gerufen, und diese Worte schmerzten mehr als der Verlust an sich. Du bist doch sowieso nicht mehr da. Als wäre Franka freiwillig gegangen.
»Es tut mir leid, Franziska, aber ehrlich gesagt ist die Sache längst besiegelt. Ich hätte dich wohl vorher fragen sollen, aber …«
»Bis bald, Mama. Ich ruf die Tage zurück.«
Sie legte schnell auf, wohlwissend, dass sie in nächster Zeit nicht anrufen würde. Ein halbes Jahr war das Gespräch nun her.
Ingrids Auto steht am Gartenzaun, ein kleiner roter Twingo, mit dem sie auf der Straße kaum Raum einnimmt. Es ist das erste Auto, bei dessen Auswahl sie keine Kompromisse machen musste. Frankas Vater hatte geräumige Autos gemocht und Ingrid immer wieder zu einem Kastenwagen überredet, einem Familienauto, in das er auch seine Angelausrüstung packen konnte. Beim Näherkommen sieht Franka, dass die Haustür sperrangelweit offen steht. Im Vorgarten unterhält sich Ingrid mit einer Frau. Als Franka sie erkennt, duckt sie sich intuitiv hinter den Twingo. Es ist albern, sich wie ein Kind zu verstecken, aber sie darf June auf keinen Fall begegnen. Nach all dem, was heute los war, hat sie keine Lust auch noch ihrer Tante über den Weg zu laufen. Was sollte sie sagen? Hallo June, schön dich zu sehen, ist ein paar Jahre her, aber geht’s gut?
Franka beobachtet, wie Ingrid und June den frisch gemähten Rasen zusammenrechen. June sieht erschreckend alt aus. Ihr Haar ist von weißen Strähnen durchzogen, ihr Gesicht wirkt mager und fahl. Dagegen sieht Ingrid, die nur ein paar Jahre jünger ist, gesund aus, der Teint leicht gebräunt, als habe sie gerade einen längeren Urlaub hinter sich. Der Anblick ihrer Mutter, die in völliger Eintracht mit June im Garten werkelt, versetzt ihr einen Stich. Offenbar ist es ihnen während ihrer Abwesenheit ziemlich gut gegangen. Sie sollte jetzt wirklich hinter dem Auto hervortreten und den beiden wie eine Erwachsene begegnen. Aber dann nähert sich June, den Rechen in der Hand, dem Gartenzaun, und panisch krabbelt Franka hinter der Hecke zur Hauseinfahrt, sieht die offene Garagentür und kriecht auf allen vieren hinein. Sicherheitshalber duckt sie sich hinter einem hohen Stapel mit Winterreifen. Sie hört, wie June Ingrid etwas zuruft, dann ist es eine Ewigkeit lang still.
Dafür ist sie also zurückgefahren: Um sich in der Garage ihrer Mutter vor ihrer Tante zu verstecken. Franka steht auf, wobei sie mit dem Rucksack gegen ein Regal mit Übertöpfen stößt und ein großer Tontopf zu Boden fällt. Das Garagentor wird aufgeschoben, Licht fällt erst auf die Scherben, dann auf sie.
»Franziska?«, ruft ihre Mutter überrascht. »Was machst du denn hier?!«
Sie stehen einander gegenüber, zwischen dem Gerümpel, das sich seit Jahrzehnten in der Garage ansammelt, dem kaputten Rasenmäher der Fuchsin, den ihr Vater reparieren wollte, Frankas Kinderfahrrädern, einem verrosteten Roller, einem platten Hüpfball. Franka weiß nicht, was sie erwartet hat, sicherlich keinen Freudentanz, aber doch, dass ihre Mutter sich freuen würde, sie zu sehen. Aber wie Ingrid dort steht, das Garagentor mit beiden Händen nach oben gestemmt, die Augen zusammengekniffen, ist es offensichtlich, dass ihr der Besuch ungelegen kommt. Franka ist enttäuscht.
»Ich meine, du hättest ja mal kurz Bescheid geben können«, sagt Ingrid, die ihre Enttäuschung zu bemerken scheint, »dann hätte dich doch vom Zug abgeholt. Hast du nicht mehr als den Rucksack dabei?«
Die Frage hört sich wie ein Vorwurf an. Gerade noch hat sie sich wie ein Eindringling gefühlt, im nächsten Moment scheint Ingrid ihr vorzuwerfen, dass sie wohl nicht lange bleiben wird. Egal, was sie tut, immer hat sie das Gefühl, ihre Mutter vor den Kopf zu stoßen.
»Eigentlich wollte ich die hier wegfahren«, sagt Ingrid und zeigt auf ein paar Säcke mit Gartenabfällen, »aber komm doch erstmal rein.«
Franka begleitet ihre Mutter zurück in den Garten. June ist weg. Bevor sie ins Haus gehen, umarmt Ingrid sie, formt mit ihren Armen einen großen, luftigen Kreis, der wie zufällig um Frankas Körper herumreicht.
»Am Sonntag mache ich übrigens ein kleines Sommerfest. Jetzt, wo du da bist, kannst du ja mit uns feiern. Das ist doch schön.«
Die Worte treffen Franka genau dort, wo ihr Misstrauen sitzt, ein unangenehmes Ziehen knapp über dem Bauchnabel: Deswegen will ihre Mutter sie nicht hier haben, weil sie sie ganz bewusst nicht eingeladen hat.
»Super«, sagt sie verletzt, obwohl Feiern mit Ingrids Leuten das Letzte ist, worauf sie Lust hat. Immer wenn sie sich sehen, hofft Franka, dass es zwischen ihnen anders wird. Dass sie ihrer Mutter nahe sein kann, ohne Angst zu haben, ihr zur Last zu fallen, und sie sich ansehen können, ohne vor den Gefühlen der anderen zu erschrecken.
»Soll ich dir einen Kaffee machen?«, fragt Ingrid, als wäre Franka ein Gast.
»Ich mag noch immer keinen Kaffee«, antwortet Franka schroff und fügt dann versöhnlicher hinzu: »Mach doch deine Arbeit. Ich komm schon klar.«
Um die Hitze draußen zu halten, sind die Rollläden im Haus zur Hälfte heruntergelassen. Durch die Schlitze fallen tanzende Lichtpunkte auf den Küchenboden. Im Naturstein sind kleine muschel- oder farnförmige Verwachsungen zu sehen. Als Kind hat Franka Stunden auf dem Boden verbracht, die Muster abgezeichnet, um sie am Nachmittag ihrem Vater zu schenken. Er war eigentlich immer müde, wenn er von der Frühschicht aus der Kugellagerfabrik nach Hause kam. »Der Tag ist noch jung und ich schon so alt«, sagte er dann, bewunderte ihre Zeichnungen und wankte ins Bett, das er bis zum Abendessen nicht verließ. Ihre Mutter schimpfte, weil sie es ungesund fand, schon vor dem Essen zu schlafen, seinen ganzen Rhythmus mache er dadurch kaputt. Aber es wirkte nicht so, als habe ihr Vater eine Wahl.
Franka schaltet den Wasserkocher an und sucht nach einem Tee ohne Süßholzwurzel, was nicht einfach ist. Ingrid besitzt ausschließlich glücksverheißende Yogi-Tees, nur vereinzelt liegen Beutel ohne aufmunternden Sinnspruch in der Schublade. Franka hat ihre Mutter noch nie schlapp gesehen. Nicht mal kurz danach, kurz nachdem ihr Vater … Dafür hat das andere angefangen damals, bunte Tücher überall und Klangschalen. Und Räucherstäbchen. Und überhaupt. Fortan half gegen jede Gefahr ein Shanti, Hand aufs Herz und Nase zum Boden. Mit dem Tod ihres Mannes war Ingrid zum Klischee geworden. Mir geht es gut, uns geht es gut. Ein bisschen Gras und ein bisschen Frieden. Dass sie Kaffeefahrten nach Nepal mache, zog Franka ihre Mutter früher auf, aber Ingrid ging nie darauf ein. Na und, sagte sie, sie sei ja auch Witwe. Was machen alte Frauen sonst? Dabei war Ingrid gerade mal Ende dreißig, als sie mit Franka alleine war.
Mit einem leisen Plopp schaltet der Wasserkocher in den Ruhezustand. Das Wasser brodelt. Franka versucht das Wasser in eine Tasse mit Pfefferminztee zu gießen. Ein großer Schwall landet daneben, tropft von der Ablage auf ihre Zehen. Fluchend zerrt sie den nass gewordenen Socken vom verbrühten Fuß. Dann legt sie den Kopf für einen kurzen Moment auf dem kalten Steinboden ab. Die Stille im Haus ist so drückend und dumpf wie eh und je, als hätte Franka den Kopf unter Wasser gesteckt. Sie hält es keine Sekunde länger in diesem leeren Haus aus.
Vom ehemaligen Weiher ihres Vaters kann Franka durch die Zweige der Bäume hindurch die Autobahn erspähen. Auf der Fahrspur Richtung Süden stauen sich die LKWs. Obwohl die Entfernung zwischen Weiher und Straße drei bis vier Kilometer betragen muss, hört man, wenn der Wind wie gerade von Osten kommt, den Verkehr deutlich. Der Anblick der A3 verhöhnt die Geborgenheit, die Franka von dem Ort in Erinnerung behalten hat. Sie versucht das Gewässer zu umrunden, aber der alte Trampelpfad ist zugewuchert. Kröten, die sich am Ufer sonnen, springen mit schweren Bäuchen träge ins Wasser, sobald sie die Erschütterung ihrer Schritte spüren. Das Dickicht, die Hitze und der faulige Geruch erinnern an Wälder in tropischen Breitengraden, nur dass es so aussieht, als hätte jemand die Farben aus dem Bild gefiltert. Das Gestrüpp ist wegen des Wassermangels ausgedorrt, der Waldboden staubtrocken. Franka gibt den Versuch auf, sich durch das Unterholz zu schlagen und kehrt zurück ans schilffreie Ufer. Als sie sich setzt, verdecken die Blätter der Bäume die Straße, sodass die Welt wieder so eng wird wie früher.
Der Geruch von Algen, Fisch, Schlick und Sand lässt sie an die Samstage denken, wenn sie mit ihrem Vater noch vor dem Frühstück auf Kontrollgang zum Weiher ging. Das Licht fiel schräg durch die Zweige und spreizte sich in der feuchten Luft. Ihr Vater zeigte auf Spinnweben am Wegrand, die taunass im Bodenlaub glitzerten. Wenn das Rufen eines Vogels erklang, verstummte er mitten im Satz, damit auch sie aufhorchte. Sobald sie am Weiher ankamen, beobachteten sie schweigend, wie die Karpfen mit ihren hervorstehenden Mäulern die Wasseroberfläche für einen Moment in Aufruhr versetzten, bevor sie wieder abtauchten, um mit ihren Barteln am Grund nach Nahrung zu suchen. Erst auf dem Rückweg sprachen sie wieder, erzählte ihr Vater, dass Frankas Großvater, der Jäger gewesen war, ihm nach und nach alles mitgegeben hatte, um sich um den Wald und die Weiher kümmern zu können.
Jetzt, denkt Franka bitter, könnte Leon sie nicht mehr spöttisch Großgrundbesitzerin nennen. Jetzt ist sie einfach nur noch Franka. Vielleicht hat sie den Namen deshalb behalten, weil er trotz allem, was passiert ist, das Beste war, was sie von hier hatte mitnehmen können.
»Du warst bestimmt so ein Kind, das sich nichts hat anmerken lassen, wenn dir ein anderes Kind an den Haaren gezogen hat. Du hast es einfach angesehen, so ernst, wie du immer schaust, und es ist davongerannt«, sagte Leon, als sie das erste Mal zusammen den Tanzkurs schwänzten. Franka gefiel sofort, dass er dachte, sie sei stark. Leon war gerade erst ins Dorf gezogen, weil sich seine Eltern getrennt hatten. Bei ihm konnte sie sein, wer immer sie sein wollte. Er sagte oft Sätze über sie, die schön klangen, aber wenig mit der Wahrheit zu tun hatten. Trotzdem korrigierte Franka ihn nur selten. Sie mochte, wenn er sie dabei so durchdringend ansah, als wollte er ihre Gedanken lesen. Als steckte da etwas in ihrem Kopf, das ihn brennend interessierte.
Umso aufgeregter war sie, als sie ihn das erste Mal mit zum Abfischen nahm. Hier konnte sie nicht mehr verstecken, wer sie eigentlich war. Trotzdem wollte sie ihm unbedingt zeigen, dass der Weiher eine verantwortungsvolle Aufgabe und nicht irgendeinen Besitz darstellte. Insgeheim hatte sie gehofft, Leon würde sich genauso dafür begeistern können wie sie, aber schon als sie am frühen Morgen in der Dämmerung durch den Wald radelten, ahnte sie, dass er sie wohl eher für verrückt erklären würde, als ihre Leidenschaft zu verstehen. Jedes Mal, wenn sie den Kopf wandte, um zu sehen, ob Leon ihr folgte, begegnete sie seinem mürrischen Blick. Er rumpelte über die Wurzeln, die aus dem Waldboden ragten, als würde er sie unter seinen Reifen zermalmen wollen. Als sie ankamen, zeigte sich ein erster Lichtstreifen am Horizont. Wie Spiegelscherben, die nur ein feiner Riss voneinander trennte, lagen die Fischweiher in der Waldlichtung. Nur der Weiher, der abgelassen wurde, schien matt vom aufgewühlten Schlamm. Der Bauer, der den Weiher von ihrer Mutter gepachtet hatte, lud Franka jedes Jahr ein, damit sie die Handgriffe nicht vergaß. Bereits am Abend zuvor war der Mönch geöffnet worden, über den sich das Wasser regulieren, von einem ins nächst tiefer liegende Bassin leiten ließ. Die Fische waren gezwungen, sich im vorderen Bereich des Weihers zu tummeln. Es war wichtig, nicht zu viel Wasser abzuleiten, damit genug Sauerstoff für die Tiere blieb und sich das Wasser in der aufgehenden Sonne nicht zu schnell erwärmte. Einige Helfer standen schon im Weiher, zogen Netze durchs Wasser, um die Tiere aufzufangen. Die, die nichts zu tun hatten, tranken am Ufer Kaffee. Die größte Freude würde den meisten das Baggern am Ende bereiten, wenn der Schlick ausgehoben wurde, damit der Weiher nicht mit der Zeit verödete.
Leon schlüpfte in die Gummistiefel ihres Vaters, die mindestens zwei Nummern zu groß für ihn waren. Auch die Wathose schlackerte an den Beinen. Belustigt ließ er die Hosenträger gegen die Brust schnalzen.
»Sie müssen ein bis zwei Jahre auf dem Buckel haben«, sagte der Bauer, der zu ihnen ans Ufer getreten war, und meinte damit die Karpfen. »Erst wenn sie doppelt so lang wie breit sind, gehören sie auf den Teller.«
Leon folgte Franka unsicher die Böschung hinab ins Wasser. Er musste mit beiden Händen die Stiefel festhalten, um sie wieder aus dem Schlamm zu ziehen. Schmatzend setzte er einen Fuß vor den anderen.
»Wie das riecht«, sagte er und verzog das Gesicht so wie ihre Mutter, wenn Franka mit ihrem Vater vom Abfischen nach Hause gekommen war. Je stärker der Wasserpegel sank, desto mehr Vögel kamen, angelockt vom Übermaß an Fressen, das sich hier bot. Halbherzig zog Leon mit am Netz, bemüht, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Franka beobachtete ihn aus den Augenwinkeln. Er versuchte nicht mal so zu tun, als habe er Spaß.
Gegen acht Uhr war ein Großteil der Fische geerntet oder in den anliegenden Weiher übergesetzt worden. Die Fische, die durchs Netz gefallen waren, zuckten im Schlamm und wurden nun mit den Händen eingesammelt. Schritt für Schritt watete Franka voran. Eine tiefe Ruhe überkam sie, wie immer, wenn sie hier war und gebückt einen Fuß vor den anderen setzte. Sie vergaß alles um sich herum, wie alt sie war und wer noch da war. Sie war wieder Kind, und wenn sie aufblickte, würde dort ihr Vater stehen und ihr zuwinken. In einer Tasche am Ufer hatte er Tee mit Saft mitgebracht, und im anbrechenden Morgen würden sie gemeinsam mit allen Helfenden Brotzeit machen, die Ingrid am Abend zuvor vorbereitet hatte, ihr Tribut, damit sie nicht mithelfen musste. Franka blickte auf, aber neben ihr stand niemand, auch Leon nicht. Sie sah sich um. Leon hatte sich ans Ufer gerettet. Er unterhielt sich mit einem Mädchen, schüttete Tee aus Frankas Thermoskanne in einen Plastikbecher. Das Mädchen lachte über etwas, das Leon erzählte, eine große Spiegelreflexkamera baumelte um ihren Hals. Langsam watete Franka auf die beiden zu. Leon winkte, er sah deutlich fröhlicher aus als vorhin.
»Hey«, rief er, »wusstest du, dass die Seen auch Himmelsweiher heißen? Das hat mir Laura gerade erzählt. Sie arbeitet für das Lokalblatt hier.«
»Den Fränkischen Tag«, sagte Laura. »Aber nur manchmal.«
Franka, die am liebsten die Augen verdreht hätte, bemühte sich, keine Grimasse zu ziehen, sondern zu lächeln. Sie hatte Leon schon tausend Mal erzählt, wie und warum die Weiher so hießen, und nie hatte es ihn besonders interessiert. Bestimmt hatte Laura vor einer Stunde auch noch keine Ahnung gehabt, was ein Himmelsweiher war, und in einer Stunde hatte sie dieses Bauernwissen wieder vergessen. Was hatte sie überhaupt hier zu suchen, wer wollte schon von abgefischten Weihern lesen, wenn alle fünf Minuten irgendwo in der Gegend ein Weiher abgelassen wurde? Franka strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und schmierte sich dabei ungeschickt Schlick auf die Wange.
»Wusste gar nicht, was für nette Freunde du hast«, sagte sie zu Franka, und Franka verstand, was sie eigentlich sagen wollte: Wusste gar nicht, dass du überhaupt Freunde hast. Obwohl Laura und sie in die gleiche Klasse gingen, hatten sie bisher höchstens fünf Worte miteinander gewechselt.
»Na dann«, sagte Laura und lächelte Leon an, »ich hab eh alles. Wir sehen uns bestimmt mal in der Schule.«
Sie hob kurz die Kamera, ließ sie dann wieder baumeln, winkte und ging. Seit dem Morgen am See fragte Leon immer wieder nach Laura, scheinbar beiläufig, aber je beiläufiger es wirken sollte, desto mehr ärgerte sich Franka. Laura war doch eine von den Blondies, über die sie im Tanzkurs lästerten. Eine von denen, die Franka in der Schule wie Luft behandelten.
»Hast du davon gewusst?«, fragte Leon, und Franka ließ sich mit der Antwort Zeit, legte sich vom Bauch auf den Rücken, blinzelte in die Sonne und drehte sich eine Zigarette. Sie lagen am Weiher. Seit dem Abfischen waren sie nur noch selten hier gewesen, einmal noch im Winter, als es nicht kalt genug gewesen war, um Schlittschuhlaufen zu gehen. Erst in der vergangenen Woche war Leon der Weiher wieder in den Sinn gekommen. Es war der Nachmittag vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2006, der WM im eigenen Land. Die Welt war zu Gast bei Freunden und ein scheinbar ewiger Sommer hatte sich im Land eingenistet. Auf dem Weg zum Wald hatte Franka im Vorbeiradeln beobachten können, wie ein Nachbar auf der Terrasse die Schutzfolie von seinem neuen Flachbildfernseher zog. Auch im Dorf wollte niemand auf Public Viewing verzichten. Auf dem Bolzplatz kickten Kinder in Deutschlandtrikots auf imaginäre Tore und zankten, wer nun Klose und wer Schweinsteiger sei. Schwarz-rot-gelbe Gesichter kamen ihr auf der sonst leeren Straße entgegen, und selbst auf dem Dorffest hatte der Schützenverein eine Leinwand aufstellen lassen, aus Sorge, dass das Bierzelt sonst leer bleiben würde. Alle fieberten der Eröffnung entgegen. Alle, bis auf Leon. Leon hatte zum WM-Boykott aufgerufen, er werde, so verkündete er Franka, jedes Deutschlandspiel »am Weiher im Wald« verbringen und er hatte auch seine Klassenkameraden eingeladen, ihm dort Gesellschaft zu leisten. Eigentlich hatte Franka keine Lust, den Abend hier zu vertrödeln, aber das Spiel mit Ingrid und ihren Freundinnen anzusehen war noch öder. Ist ja nur Fußball, hatte sie gedacht, sich dann aber doch von der Stimmung auf dem Weg hierher beeindrucken lassen. Ein Drittel der Weltbevölkerung taumelte vor Begeisterung, nur sie lag hier im Dreck und ließ sich von Ameisen in den Arsch beißen. Sie steckte sich die Zigarette in den Mund und zündete sie an. In ihrem Rucksack steckten zwischen Bierflaschen, die inzwischen sicher warm geworden waren, auch ein Paar Flipflops in Deutschlandfarben, die sie nach der Schule im Ein-Euro-Laden am Marktplatz gekauft hatte. Sie freute sich schon auf Leons entrüsteten Gesichtsausdruck, wenn sie ihm die Sandalen vor die Füße werfen würde. Es war so heiß, dass sie wider besseres Wissen kurz ins brackig-braune, höchstens knöcheltiefe und erschreckend warme Wasser gestiegen war. Selbst Leon, den es vor den Fischen gruselte, war ihr kurz gefolgt. Nun trocknete der Weiherschlamm an ihren Beinen.
»Huhu, Franka, bist du da? Ich hab dich gefragt, ob du was mitbekommen hast.«
Franka holte das Bier aus ihrer Tasche, eins für sich, eins für Leon, öffnete die lauwarmen Flaschen mit dem Feuerzeug. Träge raschelten die Blätter, hier und da ein Knacksen im Unterholz, vereinzeltes Quaken am Ufer und darüber ein vibrierender Teppich aus Vogellauten, deren Stimmfäden sie trotz der Spaziergänge mit ihrem Vater nicht zuordnen konnte. Franka erkannte nur das helle Zwitschern der Amsel. Mit der Zigarettenglut trimmte sie einen Grashalm bis zum Erdboden. Er kräuselte sich in der Hitze, bevor er verglühte. Dann schüttete sie einen Schluck Bier auf die Stelle.
»Keine Ahnung«, sagte sie schließlich, obwohl es sinnlos war, so zu tun, als wüsste sie nicht, wovon Leon redete.
»Du hast also nicht gewusst, dass sich die NPD bei uns im Dorf trifft?«, fragte Leon noch einmal.
Seit Leons Bruder eine Ausbildung in Nürnberg begonnen hatte, und Leon ihn dort hin und wieder besuchte, fand sie Leon auf einmal so anstrengend. Dinge, die davor keine Rolle gespielt hatten, nahmen plötzlich ungemein viel Raum ein. Franka war nur einmal mit in Nürnberg gewesen, war mit am klebrigen WG





























