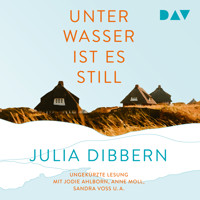14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Ankommen und Loslassen
Nach fast zwanzig Jahren kehrt Maira zurück in den Ort ihrer Kindheit. Sie will nur eins: ihr Elternhaus räumen, das seit dem Tod ihrer Mutter leer steht, und es so schnell wie möglich an einen Investor verkaufen.
Stück für Stück bereitet Maira das Haus für den geplanten Abriss vor und unausweichlich kehren die Erinnerungen zurück – die Tage am Wasser mit ihren besten Freunden, die magischen Begegnungen mit der Natur der Ostseeküste, die schwere Krankheit und der Verlust ihrer Mutter. Und eine alte Frage will endlich eine Antwort finden: Was ist damals während Mairas letzten Tagen auf dem Darß wirklich geschehen?
Bewegend, mitreißend und ohne Kitsch erzählt Julia Dibbern von der vielleicht letzten Chance einer jungen Frau, sich ihren schlimmsten und besten Erinnerungen zu stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
BUCH
Nach fast zwanzig Jahren kehrt Maira zurück in den Ort ihrer Kindheit. Sie will nur eins: ihr Elternhaus räumen, das seit dem Tod ihrer Mutter leer steht, und es so schnell wie möglich an einen Investor verkaufen.
Stück für Stück bereitet Maira das Haus für den geplanten Abriss vor und unausweichlich kehren die Erinnerungen zurück – die Tage am Wasser mit ihren besten Freunden, die magischen Begegnungen mit der Natur der Ostseeküste, die schwere Krankheit und der Verlust ihrer Mutter. Und eine alte Frage will endlich eine Antwort finden: Was ist damals während Mairas letzten Tagen auf dem Darß wirklich geschehen?
AUTORIN
Julia Dibbern, geboren 1971, bekam die Liebe zur Natur und zum Meer in die Wiege gelegt. Nach dem Architekturstudium und der Ausbildung zur Journalistin schrieb sie viele Jahre lang Sachbücher und leitete eine Erwachsenenbildungs-Akademie. Ihre Bücher wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. Sie lebt mit ihrer Familie und einer wechselnden Anzahl von Tieren vor den Toren Hamburgs am Deich. Unter Wasser ist es still ist der erste Roman von Julia Dibbern bei Limes.
Weitere Informationen unter: www.juliadibbern.de
JULIA DIBBERN
UNTER WASSER IST ES STILL
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Limes
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: © plainpicture/mia takahara
Bildnachweis Widmung: Adobe Stock/Illustrator ad_stock
BSt · Herstellung: DiMo
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30376-1V002
www.limes-verlag.de
Wale, so heißt es, sind die Hüter der Erinnerung. Vielleicht haben die Menschen sie deswegen seit Jahrhunderten erbarmungslos gejagt, weil Vergessen manchmal leichter ist als Erinnern – wo man herkommt, wer man einmal war und auch, wer man sein könnte.
Soeterhoop, vor 17 Jahren und acht Monaten
In späteren Jahren sollte Maira diesen Tag als den in Erinnerung behalten, von dem an sie allein war in der Welt.
Dabei hatte er begonnen wie jeder andere: mit dem Wischen des Fußbodens (heute im Flur) und dem vergeblichen Versuch, Mama den nassen Schlafanzug ohne Gegenwehr auszuziehen. Es war Oktober, unter den langen Ärmeln würde niemand die blauen Flecke an Mairas Armen und Schultern sehen. Wie jeden Tag hatte sie die Sicherung für den Herd ausgeschaltet und darauf geachtet, dass alle Türen abgeschlossen waren.
Der Schulweg führte am Bodden entlang, durch kühle, neblige Dämmerung. Gegen den Wind. Gefühlt verlief ihr ganzes Leben gegen den Wind, das war nicht weiter bemerkenswert. Auch daran, dass sie zu spät kam, hatten sich alle mit Ausnahme von Herrn Bartelsen gewöhnt. Maira störte sich nicht mehr an seinem tadelnden Hochziehen der Augenbrauen, sondern schob sich an solchen Tagen einfach auf ihren Platz in der Nähe des Fensters neben Jasper und zog ihre Mathesachen aus dem Rucksack, während Herr Bartelsen den Gauß-Algorithmus erklärte oder was auch immer sonst gerade auf dem Lehrplan stand. Herr Bartelsen hielt sich immer an den Lehrplan, Maira konnte sich nicht vorstellen, dass er jemals etwas Spontanes getan hatte.
Auch nach der Schule war der Tag weitergegangen wie jeder andere.
Mama versorgen.
Mittagessen.
Rausgehen, abschließen.
Aber irgendwann zwischendurch war er zerbrochen.
Und jetzt war nichts von ihm übrig als das Brennen von Mairas zerschrammten Händen, das Stechen in ihrer Lunge bei jedem keuchenden Atemzug und der Nachhall von Jaspers Stimme. »Hör auf, Maira, du kannst bei dem Wetter nicht ins Wasser gehen. Hör auf!«
Seine Worte warfen Echos in ihrem Kopf, seine Weigerung, ihr beim Retten des Wals zu helfen, in ihren müden Armen. Also hatte sie das alte Surfbrett ohne ihn zum Wasser gezerrt, war ohne ihn hinausgepaddelt, hatte sich ohne ihn dem Sturm und dem Geisternetz gestellt.
Jetzt war die Welt in Aufruhr, die Baumwipfel über ihr bogen sich im Sturm, rauschten, brausten, ließen Äste und Blätter auf den schmalen Weg niederprasseln, der mitten am Tag dunkel geworden war wie der Himmel. Donner grollte, hallte wider im Geäst und in den Farnen, über dem Meer gingen krachend Blitze nieder, während sie über den Lenker geduckt gegen den Wind anstrampelte und kaum merkte, wie ihre Lunge und ihre Muskeln brannten, wie das Blut ihrer aufgeschrammten Haut den Regen rosa färbte.
Wieder blitzte es in der Ferne. Sie hatte die Sicherung nicht ausgeschaltet.
Ihre Hände waren kalt vom Meer, von der Hilflosigkeit, vom Regen, die Kleidung klebte ihr wie die Haare am Körper, das Rad holperte über Wurzeln und Steinchen, einer der hüfthohen Farne lag quer über dem Weg, verfing sich in den Speichen, riss, als Maira ihm ihre Wut und Angst entgegenschleuderte und weiterfuhr und fuhr und fuhr, Jasper irgendwo hinter ihr.
Die Sicherung. Die Pfanne mit dem Bratöl.
Sekunden und Minuten donnerten unisono mit dem Unwetter, verfingen sich in ihrem keuchenden Atem, zerrannen schneller als die Sturzbäche von Schlamm und Wasser auf dem Waldweg. Dann kam endlich die Waldkate in Sicht, die Bank mit dem Papierkorb, das Stromhäuschen. Gleich, nur ein Stück noch, nur ein … Lichter.
Blaue, flackernde Lichter hinter der Faulbaumhecke, die ihr Grundstück umgab.
Sie spiegelten sich in den tief hängenden Wolken, färbten das gelbe Gewitterlicht geisterhaft blau. »Nein!«, krächzte Maira. Und dann noch einmal »Nein!«, als sie um die Ecke bog und das Rad auf den nassen Sandsteinen schlitterte.
Menschen in Uniform, Nachbarn, Herr Bartelsen. Warum war Herr Bartelsen hier? Feuerwehrautos, ein Rettungswagen. Der Hof war voll davon, irgendwo weit hinten registrierte Maira, dass sie die Wiese zerfahren hatten. Sie durften nicht hier sein, sie durften das nicht. Maira sprang ab und warf das Rad zur Seite, es schepperte, und sie rannte, obwohl sie doch wusste, dass sie zu spät kam. Es roch nach Rauch.
Sie wollte ins Haus, aber jemand stellte sich ihr in den Weg. Eine Uniformjacke, ein Namensschild, eine Brust, gegen die sie hämmerte, sie sollten sie durchlassen. »Maira, du kannst da jetzt nicht reingehen.«
Sie hämmerte weiter, versuchte, die Uniformjacke wegzuschubsen und sich vorbeizudrängeln. Hände hielten ihre Arme, Männerhände. »Maira, wir kümmern uns um deine Mutter, alles wird gut.«
Aber nichts war gut. Erneut versuchte sie, sich loszureißen und doch noch irgendwie ins Haus zu kommen, um die Sicherung auszuschalten, die Blaulichter und die Menschen zum Verschwinden zu bringen. Und dann noch einmal. Die fremde Hand hielt sie fest.
Jemand legte ihr eine Decke um die Schultern. »Du bist ganz nass, Kleine.« Eine Frau. Maira kannte die Stimme. Jaspers Mutter. »Komm, du musst erst mal wieder warm werden, du holst dir ja sonst was weg. Wo warst du denn nur?«
Und dann hatte sie keine Kraft mehr. Sie rutschte einfach zusammen, bis sie auf dem Boden saß, im Regen, mit der Decke um die Schultern zwischen den flackernden Lichtern. »Maira, Kind. Komm.«
Jaspers Mutter hockte sich vor sie und verstellte ihr den Blick, aber sie konnte trotzdem alles sehen. Die Tür und die Trage und den Krankenwagen.
Frankfurt, 23. Mai
Am 23. Mai wäre meine Mutter fünfundfünfzig geworden. Meistens ist das Mädchen, das ich war, weit weg. Aber an diesem Tag sind die Schleier zwischen den Zeiten dünn.
Mein Rad quietscht. Viel langsamer als sonst fahre ich zur Arbeit, einmal überholt mich sogar ein Jogger. Die Welt um mich herum scheint nicht zu mir zu gehören – oder ich nicht zu ihr. Ich bewege mich lediglich durch sie hindurch, während Frankfurt schwülwarm erwacht.
Sonst genügen die Geräusche, um die Maira von damals fernzuhalten. Rauschen, Brummen, Kreischen, Summen, Sägen, Singen – je bunter die Kakofonie der Stadt, desto sicherer steht der Damm zwischen dem Alltag und dem, was im Schlick meines Unterbewusstseins schwelt. An dem Tag, der der Geburtstag meiner Mutter gewesen wäre, genügen sie nicht.
»Schlecht geträumt?«, fragt Ingmar, als ich ihn vor der Tür zur Werkstatt treffe.
Auch ohne zu träumen kann man üble Nächte haben. Ich weiß nur, dass ich schwitzend und in meine Decke verheddert aufgewacht bin. Nichts, was ich mit meinem Boss diskutiere.
»Hast du einen Plan für heute?«
Ich nicke. Ich habe vor, an dem Gründerzeitstuhl weiterzuarbeiten, den ich derzeit restauriere. Bis heute Abend muss er fertig sein, morgen spätestens soll Oleg ihn ausliefern.
Prüfend sieht Ingmar mich an. Er ist ein feingliedriger Mann mit Goldrandbrille, kaum größer als ich, der Schnauzbart ebenso weiß wie seine Haare. »Sicher, dass wir dich allein lassen können? Siehst aus, als würdest du gleich zusammenklappen.«
»Geht schon.«
Im Inneren des Transporters rumpelt es, Olegs Kopf erscheint hinter einer Kiste. »Irgendwann kriegst du ein T-Shirt mit Geht schon drauf.«
»Morgen, Oleg.«
»Morgen, Maira.«
Kurz überlege ich, das schwere, hölzerne Rolltor zur Werkstatt zu öffnen, aber die Sonne brennt jetzt schon. Im Gebäude will ich es so lange wie möglich kühl lassen, also nehme ich die schmale Tür, die in das Tor eingelassen ist, und schließe sie sofort hinter mir.
Durch das Band aus Sprossenfenstern über dem Tor fällt Streiflicht und lässt Staubkörnchen in der Luft tanzen. Die Möbelstücke, Hölzer, Stoffe und Füllmaterialien, die sich bis zur Decke stapeln, bilden dadurch eine malerische Kulisse. Auf der Werkbank steht der Stuhl, den die Maira von gestern Abend dort zurückgelassen hat.
Während auf dem Hof die Türen des Transporters klappen, schalte ich das Radio ein, das von seinem zu schmalen Regalbrett an der Wand beständig abzustürzen droht. Der alte Diesel knattert vom Hof. Ich stelle den Sender von Ingmars Schlagersender auf Radio FFH.
Immer noch hängt mir die Nacht nach, jeden Handgriff führe ich langsam aus, als wäre er neu und fremd. Mit den Fingerspitzen berühre ich das gewachste Holz des Möbelstücks vor mir. Ich habe es feingeschliffen und poliert, bis mir beinahe der Arm abgefallen ist. Nun schimmert es sanft. Nussbaum. Ich liebe die edle Farbe und die Struktur des Holzes. Bezogen mit dem blau-weiß gemusterten Gobelin, den die Kundin ausgesucht hat, wird das Möbelstück prächtig aussehen. Die Unterkonstruktion der Sitzfläche ist bereits so gut wie fertig. Nur zwei der Kupferfedern muss ich noch schnüren, dann ein letztes Mal die Höhen kontrollieren; danach kann ich das Polster füllen und beziehen.
Ich lasse mich von der Musik und der Arbeit tragen. Die Minuten und Stunden fließen dahin, und nach einer Weile ist dieser Tag, der der Geburtstag meiner Mutter gewesen wäre, beinahe ein gewöhnlicher. Ich muss mich nur konsequent auf die Arbeit konzentrieren.
Wie viel Zeit vergangen sein muss, fällt mir erst auf, als Ingmar und Oleg zurückkommen. Sie reißen meine friedliche Blase aus Polstern, Musik und treibenden Gedankenfetzen auf, indem sie das große Rolltor öffnen. Sonne und Hitze fluten den Raum, einen Moment lang kann ich durch die plötzliche Helligkeit die monströse kanariengelbe Couchgarnitur kaum erkennen, die die beiden Männer auf Rollbrettern hereinbringen.
Ich lege die Zange beiseite, mit der ich eben Draht stramm gezogen habe, und wische mir die schwitzigen Hände an der Hose ab. »Was ist das denn?«
Oleg zieht bedeutungsvoll die Augenbrauen hoch. Sich sichtlich ein Grinsen verkneifend, macht er sich daran, den Transporter neu zu beladen.
Ingmar jedoch bleibt neben dem Sofa stehen. Er klopft mit der flachen Hand auf den gelben Stoff der Lehne, als sei es ein Pferd, dem er den Hals tätschelt. »Schick, oder?«
»Sehr.«
Ingmar lacht. »Immerhin wird es uns eine Weile beschäftigen.«
»Mich, meinst du.«
»Stefan ist nächste Woche ja aus dem Urlaub zurück. Sonst alles klar hier?«
»Klar.«
Oleg kommt herein, um die nächste Ladung zu holen. Gemeinsam tragen wir Gardinenstoffe, ein halbes Dutzend neu bezogene Hocker und vier schwere Spiegelrahmen für einen Frisörsalon zum Transporter. Dann schwingt sich Oleg wieder auf den Fahrersitz und Ingmar steigt auf der anderen Seite ein.
»Vergiss die Pause nicht.«
»Aye, Chef.«
Ein Blick auf das Display meines Smartphones sagt mir, dass die Frühstückszeit längst vorbei ist. Und Konstantin hat versucht, mich zu erreichen. Ich melde mich später bei ihm. Vielleicht. Es ist nicht so, als hätten wir noch irgendwas zu besprechen.
Die Arbeit hat die Nacht ein wenig aus meinem Herzen und meinen Knochen vertrieben. Trotzdem fühle ich mich seltsam matt, als ich mich mit meinem Frühstücksbrot im Innenhof an die Wand neben dem Rolltor lehne. Eine tapfere alte Ulme spendet dort wenigstens ein bisschen Schatten.
Ein einsamer Windhauch streicht mir über die Wangen, vereinzelte Wolken treiben vorbei, und am Himmel lachen mich tatsächlich ein paar Möwen aus. In Frankfurt am Main sollten keine Möwen kreischen.
Aus einer der oberen Wohnungen des Nachbarhauses klingt Streit. Eigentlich mag ich diese zu warme Stadt, ich mag den Hinterhof mit seinen Ziegelmauern unter abblätterndem Putz, und ich mag die Gerüche, die sich darin fangen. Lack, Holz und Harze aus der offen stehenden Werkstatt. Knoblauch und Gebratenes aus Deniz’ Döner. Gute, sichere Gerüche. Doch heute ist mein emotionaler Deich brüchig.
In der Nacht hat es geregnet, die Luft ist noch feucht, und der Frühsommerwind trägt Düfte von der Gärtnerei auf der anderen Seite der Hinterhofmauer mit sich. Eine Ahnung nur von Erde und nassem Sand, Faulbaum und Heckenrosen. Sie haben mein Innerstes erreicht, bevor ich feststellen kann, dass sie nicht hierher gehören, nicht mitten in die Stadt, Hunderte Kilometer von der Ostsee entfernt. Ich versuche, nicht hinzuriechen, konzentriere mich stattdessen auf Reste von Diesel, die noch zwischen den Häusern hängen.
Als das nicht genügt, sortiere ich die Reihenfolge der anstehenden Arbeiten im Kopf, aber es ist zu spät.
Längst hat die Vergangenheit ihren Weg durch meine Barrieren gefunden, eine helle, heile Vergangenheit zum Glück. Zwischen die Stadtklänge der Gegenwart mischt sich das Trommeln nackter Kinderfüße auf dem Sandweg, der vom Strand nach Hause führt. Drei Paar, schmutzig, zerkratzt und sonnengebräunt.
Zwei Frauen, Touristinnen, stehen im Weg; Anne rennt links um sie herum, Jasper und ich rechts. Sie schimpfen hinter uns her, ich nehme es kaum wahr.
»Mama!«, rufe ich stattdessen, »Mama!«, und sie muss mich gehört haben, noch bevor wir um die Faulbaumhecke gebogen sind, denn sie steht schon in der geöffneten Haustür unserer Rohrdachkate. Wind trägt Seeluft herüber und über uns fliegt eine Silbermöwe.
Eine Momentaufnahme. Mamas Lachen, das wie immer um ihren Mund liegt. Wie meiner ist er ein wenig zu breit. Sonne auf ihrem Gesicht, die sie die Augen zusammenkneifen lässt. Der neu gestrichene, taubenblaue Rahmen der Tür. So klar, als erlebte ich es jetzt. Als sei ich zehn Jahre alt und meine Welt noch ganz.
»Mama, wir haben einen Wal gesehen!«
»Ehrlich?«
»Ja!« Mir fehlen die Worte, um ihr zu beschreiben, wie die Flosse aus dem Meer tauchte, schwarz und glänzend einen Bogen zog, verschwand, wieder auftauchte, und wie ich lachen musste vor Glück, weil es den Wal gab. Wie die Freude darüber immer noch in mir sprudelt.
»Wie lang war er? Von hier bis zum Gartenhaus?«
»Haha. Frank hat gesagt, das war ein Schweinswal, du weißt doch, wie groß die sind.«
»Mein kluges Kind.« Sie nimmt mich in den Arm, und ich winde mich kichernd, als sie mir den Hals küsst. Sie riecht nach frischen Pfannkuchen.
Etwas an dieser Sequenz kann nicht stimmen, ich war eben noch an der Hecke neben dem Tor und Mama an der Haustür. Während ich darüber nachdenke, wie viel meiner Kindheit ich mir aus Fotos zusammengebaut habe und was wirklich passiert ist, poltert eine andere Erinnerung gegen meinen geistigen Damm, ein anderer Tag, ein anderer Wal.
Ich lege das halb gegessene Brot wieder in die Box, gehe zurück in die Werkstatt und schließe die Tür zu dem Wind und den Möwen, die hier nicht hergehören.
Nach der grellen Hitze draußen ist es im Inneren dunkel und kühl. Das kanariengelbe Ungetüm nimmt beinahe die Hälfte des Raums ein. Ich muss mich an ihm vorbeischlängeln, um zu meinem Stuhl zu gelangen, neben dem das Afrique für die Polsterung schon bereitliegt. Die Gerüche sind draußen geblieben, das Kreischen der Möwen ebenfalls.
Im Radio läuft Werbung für Fischfilet zu eins neunundneunzig.
Ich wechsle den Sender zurück zu Ingmars Schlagerprogramm. Kaffee. Arbeit. Sinneseindrücke, um das Loch im Deich zu kitten. In der Regel hilft das. Der Kaffee ist so heiß, dass ich mir fast die Zunge verbrenne, und die beschwingte Musik kurz vor der Lautstärke, bei der die Nachbarn die Polizei holen, statt miteinander zu streiten. Am frühen Nachmittag rufe ich sogar Konstantin zurück.
»Hallo?«, meldet er sich, als würde mein Name nicht angezeigt.
»Hi.«
Pause.
Dann sage ich: »Du hast vorhin angerufen.«
»Ja, ich … na ja. Es ist der 23. Mai. Ich wollte nur hören, wie es dir geht.«
»Gut geht es mir.«
»Gut.«
Pause.
»Wenn du was brauchst …«
»Nein, alles gut. Geht schon.«
»Na, dann … man sieht sich.«
»Ja.« Mein Finger schwebt schon über dem roten Button. »Konstantin?«
»Ja?«
»Danke. Fürs Nachfragen, meine ich.«
»Kein Ding.«
Er legt auf, und ich bin wieder allein mit dem Afrique und den Geisterbildern im Kopf. Dazu hat sich jetzt noch das schlechte Gewissen gesellt, dass ich Konstantin gegenüber nicht zugänglicher sein kann.
Irgendwann, nach Ewigkeiten, fällt ein Lichtreflex auf die Werkbank, ein Sonnenstrahl wohl, der sich im Lack oder im Spiegel des Transporters gefangen hat, als dieser wieder vorgefahren ist. Ich regele die Lautstärke auf ein gesellschaftsverträgliches Maß hinunter, Ingmar soll nicht denken, ich würde hier eine Party feiern.
Kurz darauf betritt er die Werkstatt. Nach einem Blick auf das, was ich heute geschafft habe, nickt er. »Sieht gut aus.«
»Ja, ich bin ganz zufrieden. Muss nur hier und da noch ein bisschen ausgleichen.«
»Hast du vor, irgendwann Feierabend zu machen?«
»Wenn ich fertig bin.«
»Du solltest dein junges Leben nicht nur mit Arbeit verbringen, sondern auch mit Spaß.«
»So jung bin ich nicht.« Ich lege das Messer zur Seite. »Und die Arbeit macht mir Spaß.«
»Wenn du wüsstest, wie jung du bist.« Er reibt sich den Schnauzbart, wie er es immer tut, wenn ihn etwas beschäftigt. Dann sieht er mich an. »Mach Schluss, Befehl vom Chef.«
Ich salutiere. »Du aber auch.«
»Selbst und ständig.«
»Und irgendwann kaputt.«
»So schnell nicht.« Er lacht kurz. »Sag mal, wie spontan bist du? Hast du morgen Abend was vor?«
Ich verneine. Lesen gilt nicht als etwas vorhaben.
»Hast du Lust, mal wieder zum Abendessen zu uns zu kommen? Du müsstest dann natürlich mal zu einer sinnvollen Zeit Feierabend machen.«
Dabei verlassen Ingmar und Gabi selbst selten vor sieben oder acht Uhr abends die Firma. Ich weiß es, weil ich oft genug abends noch arbeite. Vor Monaten hat Ingmar mir die offizielle Erlaubnis erteilt, die Werkstatt auch privat zu nutzen. Manchmal möbele ich Erbstücke für Leute aus dem Freundeskreis auf – wobei der seit der Trennung von Konstantin als nicht existent bezeichnet werden kann – oder baue aus Resten und Abfällen etwas Neues. Die besonders gelungenen Stücke bieten Ingmar und Gabi vorn im Laden als Unikate an. Derzeit steht eine schmale Zweisitzerbank dort, bezogen mit Samt in schrillem Magenta. Ich glaube nicht, dass sie jemals ein Zuhause findet, aber sie ist auf jeden Fall ein Blickfang.
Auch heute werde ich bleiben. Jetzt nach Hause zu gehen, in meine Wohnung, allein mit Netflix oder einem Buch, dem Staublappen und den Erinnerungen, die so gefährlich nah unter der Oberfläche lauern … nein.
Jeder Stuhl auf dem Bürgersteig vor Klaras Streuobstwirtschaft ist besetzt. Ich scanne die Stehtischfässer und entdecke eins, an dem nur drei Leute stehen: ein Mann Anfang dreißig, Werber, würde ich tippen. Eine Frau um die fünfzig, vermutlich Bankerin. Und eine Frau im Alter irgendwo dazwischen, bei der ich amerikanische Touristin raten würde. Mit der Zeit habe ich einen Blick für festgefügte Gruppen bekommen. Diese drei stehen zufällig zusammen. Vereinzelte wie ich, die sich einfach nur eine Ablage für ihre Teller und Gläser teilen.
Ich drängle mich zu den dreien durch. Die beiden Frauen unterhalten sich inzwischen.
»Ist hier noch frei?«
Der Typ sieht von seinem Smartphone auf und blickt kurz in die Runde, bevor er die Schultern zuckt. »Sicher.«
Die Frauen stimmen zu, ich bitte sie, meinen Platz freizuhalten, während ich mir einen Sauergespritzten und etwas zu essen hole. Mit Konstantin war ich nur wenige Male hier, er fand Klara zu touristisch. Mir gefällt das Durcheinander aus Ur-Frankfurtern, Zugereisten und Gästen. Ich mag es, den Bankerjungs zuzuhören, die im tiefsten Hessisch von ihren neuesten Deals erzählen, ebenso wie mich die bunten Sprachen ringsum beglücken. Niemand interessiert sich dafür, wer oder was ich bin. Ob ich hierhergehöre oder nicht.
Während der nächsten Stunden lasse ich den fast subtropischen Frankfurter Frühsommerabend über mich hinwegwaschen, tauche ein in die Kulisse eines Lebens, das sich beinahe richtig anfühlt. Ich bleibe, als sie gehen, und ich bleibe, als die Nächsten gehen, die sich zu mir gesellt haben. Ich bleibe, bis mein Kopf sich dreht von zu viel Äppler und mir die Müdigkeit so weit in die Knochen gekrochen ist, dass ich sicher bin: Ich werde schlafen. Heute Nacht werde ich schlafen. Trotz der Hitze und trotz der Tatsache, dass es der 23. Mai ist.
Kurz vor Mitternacht komme ich nach Hause. Die Luft in der Wohnung kommt wir vor wie ein dichter, warmer Block, obwohl ich morgens sämtliche Vorhänge geschlossen habe und die Dachfenster schon seit Tagen mit Handtüchern verhängt sind. Ich schaffe es nicht mehr unter die Dusche, sondern öffne nur noch das Schlafzimmerfenster und falle ins Bett.
Liebe Maira
Weißt du noch, Maira? Erinnerst du dich an den Tag, als wir ans Meer gezogen sind? Als wir das erste Mal das verwitterte Schild Sperlingskate am Tor des Resthofs sahen?
Wahrscheinlich nicht, du warst drei Jahre alt und fandest vor allem spannend, in einem großen Umzugswagen zu fahren.
Das erste Foto von dir, das nicht mehr in der Wohnung deiner Oma, sondern hier entstanden ist, zeigt dich schlammverkrustet und lachend auf einem Erdhaufen im Garten. Ich habe mir viel vorgenommen, als wir herzogen. Einen Gemüsegarten wollte ich anlegen, um uns beide selbst zu versorgen. Am Ende hat es nur zum Hochbeet für Salat und Küchenkräuter gereicht, aber in diesem ersten Frühjahr war ich ungeheuer motiviert. Ein wenig zu motiviert vielleicht. Ich habe unterschätzt, wie viel Arbeit es machen würde, den Garten zu pflegen und das Haus nach und nach in Schuss zu bringen, obwohl am Anfang eigentlich ständig Leute aus meiner Hamburger Clique hier waren, um uns zu helfen.
Übrigens war kurz nach dem Umzug auch bisher das einzige Mal, dass deine Großmutter uns hier besucht hat. Nur falls du dich irgendwann wunderst, warum wir so wenig Kontakt miteinander haben. Wer weiß, ob sie sich überhaupt dazu herabgelassen hätte, hätte dein Onkel sie nicht überredet. Mischa glaubt ja immer noch, man müsste nur Verständnis für ihre Marotten haben, dann könnte man mit ihr auskommen. Er ist halt auch nicht mit einem unehelichen Kind angekommen. Jedenfalls gab es bei diesem Besuch einigermaßen viel verständnisloses Naserümpfen ihrerseits und genervtes Rumschreien meinerseits, aber wenigstens hat das niemand im Ort mitbekommen. Wäre keine besonders gute Einführung in die neue Nachbarschaft gewesen.
Ich hatte sowieso anfangs genug Angst vor Anfeindungen, immerhin war es viele Jahre her, dass die Familie deiner Großmutter nach Hamburg gezogen war. Und dann kam ich hier an, viel jünger als die anderen Mütter, mit dir, meinem vaterlosen Kind. Wir waren fremd und ganz bestimmt nicht alle im Ort waren glücklich über die Rückübereignung nach der Wende.
Aber sie gewöhnten sich an uns. So schwierig es manchmal war, ich liebte den Hof von der ersten Sekunde an, und ich wollte für dich, dass du frei und mit viel Natur aufwachsen kannst. Ich mochte nicht mehr mit dir auf Spielplätzen rumsitzen. Also wagte ich den Sprung, auch wenn fast alle meine Freunde prophezeiten, ich wäre spätestens nach einem halben Jahr wieder zurück.
Aber ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Am Einzugstag jedenfalls, Mischa und Phil waren gerade dabei, dein Bett von der Ladefläche zu holen, und ich schleppte eine Bücherkiste ins Haus, stand plötzlich ein kleines Mädchen im Hof, nur ein wenig älter als du. »Wohnt ihr jetzt hier?«, hat sie mich gefragt (Kinder sprechen witzigerweise oft eher mit Erwachsenen als mit anderen Kindern), und ich bejahte es. Vielleicht kannst du dir denken, dass das Anne war. Von dem Tag an wart ihr Freundinnen.
Mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der sie auf den Hof spaziert ist, kam sie in unser Leben. Sie tat dir gut. Ihr beide tatet euch gut. Da, wo du verträumt warst, war sie lebenspraktisch und patent. Und wo sie ein wenig ruppig war, brachtest du ihr Sanftmut bei.
Kurz darauf schleppte sie Jasper an, und fortan saßen eigentlich immer drei Kinder an unserem Küchentisch oder in unserem Garten. Ich glaube, für Annes und Jaspers Eltern war es sehr praktisch, dass ich von zu Hause aus arbeitete, und ich mochte es, euch drei um mich zu haben. So war immer Leben im Haus, und mein schlechtes Gewissen, weil du weder Vater noch Geschwister hattest, konnte beruhigt schweigen.
So viel Zeit ist seither vergangen. Du bist groß geworden, elf Jahre alt schon. Ich bedaure, dass ich nicht von Anfang an die Idee hatte, unser Leben für dich aufzuschreiben. Texte, finde ich, erzählen noch mal anders als Fotos. Aber nun, immerhin mache ich seit ein paar Jahren immer mal Notizen, und ich werde auch weiter aufschreiben, was mir einfällt, sei es eine Erinnerung oder etwas aus der Gegenwart.
Diese Zeilen hier schreibe ich an einem Tag im Herbst, es ist grau und ungemütlich draußen. Aber du bist mit Anne losgezogen, um auf der Wiese hinter dem Deich Lenkdrachen fliegen zu lassen, nun, da nicht mehr so viele Touristen da sind. Es macht mich froh, zu sehen, wie selbstständig du inzwischen bist. Nachher wirst du zurückkehren, mein wildes Kind, mit roten Wangen und verknoteten Haaren, weil du wieder keine Mütze aufsetzen wolltest.
Wenn ich zurücksehe, bist du damals wirklich schnell hier angekommen, als gehörte deine Seele genau an diesen Ort, in dieses Haus, als hättet ihr nur aufeinander gewartet. Ich habe länger gebraucht, um kein Heimweh mehr zu haben. So viele Momente, in denen ich gezweifelt habe, ob wir es in der Stadt nicht besser gehabt hätten, wo es Musikunterricht und reichlich andere Angebote für dich gegeben hätte. Doch gestern beim Frühstück hast du unvermittelt gesagt: »Die armen Leute, die hier nicht wohnen können, oder, Mama?« Und ich konnte dir aus ganzem Herzen zustimmen. Die letzten Jahre waren nicht immer leicht, mehr als einmal hatte ich Angst, dass ich die Reparaturen am Haus nicht bezahlen kann. Aber irgendwie ging es immer weiter. Es wird auch in Zukunft weitergehen. Wir haben Freunde gewonnen, du deine und ich meine. Heute Abend werden wir mit einigen von ihnen am Feuer sitzen. Vielleicht bringt Andrea ihre Gitarre mit.
Ich bin so dankbar für unser Leben. Wir sind hier zu Hause, Maira. Du und ich.
Ich habe dich sehr lieb.
Deine Mama
Frankfurt, 24. Mai
Ingmar wartet bereits auf mich, als ich vorfahre. Das ist selten. Normalerweise gehe ich kurz vorn ins Büro, um ihn und Gabi zu begrüßen, wenn er nicht sowieso auf dem Hof oder in der Werkstatt zu tun hat. Dass er explizit auf mich wartet, ist in unseren nun fast zehn gemeinsamen Jahren vielleicht dreimal vorgekommen.
Ich springe vom Rad. »Morgen, Chef.«
»Gut, dass du kommst.«
»Was ist los?«
»Kleine Planänderung heute. Gabi ist krank, ich brauche dich im Laden.«
»Was Schlimmes?«
»Ach, bisschen Magenschmerzen. Wird schon wieder. Unkraut vergeht nicht, weißt du doch.«
Sähe ich nicht jeden Tag, wie sehr er seine Frau liebt, fände ich diesen Satz abfällig. So schiebe ich ihn auf Ingmars spezielle Art – er ist nicht für sein Geschick mit Worten bekannt – und nehme mir vor, Gabi eine Textnachricht zu schicken, in der ich ihr gute und schnelle Besserung wünsche. »Was ist mit dir?«
»Hab einen Termin. Große Sache, erzähle ich dir nachher.« Er sieht auf die altmodische Uhr an seinem Handgelenk.
»Ich …« Ich schlucke meinen Protest hinunter, obwohl mir schon bei dem Gedanken eng im Brustkorb wird. »Du weißt, dass ich vorn nicht besonders tauge.«
»Und du übertreibst maßlos, Küken.«
»Ganz passend ist meine Kleidung auch nicht«, unternehme ich nun doch noch einen Versuch, aus der Sache rauszukommen. »Was ist mit Thao?« Thao arbeitet zwar nur Teilzeit, aber heute wäre doch ein guter Tag für sie. Finde ich.
»Hat noch Urlaub. Also: Keine Widerrede.«
Ich habe gelernt zu erkennen, wann ich verloren habe. Also lasse ich mir von Ingmar zeigen, was im Büro zu tun ist, und nicke nur, als er mich daran erinnert, pünktlich um neun den Laden aufzuschließen. »Wenn du dich nützlich machen willst, kannst du die Stoffmuster, die gestern gekommen sind, noch sortieren und das Schaufenster mal aufräumen.«
Er weiß, womit er mich kriegt.
Das Ladengeschäft ist ein einziger großer Raum mit tiefen Schaufenstern zur Lorscher Straße, in denen die Leute Stoffe und ein paar Möbel betrachten können, die eher unmotiviert hineingestellt wirken und gefühlt seit Jahren nicht verändert wurden. Das Büro selbst ist lediglich durch einen Raumteiler abgetrennt. Ich habe schon öfter gedacht, dass man wesentlich mehr daraus machen könnte.
Wir trinken noch einen schweigsamen Kaffee, dann verabschiedet sich Ingmar, und ich bin allein mit den Rechnungen, Bestellungen und Werbesendungen, die sortiert werden wollen. Doch zuerst erkundige ich mich bei Gabi per Textnachricht, ob ich irgendwas für sie tun kann. Ihr Smartphone scheint ausgeschaltet zu sein; ich mache mich an die Büroarbeit. Glücklicherweise ist noch nicht viel angefallen, sodass ich mich schon eine Stunde später dem Schaufenster zuwenden kann.
Meine erste Tätigkeit besteht darin, die Markise auszufahren, bevor die Sonne herumkommt. Dann sperre ich potenzielle Zuschauer aus, indem ich das Fenster mit Packpapier verhänge, auf das ich in fetten Lettern geschrieben habe: Wir dekorieren für Sie um. Und schließlich mache ich mich daran, genau das zu tun.
Meine kleine Bank dient derzeit nicht als Blickfang, wie ich feststelle, sondern als Ablage für Stoffmusterkataloge. Ich hieve die Dinger herunter, als mir ein Ballen Panama-Canvas mit schwarz-weißen Blockstreifen ins Auge fällt und meine Kreativität endgültig aufweckt. Ingmar hat mir die Anweisung gegeben, das Schaufenster aufzuräumen, oder etwa nicht?
Gabi schreibt, sie sei bestimmt in ein oder zwei Tagen wieder fit, ich schicke ihr ein Bild von dem schwarz-weißen Stoff und frage sie, ob ich ihn zum Dekorieren nutzen kann. Nur keine Hemmungen, antwortet sie.
Also belade ich einen Rollwagen mit dem Stuhl, den Stoffen und den Kissen, die seit mindestens zwei Jahren das Schaufenster zieren, entferne Staub und Spinnweben und überlege dann, welcher Teppich zu dem schwarz-weißen Baumwollstoff passen könnte.
Ab und zu berate ich Menschen, die sich neu einrichten wollen, verkaufe Auslegwaren, nehme Reparaturen an. Aber im Wesentlichen bin ich den Tag über allein im Laden.
»Oh, schön kühl hier drin«, sagen die Leute beim Reinkommen. Oder »Endlich ein bisschen Abkühlung.«
Ich will lieber nicht wissen, wie hoch die Temperaturen inzwischen draußen sind, wenn man es hier als kühl empfinden kann.
Nachmittags bin ich so weit.
Meine Bank steht auf goldenen Damastwellen, dahinter schirmt der grobe schwarz-weiße Canvas den Blick in den Laden gerade so weit ab, dass sich von draußen erahnen lässt, welche Schätze hier schlummern. Ich richte die Deckenspots so aus, dass der magentafarbene Samt und die glänzenden, geschwungenen Kastanienholzbeine der Sitzbank besonders zum Tragen kommen. In der anderen Ecke, auf einem Pouf, den ich vor Wochen mit orangefarbenem Cord bezogen habe, sitzt Gabis Lieblingsstofftier, ein Kaiserpinguin. Es ist grandios schrill.
Ich nicke mir selbst Mut zu, dann entferne ich das Packpapier vom Fenster.
Ingmars Fahrrad klappert auf den Hinterhof. Kurz darauf betritt er den Laden – aus vollem Hals lachend. »Ab sofort machst du immer die Deko.«
»Keine Chance.« Ich wische mir die Hände an der Hose ab. »Da komme ich ja zu nichts anderem mehr. Gefällt es dir?«
»Es ist schauderhaft.«
Während ich noch darüber nachdenke, was ich mit dieser Aussage anfange, sagt er: »Kleb noch einen … wie heißen die Dinger? So einen Code an die Scheibe, der die Leute zu unserer Homepage führt. Allein in den paar Minuten, in denen ich den Schreck verdaut habe, sind drei Mädels stehen geblieben und haben Fotos gemacht.«
»Okay.« Ich entspanne mich. »Wird gemacht, Boss.«
Ein bisschen eingestaubt steht in der hintersten Ecke des Büros ein Folienplotter. Ich drucke den QR-Code aus und dann noch die Adresse der Website (wir müssen dringend den Instagram-Kanal aktualisieren). Gemeinsam mit Ingmar, der von außen kontrolliert, und Oleg, der mir innen hilft, klebe ich beides an die Scheibe.
Ingmar bringt gleich drei neue Kundinnen mit in den Laden, von denen zwei glücklicherweise nur schauen wollen. Die dritte bedient er.
Bevor ich mich in die Werkstatt verdrücken kann, sagt er: »Warte noch. Ich brauch dich gleich.«
Vor lauter Dekorieren hatte ich verdrängt, dass heute jemand kommt, um sich als Auszubildende zu bewerben. Ingmar hat bereits ein Gespräch mit der Frau geführt, aber da ich hauptsächlich mit ihr arbeiten werde, will er meine Meinung hören.
Er wendet sich wieder der Kundin zu und ich … warte. Um die Zeit sinnvoll zu nutzen, fotografiere ich das neue Schaufenster von außen und stelle es auf den Instagram-Account von Ingmar Prigge Raumausstattung. Auch der benötigt ein paar Aufräumarbeiten.
Das Mädchen, das eine Weile später den Laden betritt, ist schmächtig und wirkt wie höchstens fünfzehn. Ihre Haare sind blau gefärbt, die Augen wirken durch das Make-up riesig. In der rechten Augenbraue blitzt ein Piercing. Unschlüssig bleibt sie in der Nähe der Tür stehen, als bereue sie, überhaupt hereingekommen zu sein. Und ich weiß auf einmal sehr genau, warum Ingmar wollte, dass ich sie kennenlerne.
Sie merkt, dass ich sie ansehe, schielt kurz zu mir und hebt ein wenig das Kinn.
»Maira?«, brummt Ingmar aus dem Büro.
Ich löse mich aus meiner Lähmung. Mit ein paar schnellen Schritten bin ich an der Tür. »Hallo. Kommen Sie doch herein.«
Sie hält sich an den Gurten ihres Rucksacks fest, lächelt aber verhalten.
»Immer man rein in die gute Stube.« Ingmar kommt nun aus der Büroecke.
Ich atme verstohlen aus.
»Wie gefällt Ihnen die Neugestaltung?«, fragt Ingmar.
»Gut. Ich finde die Kontraste in den Materialen schön.« Ihre Stimme ist rau und viel tiefer, als ich bei ihrem Anblick angenommen hätte.
Ingmar nickt zufrieden. »Hat Maira heute gemacht. Maira ist die da.«
»Hallo«, sage ich zum zweiten Mal. »Maira Jakobs.«
»Emily«, sagte sie. »Schmidt.«
Ingmar bittet das Mädchen an den runden Tisch, an dem wir auch Gespräche mit Kundinnen und Kunden führen. Ich biete Mineralwasser, Schorle und Besprechungskekse an und setze mich dann dazu.
Emily hat Fotos und Zeichnungen auf einem Tablet dabei. Die Fotos zeigen ein hellblau angepinseltes Tischchen, das sie restauriert habe. Die Zeichnungen sind computergerenderte Entwürfe für verschiedene Räume. Ingmar ist ein guter Zuhörer; mit jedem Bild taut sie weiter auf. Nichts von dem, was sie uns zeigt, ist in irgendeiner Form ausgereift, aber ihr Eifer rührt mich.
»Hast du … haben Sie schon mal was gepolstert?«, frage ich.
Sie schüttelt den Kopf.
»Ist nicht schlimm. Ich wollte es nur wissen.«
Kann ich mir vorstellen, mit ihr zu arbeiten? Sie anzuleiten? Sie auf den Baustellen vor blöden Sprüchen zu schützen? Will ich diese Art von Verantwortung?
Nachdem sie sich mit ihrem schüchternen Lächeln verabschiedet hat, schließt Ingmar die Tür. »Und?«
»Sie wirkt wie ein Kind.«
»Sie ist achtzehn.«
»Im Leben nicht.«
»Ich denke, sie hat eine Chance verdient. Hatte bisher nicht so viel Glück im Leben, die Kleine. Denkst du, du kannst mit ihr arbeiten?«
Ich weiß, er will, dass ich sage, ›natürlich‹. Er will mich als guten Menschen sehen. Aber alles, was ich über die Lippen bringe, ist: »Solange sie nicht vorher davonrennt.«
»Das wird schon. Wir sind hier gut darin, kleine Kratzbürsten zu zähmen.«
»Kann mir nicht vorstellen, wen du meinst.«
Ingmar holt zwei Flaschen alkoholfreies Bier aus dem Kühlschrank, öffnet beide und reicht mir eine.
Wir stoßen an, ein bisschen asymmetrisch, weil ich sitze und er an der Tischkante lehnt. Mit dem Bier in der Hand macht er eine Geste, die den Raum und die Werkstatt im Hinterhof einschließt. »Das hier ist nur ein bescheidener kleiner Laden. Aber ich find’s gut, dass wir damit auch so ’n bisschen unseren Teil zu einer besseren Welt leisten können. Klingt das kitschig?«
»Ja«, sage ich. »Aber das macht nichts.«
»Bin schon stolz auf das alles hier, so aus dem Nichts aufgebaut.«
»Kannst du auch sein.«
Ich kenne die Geschichte. Früher war hier ein Schmied, dann stand die Werkstatt lange leer, bevor Ingmar sie für einen Spottpreis gemietet und später gekauft hat. »Seit meine Knie nicht mehr so wollen wie früher, habe ich immer öfter übers Aufhören nachgedacht. Aber ich kann doch nicht alles, was ich aufgebaut habe, einfach wieder vergehen lassen.«
Das ist das Problem, wenn man etwas für sich selbst erschafft. Räume, Dinge. Beziehungen. Sie besitzen einen genauso, wie man meint, sie zu besitzen. Ich drehe die Flasche in meiner Hand und betrachte den schwarz-weißen Stoff im Schaufenster.
»Na ja, was soll’s.« Er sieht auf die Uhr. »Oh, Shit, so spät schon. Ich muss los, hab heute Abend Besuch zum Abendessen.«
Synchron stürzen wir unsere Getränke hinunter.
»Wir sehen uns in zwei Stunden.«
»Ich werde da sein.«
Ingmar und Gabi wohnen in einem kleinen Einfamilienhaus in Rödelheim. Mit dem Rad brauche ich von meiner Wohnung aus zwanzig Minuten. Wieder einmal verfluche ich die Frankfurter Hitze, aber dank des dünnen Kleids, das ich trage, komme ich nur wenig verschwitzt an.
Gabi hockt vor der Tür und pflanzt Stiefmütterchen in den großen Topf, der über das Jahr immer wieder andere Pflanzen beherbergt. Als mein Rad quietschend am Gartenzaun hält, sieht sie auf, blinzelt gegen die Sonne und wischt sich mit dem Unterarm die grauen Locken aus der Stirn. »Da bist du ja schon.«
»Da bin ich.« Ich schließe mein Rad ab. »Soll ich dir helfen?«
»Lass mal. Bin so weit fertig.«
»Sieht schön aus. Tolles Blau.«
Einen Moment sinnieren wir darüber, wie sehr die Farbe der Blumen mit dem warmen Grau des frisch gestrichenen Holzhauses harmoniert, dann winkt sie mich ins Haus, die Gartenhandschuhe immer noch an den Händen. »Ingmar hat sein Spezialrezept für Grüne Soße gemacht.«
»Ich liebe Grüne Soße.«
»Sag bloß.«
Wir lächeln uns an, und ich frage mich – nicht zum ersten Mal –, womit ich es damals verdient hatte, ausgerechnet diesen beiden Menschen über den Weg zu stolpern.
Gabi bietet mir Pantoffeln an wie immer; ich lehne ab … wie immer.
»Dass du keine kalten Füße bekommst.«
Aber ich kann mit Schlappen nicht laufen und das Thermometer zeigt immer noch achtundzwanzig Grad. »Passt schon so«, sage ich. »Danke.«
Im Haus riecht es nach frisch gekochten Kartoffeln und irgendwie kräuterig.
»Ist Maira schon da?«, ruft Ingmar aus der Küche.
»Bin ich.«
Er trägt eine geblümte Schürze über Jeans und weißem T-Shirt, was ihn im Vergleich zu seiner Arbeitsuniform ganz verändert aussehen lässt. »Sehr schön. Dann können wir ja loslegen.«
Der Terrassentisch unter der Markise ist gedeckt, festlicher, als für einen simplen Wochentags-Feierabend angemessen wäre. Hat jemand Geburtstag und ich habe es vergessen? Ich kann nicht den Finger drauflegen, aber irgendetwas an dieser Einladung ist eigenartig.
Ratlos betrachte ich die drei Gedecke auf geschmackvollen Tischsets, das blank polierte Besteck, die makellosen Sektgläser.
»Setz dich doch.« Gabi tritt neben mich.
Also setze ich mich mit Blick auf den Garten.
Sie nimmt ebenfalls Platz. Ihr Lächeln erinnert mich an das meiner Mutter früher am Weihnachtsabend. Was geht hier vor?
Ingmar kommt mit der Soße, ich springe auf. »Kann ich was helfen?«
»Quatsch, bleib sitzen. Sind nur noch die Kartoffeln.«
Eine Weile essen wir schweigend, nachdem ich dreimal verkündet habe, wie wunderbar die Soße schmeckt, und mich für die Einladung bedankt habe. Eine Amsel planscht in der Vogeltränke am Rand der Terrasse. Ingmar und Gabi sehen sich an, sie nickt ihm zu, und ich gebe vor, es nicht zu bemerken.
Ingmar räuspert sich. »Also.«
Erneut nickt Gabi ihm zu, ich warte.
»Wir haben viel nachgedacht, Gabi und ich.«
Pause.
»Ich hab dir ja vorhin schon gesagt, dass ich übers Aufhören nachdenke. Wir übers Aufhören nachdenken. Werden ja nicht jünger. Aber der Laden ist unser Lebenswerk.«
Am Nachmittag habe ich, warum auch immer, nicht wirklich begriffen, was es für mich bedeuten würde, sollten Ingmar und Gabi den Laden schließen. Jetzt muss ich schlucken. Ich mag mir keinen neuen Job suchen. »Kann ich ein Glas Wasser haben?«
Gabi reicht mir die Karaffe. Sie lächelt, ich lese daraus kein Tut uns leid, Maira, du bist gefeuert. Dafür hätten sie mich wohl auch nicht zum Essen eingeladen. Oder?
»Wie ich schon sagte, so ein Lebenswerk kann man nicht einfach so hinwerfen«, sagt Ingmar. »Ach, was rede ich um den heißen Brei: Willst du das Geschäft übernehmen, Maira?«
»Ich?«
Seine Augen hinter der Goldrandbrille sind so freundlich. Und hoffnungsvoll.
Ich muss das erst verarbeiten. »Nicht dass ich mich nicht geehrt fühlen würde, aber … warum ich?«
»Warum nicht du?«
Ich hebe die Schultern. Wie kann er ausgerechnet mir etwas anvertrauen wollen, das ihm so wichtig ist?
Gabi tätschelt mir die Hand. »Du bist eine hervorragende Handwerkerin, die Mannschaft mag dich, die Kunden vertrauen dir.«
Vielleicht hätte ich es wissen können. Ingmar hat nicht erst seit gestern graue Haare und ich bin die Einzige im Team mit Meisterbrief. Er hat sogar immer mal Sätze gesagt wie: »Wenn du dann Chefin bist« oder »Warte mit dem Neuen, bis zu den Laden führst«. Aber ich habe es nicht ernst genommen, obwohl ich ab und zu mit dem Gedanken an ein eigenes Geschäft gespielt habe. Aber am Ende kam ich jedes Mal zu der Erkenntnis zurück, dass mir meine Freiheit wichtiger ist. Ich möchte wegkönnen, immer. Man weiß nie, wann es nötig wird.
»Und du bist wie eine Tochter für uns.«
Damit hat er mich.
»Gabi würde es das Herz brechen, wenn wir an einen Fremden verkaufen müssten.«
»Nicht nur mir, alter Mann.« Sie stupst ihn liebevoll an. »Dir ja wohl auch.«
Die beiden haben keine Kinder, und ich kenne sie gut genug, um zu wissen, dass sie lange brauchten, um damit ihren Frieden zu schließen. Vielleicht sogar bis zu dem Tag, an dem ich mit schwarzer Kapuze in ihren Hinterhof schlich und das Drahtgeflecht klaute, das in der Ecke stand.
»Das …«, krächze ich, räuspere mich. »Ich weiß, was dir das alles bedeutet. Und ich fühle mich sehr, sehr geehrt.« Mein Name an der Tür. Guten Tag, mein Name ist Maira Jakobs, ich bin die Inhaberin dieses Betriebs. Lassen Sie mich Ihnen unsere schönsten Stoffe zeigen. Ich bin die Inhaberin. Ich bin … jemand, der dann ganz und gar an einen Ort gehören würde. Eine Heimat hätte. Etwas flattert in mir. Etwas flüstert: Du hast das nicht verdient. »Aber ich bin Handwerkerin. Du arbeitest kaum noch mit den Händen, Ingmar. Du bist fast nur mit Angeboten und Verwaltung beschäftigt und …«
Ich unterbreche mich selbst, lache überdreht und atemlos, weil ich anfange zu begreifen, es gibt jemanden, der mich so gernhat, dass er mir sein Lebenswerk vermachen will. Mir, Maira. Diese beiden Menschen hier, die mich so abwartend ansehen. Das ist … überwältigend. Ich brauche einen Rettungsring aus Sachlichkeit, also frage ich Ingmar, an welche Ablösesumme er gedacht hat. Es ist viel, aber selbst ich, die ich mich selten ernsthaft mit dem Thema befasst habe, erkenne, dass er auf dem freien Markt mehr für den Betrieb bekommen könnte. Sehr viel mehr.
Ich schlafe schlecht, weil in meinem Kopf zu viele Fürs und Widers miteinander streiten. Den ganzen nächsten Tag denke ich über Ingmars und Gabis Angebot nach. Beim Frühstück, beim Wäschelegen und sogar im Bad.
Maira Jakobs Raumausstattung. Nein. Maira Jakobs Interior Design. Albern, das ist albern. Ich sinniere über Firmennamen, als sei ich zwölf und probierte aus, wie mein Vorname mit dem Nachnamen von Ole aus der Neunten zusammenpasst. Jakobs Räume. Das könnte funktionieren.
Jakobs Räume.
Ich flüstere den Namen vor mich hin, als könne mich jemand hören. Als könne mich jemand bei etwas Verbotenem ertappen, wenn ich ihn zu laut sage. Viel zu lange seife ich mir die Hände ein. »Jakobs Räume.« Meine Stimme ist heiser, doch mein Spiegelbild grinst. Ein bisschen unentschlossen zwar, aber immerhin. Ich habe Ingmar versprochen, mir Gedanken zu machen – »Über eine solche Entscheidung muss man mindestens sieben Nächte schlafen«, hat er gesagt, »eher mehr« – und ihm noch einmal versichert, wie dankbar ich für sein Vertrauen bin. Und jetzt müsste ich mich verflucht noch mal einfach nur freuen, hundertprozentig und nicht so zittrig.
»Angst vor Erfolg«, diagnostiziert Caroline zwei Stunden später, während wir nebeneinander in gemächlichem Tempo an der Nidda entlangjoggen. Wir haben uns kennengelernt, als ich kurz nach der Meisterschule eine Récamiere ihrer Großmutter restaurierte. Seither unternehmen wir ab und zu etwas zusammen.
»Ist klar«, kommentiere ich ihre steile These. »Wie kann man Angst vor Erfolg haben?«
»Du wärst erstaunt, wie viele Menschen darunter leiden. Gerade neulich wieder in einem Workshop gehört.«
»Ich jedenfalls nicht.«
»Dann bedank dich bei Ingmar für die einmalige Chance und sag Ja. Gerade wenn das Angebot so gut ist, wie du sagst. Weißt du, was erfolgreiche Leute von unerfolgreichen unterscheidet?«
Vor mir watschelt eine Ente über den Weg, ich laufe einen Bogen. »Auch eine Erkenntnis aus dem Workshop?«
»War eine gute Veranstaltung. Also, weil du eh nicht nachfragen wirst: Erfolgreiche Leute unterscheiden sich unter anderem darin von unerfolgreichen, dass sie sich bietende Chancen wahrnehmen«, sie springt über einen auf den Weg rollenden Ball, »und dass sie zugreifen, statt hundert Jahre zu grübeln, selbst auf die Gefahr hin, Fehler zu machen.«
Als hätte ich die größten Fehler meines Lebens nicht schon hinter mir. Schlimmer kann es kaum werden. »Definiere Erfolg«, sage ich.
»Du weißt, was ich meine. Manchmal muss man sich einfach nur entscheiden.«
»Ich wäre für fünf Gehälter verantwortlich.« Und würde ich versagen, Ingmar enttäuschen, könnte ich nicht mehr in den Spiegel sehen. Ich bin schon einmal jemandem nicht gerecht geworden.
»Hattet ihr in der Meisterschule kein BWL?«
»Außerdem müsste man den Laden ziemlich umkrempeln, um ihn zeitgemäß zu halten. Vielleicht auch eine Architektin einstellen oder so.«
»Ich vernehme mit Freude, du hast dir bereits Gedanken gemacht.«
»Ach, hör auf.« Ich sprinte los.
Mit einem Lachen folgt mir Caroline.
Nach ein paar Hundert Metern haben wir die Bank erreicht, an der wir immer Pause machen. Keuchend stütze ich die Hände auf die Oberschenkel, bis ich wieder zu Atem gekommen bin.
»Außerdem«, ich japse immer noch, »wäre ich vollkommen angebunden. Ich könnte kaum Urlaub machen und all das. Nie aus Frankfurt weg, was für ein Albtraum.«
»Jetzt hör mal auf, immer Frankfurt schlechtzumachen.«
»Tu ich doch gar nicht. Aber vielleicht will ich irgendwann woanders wohnen.«
»Wer träumt seit Pinterest nicht vom Tinyhouse in der Karibik? Am Ende macht es doch niemand, weil es nämlich auch bedeutet, seine Freunde und alles andere Vertraute zurückzulassen.«
»Ich hab ja nicht so viele Freunde. Außer dir, meine ich natürlich.«
»Gott, Maira! Gleich werf ich dich in die Nidda.«
»Gibt es da nicht inzwischen Piranhas?«
Ich schüttele die Beine aus, bevor ich die Arme quer vor der Brust dehne. »Danke jedenfalls fürs Zuhören.«
»Hat’s geholfen?«
»Ich muss einfach noch eine Weile drauf rumdenken, glaube ich. Freiwillig irgendwo sein ist schon noch was anderes, als nicht wegzukönnen.« Während ich mir selbst zuhöre, merke ich, wie negativ das klingt. Dabei sammle ich vielleicht bloß Gegenargumente, um sie vor mir selbst zu entkräften. Entscheidungsfindung. Und vielleicht rede ich mir nur ein, niemanden außer Caroline zu haben, weil ich vor mir selbst nicht zugeben will, wie wichtig mir Ingmar und Gabi geworden sind?
»Wenn der Gedanke dir solche Angst macht, ist es vielleicht wirklich nicht das Richtige.«
»Angst nicht. Doch. Ich weiß nicht.« Ich ziehe den rechten Oberarm hinter den Kopf.
Ein wenig bereue ich, Caroline von der Sache erzählt zu haben. Es geschah nur aus einem Impuls heraus, weil sie immer wieder sagt, ich solle mehr von mir erzählen und sie sei schließlich meine Freundin und würde mir auch alles erzählen. Anders als ich ist Caroline eingewoben in ein buntes soziales Netz, das in einem Dorf irgendwo im Taunus seinen Ursprung hat und in dem für ihre Eltern und Geschwister ebenso Platz ist wie für eine ganze Reihe von Freundinnen und Freunden. Wir dehnen uns eine Weile schweigend, dann traben wir zurück. Meine Gedanken ziehen sinnlose Kreise, die zu keinem Ergebnis kommen.
»Schon irgendwie lustig«, sagt sie, als wir beinahe wieder bei den Fahrrädern sind. »Du verbringst deine gesamte Arbeitszeit damit, anderen Leuten ein schönes Zuhause zu schaffen, und weigerst dich, selbst irgendwo wirklich anzukommen.«
»Ich wohne seit zehn Jahren hier, das kann man kaum als unstet bezeichnen.«
»Du weißt, was ich meine. Innerlich bist du ständig auf dem Sprung.«
»Quatsch, ich bin gern in Frankfurt. Abgesehen von der Sommerhitze. Und der stehenden Luft und dem Gestank natürlich.«
»Schön warm ist es hier.«
»Und dem Hessisch, jetzt, wo du es sagst.«
Dafür pufft sie mich scherzhaft in die Seite.
»Ernsthaft. Frankfurt ist schon okay. Aber ich interessiere mich halt für die Welt.«
»Was immer du dir einredest.«
Die letzten Meter gehen wir, um abzukühlen.
»Was wirst du Ingmar sagen?«
Ich sehe Ingmars erwartungsfrohes Lächeln vor mir, die Fältchen um seine Augen hinter der Goldrandbrille. »Dass ich Bedenkzeit brauche. Und wohl auch mit der Bank sprechen muss.«
»Für ein etabliertes Geschäft wie das solltest du doch ohne Weiteres einen Kredit bekommen.«
Auch sonst sollte ich das. Ich habe Sicherheiten, von denen Caroline nichts weiß. Nicht mal Konstantin habe ich davon erzählt.
Liebe Maira
Jedes Mal, wenn mein Leben zu groß für mich wird, wenn ich mich nach Hamburg und meinen Freundinnen dort sehne, wenn ich zu zweifeln beginne, ob Soeterhoop der richtige Ort für uns ist, jedes Mal sehe ich dann dich an, Maira.
Das Meer und der Wind haben Wurzeln in deiner Seele geschlagen, und das ist jede Telefonkonferenz und auch jedes bisschen Einsamkeit wert, das mich manchmal überfällt. »Wie kann man hier einsam sein?«, würdest du fragen, würde ich mit dir darüber sprechen. »Wie kann man einsam sein, wenn man doch umhüllt ist von Freundschaft und Abenteuer und Wildnis?«