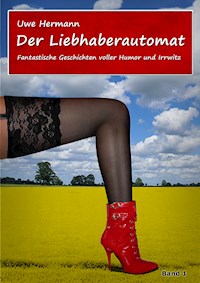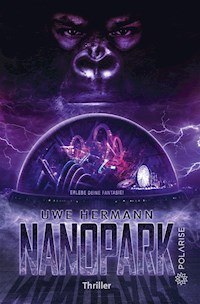Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die SPHÄRE – das bessere Berlin. Im Berlin des Jahres 2069 sind bereits Hunderttausende von Menschen in die SPHÄRE gewechselt, einer perfekten, virtuellen Kopie der Stadt. Die Transferierten, genannt Essenzen, hoffen auf einen Neuanfang und waren bereit, ihr reales Leben dafür aufzugeben. Noah Lloyd arbeitet bei GOLIATH, der Firma, die die SPHÄRE geschaffen hat, als ein Anschlag auf sie verübt wird. Dann wird ihm ein mysteriöser Datenstick zugespielt. Plötzlich steht er im Mittelpunkt der Ermittlungen. Gejagt von der Polizei muss Noah Lloyd in einem von Drogen, Prostitution und Kriminalität gezeichneten Berlin seine Unschuld beweisen. Dabei helfen kann ihm nur seine Frau, doch die hat er gegen ihren Willen in die SPHÄRE geschickt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Uwe Hermann
Userland
1 Yin und Yang
Noah Lloyd klammerte sich an seine Bierflasche und sah den zwei gewaltigen Brüsten zu, die im Schein greller Neonlichter unentwegt vor seinem Fenster auf und ab wippten. Sie gehörten zu der Videoprojektion einer überlebensgroßen, unbekleideten Frau, die auf der anderen Straßenseite vor dem Eingang eines Nachtclubs um Kunden warb. Lloyd nannte die Brüste Yin und Yang. Normalerweise brachten sie ihn auf andere Gedanken, aber nicht heute. Heute saß er stumm in seiner Wohnung und blickte durch sie hindurch, als wären sie aus Glas. Um ihn herum klebten die hereinfallenden Lichter der Reklametafeln Muster an die Wände der Apartmentwohnung im siebten Stock. Schon vor Stunden hatte sein Verstand eine Auszeit genommen und nur die Trauer um den Verlust seiner Frau zurückgelassen. Wie so oft versuchte er, Renas Bild aus seinem Kopf zu verdrängen, doch jedes Mal, wenn er alleine war, kehrte die Trauer zurück.
Vor neun Monaten hatte er sie in die Sphäre geschickt. Die schwerste Entscheidung seines Lebens, aber es war die einzige Möglichkeit gewesen, sie zu retten. Und doch hatte er sie verloren.
Lloyd nahm einen Schluck Bier. Es schmeckte fade und abgestanden. Der knapp über einen Meter achtzig große Mann mit den kurz geschorenen, schwarzen Haaren stellte die Flasche zurück auf den von Essensschachteln bedeckten Tisch und erhob sich. Der Alkohol in seinem Körper versuchte seinen Kopf in ein Jahrmarktkarussell zu verwandeln. Lloyd wankte und hielt sich am Sofa fest. Auf dem Boden lagen weitere Bierflaschen, auch sie längst geleert.
Von draußen hämmerten Regentropfen gegen die Scheiben. Der Niederschlag nahm zu, bis die Projektion der Brüste flackerte und erlosch.
Lloyd durchquerte die Wohnung mit wenigen Schritten, vorbei an dem Aquarium mit den Süßwasserfischen, den immer noch gefüllten Umzugskartons, bis zur rückwärtigen Wand mit dem Bücherregal, an der er ein gerahmtes Replikat eines uralten Kinoplakates zur Seite schob. Dahinter kam ein Wandtresor zum Vorschein, ein Überbleibsel seines Vormieters, der darin Drogen aufbewahrt hatte, bis er sein Geschäft nach einem heftigen Streit mit einem unzufriedenen Kunden und einer Kugel im Kopf hatte aufgeben müssen. Noch heute erinnerten ein paar Blutspritzer quer über dem DeLorean auf dem Kinoplakat an diesen Tag.
Lloyd gab die Zahlenkombination ein (Renas Geburtstag) und öffnete den Tresor. Im Innern befand sich nur ein angebrochener Sechserträger Bier.
Er nahm eine der Flaschen heraus und ließ die Tresortür mit dem Ellenbogen zuschnappen. Die Flasche fühlte sich kühl an, im Gegensatz zu seiner restlichen Wohnung. Die Heizung ließ sich nicht regulieren und lief immer auf höchster Stufe, und auch in seiner Küche, die nur aus einer Mikrowelle und einem defekten Kühlschrank bestand, war es unerträglich warm. Seine einzige Möglichkeit, das Bier kühl zu halten, war der Tresor. Lloyd wusste, dass er in einem heruntergekommenen Loch wohnte und auf dem besten Weg war, sich seiner Umgebung anzupassen, doch das war ihm gleich. Außerdem gab es für ihn sowieso keine Aussicht mehr auf ein Happy End. Die Kosten für den Transfer seiner Frau in die Sphäre, hatten seine ganzen Ersparnisse verschlungen. Egal wie viele Überstunden oder Nachtschichten er auch einlegen würde, er hätte nie genug Geld, um ihr folgen zu können.
Die Zeitanzeige auf der Multimediatapete sprang auf einundzwanzig Uhr und die Stadtwerke schalteten pünktlich den Regen ab.
Wenigstens etwas, was in dieser kaputten Stadt noch funktionierte.
Ohne die monotonen Geräusche der Regentropfen kehrte die Lautlosigkeit im Apartment 712 des Gebäudekomplexes in der Potsdamer Straße 85, im Bezirk Berlin-Mitte, zurück. Lloyd wankte zu seinem Sofa hinüber und ließ sich hineinplumpsen. Wütend auf sich selbst, öffnete er die Flasche und trank einen großen Schluck Bier. Was für eine dämliche Idee, den Geburtstag seiner Frau alleine feiern zu wollen. Was hatte er sich dabei gedacht? Hatte er erwartet, dass er sich besser fühlte? Dass ihn die Schuldgefühle für einen Tag in Ruhe ließen? Das Gegenteil war der Fall.
Vor ihm auf dem Tisch standen mehrere Pappschachteln mit dem Aufdruck eines polnischen Schnellrestaurants. Er hatte das Essen nicht angerührt und es war längst kalt. Wieder einmal nahm er seine Mahlzeit in flüssiger Form zu sich. Er trank erneut. Die Stille im Apartment wurde unerträglich und füllte sich mit Renas vorwurfsvoller Stimme. »Hör auf zu trinken«, sagte sie.
Lloyd schaltete den Nachrichtenkanal ein. Über einen Teil seiner Multimediatapete flimmerte der Bericht einer Demonstration, in der unzufriedene Bürger den Zugang zu der Sphäre forderten. Klaus Steffens, Berlins Innensenator, gab ein Interview, in dem er die Überprüfung des Verbotes versprach. Er wirkte nervös und verhaspelte sich wie ein Schuljunge bei seinem ersten Rendezvous. Kein Wunder, schließlich war er es gewesen, dessen Anzeige zur Schließung der Firma geführt hatte. Der grauhaarige Politiker hatte Salomon Engel und Armin Zeidler, die Gründer von Goliath, wegen aktiver Sterbehilfe angezeigt und nicht akzeptieren wollen, dass es sich bei der Sphäre um die Fortführung des Lebens auf einer anderen Ebene handelte. Die Gerichte bestätigten einen Verstoß gegen Paragraf 216 Absatz 1 des StGB und schlossen Goliath.
Die Multimediatapete schaltete den Ton des Nachrichtenkanals aus. Ein Klingeln zerriss Lloyds trübe Gedanken. Er schaute zu seinem Empathiephone hinüber, das auf dem Tisch neben der Aluminiumverpackung mit dem polnischen Krauteintopf lag. Das Telefon nahm seinen Blick wahr und erriet seine Frage: »Deine Arbeitskollegin Marla Brand vom Büro des Objektschutzes wünscht dich zu sprechen. Hast du Zeit?«
Lloyd fuhr sich mit der Hand über das Kinn, spürte die Stoppeln in seinem unrasierten Gesicht und überlegte, ob er den Anruf entgegennehmen sollte. Marla hatte ihn noch nie privat angerufen. In der Firma war ein »Hallo!« das Einzige, was sie austauschten. Endlich siegte die Neugierde und er nickte seinem Telefon zu.
Auf der Multimediatapete erschien das Logo seines Telefonanbieters. Nach einem Werbespot für Haarshampoo wechselte das Bild zu einer kindlichen Frau mit schulterlangen, lilafarbenen, fast schwarzen Haaren und schwarz geschminkten Augen. Sie trug ein dunkles Kostüm. Im Hintergrund sah Lloyd eine ihm bekannte Multimediatapete mit Schichtplänen, der Kalenderansicht des Jahres 2069 und dem Bild einer Cartoon-Katze in Siegerpose. Marla rief von der Firma aus an.
Die neunundzwanzigjährige Frau arbeitete wie er für Goliath. Während sie sich um die Lohnbuchhaltung, die Einteilung der Schichten und den restlichen Papierkram kümmerte, war er einer von acht Mitarbeitern des Objektschutzes, die mit der Sicherung des Firmengeländes beauftragt waren.
Marla weinte heftig, ihr Körper zitterte. »René und Bob sind tot!«, stammelte sie. Tränen kullerten über das Gesicht und zogen Reste ihres Make-ups wie einen Sternenschweif hinter sich her. »Diese Mörder sind in die Eingangshalle gestürmt und haben sie einfach erschossen …« Der Rest ihres Satzes verlor sich in hemmungslosem Schluchzen.
Lloyd setzte sich erschrocken aufrecht. Sein Magen zog sich zusammen. Er stellte die Bierflasche heftig auf den Tisch, dass es schepperte.
»Was ist geschehen?«
Marla wischte sich mit dem Handrücken über die Augen und verschmierte ihr Make-up noch mehr. Einer ihrer langen, blinkenden Leucht-Ohrringe in Form einer Katze fiel herunter, ohne dass sie es bemerkte.
»Es war vor drei Stunden, da sind fünf bewaffnete Männer in die Firma gestürmt. Becker haben sie sofort getötet. Sie haben ihm … einfach eine Kugel in den Kopf geschossen, als wäre er eine Zielscheibe.« Wieder erstickte ein Weinkrampf ihre Stimme. »René hat versucht, sie aufzuhalten. Er war bei Engel im Büro. Die Kameras haben alles aufgezeichnet. Es ist … schrecklich. Sie sind mit dem Privatfahrstuhl nach oben gefahren, haben René getötet und Engel gezwungen, sie in den Transferraum zu bringen.«
Lloyds dachte nach. Er verfluchte den Alkohol in seinem Blut, der seine Überlegungen durcheinanderwirbelte und jeden Gedanken erschwerte.
Plötzlich wurde Lloyd klar, dass er jetzt dort mit einer Kugel im Kopf hätte liegen können. Becker hatte für ihn die Spätschicht übernommen. Ihm wurde übel.
Er schaute wieder in Marlas verheultes Gesicht. »Wie konnten sie mit dem Fahrstuhl nach oben in Engels Privaträume gelangen? Dazu brauchten sie einen Sicherheitscode.«
Die Frau nickte. »Den hatten sie! Auf den Aufzeichnungen ist zu sehen, wie einer von ihnen vor dem Tastenfeld steht, den Code eingibt und die Fahrstuhltüren sich öffnen.«
»Wie geht’s Engel?«
Marla setzte zu einer Antwort an, doch bevor sie berichten konnte, wie es ihrem Arbeitgeber ging, riss die Verbindung ab.
Auf der Multimediawand erschien erneut das sich drehende Logo seines Telefonanbieters.
»Gespräch wiederherstellen!« Lloyds Empathiephone wählte mehrmals, aber eine neue Verbindung kam nicht zustande.
»Zurzeit sind alle Leitungen besetzt. Dein Gesprächspartner bittet dich, es zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu versuchen«, sagte sein Telefon.
Lloyd ließ Marlas Worte auf sich einwirken. Erst jetzt begriff er die ganze Tragweite. Er arbeitete seit mehr als fünf Jahren beim Objektschutz des Transferunternehmens Goliath und nie hatte es mehr als einen Einbruch oder einen Diebstahl gegeben. Und jetzt waren bewaffnete Männer in das Gebäude eingedrungen und hatten seine Kollegen getötet?
Er musste zu Goliath!
Lloyd sprang auf und griff nach dem Empathiephone. »Ich brauche meinen Wagen!«, rief er der Multimediatapete zu. Er schluckte eine Tablette, um den Alkohol in seinem Blut zu neutralisieren. Dann hastete er zum Aquarium hinüber und öffnete die Abdeckung. Seine Hand tauchte in das Wasser ein, ohne nass zu werden, glitt durch die Projektionen der Fische und Korallen hindurch bis zum Boden und hob die dort versteckte Waffe auf. Im Laufen zog er seinen Mantel an und stürmte aus der Wohnung.
2 Goliath
Lloyd rannte über den schmutzig grauen Flur, vorbei an leer stehenden Wohnungen und mit Graffiti besprühten Wänden, bis zu einem gläsernen Außenlift. Er war einer der wenigen Fahrstühle, die in diesem Wohnblock noch funktionierten. Obszöne Schmierereien und noch mehr Graffiti versperrten den Blick nach draußen. Doch dort gab es sowieso nur die überlebensgroßen Projektionen nackter Haut zu sehen, die vor Bars, Nachtclubs und Bordellen Kunden anlockten. Dazwischen sich drehende Glücksschweinchen und vierblättrige Kleeblätter über den Kasinos und Spielhöllen der Stadt.
In der Kabine kickte Lloyd mit dem Fuß gegen eine leere Alkoholflasche, deren hochprozentiger Inhalt längst geleert worden war. Sie rotierte um ihre Achse, kullerte über den Boden und knallte an den Kopf ihres Besitzers, der zusammengekauert in einer Ecke der Kabine lag und seinen Rausch ausschlief.
Lloyd nannte als Ziel das Erdgeschoss und der Expresslift setzte sich quietschend in Bewegung. Während er Stockwerk um Stockwerk in die Tiefe rumpelte, versuchte Lloyd erneut, die Firma zu erreichen. Niemand nahm seinen Anruf entgegen.
Kreischend hielt der Lift im Erdgeschoss an. Lloyd zwängte sich durch den größer werdenden Spalt hindurch und rannte den Hausflur entlang. Über ihm flackerten defekte Lichtleisten und begleiteten seine Schritte bis zur Tür. An der Wand neben dem Ausgang hing ein mit schweren Eisenriegeln gesicherter Drogenautomat. Davor standen ein paar Gestalten und versuchten ihn mit Hammer und Montiereisen aufzubrechen. Die Männer sahen Lloyd und unterbrachen ihre Arbeit. Keiner sagte ein Wort, aber ihre Blicke waren Drohung genug. Lloyd hatte weder die Zeit noch die Lust, sich mit ihnen anzulegen. Sollten sie den Automaten doch aufbrechen. Der war seit Monaten defekt. Die Spinner würden früh genug merken, dass in diesem außer ein paar Spinnweben nichts zu holen war – wenn sie den Automaten denn aufbekamen. Er rannte an den Gestalten vorbei nach draußen und sie widmeten sich wieder ihrer schweißtreibenden Angelegenheit.
Verstörend kalter Wind schlug Lloyd entgegen und vertrieb den Restalkohol in seinem Blut wie ein Rudel Hunde eine Katze. Augenblicklich benetzte Regen seinen Mantel. Ein paar Wolken hatten den Befehl der Berliner Stadtwerke offensichtlich ignoriert und leerten sich wie ein undichtes Planschbecken über die Potsdamer Straße.
So viel zu der Zuverlässigkeit der Stadtwerke. Lloyd blieb stehen und sah sich nach seinem Wagen um. Die Luft roch nach Elend, Leid und anderen Gerüchen, wie es sie nur in solch heruntergekommenen Vierteln gab. In den Pfützen flackerte das Neonlicht der unzähligen Werbetafeln, als hätte jemand phosphoreszierende Farbe über den Bordstein vergossen. Frauen, die meist wenig bis kaum Kleidung trugen, lehnten zügellos an den Hauswänden, während ihre männlichen Kunden mit hochgeschlagenen Kragen vorübereilten, als hätte nur der Zufall sie in dieses verruchte Viertel geführt.
Auch Lloyd schlug den Kragen seines Mantels hoch, doch er suchte keine weibliche Unterhaltung, sondern wartete auf seinen Wagen. Auf der anderen Straßenseite tanzten wieder die roten Lackpumps der nackten Schönheit vor dem Eingang des Nachtclubs. Hoch über ihnen wippten Yin und Yang.
Eine Frau rannte an Lloyd vorüber, warf ihm einen ängstlichen Blick zu und verschwand in einer Seitengasse, als wäre diese weniger gefährlich als er.
Er musste unbedingt mehr auf sein Äußeres achten. Lloyd strich sich mit dem Handrücken über sein stoppeliges Kinn.
Ein Penner, der mit dem Rücken an einer Hauswand lehnte, schaute der Frau nach und rief etwas von dem Ende der Zivilisation und dass der Raubbau an der Umwelt an allem schuld sei. Und die Lobbyisten. Und die Politiker. Und natürlich die Sphäre.
Zu beiden Seiten der Potsdamer Straße schmiegten sich Bars, Bordelle und Sexboutiquen wie Liebende aneinander. Wer dort nicht fündig wurde, konnte sein Glück in den vielen anderen Rotlichtbezirken der Stadt suchen, die wie Pilze aus dem Boden geschossen waren. Schon verrückt. Je ärmer die Menschen wurden, umso mehr Geld gaben sie für ihre Bedürfnisse aus – oder für das, was sie dafür hielten. Die Straße weiter runter drängte sich eine lange Menschenschlange vor einem Nachtclub, in dem legale Drogen und Getränke zu kleinen Preisen verkauft wurden. Gerade brach eine Schlägerei unter den Wartenden aus. Ein paar Schüsse fielen. Die Menschen stoben auseinander, nur um sich nach kurzer Zeit erneut anzustellen.
Ein Schwarm Überwachungsdrohnen der Ermittlungsbehörde surrte über Lloyds Kopf hinweg, Richtung Nachtclub. Weiter südlich, auf der anderen Seite der Bülowstraße lag das Viertel der Südkoreaner, um das man besser einen Bogen machte. Dort gab es keine ausschweifenden Exzesse, und wenn doch, dann hinter unbeleuchteten Häuserfassaden mit den Steinstatuen ihres Stadtteilführers.
Lloyd zog sein Telefon aus der Tasche und ließ es das Internet nach Informationen über einen Anschlag auf Goliath durchsuchen. Es dauerte einen Moment, dann flimmerte das Ergebnis über den Bildschirm. Die sozialen Medien waren voll mit Berichten. Drohnenvideos zeigten Polizeikräfte, die das Gelände absperrten und Anti-Drohnenbereiche einrichteten. Die wendigen Ein-Mann-Kopter eines mobilen Einsatzteams standen mit blinkenden Lichtern vor dem dreieckigen, gläsernen Bauwerk der Firma und dessen aus dem Innenhof aufragendem kugelförmigen Hauptgebäude. Ein Blogger schrieb von einem Terroranschlag mit Dutzenden von Toten, ein anderer vermutete eine Inszenierung, um die Regierung zur Rücknahme der einstweiligen Verfügung zu bewegen.
Lloyds autonom gesteuertes E-Fahrzeug fuhr vor. Vier glänzende Kugeln, von Magnetfeldern gehalten, trieben das flunderförmige Auto an. Sie erlaubten plötzliche Richtungsänderungen und hätten es nahezu lautlos bewegt, wären sie und der Rest des Fahrzeuges nicht so heruntergekommen gewesen. So klapperte die altersschwache Karosserie des Wagens wie eine Plastiktüte voller leerer Bierdosen.
Die Beifahrertür schwang auf. Lloyd ließ sein Telefon in die Tasche gleiten und stieg ein. Das Kunstleder der alten Sitze knarzte. Im Inneren roch es nach Rauch, Schweiß und Alkoholresten.
Der Wagen begrüßte ihn mit einer Stimme, die zum Rest des Fahrzeugs passte, und erkundigte sich nach Lloyds Wünschen.
»Bring mich in die Firma!«, befahl er.
Die Beifahrertür schloss sich mit einem schmatzenden Geräusch und der Wagen fuhr los. Er fädelte sich in südlicher Richtung in den Verkehr ein und beschleunigte. Nach einem kurzen Moment bog er in die Kurfürstenstraße ein und fuhr weiter nach Westen.
Es herrschte nur wenig Verkehr auf den Straßen. Seit Jahren wechselten immer mehr Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben in die Sphäre. Zurückgeblieben waren nur Loser, die sich die Passage nicht leisten konnten.
So wie er. Lloyd war frustriert und Rena schlich sich in seine Gedanken. Er sah ihre kurzen weißen Haare, roch ihr süßes Parfüm und hörte ihr Lachen. Warum war das Leben nur so ungerecht?
Erbittert presste er die Lippen aufeinander und konzentrierte sich auf Marlas Worte. Der Überfall! Die Angreifer hatten Engel gezwungen, sie in den Transferraum zu bringen. Reichte eine Person zur Bedienung der Anlage überhaupt aus? Lloyd wusste es nicht.
An dem Tag, als er Rena aus dem Krankenhaus geholt und in die Firma gebracht hatte, hatte sich ein halbes Dutzend Personen im Transferraum aufgehalten. Männer in weißem Kittel, wie die Ärzte, die ihr nicht hatten helfen können, überwachten Kontrollmonitore. Sie scannten Renas DNA, kopierten ihre Gedanken, ihre Erinnerungen, ihre Persönlichkeit, kurz: alles, was sie ausmachte, und schickten diese Daten – Essenz genannt – in die Sphäre, einer virtuellen Kopie von Berlin.
Vor Rena hatten bereits Hunderttausende von Menschen diesen Schritt unternommen. Manche, weil sie den Tod fürchteten, andere, weil sie hofften, die Sphäre wäre das Paradies. Sie versprach ein Leben ohne Krankheit und Hunger, ohne Armut und Langeweile. Ein Neuanfang im gelobten, virtuellen Land! In einer 3D-Welt, in der es nur Sieger gab.
NPCs – Non-Player-Character –, vom Computer gesteuerte, künstlich erschaffene Essenzen kümmerten sich dort um die Bedürfnisse der Menschen. Niemand brauchte zu arbeiten.Doch um in die Sphäre zu gelangen, gab man seinen alten, realen Körper auf – und jede Hoffnung, jemals wieder in die wirkliche Welt zurückkehren zu können. Der Körper starb, nachdem die Essenz des Menschen transferiert worden war. Zurück in der von den Auswirkungen der Klimakatastrophe, der Umweltverschmutzung und der Gewalt geprägten Welt blieben nur diejenigen, die sich den Transfer nicht leisten konnten.
Schließlich verbot die Regierung die Benutzung der Anlage und zwang Engel und Zeidler, den Betrieb einzustellen.
Lloyd hatte sein Telefon angewiesen, das Internet nach neuen Meldungen über einen Angriff auf Goliath zu durchsuchen. Bislang wiederholten sich die Berichte, durchsetzt mit immer wilderen Spekulationen, doch jetzt gab es ein Video, das einen Leichenwagen vor der gläsernen Vorderfront des Gebäudes zeigte. Das Telefon legte das Video auf die Innenseite der Windschutzscheibe.
Lloyd sah Lastenroboter vier Särge herantragen und in den Leichenwagen verladen. Im vorderen Bereich des Firmengebäudes standen Absperrungen, bewacht von drei Meter großen Sicherungseinheiten der Polizei. Inzwischen brachten die öffentlichen Nachrichtenkanäle einen Sonderbericht über den Angriff, aber mehr als das, was Lloyd wusste, meldeten sie nicht. Kein Wort über den Gesundheitszustand des Firmeninhabers Salomon Engel, dessen Geschäftspartners oder der anderen Personen, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs in der Firma aufgehalten hatten. Was war aus den Angreifern geworden? Marla hatte von fünf Personen gesprochen. Waren sie noch im Gebäude? Oder hatten sie es in die Sphäre geschafft?
Lloyds Wagen verließ die Hardenbergstraße und den Ernst-Reuter-Platz. Er wechselte auf den vierspurigen Zubringer und folgte ihm für einige Kilometer in östlicher Richtung. In der Ferne tauchte die gewaltige Kugel des Hauptgebäudes auf, die aus dem Innenhof des dreieckigen Gebäudekomplexes wie ein gewaltiger Fußball emporragte. Auf ihr leuchtete in riesigen Buchstaben Goliaths Schriftzug.
Schließlich erreichte er den Parkplatz vor dem beleuchteten Firmengelände. Drei Meter große Sicherungseinheiten der Polizei standen an provisorisch errichteten Absperrgittern und hielten mit ihren eindrucksvollen Waffenarmen Schaulustige auf Distanz.
Lloyd ließ seinen Wagen am Rande der Absperrung, in der Nähe des angrenzenden Parks, anhalten und stieg aus. Inzwischen war es kurz vor zweiundzwanzig Uhr. Es hatte zu regnen aufgehört und die Luft roch bereits wieder nach Rauch und Chemikalien, als verbrennte jemand alte Autoreifen. Ein vertrauter Geruch im Berlin des Jahres 2069, Umweltschutz stand schon lange nicht mehr an erster Stelle.
Sein Wagen fuhr klappernd davon, Richtung Parkplatz. Im angrenzenden Park krächzten ein paar Tauben, aufgeschreckt durch den Lärm seines Fahrzeuges.
Lloyd ging zum Haupttor hinüber, vor dessen Absperrgitter eines der zweibeinigen, metallenen Ungetüme den Weg blockierte. Sein Waffenarm schwenkte herum: »Weitergehen, Bürger! Dies ist ein Polizeieinsatz! Das Betreten des Geländes ist verboten!«
Lloyd blieb sofort stehen. R12-Einheiten waren dafür berüchtigt, dass sie hin und wieder auch grundlos das Feuer eröffneten. Keiner wusste, ob das Teil der Abschreckungsstrategie des Herstellers war oder ob Hacker sich einen Spaß mit ihnen erlaubten.
Sicherheitshalber streckte Lloyd die Arme in die Höhe.
»Ich bin Noah Lloyd und gehöre zum Objektschutz«, wies er sich aus, obwohl der Roboter längst den Identifikationssender seines implantierten Ausweises gescannt haben musste.
»Bitte warten Sie. Ein menschlicher Mitarbeiter wurde über Ihre Ankunft unterrichtet.«
Lloyd wagte nicht, sich zu rühren. Mehrere tragbare Scheinwerfer beleuchteten das Gelände und seine Gebäude. Vor der gläsernen Vorderfront des Eingangsgebäudes standen die Maschinen des Kopter-Teams, die er bereits auf den Internetvideos gesehen hatte. Sie erinnerten ihn sofort an Rena. Auch sie hatte einem dieser Teams angehört.
Aus dem Haupteingang des Gebäudes trat eine schlanke, durchtrainierte Gestalt in schwarzer Fliegermontur und Stiefeln. Ein Quadpilot! Sie trug einen Helm mit heruntergeklapptem, verspiegeltem Visier. Lloyd ahnte, dass über dessen Innenfläche in diesem Moment der Inhalt seiner Akte scrollte. Spätestens jetzt wusste sein Gegenüber, dass er Renas Ehemann war und dass er sie in die Sphäre geschickt hatte.
Die Gestalt kam näher und Lloyd erkannte an ihrer Bewegung, dass es sich um eine Frau handelte. Auf der Brusttasche ihrer Flugmontur stand ihr Name: Lina Graf.
»Sie sind Noah Lloyd?«, fragte sie, obwohl ihr die R12-Einheit längst seine Daten übermittelt haben musste.
Er nickte und sagte: »Ich arbeite beim Objektschutz. Eine Kollegin rief mich an und erzählte mir, was geschehen ist. Wie geht’s Salomon Engel und meinen Kollegen? Kann ich helfen?«
Unter ihrem Helmvisier flackerte der Widerschein einer eintreffenden Nachricht. Sie ignorierte seine Frage. »Mein Scanner zeigt mir, dass Sie bewaffnet sind. Geben Sie mir Ihre Pistole!« Sie streckte die Hand aus.
Lloyd zögerte. »Ich habe eine Waffenbesitzkarte!«
»Das sehe ich, trotzdem lasse ich Sie nicht mit einer Waffe ins Gebäude!« Die R12-Einheit entsicherte mit einem unüberhörbaren metallischen Klicken ihren Waffenarm, der noch immer drohend auf ihn zeigte.
Lloyd schob langsam eine Seite seines Ledermantels zurück, bis sein Waffenholster sichtbar wurde.
Die Frau nahm ihm die Pistole ab und steckte sie ein. »Schön, dass Sie freiwillig gekommen sind, Bürger Lloyd. Wir hätten sonst eine Einheit losgeschickt, um sie abzuholen.« Sie befahl der R12-Einheit, das Absperrgitter freizugeben.
Lloyd schaute sie verdutzt an. »Sie wollten mich abholen? Warum?«
Lina Graf antwortete nicht. Sie wartete ungeduldig, bis er durch die Öffnung des Absperrgitters trat. Dann wies sie ihn mit einer Handbewegung an weiterzugehen. In Anbetracht der Waffen der R12-Einheit gehorchte Lloyd, ohne weitere Fragen zu stellen.
In Begleitung der Quadpilotin näherte Lloyd sich dem Hauptgebäude. Hinter dem Parkplatz stiegen sie die Stufen zum höher gelegenen Eingangsbereich hinauf, vorbei an mehreren Beeten mit nachtaktiven Blumen und einem beleuchteten Springbrunnen, bis sie schließlich vor dem Gebäude standen.
Dort parkte ein Lieferwagen der Spurensicherung. Lloyd sah drei Männer in weißem Schutzanzug, mit Koffern und Scannern in den Händen, die im Inneren des Gebäudes verschwanden. Links neben ihrem Fahrzeug stand ein Krankenwagen, dahinter zwei Mannschaftstransporter mit blinkenden Rundumleuchten und dem über der Karosserie scrollenden Schriftzug der Berliner Polizei.
Zwei Sicherheitsbeamte lösten sich aus ihrem Schatten, als hätten sie auf ihn gewartet. Wortlos schlossen sie zu ihnen auf.
Lloyd fühlte sich plötzlich unbehaglich. Er schaute über die Schulter zurück. Seine Schritte gerieten ins Stocken. Die beiden Männer folgten ihm, die Hände beunruhigend nahe an den Waffen. Was ging hier vor?
»Weitergehen!«, befahl einer von ihnen.
Sie führten Lloyd an dem gläsernen Haupteingang der Kunden vorbei zu einer Seitentür, wo ihnen ein Mitarbeiter des Werksschutzes öffnete. Einem schmucklosen Flur mit kitschigen Wandbildern und noch mehr nachtaktiven Pflanzen in Blumenkübeln folgend, gelangten sie in die Eingangshalle. Im Zentrum des fünfstöckigen Hauptgebäudes wimmelte es von Polizisten und Beamten der Spurensicherung. Mehrere Scannerdrohnen flogen dicht über dem Boden entlang und suchten nach DNA-Spuren. Andere durchstreiften Etage um Etage und überprüften jeden Winkel. Hinter einer Wand aus Werbetafeln sah Lloyd eine Gruppe weiß gekleideter Rettungssanitäter.
»Warten Sie hier!«, befahl Lina Graf schroff und verschwand in einer Tür zu ihrer Linken. Die beiden Sicherheitsbeamten blieben zurück und lehnten sich mit verschränkten Armen an die Wand, ohne ihn aus den Augen zu lassen.
Lloyd erschrak, als sein Blick auf die Blutlache vor dem Infostand in der Mitte der Halle fiel. Hier musste René gestorben sein. Sein Magen rebellierte bei diesem Gedanken und er schaute eilig weg.
An den Wänden hingen markige Werbesprüche: ›Bau dir dein eigenes Leben – in der Sphäre!‹ und ›Die Sphäre: Wo sich deine Träume erfüllen!‹
Lloyd sah Marla im selben Moment, in dem sie herüberschaute. Sie stand im Wartebereich in einer Gruppe Mitarbeiter auf der gegenüberliegenden Seite der Eingangshalle und nippte an einem Becher Tee, den ihr einer der Rettungssanitäter gereicht hatte. Helfer kümmerten sich um sie.
»Noah!« Sie stellte den Becher auf einem der Tische ab und rannte auf ihn zu.
Ihre stürmische Umarmung und die Intensität, mit der sie ihn drückte, überraschten Lloyd. Zwar kannten sie sich schon einige Zeit, doch zu mehr als einem freundlichen Gespräch unter Kollegen war es nie gekommen.
Die Sekunden verstrichen und Lloyd ließ es geschehen. Die Berührung war ihm alles andere als unangenehm. Außerdem war sie jung und sah gut aus. Er roch ihr Parfüm, das nach Vanille und Honig und irgendwie nach Katze duftete.
Schließlich schob er sie mit sanfter Gewalt von sich. »Geht es dir gut?«
»Die Ärzte haben mir etwas zur Beruhigung gegeben. Sie wollten mich ins Krankenhaus bringen, aber als ich erfahren habe, dass sie dich abholen, wollte ich unbedingt warten.«
»Warst du im Gebäude, als es passierte?«
Sie nickte. In ihren dunklen Augen funkelten Tränen. »Überstunden!« Ein heiseres Lachen folgte. »Die Regierung will die einstweilige Verfügung zurücknehmen, weiß aber nicht, wie sie das anstellen soll, ohne einen Fehler einzugestehen. Ich saß über dem Pressetext, den sie Engel geschickt haben, als die Angreifer das Gebäude stürmten.« Sie strich sich mit den Fingern durch die Haare und bemerkte, dass einer ihrer Ohrringe fehlte. Sie sah sich nach ihm um.
»Wie geht es Engel? Und meinen Kollegen?«
»Bürger Engel hat nur eine leichte Kopfverletzung. Von den anderen ist niemand verletzt. Bis auf …« Sie schluchzte und die Tränen flossen erneut.
Plötzlich hatte Lloyd das Bedürfnis, sie in den Arm zu nehmen und zu trösten. Für einen Moment fragte er sich, was Rena dazu sagen würde. Er streckte die Hand nach ihr aus, berührte sie sanft an der Schulter, als Graf aus dem Raum schaute. »Lloyd, kommen Sie rein! Sie werden erwartet!«
Einer der beiden Männer, die Lloyd und der Pilotin gefolgt waren, löste sich von der Wand und wies in Richtung der Tür.
Lloyd nickte Marla aufmunternd zu. Dann drehte er sich um und betrat an Graf vorbei den Raum.
Überrascht sah er sich Armin Zeidler gegenüber. Der siebenundfünzigjährige Mitbegründer von Goliath stand mit dem Rücken an ein Sideboard gelehnt und schaute ihn durch die Gläser seiner schwarzen Brille mit bewegungslosem Gesicht an.
Lloyd blieb stehen. »Bürger Zeidler? Ich wusste nicht, ob Sie … Wie geht es Bürger Engel? Ist alles …«
»Nehmen Sie Platz!«, unterbrach ihn Zeidler ruppig und deutete auf einen Stuhl vor einem Schreibtisch in der Mitte des Raumes.
Hinter Lloyd schloss Graf die Tür und stellte sich mit verschränkten Armen daneben.
Irritiert setzte sich Lloyd. Unvermittelt kam er sich wie ein Kaninchen in einem Fuchsbau vor. Was zur Hölle passierte hier? Er sah sich um. Aus dem angrenzenden Raum drang ein leises Summen und Piepen zu ihm herüber. Dort saßen Operatoren mit Datenhelm auf dem Kopf und überwachten die Bilder der Scannerdrohnen. Über den Boden schlängelten sich Strom- und Netzwerkkabel, die in Hochleistungsrechner an der Rückwand des Raumes hinter einem Konferenztisch verschwanden. Unverkennbar hatten die Einsatzkräfte diese Räume in aller Eile zur Einsatzzentrale umfunktioniert.
Lloyds Blick fiel wieder auf Zeidler. Der Geschäftspartner und Mitinhaber von Goliath schaute ihn bewegungslos an. Lloyd kannte ihn als umgänglichen Arbeitgeber – solange man sein Leben im Sinne der Firma gestaltete und sich nichts zuschulden kommen ließ, doch in diesem Moment hatte er jede Spur von Freundlichkeit verloren.
Lloyd gegenüber nahm ein schwarzhaariger Anzugträger unbestimmbaren Alters Platz. Dessen rechtes Auge war größer als das linke und offensichtlich künstlich.
»Guten Abend, hallo, Bürger Lloyd!«, sagte er, nur um den Blick seines künstlichen Auges sofort in den Bildschirm eines Tabletcomputers zu versenken, der vor ihm auf dem Tisch lag. Das andere Auge beobachtete Lloyd weiterhin. »Mein Name ist Polizeihauptkommissar Robert Braun. Ich leite die Untersuchung.« Während er sprach, überflog Braun den Text auf dem Tabletcomputer und tippte eine Antwort. Dann sah er auf und schaute Lloyd wieder mit beiden Augen an. »Wir haben ein paar Fragen an Sie.«
Seine Stimme harmonisierte hervorragend mit dem Rest seiner unfreundlichen Gestalt.
Lloyd setzte sich aufrecht. »Können Sie mir erklären, was das alles soll? Ich werde wie ein Verdächtiger behandelt und anscheinend wollten Sie mich sogar von einem Streifenwagen abholen lassen. Machen Sie das mit jedem meiner Kollegen?«
Braun ignorierte seinen ärgerlichen Tonfall. »Nur mit denjenigen, die sich zum Zeitpunkt des Anschlages nicht in der Firma aufgehalten haben.« Er zog seinen Tabletcomputer näher zu sich heran und tippte mit den Fingern darauf herum. »Fangen wir damit an, dass Sie mir erzählen, wo Sie heute Abend waren.«
»Zu Hause. Ich habe Urlaub«, knurrte Lloyd.
Brauns rechtes Auge schaute auf den Tabletcomputer. »Das ist Ihr erster Urlaub seit langer Zeit. Das ist schon ein seltsamer Zufall, dass ausgerechnet an diesem Tag die Firma überfallen wird.«
Lloyd stieß sauer auf von zu viel Alkohol und Stress. Er konnte nicht verhindern, dass der Ärger in ihm seine Wortwahl übernahm.
»Was wollen Sie damit andeuten? Glauben Sie, dass ich etwas mit dem Überfall zu tun habe?« Er schluckte den sauren Geschmack in seiner Kehle herunter und stieß ein verunglücktes Lachen aus. »Das ist lächerlich. Ich war den ganzen Abend zu Hause und habe den Geburtstag meiner Frau gefeiert.«
»Ihre Frau ist tot!«, sagte Braun scharf.
»Meine Frau ist nicht tot, sondern in der Sphäre«, erwiderte er mühsam beherrscht.
»Für die Regierung ist das das Gleiche.«
»Aber nicht für mich!«
»Gibt es jemanden, der Ihre Aussage bestätigen kann?«
Lloyd dachte kurz an Yin und Yang. Dann schüttelte er stumm den Kopf.
Braun und Zeidler warfen sich vielsagende Blicke zu.
Lloyd platzte der Kragen. Er ballte die Hände zu Fäusten. »Ich brauche kein Alibi, weil ich mit dem Anschlag auf die Firma nichts zu tun habe!«, schrie er.
Zeidlers Antwort donnerte durch den Raum: »Dann erklären Sie uns, wieso die Angreifer Ihren Fahrstuhl-Zugangscode kannten, mit dem sie in die oberen Räume gelangten!«
3 Unter Verdacht
Als sie Lloyd gehen ließen, kratzten die ersten Strahlen der Morgensonne bereits an Berlins schmutzig grauem Himmel. Der Wind trieb zerfledderte Wolken vor sich her, so ruhelos, wie Lloyd sich fühlte. Polizeihauptkommissar Braun hatte ihn die ganze Nacht über verhört und nach Gründen gesucht, um ihn einsperren zu können, doch abgesehen von der Tatsache, dass die Angreifer seinen Zugangscode benutzt hatten, hatte es nichts Belastendes gegeben. Trotzdem durfte Lloyd Berlin nicht verlassen. Das Schlimmste aber war, dass er seinen Job verloren hatte. Alle Unschuldsbeteuerungen waren zwecklos gewesen. Zeidler hatte seinen Ausweis verlangt und ihn am Ende des Verhörs aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Er hatte gesagt, dass er sich keinen Mitarbeiter leisten könne, der so verantwortungslos mit seinem Sicherheitscode umginge.
Lloyd fühlte sich schlecht wie seit Monaten nicht mehr. Er hatte geglaubt, längst alle Facetten der Verzweiflung gekannt zu haben, doch jetzt belehrte ihn Zeidler eines Besseren. Wovon sollte er seine Miete bezahlen? Und schlimmer noch: Wie sollte er die Raten für Renas Transfer aufbringen? Noch immer schuldete er Goliath eine große Summe an Geld. Was würde geschehen, wenn er mit der Zahlung in Verzug geriet? Würde Zeidler Renas Essenz aus der Sphäre löschen? Mit Sicherheit waren die Ingenieure bei Goliath dazu in der Lage, aber würde Zeidler so weit gehen? Lloyd wurde übel bei dem Gedanken.
In seiner Wohnung begrüßten ihn Yin und Yang, doch Lloyd war zu müde, um ihnen »Hallo!« zu sagen. Er zog seinen Ledermantel aus und ließ ihn achtlos auf den Boden gleiten. Seine Waffe hatte die Quadpilotin einbehalten und er pfefferte das nutzlose Schulterholster missmutig in die Ecke. Inzwischen hatte er nicht einmal mehr die Kraft, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Er wollte nur noch schlafen. Angezogen, wie er war, ließ er sich auf sein Bett fallen und schnarchte sofort weg.
Lärm weckte Lloyd. Es war so früh am Morgen, dass seine beiden Bekannten noch nicht vor dem Fenster auf und ab hüpften. Er erhob sich und setzte sich gähnend auf die Bettkante. Sein Körper fühlte sich an wie nach einer Schlägerei. Der Lärm nahm zu und Lloyd ging zum Fenster hinüber und schaute hinaus.
Unten auf der Straße zog eine Demonstration vorbei, die lautstark für chronisch Kranke einen Zugang zur Sphäre auf Rezept forderte.
Lloyd trat vom Fenster zurück an den Couchtisch. Er verspürte Hunger. Zwischen den leeren Bierflaschen entdeckte er die Aluschalen mit dem polnischen Gericht, das er sich am letzten Abend hatte kommen lassen. Er öffnete eine von ihnen, griff nach einer Gabel, und probierte einen Bissen. Angeekelt verzog er das Gesicht. Als Frühstücksersatz taugte es nicht.
Lloyd warf die Schale achtlos zurück auf den Tisch und überlegte kurz, sich ein Bier zu holen – ein paar Flaschen lagerten noch in seinem Tresor –, doch er verwarf den Gedanken. Noch besaß er so etwas wie Prinzipien und eine besagte: das erste Bier nie vor 12 Uhr. Außerdem hatte er keine Zeit, um in seiner Wohnung auf den Rauswurf zu warten. Er musste herausfinden, wie die Angreifer an seinen Sicherheitscode gekommen waren.
Lloyd nahm seinen Mantel und verließ das Apartment.
Unten im Eingang des Wohnhauses hing der Drogenautomat noch immer unversehrt an der Wand. Eine Blutlache und ein abgebrochenes Montiereisen zeugten davon, dass die Bande zwar etwas geöffnet hatte, dass das aber nicht der Automat gewesen war. Ihre Wut hatten sie an der Eingangstür ausgelassen. Sie hing jetzt windschief im Rahmen. Lloyd zog sie auf und trat auf die Straße.
Der Kiez schlief noch, trotzdem sah er vereinzelt Frühaufsteher. Die leicht bekleideten Frauen trugen jetzt Jeans und Mantel und saßen übernächtigt in einem der wenigen Cafés; die anderen schliefen nach einer Nacht voller Aufopferungsbereitschaft alleine in ihrem Bett.
Für einen Moment genoss Lloyd die Ruhe. Er hatte Kopfschmerzen, aber die frische Luft ließ ihn das hämmernde Pochen in seinem Schädel vergessen. Ein kühler Windhauch schlug ihm entgegen und lenkte seine Gedanken in sinnvolle Bahnen. Was sollte er tun? Leider hatte er keine Antwort auf diese Frage. Der Tag begann so düster, wie die Nacht geendet hatte. Er brauchte einen Kaffee!
Lloyd wandte sich nach Süden und folgte der Potsdamer Straße, vorbei an den Abfällen der letzten Nacht. Zwei Minuten später erreichte er das Café in der Pohlstraße. Es hatte noch geschlossen, doch jeder, abgesehen von den Touristen, kannte den Hintereingang, der für die Stammkunden immer offen stand. Er trat ein.
Außer ihm hatten drei weitere Frühaufsteher den Weg hierher gefunden. An einem Tisch bemerkte er eine dunkelhaarige Frau mit verweinten Augen, die in ihre Tasse starrte, als suchte sie darin die Antworten auf ihre Fragen. In der anderen Ecke saß ein Mann in Frauenkleidern mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt. Er rührte sich nicht und es war nicht auszumachen, ob er schlief oder längst das Zeitliche gesegnet hatte. Den dritten Gast kannte Lloyd. Die rothaarige, schlanke Schönheit hieß Michaela Schmidt, doch sie benutzte nur ihren Künstlernamen »Savon«.
Savon trug noch ihre Arbeitskleidung und sah aus, als hätte sie ihr Bett in der letzten Nacht nur beruflich gesehen. Als er eintrat, schaute sie auf und winkte ihn zu sich herüber. »Hey, Noah! Seit wann gehörst du zu den Frühaufstehern?«
Lloyd schlenderte zu ihr hinüber und setzte sich. Sie roch nach Aprikosenparfüm. »Du siehst so scheiße aus, wie ich mich fühle«, sagte er müde.
Sie kicherte. »Willkommen in meiner Welt! Was führt dich so früh in den Koffeinbunker? Eine schlimme Nacht?«
»Du hast ja keine Ahnung.« Er seufzte.
Die Besitzerin, eine untersetzte, reichlich grell geschminkte Frau mit Zöpfen wie eine Sechsjährige, kam heran. Morgens um diese Zeit gab es nur Kaffee und so stellte sie wortlos einen Pott mit einer schwarzen Brühe auf den Tisch. Sie wartete, bis Lloyd sein Empathiephone aus der Tasche zog, hielt ihres darüber und buchte die Eurobits ab. Dann schlurfte sie zurück in ihre Küche, als hätte sie alle Zeit der Welt.
Lloyd nahm einen Schluck und verbrannte sich prompt die Lippen.
»Ich habe gehört, dass sie dich gefeuert haben.«
Er nickte und antwortete: »Das hat sich ja verdammt schnell herumgesprochen.«
»Im Kiez gibt es keine Geheimnisse. Du warst noch nicht wieder in deiner Wohnung, da pfiffen die Spatzen deine Kündigung bereits von allen Dächern.«
»Wohl eher die Bordsteinschwalben.«
Wieder kicherte sie. Er mochte ihr kindisches Lachen. Zärtlich nahm sie seine Hand. »Wenn du dich mal ausquatschen willst oder Hilfe brauchst … na ja, du weißt ja, wo du mich findest. Ich bin immer für dich da – außerhalb und während meiner Arbeitszeit.« Sie lächelte ihn auf diese besondere Weise an. Er wusste, dass sie ihn mochte und mehr wollte als nur reden, doch er hatte ihre Angebote immer ausgeschlagen. Seine Gefühle gehörten Rena. Obwohl, Michaela hätte etwas Glück durchaus verdient. Sie war mit großen Erwartungen nach Berlin gekommen, aber Erwartungen alleine genügten nicht. Man brauchte auch Glück und das hatte ihr gefehlt. Michaela war ein liebes Mädchen, das in einer anderen Welt und zu einer anderen Zeit etwas aus sich hätte machen können. Aber nicht an diesem heruntergekommenen Ort!
»Vielleicht kannst du mir ja wirklich helfen«, hörte er sich sagen. »Wenn du etwas über die Angreifer auf Goliath erfährst, lass es mich wissen.« Er nahm sein Empathiephone vom Tisch und schickte ihr seinen Zugangscode für die Wohnung auf ihr Telefon.
Ihre eisblauen Augen leuchteten. »Ich werde mich umhören«, versprach sie. »Leider muss ich jetzt ins Bett – alleine, sonst halte ich heute Nacht meine Schicht nicht durch.« Sie schenkte Lloyd einen Kussmund und verließ das Café.
Lloyd schaute ihr lange nach und bereute die Gedanken, die ihm dabei kamen. Er trank den Kaffee aus und wollte sein Telefon einstecken, als eine neue Kurznachricht eintraf. Sie war verschlüsselt und verlangte zur Dechiffrierung seinen Firmenzugangscode.
Plötzlich schlug Lloyds Herz wie wild. Der Absender kannte seinen Code! Sonst hätte er die Nachricht nicht mit ihm verschlüsseln können. War sie von den Typen, die Goliath überfallen hatten? Aber aus welchem Grund sollten sie sich mit ihm in Verbindung setzen?
Er tippte seinen Zugangscode ein und die Nachricht wurde entschlüsselt.
Sie begann mit einem Link zu einem Video auf einer Nachrichtenplattform und Lloyd rief es auf.
Eine Moderatorin befragte Armin Zeidler zu dem Anschlag auf Goliath. Das Interview musste irgendwann in der Nacht entstanden sein, während man ihn verhört hatte.
Lloyd stellte den Ton lauter.
Zeidler schilderte den Ablauf der Ereignisse, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Er sprach von vier Toten: zwei Angreifern und zwei Mitarbeitern des Objektschutzes.
»Wie steht es um den Gesundheitszustand von Bürger Engel, Goliaths Firmengründer?«, wollte die Moderatorin wissen.
Lloyd drehte die Lautstärke weiter auf. Der regungslos an dem Ecktisch sitzende Mann öffnete die Augen und warf ihm einen empörten Blick zu.
»Bürger Engel hat eine leichte Verletzung und wird ärztlich betreut. Ich soll Ihnen ausrichten, dass er über diesen Angriff zutiefst entsetzt ist. Goliath wird mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die Strafverfolgungsbehörden unterstützen. Seine Gedanken sind bei den Angehörigen der beiden Wachleute.«
»Gibt es neue Informationen über die Angreifer? Wie haben sie es ins Gebäude geschafft? Und wurden sie in die Sphäre transferiert?«
»Das haben sie versucht, doch bevor sie Bürger Engel dazu zwingen konnten, griffen die Sicherheitskräfte ein. Keiner von den Angreifern ist in die Sphäre entkommen.«
»Weiß man, wer die Angreifer waren? Gibt es Informationen über die Toten?«
»Ein Tatverdächtiger ist in Gewahrsam. Mehr kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.«
Die Moderatorin bedankte sich und das Video endete.
Tatverdächtiger! Lloyd verzog unwillig das Gesicht. Er wusste genau, von wem Zeidler sprach. Jeder schien ihn am liebsten hinter Gitter zu sehen.
Lange starrte er auf das Standbild des Videos und dachte nach. Kein Wort über die Identität der Angreifer. Hatten sie von Engel verlangt, dass er sie in die Sphäre transportierte? Und wie waren sie an seinen Code gekommen? Lloyd kannte auf keine der Fragen eine Antwort.
Schließlich schloss er das Video und der Rest der Nachricht erschien. Es waren nur zwei Sätze, aber ihr Inhalt hätte brisanter nicht sein können.
Lloyd schnappte überrascht nach Luft: »Zeidler lügt! Wenn Sie die Wahrheit erfahren wollen, kommen Sie um 12 Uhr ins Restaurant des Fernsehturms!«
4 Unfreundliches Personal und teures Bier
Lloyd hatte noch im Café per Telefonapp seinen Wagen gerufen. Er hatte bis zum Treffen mit dem geheimnisvollen Absender der Nachricht zwar noch über eine Stunde Zeit, doch die Aussicht, etwas über die Hintergründe erfahren zu können, nahm ihm die Ruhe und die Lust auf einen weiteren Kaffee.
Als er auf die Straße trat, musste er einen Augenblick lang warten, bevor sein klapperndes E-Fahrzeug vorfuhr. Lloyd stieg ein.
Sein Wagen kannte bereits das Ziel und blieb auf der Pohlstraße. Die Animation einer überlebensgroßen Katze leckte sich vor den Räumen einer Tierhandlung genüsslich die Pfote. Ein Supermarkt, eine Wäscherei und mehrere Restaurants später fuhr Lloyd auf der neuen Schnellstraße, Richtung Berlin-Mitte. Nach einer halben Stunde saß er im Restaurant des Fernsehturms, zweihundertsieben Meter über der Stadt, und bebte vor Anspannung. Vor ihm auf dem weißen Plastiktisch stand ein Glas Bier, das er sich bei einer unfreundlichen Dame an der Essensausgabe für viel Geld gekauft hatte. Es war halb zwölf, als er mit dem ersten Schluck seine Aufregung herunterzuspülen versuchte. (Scheiß auf die Prinzipien!) Es klappte nicht.
Unauffällig sah er sich um. An den Wänden des Restaurants hingen Girlanden und Blumengebinde. Plakate wiesen auf die Einhundertjahrfeier hin, die zu Ehren des Fernsehturms in ein paar Tagen beginnen würde. Markige Sprüche versprachen spannende Veranstaltungen rund um das seit 1979 denkmalgeschützte dreihundertachtundsechzig Meter hohe Gebäude der Stadt.
Lloyds Blick wanderte weiter, über animierte Werbetafeln hinweg, ohne sie zu beachten. Die Aussicht auf Livemusik, Feuerwerk oder nicht enden wollende Ansprachen von Politikern interessierten ihn in diesem Moment herzlich wenig.