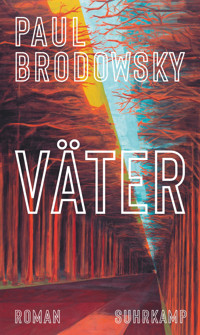
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erst als der Sohn ihn danach fragt, spricht der Vater, Jahrgang 1933, von der NS-Zeit. Von der Napola, der Nationalpolitischen Lehranstalt, vom jüdischen Fellhändler am Markt und von seinem Onkel. Jenem Onkel Paul, nach dem der Sohn benannt ist und der NSDAP-Kreisgeschäftsführer war. Im Bundesarchiv findet der Sohn, als jüngstes von acht Kindern 1980 geboren, nur eine schmale Akte. Doch ihn lassen die Fragen nicht los: Wie setzen sich nationalsozialistische Prägungen auch in seiner Familie fort? Welche überkommenen Ideale, welche patriarchalen Vorstellungen haben sich in ihn eingeschrieben und gibt er vielleicht selbst weiter? In welchen Konflikten treten sie bis heute zutage? Er stellt fest, wie herausfordernd es ist, im Umgang mit den eigenen Kindern seine Rolle als progressiver Vater zu finden, zumal ihm klare Vorbilder dafür fehlen.
Paul Brodowsky erzählt in seinem Roman Väter von einem Jahrhundert deutscher Geschichte. Er verdichtet Erinnerungen, Recherchen und Reflexionen zu einem Bild der BRD nach der Zeit des Nationalsozialismus – er arbeitet auf, was in vielen Familien bis heute verschwiegen wird, und spannt so den Bogen von den dreißiger Jahren bis zur Gegenwart. Eine schonungslose Selbstbefragung und Spurensuche nach den Prägungen durch die Großväter und Väter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Paul Brodowsky
Väter
ROMAN
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2023.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagabbildung: David Schnell, Wald, 1999, Eitempera auf Leinwand, 200 cm x 150 cm, VNG art, courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin, Foto: Uwe Walter, Berlin, @ VG Bild-Kunst, Bonn 2022
eISBN 978-3-518-77536-3
www.suhrkamp.de
Widmung
Für L. und für S.
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Mein Vater tanzt
Dank
Quellen
Bildnachweise
Informationen zum Buch
Väter
Mein Vater tanzt ausgelassen, beinahe ekstatisch. So habe ich ihn noch nie erlebt, immer wieder fordert er neue Frauen auf, die Braut, die Brautmutter oder die Freundin des jüngeren Bruders des Bräutigams, er tanzt wie ein Derwisch, wirft sich voll hinein, singt mit bei den Refrains der Lieder, ganz gleich, ob er die Cover-Songs kennt oder nicht, Beatles, Stones, Elvis, aber auch neuere Sachen, die der dunkelhaarige, Mitte vierzigjährige Alleinunterhalter hinter dem Keyboard spielt, Michael Jackson, a-ha und frühe Eurodance-Nummern, die ich aus dem Radio oder von Mittelstufenpartys kenne, Right Said Freds Don’t Talk Just Kiss, eine Keyboardpolkaversion von Please Don’t Go von Double You, Don’t goo-ohohoho, don’t go away, singt mein Mitte sechzigjähriger, vollbärtiger, glatzköpfiger, mir damals schon eher klein vorkommender Vater, deutlich übergewichtig, vermutlich rund fünfundneunzig oder achtundneunzig Kilo schwer bei einem Meter siebzig Körpergröße, während er eine ungefähr gleich alte Frau mit Perlenkette herumwirbelt. Wenn er mit meiner Mutter auf Festen ist, beginnt er immer, mit ihr zu tanzen, fordert sie auf, meine Mutter lässt sich mit gequältem Blick darauf ein, für einen, maximal zwei Walzer, man kann sehen, wie schlecht sie auf der Tanzfläche harmonieren, und mein Vater lässt dann auch bald wieder ab vom Tanzen, nicht aber an diesem Abend. Keiner der anderen Gäste tanzt so wild. Betrunken kenne ich meinen Vater nur dumpf versunken am Tischende sitzend, oft auch dann, wenn meine Eltern Gäste haben, oder konträr dazu, aber das nur im engen Familienkreis, verbal leicht übergriffig, seine Sprache ebenso verschlurt wie seine nach außen gekehrte, unspezifische, übertriebene Emotionalität, bis hin zu der offenen Aggressivität seiner in meiner frühen Kindheit etwa halbjährlichen, den ganzen Abend und die halbe Nacht andauernden Wutanfälle. Es befremdet mich, meinen Vater hier so rauschhaft ausgelassen zu erleben, und ebenso befremdet mich, dass alle Menschen in dieser uns beiden fast völlig unbekannten Umgebung so ungebrochen positiv darauf reagieren – seine Rauschzustände werden in der Familie immer mit kollektiver Verachtung und gleichzeitig mit Angst hingenommen, etwas, was man ertragen und überstehen muss wie einen Sturzregen auf einer Wanderung, morgen ist es vorbei. Hier auf der Hochzeit kommentieren die Söhne des Schulfreundes meines Vaters seine alkoholisierte Beschwingtheit geradezu bewundernd, schön, dass Onkel August so viel Spaß hat, sagen sie völlig ironiefrei. Wir sind auf der Hochzeit seines einzigen Patenkindes, des Sohns eines Schulfreundes. Es ist eine der ganz wenigen Reisen, die ich mit ihm zu zweit mache, nach F., südlich von Köln. Der Schulfreund meines Vaters hat dort ein Taxiunternehmen, seine Söhne sind beide als Fahrer angestellt, die Familie leistet sich privat einen kleinen rot-schwarzen Alfa Romeo und einen grazilen fuchsroten Windhund, der in Schönheitswettbewerben Preise ergattert, sie besuchen uns einmal etwa zwei Jahre zuvor zusammen mit dem Hund in Flensburg. Mein Vater und ich essen auf der Hinfahrt zu der Hochzeit gemeinsam im ansonsten leeren Speisewagen des Intercityzuges, es ist das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Speisewagen sitze, wir bestellen zwei Teller Erbsensuppe, aber die Kellnerin rät uns von der Suppe ab, die sei sauer, sagt sie und verzieht leicht das Gesicht. Wir bleiben drei Nächte in F., tauchen ein in den Taxifahrerkosmos, gehen am Vorabend der Hochzeit essen, meine Eltern gehen nie mit uns essen, außer auf Reisen.
– Wollt ihr zum Griechen, zum Italiener oder zum Chinesen?, fragt uns einer der Söhne des Schulfreundes meines Vaters.
Ich bin beeindruckt von so viel Kosmopolitismus, der Klarheit dieser Lebensform – der wunderschöne, nie einen Laut von sich gebende, melancholische Windhund, Auto fahren, essen gehen, Manschettenknöpfe, gestärkte Oberhemden, all das scheint mir irgendwie beneidenswert, am Nachmittag vor dem Hochzeitstag werde ich Kaffee kaufen geschickt, in den um die Ecke liegenden Supermarkt, ein Pfund Dallmayr prodomo, dieser Markenname klingt für mich wie eine märchenhaft fremde Losung, ich muss zweimal nachfragen, ehe ich verstehe, um was es sich dabei überhaupt handelt, und mir die seltsame Formel einprägen kann, bei uns zu Hause gibt es ausschließlich Albrecht Gold Kaffee. Außerdem darf ich auf dem Amiga des älteren Sohnes stundenlang Computer spielen, auch im Haus meiner Eltern gibt es Rechner, einen Commodore 64 mit Floppy-Disk-Laufwerk, einen Atari und einen 286er, den sich meine älteste Schwester, Sigrid, Mitte der Achtziger vom Preisgeld eines Bundesschülerwettbewerbs kauft, das sie für ihre Facharbeit in Chemie erhält, aber für alle diese Rechner gibt es bei uns im Haus so gut wie keine Spielesoftware – hier darf ich am Vorabend des Festes bis tief in die Nacht hinein Ports of Call spielen und Frachtschiffe in alle Überseehäfen der Welt dirigieren. Auf dem Fest dann trinke ich erst Wein und später Bacardi Cola, es ist das erste Mal, dass ich überhaupt in Anwesenheit meines Vaters Alkohol trinke, er selbst trinkt sehr viel, wie bei ihm damals bei solchen Gelegenheiten, aber durchaus auch an normalen Wochentagen üblich, ich hingegen kippe verstohlen, als das Tanzen schon im Gange ist oder die Braut gerade entführt wird, oder ist es irgendein anderes Hochzeitsspiel, die Tische stehen überwiegend verwaist da, jedenfalls kippe ich nach und nach verstohlen Reste aus den noch herumstehenden Weingläsern in mich hinein, während ich im Verlauf des Essens allen mir angebotenen Wein neben meinem Vater sitzend strikt abgelehnt habe.
– Ich trinke keinen Alkohol!, sage ich.
Später lungere ich dann bei der Bar herum, bis mich die Braut fragt, ob ich noch etwas möchte, ich könne an der Bar alles bestellen, woraufhin ich mich für ein unverräterisches Mixgetränk entscheide und so also zu meiner ersten Rum Cola komme.
Und dann, am letzten Abend in unserem Ferienhaus in D., ich mache über einige Tage hinweg Interviews mit meinem Vater, die Kinder schlafen, meine Mutter ist ebenfalls schon ins Bett gegangen, ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass mein Vater und ich noch weitersprechen, gießt mein Vater mir und sich selbst noch etwas Rotwein ein und bringt seinen Ahnenpass an den Tisch, jenes Dokument, das 1943 für ihn angefertigt wird und seine, wie es damals heißt, arische Abstammung nachweisen soll, wegen seines Eintritts als Zehnjähriger in die Nationalpolitische Erziehungsanstalt in Stuhm. Ein halbes Jahr zuvor erzählt er mir vollkommen aus dem Nichts, dass er eine jüdische Großmutter habe, wir sitzen in Berlin im Auto, ich bringe meine Eltern zum Bahnhof, wir haben den Tag über den ersten Geburtstag unserer Tochter Anouk gefeiert und das Fest zum Anlass genommen, Judiths und meine Eltern miteinander bekannt zu machen, der Tag im Garten verläuft entspannt, es gibt Kaffee und Kuchen, Geschenke für Anouk, die Kinder laufen herum und genießen sichtlich, dass alle vier Großeltern gleichzeitig da sind, wir zupfen Unkraut, pflanzen zwei Blumen ein, Peter, Judiths Vater, erklärt mir, wie ich die drei Rosenstöcke, die noch von unserem Vorgänger im Garten stehen, im Frühjahr zurückschneiden könne, gegen sechzehn Uhr breche ich mit meinen Eltern auf, sie wollen nach S., am nächsten Tag wird dort ein anderes Enkelkind von ihnen eingeschult, der älteste Sohn meiner Schwester Uta, und mein Vater fängt also im Auto sitzend plötzlich an, in einem stockenden, beinahe beichtenden Tonfall zu erklären, dass seine Großmutter eine geborene Salamon gewesen sei.
Vor dem Fenster der Baum, an den Enden der Zweige die blassgrünen Knospen, darunter jeweils die abgestorbenen, aber noch nicht herabgerieselten Riste der Ahornsamen des Vorjahres, trocken und brüchig, hinter dem Baum die Brücke über den Landwehrkanal mit einer Handvoll Touristen, die den Sonnenuntergang betrachten, jenseits des Kanals in der Glogauer Straße die sich über den Asphalt beugenden Straßenlaternen, das noch schwach grünliche Neonlicht der gerade erst aufglühenden Leuchtkörper, die blattlose Krone des Baumes scheint greifbar nah, am Fenster stehend beim Blick nach unten die zum Stamm hin zusammenlaufenden Äste und unter der braunen, von Pflaster- und Kantsteinen eingefassten Baumscheibe, die reichen muss, den Baum mit Regenwasser zu versorgen, das Wurzelwerk, das sich unbesehen auffächert, ähnlich der Baumkrone, nur knorriger, weinstockartig, verwachsen und unbeschnitten, sich verästelnd bis in kleinste Wurzelkapillaren, Mykorrhizen, Steine, Glasfaserkabel und Abwasserrohrgeflechte, Fraß und Erdgänge der unterirdischen Bewohner.
Der Wecker klingelt. Aber es ist nicht der Wecker, wie ich noch im Halbschlaf bemerke, sondern Judiths Mobiltelefon, und weil Judith nicht aufsteht, um den Alarm auszustellen, stehe ich auf, gehe rüber und stelle ihn aus. Judith liegt nicht neben mir wie gestern Abend beim Einschlafen, stattdessen liegt dort Anouk, ich nehme an, dass sie nachts wach geworden ist und darauf besteht, in unser Bett zu kommen, Judith, vermute ich, liegt inzwischen auf dem Hochbett im Arbeitszimmer, sie kann oft nicht wieder einschlafen, wenn noch ein oder beide Kinder zwischen uns liegen. Anouk bewegt einen Arm, aber schläft weiter, unbeeindruckt vom Weckgeräusch. Ich gehe zur Toilette und dann in die Küche, setze Wasser auf. An meinen Fußsohlen bleibt etwas Sand haften, ich ziehe Handfeger und Schaufel unter dem Spülschrank hervor und fege die Küche, gestern Abend habe ich hier die Kinderschuhe entleert, den mitgetragenen Sand vom Spielplatz in den Müll geschüttet, dabei geht oft etwas daneben, eigentlich müsste ich gleich die ganze Küche oder besser die ganze Wohnung saugen, so schaffe ich nur eine Insel relativer Sand- und Krümelfreiheit. Ich fülle Wasser in die Espressokanne und höre, wie Milan von seinem Bett aus leise murrt, konturloses Melde- und Protestgeräusch, ich gehe ins Kinderzimmer, sage ihm guten Morgen, streiche ihm über den Kopf. Er liegt eingeigelt und noch nicht ganz wach im Bett, möchte aufs Lager getragen werden, wie er sagt, ausnahmsweise, also hebe ich ihn auf, den kleinen, schlaksigen, noch schlafwarmen Körper, der sich sofort wie ein Rucksack auf der Brust an mich schmiegt, und trage ihn samt Bettdecke ins Wohnzimmer, lege ihn dort auf der Steppdecke am Boden ab. Er protestiert heute Morgen nicht, dass er kein Kinderhörspiel hören darf, nimmt sich stattdessen ein Bilderbuch. Ich gehe zurück in die Küche, schütte Milch aus dem Kühlschrank in die beiden Fläschchen und etwas kochendes Wasser dazu, um die Milch zu erwärmen, bringe ihm seine Flasche. Von Anouk höre ich aus dem Schlafzimmer jetzt auch ein wortloses Sich-bemerkbar-Machen, ich gehe zu ihr, trage sie in ihrem Schlafsack in die Küche. Sie fragt nach ihrer Mama, sichtlich enttäuscht, dass ich es bin, der sie holt, protestiert etwas, lässt sich dann aber mit ihrer Flasche beruhigen. Ich schalte das Küchenradio an, Deutschlandfunk, setze den Kaffee auf, gieße Sojamilch in den Milchschäumer, gehe ins Arbeitszimmer und wecke Judith.
– Es ist zehn vor sieben, sage ich.
Sie sagt, sie komme gleich, und bleibt noch etwas liegen, wie sie das fast immer tut, wenn ich sie wecke. Zurück in der Küche schneide ich Brot, decke den Tisch, zwei Melaminteller für die Kinder, zwei Porzellanteller für Judith und mich, Messer, Ziegenfrischkäse, Marmelade, Honig. Judith kommt in die Küche, sie sieht etwas zerschlagen aus, sie sagt, sie habe Kopfschmerzen, ob sie als Erste duschen könne?
Anouk gibt mir ihre leere Flasche, ich spüle sie aus und stelle sie umgedreht auf das Abtropfgitter. Ich schiebe Brot in den Toaster, fülle Milch und Milchschaum in zwei japanische Holzschalen und gieße dann den inzwischen durchgelaufenen Espresso darauf. Anouk möchte, dass ich ihr den Schlafsack aufmache. Ich schmiere Milan ein Brot mit Frischkäse und Erdbeermarmelade, suche Klamotten für ihn raus. Dann schnappe ich mir Anouk, die im Flur auf dem Fußboden angefangen hat, mit zwei Feuerwehrautos zu spielen, trage sie ins Schlafzimmer, lege sie auf den Wickeltisch, ziehe ihr den Schlafanzug aus, öffne die Windel, wische mit ein paar Feuchttüchern ihren Po sauber, schneller, als ich sie davon abhalten kann, kratzt sie sich mit zwei Fingern am Hintern, ich wische rasch ihre Finger wieder sauber, bevor sie die Scheiße irgendwo hinschmiert. Als ich ihr eine neue Windel angezogen habe, kommt Judith aus der Dusche, es ist jetzt 7:20 Uhr, in fünfundvierzig Minuten müssen wir spätestens aufbrechen zur Kita, sonst kommen wir zu spät. Ich gehe ins Wohnzimmer, sage Milan, er solle sich jetzt anziehen, sonst werde nach hinten raus alles gehetzt. Er möchte etwas vorgelesen bekommen, ich lese ihm eine Doppelseite aus seinem Buch über riesige Baumaschinen, Tagebaubagger und Kipplader vor, dann sage ich noch einmal, dass er sich jetzt bitte anziehen solle. Es ist 7:31 Uhr. Ich springe unter die Dusche, erst kalt, dann heiß, Shampoo, Spülung, Duschgel, Gesichtsseife, kalt abduschen, abtrocknen, Deo, dann frische Unterwäsche und in die übrigen Klamotten von gestern Abend. 7:50 Uhr. In der Küche schmiere ich mir eine getoastete Vollkornbrotscheibe, Judith hat inzwischen beide Kinder angezogen, Milan isst die Reste seines Marmeladenbrotes, Anouk kaut an ihrem Brot mit Frischkäse. Ich schütte nebenbei den lauwarmen Kaffee in mich hinein.
– Wer bringt die Kinder?, frage ich Judith. Kannst du, dann kann ich schon packen?
– Ich wollte hier arbeiten und nebenbei noch ein bisschen die Wohnung putzen, damit es nicht so dreckig ist, wenn meine Mutter nachher kommt, sagt sie.
Dann werde ich meinen Zug verpassen, denke ich, sage aber nichts, da Judith ab heute Nachmittag eine ganze Woche lang alleine mit ihrer Mutter für die Kinder zuständig ist.
– Milan, geh bitte vor und zieh deine Schuhe an, sage ich.
Ich stehe auf und packe zwei Äpfel und ein Schnuffeltuch in einen Jutebeutel. Es ist 7:57 Uhr. Ich schnappe mir Anouk von ihrem Stuhl, sie hält ihr Brot fest und isst weiter daran herum. Ich gehe mit ihr in den Flur, ziehe ihr die Schuhe an, die wir gestern gekauft haben, sie lässt es heute ohne Protest über sich ergehen.
– Milan, zieh bitte deine blaue Fleecejacke an, sage ich.
Milan spielt mit einem der Feuerwehrautos und reagiert nicht. Ich schlüpfe in meine eigenen Schuhe. Judith versucht, Anouk ihr Kleid überzuziehen, sie hat nur eine helle Wolle-Seide-Leggings und ein fleischfarbenes Wolle-Seide-Shirt an, aber Anouk protestiert, strampelt mit den Armen, wehrt sich nach Leibeskräften.
– Später, später!, sagt sie.
– Dann musst du ihr das Kleid in der Kita anziehen, damit sie nicht den ganzen Tag als Ski-Opa rumläuft, sagt Judith und packt das Kleid in den Jutebeutel.
– Milan, zieh jetzt bitte endlich deinen Fleece an, wir kommen zu spät!, sage ich.
Er schaut genervt auf und nimmt in schlafwandelndem Tempo seine Jacke vom Haken. Als wir die Wohnung verlassen, ist es 8:06 Uhr, alle drei haben wir jetzt Jacken an, die beiden Kinder Mützen und Fahrradhelme. Nach dem Frühstück meine Zähne zu putzen, habe ich aus Zeitmangel auf ein unbestimmtes Später verschoben, was meistens bedeutet, dass ich sie bis zum Abend nicht putze. Judith trägt Anouk auf dem Arm nach unten, Milan läuft voraus. Unten im Hausflur schließe ich erst Milans und dann mein Fahrrad auf, Milan wendet sein Rad in dem engen Flur und schiebt es nach vorne auf die Straße, ich folge ihm. Judith setzt Anouk in den Kindersitz, schnallt sie an, verabschiedet sich von den Kindern. Es ist 8:12 Uhr.
– Ich verpasse meinen Zug, sage ich schlecht gelaunt.
Judith sagt nichts, schaut nur etwas schuldbewusst.
– Bis gleich, sage ich.
Wir fahren los. Milan will Großwagen und Kleinwagen spielen, wir tauschen Polizeifunksprüche aus. An jeder Kreuzung halten wir an der Bordsteinkante an.
– Links, rechts, links, sage ich.
Milan schaut und fährt jedes Mal erst los, wenn die Straße in beide Richtungen drei oder vier Häuserblöcke weit frei ist. Zwischendurch schiebe ich ihn mit einer Hand an seiner Schulter etwas an, damit wir schneller vorankommen. An der Wildenbruchstraße ist so viel Querverkehr, dass ich ungeduldig werde. Als sich eine eher knappe Lücke ergibt, sage ich:
– Jetzt können wir!
Milan protestiert etwas, kommt dann aber nach. Ein schwarzer Passat, der links blinkt, biegt an der Querstraße auf der anderen Seite der Brücke nicht ab und kommt weiter in mittlerem Tempo auf uns zu. Ich halte auf der Straße an, der Passat bremst auf der Brücke und wartet darauf, dass Milan die Straße überquert. Die Situation ist etwas unangenehm, aber nicht wirklich brenzlig, Milan muss anhalten, um sein Vorderrad den Bordstein hochzuwuchten, dann fahren wir weiter. Wir kommen um 8:31 Uhr an der Kita an, Milan ist fünf Minuten später im Gruppenraum, sechs Minuten zu spät, aber Georg, der Erzieher, sagt nichts und schaut nur gnädig. Milan und ich verabschieden uns in der Tür zum Gruppenraum mit einem Kuss, wie jeden Morgen, dann gehe ich mit Anouk zu ihrer Gruppe, ziehe ihr in der Garderobe Helm, Mütze, die beiden Jacken und die Schuhe aus und die Lederschlappen an. Wieder weigert sie sich, das Kleid anzuziehen. Die Mutter von Lilly, die gerade ihrem Kind aus den diversen Klamotten hilft, versucht, mich zu unterstützen.
– So ein schönes Kleid, Anouk!, sagt sie.
Aber Anouk bleibt stur.
– Später, später!, sagt sie.
Sie nimmt Apfel und Schnuffeltuch entgegen, klopft mit dem Apfel gegen die Tür des Gruppenraums, die Tür wird von innen geöffnet, ich verabschiede mich von Anouk, und schon ist sie verschwunden. Ich rase nach Hause, hole den Rollkoffer aus dem Keller, eile nach oben. Zum Packen habe ich noch fünfundzwanzig Minuten Zeit. Ich drucke mein Bahnticket aus, schmeiße fast wahllos Klamotten und möglichst gezielt einige Bücher in den offenen Koffer, packe den Rechner ein, das Netzteil, das Ladegerät für das Mobiltelefon, für die Fahrt drei kleinere Äpfel aus unserem Garten. Als ich fertig bin, realisiere ich, dass genau jetzt mein Bus kommt, der mich zur S-Bahn bringen soll, die zum Südkreuz fährt.
Ich verabschiede mich hastig von Judith, stürze mit dem Rollkoffer und der Laptoptasche aus der Wohnung. Unten auf der Straße fällt mir auf, dass ich das Aufnahmegerät nicht dabeihabe. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich die letzte Datei mit den Gesprächsaufnahmen mit meinem Vater schon vor einigen Wochen heruntergeladen habe oder nicht, und eigentlich möchte ich am Nachmittag meinen Vater weiter interviewen, also haste ich zurück, die Haustür steht noch offen, lasse den Rollkoffer unten im Hausflur stehen, springe die Treppen hoch bis in den dritten Stock, schließe die Wohnung auf, rufe der verwunderten Judith eine Erklärung zu, eile zum Sideboard, stopfe Gerät und Kabel in meine Laptoptasche, renne wieder, zwei Stufen auf einmal nehmend und die letzten vier Stufen jedes Absatzes ganz überspringend, die Treppe runter und weiter bis zur Bushaltestelle. Zum Glück kommt relativ bald der nächste Bus. Zwei Haltestellen später steige ich aus, renne mit dem Koffer im Schlepptau über die Straße, stürze die Treppen hoch auf das Ringbahn-Gleis, als gerade die richtige Bahn einfährt, die heute Morgen wegen einer Weichenstörung jedoch an der Hermannstraße ihre Fahrt beendet. Als ich am Südkreuz ankomme, hat der ICE vor einer Minute den Bahnhof verlassen.
Vor dem Fenster der Baum, die Blätter des Ahorns werden von der tiefstehenden Sonne angestrahlt, ein warmes Licht liegt auf seiner Krone, beleuchtet die Blätter, die graugrünen Flechten auf der Aststruktur. Unten auf der Thielenbrücke stehen Paare und kleine Gruppen, sie machen Fotos von der über dem Landwehrkanal untergehenden Sonne, das sich leicht kräuselnde Wasser des Kanals ist mit Gelb- und Orangetönen bedeckt, so dass man das Schwarz des Wassers nicht erkennen kann, Schlamm und hinabgesunkenen Müll am Grund, ein halb verrostetes Fahrrad, einen gefluteten Röhrenfernseher, Glasflaschen, rottendes Holz.
Wenn ich mir das Innere meines Körpers vorstelle, denke ich an die Farbe Rot, Blutrot, das Violettrot der Leber, das Graurot von Darmschlingen. Aber natürlich ist es in meinem Körper fast überall dunkel, dunkel wie das Wasser der Ostsee bei Nacht, tangdunkel, miesmuschelschalenschwarz, das Innere von geborstenen Feuersteinknollen. Aus diesem Dunkel einige Bilder:
eine geteerte Einfahrt in Form eines Halbkreises, dahinter hell gestrichenes Holz, es muss das Haus gegenüber sein, ein sonniger Tag, in der Mitte des Halbrunds ein Beet, in dem mohnrote Blumen blühen, auf der Einfahrt steht mit dem Heck zur Straße ein hellblauer Kombi, meine Mutter hebt mich hoch, durch die Heckscheibe kann ich sehen, dass in dem Auto eine Handvoll Katzen ist, eine schwarz-weiße Katze hält sich mit eng zusammengestellten Füßen auf dem schmalen Polster der Rückbank, eine weiß-braun gescheckte Katze döst auf dem Beifahrersitz, eine getigerte Katze springt zwischen den Vordersitzen hindurch auf das Armaturenbrett, im Kofferraum spielen zwei junge Katzen miteinander, beide halb auf der Seite liegend, sie betatzen sich mit eingezogenen Krallen, ihre hellen Bauchfelle pulsieren
ich stehe vor unserer Nachbarin, Mary, sie ist sehr schlank und sehr groß, etwas älter als meine Mutter, ich schaue zu ihr hoch, lächle sie an, sage: Cookie, cookie, sie zieht bedauernd die Augenbrauen hoch, hebt die Arme und sagt sehr langsam und deutlich: All … gone
mein Vater trägt mich als Zweijährigen über die Holzwege auf Fire Island, ich habe eine ausgeblichene Kapuzenjacke mit gesteppten Ärmeln an, er hält mich hoch, fast auf Schulterhöhe, ich blicke etwas verkniffen in die Kamera, die Sonne oder den Seewind in den Augen, mein Vater hält dieses achte Kind, das ich bin, wie einen Pokal oder eine Trophäe ins Bild, er hat noch dunkle Haare, wenngleich schon eine Halbglatze, eine, wie ich heute finde, entfernt an den älteren Arnold Schönberg erinnernde Frisur und Schädelform. Ob dieses Foto von meinem Vater und mir noch existiert oder jemals existiert hat, weiß ich nicht
ich gebe Bellport Browns Lane NY in die Suchmaske ein, zoome an den unteren Straßenabschnitt nahe der Bellport Bay und der kleinen Marina heran, schalte auf Satellitenansicht und überlege, welches der Häuser es gewesen sein könnte, das meine Eltern ein Jahr lang gemietet hatten 1981/82, ich kann ein Wohnhaus ausmachen, das einen Widow’s Walk zu haben scheint, eine Art Dachterrasse für Kapitänswitwen, die nach ihren Männern auf See Ausschau halten, vermutlich ist der Widow’s Walk um 1920, als die Häuser dort gebaut werden, bereits ein nostalgisches, eher ornamentales Architekturrelikt, ein Zitat älterer Bauten, das zu dieser Zeit schon seine ursprüngliche Funktion eingebüßt hat, wenn denn Widow’s Walks jenseits von Erzählungen überhaupt jemals diese Funktion erfüllt haben. Ich schalte auf die Street-View-Funktion um, ja, es ist das richtige Haus, das ich von Fotografien und zwei späteren kurzen Besuchen 1986 und 1993 kenne, ich schalte zurück auf Satellitenansicht, zoome wieder heraus und schaue mir aus der Satellitenperspektive die gegenüberliegenden Häuser an, keines hat eine halbkreisrunde Einfahrt. Das Bild von den Katzen im hellblauen Kombi habe ich nur geträumt. Oder die Einfahrt wurde in den letzten fünfunddreißig Jahren abgerissen und eine neue, weniger raumgreifende gebaut. Als ich weiter rauszoome, sehe ich in der Querstraße, an der Shore Road, exakt die halbkreisrunde Einfahrt, kurz vor der Abzweigung zu den Bootsstegen, ein Weg, den wir oft auf Spaziergängen genommen haben dürften, dahinter ist ein leeres Grundstück, zu erkennen ist nur ein heller Fleck im Rasen, als hätte hier ein Haus gestanden, das erst vor Kurzem abgerissen wurde
Fire Island hat in den Jahren nach 1982 einen fast magischen Klang in unserer Familie, die Erinnerungen an die Dünenlandschaft der Barriereinsel mit ihrem feinen, saubergewaschenen Sand, handflächengroße Trogmuscheln im Spülsaum, 1986 dann ein toter, vielleicht drei Meter langer Weißer Hai, um das Tier eine Gruppe Schaulustiger, Kinder und Jugendliche, einige versuchen vergeblich, sich einen der Zähne aus dem Maul zu brechen, beeindruckend hohe, beinahe olivfarbene Atlantikwellen, oder ist die erinnerte Farbe des Wassers vor allem durch die Kodak-Color-Skala der Abzüge der Farbfotos aus den frühen Achtzigerjahren geprägt, natürlich ist die Farbe je nach Wetter, Jahres- und Tageszeit denkbar unterschiedlich, in meiner Erinnerung haben die vier Meere meiner Kindheit je nur eine und jeweils eine andere Grundfarbe, die Ostsee ist immer tangschwarz unter einem Mantel von Grau oder Blau, die Nordsee ist graugrün, das Mittelmeer azurblau und klar, der Atlantik vor Fire Island olivfarben, aufgewühlt und etwas trübe. Auf Fire Island stehen, am Ostrand des westlichsten Landes der Welt, und über den offenen Atlantik zurückblicken nach Europa, das man für eine überschaubare Zeit hinter sich lässt – ein Jahr lang dürfen wir uns als Emigranten fühlen, wie so viele Europäer vor uns in den USA. Christopher Isherwood, so heißt es, begründet 1939 auf Fire Island fünfzehn Kilometer westlich von Smith Point, wo meine Familie und ich immer baden gehen, in Cherry Grove eine schwule Strandcommunity, im selben Jahr, in dem er Goodbye to Berlin veröffentlicht, und nur sechs Jahre nachdem er Berlin verlassen muss, nichts, was meine Eltern damals auch nur ahnen, sie würden schwule Strandcommunitys natürlich ablehnen, aber sie wissen um die zahlreichen Emigranten, die vierzig oder fünfundvierzig Jahre zuvor in die Vereinigten Staaten gelangt sind, kennen die bekannteren unter ihnen, Thomas Mann, Bertolt Brecht, wenngleich sie auch innerlich nie eine direkte Linie von diesen Intellektuellen zu den eigenen kleinen Schicksalen ziehen würden, und anders als diese Geflüchteten im Exil sind sie freiwillig hierhergekommen und eben nicht geflohen, ohnehin ist in Bezug auf Amerika das Gefühl viel stärker, an der Westbindung der Bundesrepublik gewissermaßen mitzuarbeiten, immer wieder ist von den Bunsen- und Natotagungen die Rede, an denen mein Vater als Chemiker teilnimmt, Anfang der Neunzigerjahre organisiert er an seiner Universität selbst solch eine Bunsentagung. Unser Außenseiter- und Emigranten-auf-Zeit-Status hier in den USA erscheint uns als eine Art Auszeichnung, ein Privileg, anders als in Flensburg, wo wir fast immer uneingestandene Außenseiter sind, Sonderlinge, die Familie mit acht Kindern, alle Kinder mit relativ guten Leistungen in der Schule, wie mein Vater sagen würde, vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern, woraus wir alle ein nerdiges Selbstbewusstsein in unterschiedlichen Schattierungen ziehen, wiederum angespornt von unserem Vater, der keine Gelegenheit auslässt zu betonen, wie stolz er auf die guten Noten, die Intelligenz seiner Kinder sei, alle acht relativ unsportlich, ungelenk, keiner von uns kann mit einem Ball einen sauberen Pass spielen, wir tragen selbstgestrickte oder von den älteren Geschwistern durchgereichte, immer etwas unzeitgemäße Kleidung, manchmal etwas kratziger, als uns lieb ist, manchmal zu große Teile, noch bevor Anfang der Neunzigerjahre Baggypants und übergroße T-Shirts angesagt sind. Wir acht Kinder sprechen ein gepflegtes, beinahe schon elitär-gesuchtes Hochdeutsch ohne Regionalismen, unsere Beliebtheit vor allem in der Oberstufe ist antiproportional zu unseren Noten, aber hier in Bellport sind wir gut integriert, alle lernen sehr schnell Englisch, wir singen englische Lieder, den Kanon I Like the Flowers, der sich mit Fire Island bei den finalen Zeilen direkt zu verbinden scheint: I like the fireside,/when the light is low, die Insel ist in meiner Vorstellung von einem riesigen Lagerfeuer überzogen, ein Bild der Wärme, des Ekstatischen, Freizeit, Urlaub, Euphorie, durch diese Flammen kann man hindurchschreiten, sie umgeben einen, teilen hier den Raum mit dem eigenen Körper, ohne dass sie einen verzehren, eine Art Doppelbelichtung der Erinnerung, der Name dieser Insel könnte also nicht passender sein. Jahre später denke ich, dass sich Fire natürlich auf das Leuchtfeuer bezieht, das hier schon Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gebaut wird, um Schiffe sicher nach New York zu leiten, aber jetzt finde ich im Internet heraus, dass es keine eindeutige Erklärung zum Ursprung des Inselnamens gibt; vielleicht, so besagt eine Hypothese, bezieht er sich auf die hier im achtzehnten Jahrhundert gängige Praxis, nachts Feuer zu entzünden, um Schiffe auf die Sandbänke zu locken und anschließend zu plündern. 2013 sehe ich im Netz Bilder von den Verwüstungen durch Hurrikan Sandy in New Jersey, und unvermittelt suche ich nach Meldungen, die etwas zum Schicksal von Fire Island mitteilen, tatsächlich finde ich einige Blogeinträge von einer Bewohnerin, die Insel ist an drei Stellen überspült, es bilden sich tiefe Rinnen zwischen dem offenen Atlantik und der Great South Bay hinter der Barriereinsel, in den Monaten danach schüttet man zwei dieser Durchbrüche wieder zu, die dritte, größte Öffnung liegt an einer Stelle, die vor hundert Jahren schon einmal offen ist, historische Karten verzeichnen den Durchbruch unter dem Namen Old Inlet, seit 2013 bleibt diese Stelle offen, die Insel teilt sich, dort, wo wir 1982 entlangspazieren, am Strand baden gehen, ist jetzt Meer
ein anderes Familienlied, meist irgendwann gegen Ende der Familienfeste gesungen: Land der dunklen Wälder/und kristall’nen Seen, oder heißt es Kristallenseen, ich kann den Text nur rhythmisiert denken, angepasst auf die Phrasierung: Land der du-hunklen Wäl-der/und Kris-tallen-seen, das Lied ist innerhalb der Familie nur oral überliefert, nie sehe ich den Text gedruckt, anders als die Kirchen-, Weihnachts- oder Kinderlieder, für die es Bücher oder Textzettel gibt, oder die Lieder, die ich in den verschiedenen Schulchören singe, für die wir Textblätter und Noten als Kopien bekommen, außerhalb unserer Familie singt auch niemand dieses Lied, es taucht auf den Festen auf wie eine Erinnerung, fast wie ein innerer Drang, aus dem Dunkel hochkommend und dahin wieder zurücksinkend, meine älteste Schwester, Sigrid, singt es mit durchgedrücktem Rücken in Hab-Acht-Stellung, mein Vater ganz ähnlich mit einem heiligen Ernst, meine Mutter melancholisch und, wie alles, was sie singt, immer etwas schief – die an sich in Dur gehaltene Melodie erscheint mir gleichwohl traurig, sozusagen in einem inneren Moll. Der Text des Liedes steckt voller Überhöhungen und Mythologisierungen der Landschaft, urwüchsig und unberührt, dunkle Wälder, Seen, Kristall, zugleich ist in dem Lied die Sehnsucht nach Rückkehr der Heimatvertriebenen aufgehoben, Über weite Felder/lichte Wu-hun-der geh’n, eingemischt ist auch völkische Landserromantik, Starke Bauern schreiten/hinter Pferd und Pflug, das Gefühl rassischer Überlegenheit, wie man zu Zeiten der Entstehung des Liedes gesagt hätte. Wir jüngeren Geschwister müssen bei der dritten Strophe jedes Mal lachen, wenn sich der Text der Zeile Elche steh’n und lauschen nähert, die wir zu Elche steh’n und rauschen abändern, die auf der Nehrung stehenden Elche, die in die Dünen pissen
ich wache im Dunkeln auf, klettere die Sprossenleiter meines Hochbettes hinunter, gehe durch den unbeleuchteten Flur in das Schlafzimmer meiner Eltern, auf die Seite des Doppelbettes, wo meine Mutter schläft, die riesige damastweiße Federbettdecke klappt an ihrem langen Arm auf, ich schlüpfe unter die Decke, sie klappt wieder herunter. Kein Murren, kein Zögern, höchstens ein Murmeln im Halbschlaf. Doppelte Erleichterung, wenn meine auf der Seite schlafende Mutter mir zugewandt weiterschläft, leichte Enttäuschung, wenn sie mir den Rücken zudreht, abgewandt, die weite, kühle Fläche ihres Rückens unter dem hellen Nachthemd. Durch den schmalen Streifen zwischen den beiden braun-orange gemusterten Gardinen fällt jedes Mal, wenn ein Auto die Straße vor dem Haus durchfährt, das Licht der Scheinwerfer, wandert als sich verschiebender, erst immer schmaler werdender Balken, dann, nach der Mitte des Zimmers wieder breiter werdend von der einen Wand über die Zimmerdecke zur gegenüberliegenden Wand, immer in entgegengesetztem Verlauf zu dem an- und abschwellenden Rauschen der Fahrzeuge. Wenige Jahre später lassen meine Eltern an allen Fenstern des Hauses aschegraue Rollläden anbringen
ich sitze mit meiner Mutter bei unserem Kinderarzt im vierten Stock der Klinik nördlich des Stadtparks, Herr Daniel hat weißes Haar, Halbglatze, mit seiner näselnden, etwas schnarrenden Stimme fragt er mich, ob ich die Namen meiner Geschwister kenne – Sigrid, Claire, Isabelle, Hans, Ina, die Zwillinge Uta und Franz. Dann fragt er mich, wie alt ich jetzt sei:
– Drei.
Und was ich zum Geburtstag bekommen hätte. Ich sage:
– Eine große Tüte Brezeln.
Herr Daniel bittet mich, etwas zu zeichnen, dann horcht er mich ab, testet mit einem kleinen gummibeschlagenen Hammer meine Reflexe. Er lächelt viel und leicht spöttisch, wendet sich immer wieder mir und dann in einem fließenden Parlando meiner Mutter zu, er hat warme, etwas fleischige Hände. Sie besprechen etwas, was meine Augen betrifft, ich soll noch einmal die Augen weit öffnen und nach links schielen. Das solle am besten ein Augenarzt anschauen
die Erinnerung an die Untersuchung beim Kinderarzt, die Tüte Brezeln löst eine andere Erinnerung aus: Auf dem Teak-Sideboard im Esszimmer liegen meine Geschenke, jene große Tüte Brezeln, eine 200-Gramm-Tafel Marabou-Schokolade, wie wir sie zu jedem Geburtstag bekommen, eine Fähre für die Holzeisenbahn, auf dem Esstisch brennen Kerzen auf einem von meiner Mutter selbstgeleimten, runden Holzbrett mit achtzehn Holzknöpfen darauf, für mich brennen drei über den Kreis verteilte Tannenbaumkerzen und das Lebenslicht in der Mitte, meine Geschwister sitzen um den Tisch, am Stirnende mein Vater, rechts von ihm unsere Mutter, sie sitzt vor der Tür zum Flur und der dahinterliegenden Küche. Der Tisch teilt sich in warme, hellere Zonen und in weniger helle Plätze. Wir Kinder wollen immer neben unserer Mutter sitzen, ein Schutzwall zwischen uns und dem Vater, oder zum großen Fenster zur Straße hin. Wenn man spät zum Essen kommt, muss man auf der unserer Mutter gegenüberliegenden Seite neben dem Vater sitzen, auf dem ersten oder zweiten dunklen Platz. Gegessen wird immer zu denselben festen Zeiten, morgens vor der Schule um zwanzig nach sieben, im Winter mit heruntergelassenen Rollläden, in den Ferien wie auch an Sonn- und Feiertagen später, eher gegen neun Uhr, mittags essen wir um eins, ohne unseren Vater, in der Tageshelle, die durch das große Fenster hereinfällt, abends um sechs, mit laufendem Radio im Hintergrund wieder in der Wärme der Glühlampen, die aus dem achtarmigen Kugellampenlüster über dem Esstisch herunterstrahlen. Dieses Ich meiner frühen Erinnerungen ist umgeben von einem gleichfalls achtköpfigen Wir, meinen Vater nicht mitgezählt
Ich sitze im Ferienhaus meiner Eltern in D. in Schleswig-Holstein, auf dem Tisch vor mir steht eine Porzellankanne für Tee, ich habe mir darin Sencha aufgegossen. Die Kanne ist streng zylindrisch, weiß, fein vertikal gerippt, Design aus den frühen Sechzigerjahren, ein Einzelstück des umfassenden Rosenthal-Porzellan-Services meiner Eltern, in den Sideboards des Esszimmers in Flensburg stapeln sich etwa zweihundert Teller in vier Größen, kleine flache, große flache, tiefe Teller und extra kleine Dessertteller, dazu ebenfalls vertikal gerippte Kaffee- und Teetassen mit den markant mattschwarzen Untertassen, daneben Zuckerdosen, Milchkännchen, Suppenterrinen, Servierschüsseln und Saucieren. Alles gestaltet von dem finnischen Designer Tapio Wirkkala, der Anfang der Sechzigerjahre für das bundesrepublikanische Vorzeigeunternehmen in Oberfranken dieses Service entwirft, Ausdruck einer bürgerlichen Moderne, eines Kosmopolitismus, der die jüngere Geschichte vergessen machen will – Rosenthal bringt nach der Zwangsarisierung des Betriebes 1937 in den frühen Vierzigerjahren Sonderserien für Staat und Partei heraus, mit Reichsadler samt Hakenkreuzemblem in der Bodenmarke. Hinter der Teekanne geht der Blick weiter durch die Panoramafensterscheibe auf den Balkon, dort steht ein weißer Monoblocstuhl von einem namenlosen Industriedesigner, ein Stuhl von der Sorte, die weltweit zig Millionen Mal so oder artverwandt existiert. Man kann in diesen Stühlen eine entfernte, stapelbare Kunststoffvariante des neuenglischen Adirondack Chair sehen, den globalisierten Siegeszug amerikanischer Formsprachen, katalysiert von einer auf sorglosem Rohstoffverbrauch fußenden Massenproduktion, der Stuhl kostet neu weniger als der Deckel der vor mir stehenden Teekanne. Die vertikalen Plastikrippen der Rückenlehne bilden ein seltsames optisches Spannungsverhältnis zu den Rillen auf der Kanne, die frei stehenden Kunststoffarmlehnen fließen in einer Bewegung von der Rückenlehne zu den Vorderbeinen und korrespondieren mit dem eleganten Bogen des Griffs an der Seite der Kanne. Bei genauerem Hinsehen fallen am Stuhl die rauen, durch die Gussformen verursachten Kanten und hier und da ein leichter Moosbelag ins Auge.
Drei Wochen zuvor bin ich auch schon in D. und besuche mit Milan und Anouk meine Eltern. Meine Mutter ist immer wieder mit den beiden Kindern im Garten, der verrottende, notdürftig gestrichene Sandkasten, ein verbeultes Bobby-Car, ein Plastik-Krocket-Set, mit dem ich auch schon als Kind spiele, die von den Neffen im Vorsommer gebaute Treppe am Hang. Ich führe Interviews mit meinem Vater, er sitzt auf der verblichenen dänischen Siebzigerjahrecouch, ich auf einem der Hanfleinenstühle vor ihm. Zwischen uns auf einem weiteren Stuhl das Aufnahmegerät, das ich leicht nervös auspegele und in eine leere Butterdose stelle, damit die beiden Mikrofone am oberen Ende in seine Richtung zeigen, das Gerät und den Aufnahmevorgang möglichst unscheinbar machen wollend, was natürlich nicht richtig gelingt. Mein Vater sitzt aufrecht da, leicht vorgebeugt, fokussiert, seit Monaten habe ich angekündigt, ihn zu seinem Leben befragen zu wollen, der Ton seiner Stimme, als er zu sprechen beginnt, erinnert mich an die Aufnahmen, die er mit seiner Mutter Ende der Siebzigerjahre macht, mit einem Telefunken-Tonbandgerät, an das ich mich noch aus meinen frühen Kindertagen erinnere, bevor mit einer neuen Stereoanlage ein Kassettenrekorder Einzug hält in das Wohnzimmer meiner Eltern, genau genommen kenne ich diese Tonbandaufnahmen nicht richtig, eigentlich nur aus seiner Nacherzählung, bewusste Dokumente, um Familiengeschichte festzuhalten.
– Es ist Heiligabend, ich sitze mit meiner Mutter am Wohnzimmertisch, am Baum brennen die Kerzen …, sage er da auf der Aufnahme, sagt mein Vater bei einer anderen Gelegenheit.
Auch jetzt fängt er mit dem gleichen, etwas forciert nonchalanten Parlando an zu erzählen, ich komme zunächst kaum dazu, ihm konkrete Fragen zu stellen, so sehr ist er im Erzählfluss, eingangs will ich mir Überblick verschaffen, ihn nach den Stationen seines Lebens befragen, den Orten, an denen er gelebt hat in den vergangenen achtzig Jahren, aber statt eines knappen Gerüsts verästelt sich sein Erzählen sofort. Wir sprechen vier-, fünfmal in halb- oder auch einstündigen Abschnitten, immer wieder unterbrochen von den Kindern, die hereinkommen und eine Süßigkeit wollen, Anouk, die gewickelt werden muss oder auf den Schoß will, Milan, der neugierig fragt, was wir da machen, ob er zuhören dürfe, und dann nach zwei Minuten ein Buch vorgelesen haben will. Wir kommen in den insgesamt rund drei Stunden von 1933, dem Jahr seiner Geburt, bis etwa 1955. Mein Vater erzählt fließend, ausführlich, kontrolliert. Ich lasse ihn sprechen, versuche nur, ihn hier und da auf Persönlicheres zu lenken als die reinen Stationen, die in Anekdoten ausgebreitete Schul- und Lernkarriere. Eigentlich möchte ich wissen, was für Prägungen mein Vater als Kind bekommt, welche Traumata er erfährt, um für das Buchprojekt, an dem ich arbeite, zusammenzutragen, wie ich selbst durch diese Traumata geprägt bin, auch wenn ich ihm das so nicht sage. Zudem ist die Erforschung dieses Herkommens, dieses dunklen inneren Kontinents eines familiären kollektiven Bewusstseins für mich selbst noch Neuland, ich muss mich in diesem Terrain erst noch orientieren, gefühlt halb unter Wasser, ich sammle, symptomatisiere innerlich, noch ohne ganz klares Ziel. Die Gespräche scheinen mir für mein Schreibprojekt bis hierhin wenig ergiebig, jenseits meines eher allgemeinen, natürlich bei mir auch vorhandenen, ungerichteten Interesses am Leben meines Vaters. Fast nie, fällt mir auf, erzählt er von Emotionen, fast nie so, dass man tatsächlich mitfühlen könnte, alles bleibt sachlich, durchzogen von kleinen Erfolgsgeschichten, von Aufstiegs- und Bildungsstolz, von Abbildern seiner früheren Tüchtigkeit. Über seine Mutter, seine Schwester, seinen Vater erfahre ich fast nichts. Ich notiere mir Stichwörter zu einigen Punkten, zu denen ich weiter gehende Fragen habe. Die Dreißigerjahre, der Krieg, die Zeiten, die mich vordringlich interessieren, kommen insgesamt sehr kurz, trotzdem will ich erst mal eine entspannte Gesprächsatmosphäre, einen ruhigen Erzählraum entstehen lassen. Hinter seinem Rücken der sich mit dem Licht verändernde See, die kahlen Vorfrühlingsbäume, wilde Kirsche, Esche, ein Apfel- und ein verschossener Walnussbaum am Hang, unten im Bruchstreifen vor dem See Schwarzerlen und Efeu. Ich frage ihn nach Freizeitbeschäftigungen, um von den ewigen Beschreibungen der Schulverhältnisse wegzukommen, nach Mädchengeschichten; Chorsingen, Lesen in der Bibliothek, Turnen, Tischtennisverein, Schachklub, Tanzkurse, die er und zwei seiner Freunde kostenlos besuchen dürfen, weil sich bei den Kursen viel mehr Mädchen als Jungen anmelden.
Hinter dem Plastikstuhl und dem Balkongeländer lassen die Wildkirschen ihre Blätter schon teilweise hängen, sie beginnen, sich einzurollen, so dass man die graurosa Blattunterseiten, die verfärbten Blattriste sehen kann und hier und da einzelne gelborange oder purpurfarbene, abgestorbene Blätter. Weiter unten die Schwarzerlen, das Vertikalmuster der astlosen Stämme wie handgezeichnete Striche vor dem bleifarbenen See. Ein Nachbar hackt Holz. Gedämpfte Geräusche wiederkehrender, immer leicht arhythmischer Schläge, von kurzen Pausen unterbrochen, in denen ein neuer Kloben auf den Hackklotz gehievt wird. Alle Stunde das Sirren der Motorsäge, ein wie vergrößertes, polyphones Hornissensummen, dem man zwischendrin das zubeißende Durchfräsen des Materials anhört.
Ende der Achtzigerjahre lassen sich meine Eltern einen gusseisernen Kaminofen ins Wohnzimmer ihres Ferienhauses bauen. In den Jahren danach fällt mein Vater gemeinsam mit meiner Mutter, meiner Schwester Uta oder meinem Bruder Hans einige Bäume auf dem Grundstück, um sie zu Feuerholz zu verarbeiten. Zwei ausgewachsene Eichen, zwei dickere Eschen, eine Wildkirsche. Die vordere der beiden Eichen fällen wir an einem Spätsommertag. Meine Mutter ist eigentlich dagegen, meine Schwester Ina allemal, aber mein Vater sagt, der Baum nehme die Sicht auf den See, verschatte das obere Grundstück, vor allem sei er krank, wenn er bei einem Sturm umfiele, könnte er auf das Haus stürzen. Er borgt sich eine Trummsäge von unserem Nachbarn aus, das handbreite Sägeblatt ist länger als mein damals zwölfjähriger Körper und endet in hölzernen, jeweils mit zwei Händen zu umgreifenden Holmen. Aus Protest gegen die Baumfällung verfolge ich das Geschehen aus einer Art Versteck in der Krone des Klarapfelbaums. Mein Vater erklärt Uta, dass sie zunächst mit unserer kleineren, abgestoßenen Bügelsäge einen Keil aus dem Stamm schneiden soll.
– In diese Richtung fällt der Baum dann, sagt mein Vater.
Nach einer Weile hat die Säge kaum noch Platz für die Sägebewegung, weil der Stamm einen zu großen Durchmesser hat, daraufhin setzen mein Vater und meine Schwester die Trummsäge an, ziehen sie vor und zurück, vorsichtig zunächst.
– Nicht schieben!, ruft mein Vater.
Sie kommen in einen Rhythmus, aber der Baum neigt sich leicht, klemmt das Blatt ein, sie ziehen die Säge aus dem Spalt. Ich bin von dem Apfelbaum hinuntergestiegen und schaue durch die Ruten der Johannisbeerbüsche weiter zu. Um einen zweiten Schnitt für den Keil herauszusägen, nimmt mein Vater wieder die Bügelsäge, ein jetzt spielzeughaft klein erscheinendes Werkzeug, und setzt ein Stück über dem ersten Schnitt einen weiteren schräg nach unten an. Schließlich können sie den Keil herausziehen.
– Jetzt kämpft er noch, sagt mein Vater trocken.
Er dreht sich zu mir um, ich stehe noch immer in stummem Protest in den Büschen, er fragt mich, ob ich nicht mithelfen wolle. Ich komme aus den Johannisbeeren, widerwillig, neugierig, ein bisschen stolz.
– Jetzt den Fällschnitt, sagt mein Vater. Ihr fangt an, hier.
Er markiert mit der Bügelsäge eine Stelle gegenüber dem Keil, zwei Zentimeter unter dem Grundschnitt. Meine Schwester und ich sägen, das Blatt zieht Späne aus dem Spalt.
– Immer bisschen Gegenspannung, sagt Uta, sonst wellt das Blatt.
Wir wechseln uns ab, damit unsere Arme und Schultern nicht ermüden. Als der Schnitt ungefähr drei Handbreit tief ist, ächzt die Eiche.
– Jetzt kommt er jeden Moment, sagt mein Vater.
Nichts passiert. Uta und er sägen weiter.
– Gegenspannung, ruft er.
– Mach ich ja, sagt Uta.
Mein Vater zieht die Säge mit aller Kraft durch das widerständige Material, wieder klemmt das Blatt, das Gesicht meines Vaters verzerrt sich, aufeinandergebissene Kiefer, gebleckte Zähne, die Brauen hochgezogen, Augen- und Stirnpartie liegen sekundenweise in Falten, er zieht die Luft scharf ein, ein Gesichtsausdruck, den er auch bei seinen unkontrollierten Wutanfällen hat, wenn er sich über etwas ärgert, etwa wenn die Kollegen aus der Organik und der Anorganik mit den operettenhaften Namen Pein, Schitthelm und Buanelli ihn aufregen, weil sie wieder einmal gegen ihn paktieren, oder wenn er einen Artikel im SPIEGEL liest, der ihm nicht passt, dem SPIEGEL, den er jeweils montags kauft und jeden Dienstag nach einer festen Abmachung an den Kollegen Schickl weiterverkauft, um das rote Magazin möglichst nicht zu unterstützen, oder, was ähnlich oft vorkommt, einen Artikel in der FAZ, etwa wenn die Regierung Kohl wieder einmal die Sozialausgaben oder die Rente erhöht, wenn die Grünen, die Atomgegner, einen Vorstoß wagen, die chemische Industrie in Misskredit ziehen, sich jemand für die Gastarbeiter engagiert oder sich für die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie ausspricht, oft schüttelt er das Blatt, wie um die Buchstaben in eine andere, passendere Reihenfolge zu bringen, schlägt mit dem Handrücken gegen das Papier, faltet die Zeitung klein, auf ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel der Blattgröße, wirft das gestauchte Papier auf den Telefontisch, springt vom Sofa auf, schreitet hastig im Wohnzimmer auf und ab, rückt die schweren Sessel, die Esszimmerstühle zentimeterweise vor oder zurück, während sein Gesicht im Moment des Verrückens von dieser raubtierhaften Mimik durchzogen wird.
– Papa, es gibt Essen!, sage ich dann.
Er atmet kurz aus.
– So, ich komme, antwortet er.
Und innerhalb von einer Sekunde ist diese Wutmaske abgelegt. Nicht so, wenn seine Wut unserer Mutter oder einem von uns Kindern gilt, dann halten wir uns lieber fern von ihm, weil sich seine Aggression in diesen Phasen jäh an uns entladen kann. Untereinander, aber auch gegenüber meiner Mutter bezeichnen wir Kinder diese Wutanfälle als Schafe schlachten, um das drohende oder heraufziehende Übel unauffällig benennen zu können:
– Nicht, dass dann wieder Schafe geschlachtet werden.
– Vorhin wurden deshalb wieder Schafe geschlachtet.
Eine Formel, die auf keine anekdotische Entstehung zurückgeht, sondern irgendwann einfach von meiner Schwester Uta ins Spiel gebracht wird und hängen bleibt, wahrscheinlich wegen der lautmalerischen Ähnlichkeit zu dem Geräusch der während dieser Wutanfälle durch die zusammengebissenen Zähne eingesogenen Atemluft.
Jetzt haben mein Vater und Uta die Säge wieder halbwegs befreit, sie ziehen sie weiter mit aller Kraft durch, hin und her, hin und her, wieder knackt es.
– Jetzt stirbt er, sagt mein Vater.
Einzelne berstende Geräusche.
– Achtung!, ruft er. Blatt raus!
Der Baum wankt.
– Blatt!, ruft mein Vater und zieht die Säge erst an seiner Seite und dann an der Seite meiner vor Schreck erstarrten Schwester aus dem größer werdenden Spalt.
– Weg!, bellt er.
Alle drei springen wir zwei Schritte zurück, während der Baum, zunächst erstaunlich langsam, dann schneller werdend, unter dem Bersten des Kernholzes und dem sirrenden Peitschen von Zweigen und Blattwerk zu Boden geht. Plötzlich ist es still. Ungewohnte Helle. Jetzt ist er tatsächlich tot, einer dieser Gartenbewohner, der, seit ich denken kann, dort steht und mit mir wächst, er fällt präzise und ausweglos in Keilrichtung, auf den Rasenweg neben dem Haus und stürzt den hinteren Teil des Gartens in Unordnung, die Wege nur mit Mühe passierbar, alles voller Zweige und Büschel von Eichenblättern, die so bodennah sonst nie in dieser Fülle vorkommen, zwei der Johannisbeersträucher sind lädiert, einige der Ruten unter einem größeren Ast umgeknickt, ihre braunrote Rinde abgeschält, so dass das blassgrüne Kambium zum Vorschein kommt.
Manchmal überkommt mich der Drang, mein Gesicht genau in diese Grimasse hineinzulegen, wenn Milan mich zur Weißglut bringt, eine Schraube festgerostet ist und rasch gelöst werden müsste, wenn ich im Netz einem Posting von einem fernen Bekannten begegne, das Positionen der AfD propagiert, und ich mir beim Duschen, beim Aufräumen der Küche, mit den Kindern in der U-Bahn überlege, welche Argumente ich vorbringen möchte, um dem Posting etwas entgegenzusetzen, manchmal fragt mich Anouk dann:
– Was ist los, Papa?
Oder sie sagt:
– Ganz ruhig, Papa, alles gut!
Ich erschrecke dann jedes Mal, denke: die Vatergrimasse!, und entspanne meine Gesichtsmuskeln.
ich bin erstaunt, wie geschickt mein Vater zuschlägt, er spaltet die Stücke meist mit einem einzigen Hieb, dabei fällt die eine Hälfte des Stammstücks vom Hackklotz herunter, die zweite bleibt stehen, damit man sie gleich weiter teilen kann
Uta und ich stellen uns ebenfalls vor den Hackklotz und schlagen die Axt in einer fließenden Bewegung, weit ausholend, von hinter dem Kopf hinunter bis zum oberen Rand der Stammscheibe. Nach und nach finden wir die richtige Balance aus Konzentration und Wille. Wenn man unpräzise oder zu schwach schlägt, bleibt die Axt stecken, die man dann mühsam mit Schlägen gegen den Holm wieder heraushauen muss. Wenn man richtig trifft, gleitet die Axt kraftvoll und fast mühelos durch das nasse Holz.
– Chopping firewood, sagt mein Vater unvermittelt.
Wir schauen ihn fragend an.
– Ronald Reagan hat mal gesagt, das sei seine Lieblingsfreizeitbeschäftigung
Ich sitze im Zug und tippe eine Kurznachricht an Judiths Mutter in mein Telefon. Sie ist unterwegs nach Berlin, um die Woche über Judith bei der Kinderbetreuung zu unterstützen.





























