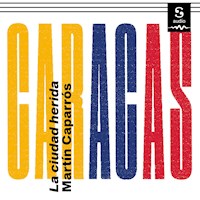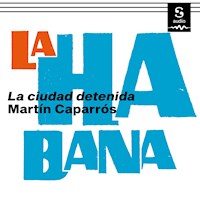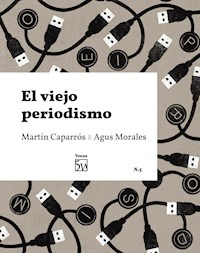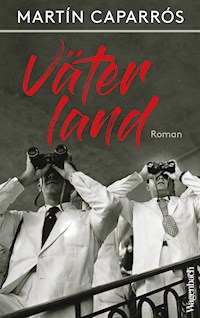
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Buenos Aires, 1933. Die Krise ist überall, die Stadt ein Pulverfass. Ablenkung bietet nur der Fußball, der gerade als Volksdroge entdeckt wird. Ausgerechnet jetzt verschwindet der berühmteste Spieler des Landes – angeblich um mehr Gehalt von seinem Verein River Plate zu erpressen. Oder hat er doch etwas zu tun mit dem mysteriösen Tod eines Mädchens aus der Oberschicht? Andrés Rivarola, ein charmanter Tagedieb und verhinderter Tangodichter, will eigentlich nur einem Bekannten, dem Kokain-Dealer des Fußballers, aus der Patsche helfen. Mit dabei: Raquel, eine polnische Jüdin mit zurückgegelten roten Haaren, die elegante Herrenanzüge trägt und wenig von festen Bindungen hält. Sie ist entschlossen, die Wahrheit über den Tod ihrer Freundin herauszufinden. Ungebremst schlittert das Duo in eine politische Verschwörung hinein, die um einige Nummern zu groß ist für die beiden. Mit viel Sprachwitz lässt Martín Caparrós das Buenos Aires der dreißiger Jahre lebendig werden: halbseidene Bars, verqualmte Zeitungsredaktionen, skurrile Nebenfiguren, Dichtercafés, faschistische Aufmärsche, dampfende Schlachthöfe – ein Tango am Abgrund.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die argentinische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel Todo por la patria bei Grupo Editorial Planeta in Buenos Aires.
Die Veröffentlichung wurde unterstützt vom Übersetzungsförderungsprogramm »Sur« des Außen- und Bildungsministeriums der Republik Argentinien.
Obra editada en el marco del Programa »Sur« de Apoyo a las Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.
Der Übersetzer dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Förderung seiner Arbeit am vorliegenden Text.
E-Book-Ausgabe 2020
© 2018 Martín Caparrós, published in arrangement with Casanovas & Lynch Literary Agency S.L.
© 2020 für die deutsche Ausgabe:
Verlag Klaus Wagenbach Emser Straße 40/41, 10719 Berlin www.wagenbach.de
Covergestaltung Julie August unter Verwendung einer Fotografie (Ausschnitt) von Kurt Klagsbrunn (Im Jockey Club Brasileiro, 1945), mit freundlicher Genehmigung von Victor Hugo Klagsbrunn
Alle Rechte vorbehalten
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 9783803142757
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 3323 6
www.wagenbach.de
Und genau in dem Moment denk ich an San Martín. Nicht an den Martín Fierro, nicht an Sarmiento, nicht an das scheue Gürteltier Yrigoyen, nicht an die Pulpera de Santa Lucía, nein, an San Martín. Ich denk an ihn und muss den Kopf schütteln, und warum auch immer sage ich zu Gorrión, was wohl unser großer Volksheld dazu sagen würde, wenn er sehen könnte, wie es um uns steht: ja, dass wir am Arsch sind, Bruder, vergiss nicht, wie gut wir drauf waren, vorn mit dabei, echte Titelkandidaten, und jetzt langt es gerade noch zum Unentschieden. Jetzt kracht alles zusammen, sind wir mittendrin im Rette-sich-wer-kann, willst du was zu fressen, nimmst du einem anderen das Brot weg, hast du Arbeit, tust du so, als hättest du keine, damit kein anderer sie dir wegschnappt. Und wenn uns das schon wehtut, sage ich, dann stell dir vor, wie das erst für den armen San Martín sein muss, bei all der Mühe, die er mit dem Krieg hatte, bei all den falschen Hoffnungen, die er sich gemacht hat. Oder für die Millionen armer Teufel, die von so weit hergekommen sind, meine Alte, die Ärmste, so viel Arbeit, so viel Plackerei, so viele Träume, und jetzt das. Mein armer Alter, der das zum Glück nicht mehr erleben muss. Obwohl, stell dir vor, sie wären in Italien geblieben, sage ich, der Hunger, die Angst, die sie jetzt hätten wegen diesem Schwachkopf, diesem Pfannkuchengesicht mit seiner lächerlichen Kellnermütze aus dem Copacabana. Oder auch nicht, wer weiß, vielleicht wären sie ja begeistert und würden dem Duce zujubeln wie all die anderen Idioten. Also war es letztlich doch besser, dass sie gekommen sind, sage ich, selbst wenn’s nur für das hier war. Aber stell dir vor, jemand hätte ihnen gesagt, sie würden sich hier, im Land der Träume und großen Illusionen, im berühmten Ardschentina, den Arsch für ein Stück Brot aufreißen müssen, sage ich und hole Luft, um meine Schimpftirade fortzusetzen, doch Gorrión Ayala nutzt die Unterbrechung, um mir zu sagen, ich solle den Mund halten und spielen, er habe es satt, mir zuzuhören. Los, Pibe, mach schon, uns läuft die Nacht davon. Oder kommt uns schon entgegen.
Manche nennen es Piff. Andere auch Tsssss und Fiuuu oder ähnlichen Blödsinn – Geräusche, wenn die Wörter versagen. Es ist fast drei Uhr morgens, die Piffs nehmen zu. Das Queue weiß nicht mehr, wie und wohin es stoßen soll, damit die Kugel ihr Schicksal erfüllt und gehorsam über den grünen Filz rollt, an drei Banden abprallt und die Kugel trifft, die sie treffen soll. Der Besitzer des Queues weiß es noch weniger. Das Piff schallt durch den Raum.
»Scheiße, Gorrión, wollen wir nicht lieber aufhören?«
»Warum, hast du was Besseres vor?«
»Nein, aber ich hab auch nichts in der Tasche, um dich zu bezahlen, wenn du jedes Mal gewinnst.«
Ich bin der Großmeister des Piffs. Erschöpft wische ich mir mit dem aufgekrempelten Ärmel meines weißen Hemds über die Stirn. Ich trage es wie immer offen, ohne eine einzige Falte. Ich greife nach dem halbvollen Bierglas auf dem Marmortischchen an der Wand.
»Keine Sorge, Pibe. Du weißt ja, wie sehr ich’s mag, wenn du mir was schuldest.«
Gorrión schenkt mir ein Grinsen voller fauler Zähne, während ich mich auf den nächsten Stoß zu konzentrieren versuche. Im Untergeschoss des Los 36 Billares herrscht eine Bullenhitze, die Ventilatoren bewegen kaum die verrauchte, stickige, fast vollständig verbrauchte Luft. Die niedrigen Lampen verwandeln jeden Tisch in eine einsame Insel inmitten eines Schattenmeers. Viele sind besetzt: Männer und noch mehr Männer, Zigaretten, Schweißgeruch, Flüche.
»Ich kann nicht glauben, dass ich schon zwei Stunden Zeit und Kohle mit diesem Schwachsinn vergeude.«
»Zwei Stunden?«
Fragt Ayala, und ich will einen Blick auf meine Armbanduhr werfen. Da fällt mir ein, dass ich sie letzte Woche verpfändet habe. Hinten an der Wand zeigt eine große Uhr – mit freundlicher Unterstützung von Licor de los 8 Hermanos – an, dass es siebzehn nach drei ist.
»Ja, Gorrión, zwei Stunden, zweieinhalb.«
»Und die zehn Jahre davor?«
Ich sehe ihn an, seufze, fahre mir mit der Hand durchs Haar – die Erleichterung, sich mit den Fingern in diesem dunklen Gestrüpp zu verheddern. Noch habe ich Haare.
»Naja, es gab auch Jahre, da ging’s mir wunderbar.«
»Als deine Mami dir noch die Brust gegeben hat.«
»Red keinen Stuss, Gorrión. Wirklich, ich hatte meine Momente.«
Ich suche nach der Kreide, als mein Blick auf den großen Wandspiegel fällt – das Glas fast blind, die Cynar-Reklame kaum noch lesbar –, und was ich sehe, gefällt mir nicht.
»Und dann bist du aufgewacht.«
Der Spiegel zeigt dreißig schlecht gelebte Jahre, Augenringe, einen Zweitagebart. Abgesehen davon bin ich schlank, habe ein markantes Gesicht, hellbraune Augen und ein Lächeln, das verführerisch sein könnte, wenn es nicht meins wäre.
»Dann sind die Frauen aufgewacht, Gorrión, das war das Problem. Und dazu noch diese ganzen Plagen, die Seuche. Was für Arschlöcher. Und jetzt sagt dieser Fettwanst Justo, die Krise sei vorbei. Seine vielleicht, so ein Scheißkerl. Und ich schieb weiter Kohldampf wie der größte …«
Ayala schafft vier Karambolagen nacheinander. Er spielt gelassen, sicher. Ich sehe ihn neidisch an, versuche Respekt oder liebevollen Neid zu zeigen. Was nicht einfach ist. Ayala ist dünn wie ein Besenstiel, hat schütteres Haar, einen krummen Rücken, eine krumme Nase. Der Typ von Mann, den Frauen fragen, ob er gut verdient – wenn sie ihn überhaupt was fragen. Über den Tisch gebeugt, die Hände am Queue, dreht er den Kopf zur Seite und sieht mich an.
»Hast du’s mal mit Arbeit versucht, Pibe?«
»Leck mich, Gorrión. Wenn du mir so kommst, geh ich pennen.«
»Als ob man bei der Hitze schlafen könnte …«
Ayala legt die Kugeln in Position, um die nächste Partie zu beginnen. Ich frage nach einer Zigarette, er hält mir seine Schachtel hin: »Laponia, erfrischend mit Menthol«.
»Scheiße, Gorrión, so was kann man doch nicht rauchen.«
»Nicht? Manche von uns müssen sich nicht beweisen, dass sie Männer sind.«
Hinten im Salon kommt ein Zeitungsjunge die Treppe herunter und ruft die Namen der Morgenzeitungen aus: Nación, Crítica, Prensa, El Mundo. Ich brülle:
»Bartolo, hierher!«
Der Zeitungsjunge kommt zu uns. Er hat schon einige Jahre auf dem Buckel, eine schief sitzende Mütze, Knickerbocker, die abgelaufensten Schuhe in einer Stadt der abgelaufenen Schuhe. Und er hat einen groben italienischen Akzent:
»Wie ofte ich musse Ihne sage, dass ich nich heiße Bartolo, Scheffe?«
»Beruhig dich, Bartolo, ich sag’s nie wieder.«
Der Zeitungsjunge hält mir La Nación hin, und ich sehe ihn mit meinem schönsten Lächeln an.
»Für wen hältst du mich, ein Zylindergesicht? Gib mir die Crítica, ich will mich ein bisschen amüsieren.«
»Wie immer Sie wunsche, Scheffe. Wenn eine Mann nich kenne seine eigene Gift …«
Auf der Titelseite der Crítica prangt die Schlagzeile: »Wo steckt die Bestie?« – und darunter das Foto eines jungen Fußballspielers. Ich betrachte es ohne großes Interesse. Ayala reißt mir die Zeitung aus den Händen.
»Bernabé!«
»Ja, Bernabé – und? Bist du jetzt auch verrückt nach diesem Blödsinn?«
»Was für ein Blödsinn, Bruder?«
»Fußball, was sonst.«
Ayala seufzt, macht große Augen, liest laut vor: »Die Sorge wächst. Wie die Führungsriege des Club Atlético River Plate bekannt gab, ist der wichtigste Spieler des Vereins, der Mittelstürmer Bernabé Ferreyra, dem Trainingsauftakt nach den Weihnachtsferien ferngeblieben …«
»Spielst du jetzt, Gorrión, oder hast du dich in ein Radio verwandelt?«
»Mann, Pibe, die Sache ist ernst. Auch wenn du’s nicht glaubst, sie ist verdammt ernst. Wenn der Kerl nicht bald wieder auftaucht, bin ich am Arsch. Wenn ich Glück habe.«
Ayala weiß alles über Bernabé. Wir bestellen noch zwei Bier, setzen uns, um in Ruhe zu rauchen, und er fängt an zu erzählen. Ein bisschen was weiß ich natürlich auch: Der Kerl ist so berühmt, dass eine Zeitung vor ein paar Wochen schrieb, er sei »der erste Bürger des Landes«, der berühmteste Typ von ganz Argentinien. Inmitten von Putsch, Krise, Elend war Bernabé Ferreyra die einzig gute Nachricht: ein Crack ohnegleichen.
Zwei Jahre zuvor, im Sommer 1931, hatte der Fußball Farbe bekannt. Längst war Fußball viel zu beliebt, um weiter zu behaupten, man spiele nur um die Ehre von ein paar verblichenen Trikots. Die Spieler der ersten Liga kassierten schließlich seit Jahren, keiner besonders viel, nicht genug, um reich zu werden, aber sie bekamen anständige Löhne, sodass die Besten von ihnen nicht mehr zusätzlich arbeiten mussten, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und sich voll und ganz dem Training widmen konnten – oder ihre Eier schaukelten, sagt Ayala. Und das sei ja auch nur gerecht: Die Stadien waren immer voller, die Fans zahlten Eintritt, die Clubs sahnten ab. Es konnte nicht angehen, dass die Spieler als Einzige kein Stück vom Kuchen abbekamen.
»Offenbar hat Boca am besten bezahlt, um die hundert Mäuse pro Woche, und bei den anderen großen Clubs waren es um die siebzig, achtzig. Aber das war noch gar nichts.«
Ich frage, was das heißen soll, gar nichts, dass ich von hundert Mäusen die Pension bezahlen und einen Monat leben kann. Ayala sagt gut, gar nichts für die, und dass manche Präsidenten den Spielern eine Stelle in einer ihrer Firmen besorgen oder in der Verwaltung bei einem befreundeten Politiker – eins dieser netten Pöstchen, bei denen man nichts anderes tun muss, als am Monatsende seine Lohntüte einzusacken. Ein Kinderspiel.
Sagt er, und ich sage, das Lustigste daran ist, dass keiner es ausgesprochen hat.
»Als würde es was bringen, einfach nichts zu sagen. Argentinier eben.«
»Argentinier, ja, und genau deshalb wollten sie mehr und mehr, und am Ende haben sie alles verbockt.«
Sagt Gorrión. Dass die Spieler sich als Gegenleistung für die Kohle verpflichtet hätten, nicht den Verein zu wechseln, aber dass sie irgendwann nicht mehr dazu bereit waren. Sie traten in Streik, es gab Zoff. Also stellten die großen Clubs in Aussicht, eine Profiliga zu gründen. Die Spieler hätten zwar weiterhin kein Recht, einfach so zu gehen, aber dafür bekämen sie ordentliche Verträge und offizielle Gehälter. Einige kleinere Clubs hatten was dagegen, verteidigten die letzten Reste des Amateursports. Aber die Militärs in der Regierung waren besorgt wegen der Probleme, die eine Saison ohne Fußball mit sich bringen könnte, machten Druck, und im April ging es los mit der ersten argentinischen Profimeisterschaft. Um vorbereitet zu sein, kauften die großen Vereine neue Spieler ein. Doch Bernabé Ferreyra wollte keiner.
»Was für Idioten, Pibe. Da war er, direkt vor ihrer Nase, und sie haben’s nicht gemerkt.«
Als wäre das noch nötig, erklärt Gorrión es mir: Ferreyra war ein dunkelhaariger, etwas untersetzter Junge mit einem großen Kopf und buschigen Augenbrauen. Er stammte aus Rufino, einem Dorf in der nördlichen Pampa. Schon als junger Bursche machte er in seiner Provinzliga wegen seines strammen Schusses von sich reden. 1924 gab er mit fünfzehn sein Debüt beim Eisenbahnerclub von Junín, der nächstgelegenen Stadt, wo man ihm auch eine Stelle als Anstreicher in den Werkstätten der Buenos Aires and Pacific Railway besorgte. Mit siebzehn ging er nach Rosario. Dort spielte er dreimal in der ersten Mannschaft der Newell’s Old Boys, doch der Trainer hielt ihn nicht für gut genug. Ende des Jahres kehrte er nach Junín zurück. Ende 1929 schlug ihm einer der Clubchefs von Atlético Tigre vor, zu seinem Verein zu wechseln. Mit seinen zwanzig Jahren fühlte sich Ferreyra schon etwas zu alt für solche Abenteuer und lehnte das Angebot ab. Sein Bruder Paulino musste sich ins Zeug legen, um ihn zu überreden.
Tigre zahlte zweihundert Pesos im Monat. In seinem ersten Spiel schoss Ferreyra vier Tore. Danach wurde die Liga unterbrochen, denn die erste Weltmeisterschaft stand an, die, die wir fast gewonnen hätten, die in Montevideo. Einige Clubs nutzten die Pause, um auf Tournee zu gehen und Kasse zu machen. Von Tigre ausgeliehen, ging Ferreyra mit Vélez Sarsfield auf Rundreise durch ganz Amerika. Sie dauerte fünf Monate, mit insgesamt fünfundzwanzig Spielen. Vélez verlor nur ein einziges und erzielte vierundachtzig Tore. Achtunddreißig davon schoss Ferreyra. Als er zurückkehrte, war er fast schon eine Berühmtheit.
Es ist seltsam, Gorrión so erregt zu sehen. Er ist völlig hingerissen von den heroischen Anfängen des Champions. Er erzählt, dass Ferreyra in seiner ersten Profisaison zwar kaum gespielt habe – aber in den dreizehn Spielen für Tigre erzielte er neunzehn Tore. Ende des Jahres beschloss der Präsident von River Plate, Antonio Liberti, Bernabé um jeden Preis zu verpflichten. Boca Juniors hatte diese erste Meisterschaft gewonnen, und Liberti musste verhindern, dass Boca auch die zweite gewann, koste es, was es wolle. Er hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass Tigre eine so gewaltige Ablösesumme fordern würde.
»Fünfunddreißigtausend, Pibe, kannst du dir das vorstellen? Fünfunddreißigtausend argentinische Pesos. Für die Kohle kriegst du zehn Autos. Der reine Wahnsinn.«
Das sei der reine Wahnsinn, sagt er. Noch nie habe irgendwo auf der Welt ein Verein so viel für einen Spieler ausgegeben. Doch River trieb die Kohle auf, und dann stellte sich heraus, dass auch Ferreyra seinen Anteil wollte: zehntausend Pesos. River blieb nichts anderes übrig, als einzuwilligen, und akzeptierte auch, ihm eine Dauerkarte für die Eisenbahn zu spendieren, damit er nach jedem Spiel für ein paar Tage nach Junín fahren konnte. Es war unglaublich. Und da hätten alle begriffen, sagt Gorrión, dass River der Club der Reichen ist.
»Darum nennt man sie auch die Millonarios. Und das Schlimmste ist, dass Bernabé ihnen jeden einzelnen Peso mit Toren und noch mehr Toren zurückgezahlt hat. Eine richtige Bestie, dieser Hinterwäldler.«
In seinem ersten Spiel, im März ’32, erzielte er zwei Treffer gegen Chacarita – und seitdem hörte er nicht mehr auf, Tore zu schießen. Er war technisch nicht der Beste, aber seine Granaten aus dreißig, vierzig Metern waren schlicht unhaltbar. Vor dem vierten Spiel verkündete River stolz, die zehntausend Pesos Handgeld bereits mit dem Verkauf der Eintrittskarten eingespielt zu haben, und das sei erst der Anfang. Zigtausende Zuschauer strömten ins Stadion, um ihn zu sehen – noch nie hatte ein Fußballer eine solche Aufregung verursacht. Buenos Aires war verrückt nach Bernabé.
Ich erinnerte mich: Die Crítica fing an, ihn »die Bestie« zu nennen, und rief einen Sonderpreis – eine Medaille aus massivem Gold – für den Torhüter aus, der ein Spiel überstand, ohne dass Bernabé ihm einen reinmachte. Am zwölften Spieltag gewann ein junger Bursche von Huracán den Preis, ein gewisser De Nicola. Doch danach traf Bernabé weiter.
»Ein Freund hat mir erzählt, dass der Typ sich einen besonderen Ball bastelt, mit zwei Kammern. Den legt er für ein paar Tage in einen Eimer voll Wasser, bis der Ball sich vollgesogen hat und hart ist wie eine Kanonenkugel. Und so schießt er auch.«
Im entscheidenden Spiel gegen Boca zog Bernabé von der Strafraumgrenze ab, der gegnerische Torwart hielt den Ball mit dem Bauch, brach dann aber ohnmächtig zusammen. Bernabé setzte nach und schob den Ball seelenruhig über die Linie. River war Meister. In den vierunddreißig Spielen hatte Bernabé dreiundvierzig Tore erzielt. Dann kam der Sommer und jetzt mit der fürchterlichen Februarhitze die Meldung, Bernabé sei nach Junín verschwunden und werde nicht zurückkehren, bis River ihm nicht dreißigtausend Pesos in bar bezahlt hätte.
»Und ich bin geliefert.«
Sagt Gorrión Ayala und fuchtelt wild mit der Zeitung herum, als könnte das etwas an der Nachricht ändern.
»Ich bin geliefert, ich spring in den Fluss. Und ich schwör dir, ich kann nicht schwimmen.«
»Kennst du irgendeinen Tango von Discepolín, Gorrión?«
»Nicht dass ich wüsste, Pibe. Ich glaub nicht.«
»Du hast garantiert schon mal einen gehört. Yira, yira zum Beispiel, sag nicht, den hast du noch nie vor dich hingesungen. Du wirst sehen, dass alles Lüge ist …«
Gorrión sagt ja klar, natürlich, und ich verkneife mir, zu sagen, wie unglaublich ich es finde, dass jemand ein Lied singt, ohne zu wissen, von wem es ist – als wär’s auf den Bäumen gewachsen. Dass jemand die Ideen eines anderen wiederholt, sie zu den eigenen macht, sie vor sich hinträllert und nicht mal weiß, wer der Typ überhaupt ist.
»Ja klar, wenn das Schicksal, dieses Flittchen und so weiter. Aber mein Schicksal ist das mieseste Flittchen von allen. Es verdient nicht mal den Namen Schicksal.«
Ich hatte zu Ayala gesagt, dass wir gehen sollten, ich hätte genug, und dass es, wenn wir noch fünf Minuten länger im Billardsalon blieben, hell werden würde, und dann würden wir Leuten auf dem Weg zur Arbeit begegnen, und es gebe nichts Deprimierenderes, wir sollten uns also lieber auf die Socken machen – also laufen wir jetzt die Avenida de Mayo in Richtung der Plaza entlang. Die Laternen brennen noch, um uns herum das ungewisse Licht der Morgendämmerung. Ein feiner Nieselregen erfrischt uns. Ich schaue zum Himmel, öffne den Mund, um ein paar Tropfen zu erhaschen. Ich lege eine Hand auf seine Schulter.
»Willst du mir jetzt endlich verraten, was zum Teufel da drinnen mit dir los war?«
»Du glaubst mir nicht, Bruder, oder?«
»Was soll ich dir denn glauben, Gorrión, wenn du den Mund nicht aufmachst?«
»Ich kann’s dir gerne noch mal sagen, Pibe: Wenn Bernabé nicht zurückkommt, bin ich geliefert.«
Ich suche in den Taschen nach der Zigarette, von der ich weiß, dass ich sie nicht habe. Ayala bietet mir einen seiner Mentholstängel an, und wir bleiben an einer Ecke der Calle Florida stehen, unter dem Vordach des Eingangs von Gath & Chaves, um sie anzustecken. Er versucht es ein paarmal, aber es gelingt ihm nicht, das Streichholz an der Ranchera-Schachtel zu entzünden. Er muss wirklich nervös sein.
»Aber du bist doch noch nicht mal Anhänger von River, Gorrión. Oder hab ich was verpasst?«
»Nein, che, natürlich nicht.«
»Und was spielt es dann für eine Rolle, ob dieser Junge weg ist oder nicht? Drehst du jetzt völlig durch, oder was?«
»Schön wär’s, Bruder. Aber wer hier durchdreht, ist er. Zu viel Koks, Pibe, viel zu viel.«
Ich nehme ihm die Streichholzschachtel aus der Hand, zünde das Streichholz und dann meine Zigarette an und stehe mit dem brennenden Streichholz da – jetzt begreife ich.
»Sag nicht, du hast ihm was verkauft?«
Wir laufen die Florida entlang, zwischen Milchkarren, Müll, Obst- und Gemüselieferanten, Obdachlosen, die der Regen aufgeweckt hat. Der Geruch nach Pferdeäpfeln wird stärker. Ja, er habe ihm was verkauft, sagt Ayala, und dass er seit Wochen kein Geld von ihm sieht, der Kerl stellt sich dumm, und er hat ihm trotzdem weiter Kredit gegeben, weil es der große Bernabé ist und weil er ihn mag, ein netter Bursche.
»Und natürlich konntest du nicht zulassen, dass er seinen Stoff beim Zeitungsjungen an der Ecke Corrientes und Esmeralda kauft, so wie alle anderen auch.«
»Pibe, das ist Bernabé.«
»Ja, das ist Bernabé. Und dir kommt’s gelegen, dass er bei dir kauft, weil das gut fürs Geschäft ist.«
»Na ja, das auch.«
Gibt Ayala zu.
»Ich glaube, du wolltest dir so eine hübsche Binde zulegen wie diese Zigarren, auf denen steht: Hoflieferant des Königs von England.«
»Hör auf, dich über mich lustig zu machen, Bruder.«
»Wie soll ich mich denn nicht über dich lustig machen, mein Lieber? Es ist alles halb so schlimm, er hat dich um ein paar Pesos beschissen. Er wird sie dir schon zurückgeben, und wenn nicht, auch egal. Ist ja nicht das erste Mal, und es wird auch nicht das letzte sein.«
»Hier geht es nicht um ein paar Pesos, Pibe. Es sind mehr als fünfhundert.«
»Fünfhundert?«
Unwillkürlich – ohne nachzudenken – bleibe ich stehen, stelle mich ihm in den Weg, packe ihn an den Schultern. Dicht neben uns wiehert ein Pferd, der Milchmann brüllt, seine Hunde kläffen uns an.
»Fünfhundert Mäuse, Gorrión? Bist du sicher?«
»Natürlich bin ich sicher. Und stell dir vor, es sind nicht mal meine. So viel Kohle hab ich nicht. Ich musste mir den Stoff auf Kredit bei Don Cologgero besorgen, und wenn ich nicht bezahle …«
Ayala lässt den Satz unvollendet, es ist klar, wie er weitergeht. Wir wissen es beide.
Wir schweigen. Mit gesenktem Kopf schlurfen wir zum La Martona an der Ecke Viamonte und San Martín. Wir treten ein, setzen uns an einen der Tische, bestellen zwei Gläser warme Vanille-Milch, zwanzig Centavos das Glas. Ich hole tief Luft und gehe die Sache an. Es gibt Tage, da bin ich überzeugt, fast jedes Problem lösen zu können – ja, dass ich gar nichts anderes kann, als Probleme zu lösen. Heute ist keiner dieser Tage, aber irgendwas muss ich versuchen:
»Darf ich dir eine Frage stellen, Bruder?«
»Mach, was du willst.«
»Ich will ja nicht nerven, aber wieso hat jemand so viele Schulden bei dir?«
»Das war Bernabé, Andrea. Ist Bernabé, meine ich.«
Es ist seltsam, sehr seltsam, dass er mich Andrea nennt. Niemand nennt mich Andrea. Meine Mutter. Niemand – oder fast niemand – weiß, dass ich Andrea heiße. Ayala natürlich – in der Schule, als wir zusammen auf die Nr. 4 in Barracas gingen, haben mich ein paar besonders aufdringliche Lehrerinnen bei meinem Vornamen gerufen, statt mich Rivarola zu nennen. Aber er muss wirklich verzweifelt sein, wenn er mich Andrea nennt. Ich versuche, gelassen zu wirken, mich verständnisvoll zu geben. Es gab Zeiten, da konnte ich das.
»Ist ja gut, ich hab’s kapiert. Aber warum hast du ihm so lange was gegeben, ohne ihm was abzuknöpfen?«
»Was heißt lange? Einen Monat vielleicht, anderthalb.«
»Verarsch mich nicht, Gorrión.«
»Sehe ich aus, als würde ich dich verarschen?«
Das Lächeln gerät mir etwas schief, als würde ich einer Nachbarin zulächeln, der gerade der Kanarienvogel weggestorben ist.
»Nein, Gorrión, ich weiß. Aber der Kerl kann nicht in einem Monat fünfhundert Mäuse für Koks ausgegeben haben. Da könnte er gar nicht mehr spielen. Nicht mal mehr aufrecht stehen.«
»Und wer sagt, dass er es selbst nimmt? Vielleicht nimmt er gar nichts. Na ja, ein bisschen schon, ich hab’s gesehen. Aber er kauft es nicht für sich. Er will nur was dahaben, um es Freunden anzubieten, Revuetänzerinnen. Weil der große Bernabé immer was dabeihaben muss, das er der ganzen Welt anbieten kann. Aber wen juckt das jetzt noch, Andrea? Kannst du dir vorstellen, was diese Jungs mit mir anstellen, wenn ich nicht bald zahle?«
»Klar kann ich das, Clemente. Aber das lassen wir nicht zu, oder, Bruder?«
»Und wer soll sie daran hindern? Du vielleicht?«
»Wer weiß.«
Sage ich, ohne groß nachzudenken, atme tief durch und schweige ein paar Sekunden. Der Laden beginnt, sich mit Büroangestellten zu füllen, die vor der Arbeit noch schnell einen Milchkaffee oder eine heiße Milch mit Schokolade bestellen. Es muss schon halb acht, acht sein. Ich kann ein Gähnen nicht unterdrücken, dann lächle ich. Ayala fragt, was das verdammt noch mal soll.
»Nichts, nur ein dummer Gedanke. Ich dachte bloß, ein paar Gramm von dem Stoff, um den dich dieser feine Herr beschissen hat, würden mir jetzt auch ganz guttun. Aber keine Sorge, Gorri. Ich wette mit dir um einen Fuffi, dass du dein Geld bald wieder hast.«
»Red keinen Scheiß, Mann. Wie kannst du immer noch wetten, nach allem, was dir passiert ist?«
»Das Spielen war das geringste Problem, das weißt du. Die Tussi hat mich verlassen, weil ich meine Arbeit los war.«
»Ich wollte ja nie fragen, warum dich dieser Fatzke rausgeschmissen hat, Andrés. Aber hast du in die Kasse gelangt?«
»Spinnst du, Gorrión? Warum hätte ich das tun sollen? Es war alles gut, ich hab ihm die Anträge geschrieben und mein Geld gekriegt, er hat gut bezahlt, und manchmal gab’s einen kleinen Zuschlag von einem Kunden, Geld oder Naturalien. Warum also hätte ich das tun sollen, Gorrión? Ich bin vielleicht bescheuert, aber so bescheuert nun auch wieder nicht.«
»Und warum hat er dich dann rausgeschmissen?«
»Warum sitzen Millionen arme Teufel auf der Straße, Bruder? Weil alles den Bach runtergeht, weil dieses Land im Arsch ist. Was weiß ich. Weil man uns beschissen hat wie die letzten Deppen.«
»Ganz ruhig, Pibe, reg dich ab. Und wegen dem Mädchen, vergiss es. Wie heißt es so schön in dem Tango: Sie ist fort, was soll’s, nur Geduld und etwas Brot. Vielleicht ist es ja wirklich halb so schlimm. Im Grunde hat sie dir einen Gefallen getan: Sie hat dich in Ruhe gelassen, jetzt kannst du tun und lassen, was du willst.«
»Ich bin ruhig, Gorrión, keine Sorge. Die Frau kann mir gestohlen bleiben. Was mich fertig macht, ist die Kleine nicht zu sehen.«
»Da kann ich dir auch nicht helfen. Aber du wirst sehen, am Ende ist Blut dicker als Wasser.«
Sagt Ayala und zwinkert mir zu, sodass sich sein Gesicht zu einer Grimasse verzieht. Ich sage ja, und dass ich mit ihm um die fünfzig Mäuse wette. Es klingt gezwungen, als wollte ich nicht ihn, sondern mich selbst überzeugen:
»Ich wette mit dir um die fünfzig Mäuse, Gorrión. Ich regle das für dich, und du wirst sie mir mit Freuden zahlen. Vertrau mir.«
»Dir, Bruder?«
»Ja, mir, verdammte Scheiße.«
Wieder dieser Lärm, dieses Kreischen einer Maus, die von einem Tiger vergewaltigt wird. Es bringt nichts, mir das Kissen auf den Kopf zu pressen – das Kreischen bohrt sich weiter in meine Ohren. Einen Moment überlege ich ernsthaft – so ernsthaft, wie man in meinem Zustand überlegen kann –, den kleinen Franzosen kaltzumachen. Oder seine Mutter, der arme Junge hätte bestimmt nie freiwillig Geige gelernt, daran ist nur diese Idiotin schuld, die einen Versager aus ihm machen will, bevor er zehn ist. Aber wieso ist so ein Radau um diese Uhrzeit überhaupt erlaubt? Ich muss dringend ein ernstes Wörtchen mit Doña Norma reden – entweder sie sorgt für Ordnung, oder ich ziehe aus. Aber vielleicht sollte ich besser mit was anderem drohen, etwas, das ihr wirklich Angst einjagt. Und das Licht, das durchs Fenster fällt, nervt mich auch. Es sticht mir in die Augen, aber das Schlimmste ist, dass es mir offenbar sagen will, dass es nicht mehr ganz so früh ist. Egal, ich denke gar nicht daran aufzustehen. Wozu auch?
»Ruhe, verdammt!«
Höre ich mich plötzlich brüllen. Das Kreischen hält an. Und dann diese Hitze und das feuchte Laken und die letzte Nacht, die langsam wieder Konturen annimmt. Warum zum Teufel habe ich Ayala bloß gesagt, ich würde die Sache mit dem Fußballer für ihn regeln? Ich weiß ja nicht mal, wie ich heute Abend was zu essen kriegen soll. Ich wälze mich herum, es ist zwecklos, ich werde nicht mehr einschlafen. Schweißgebadet quäle ich mich aus dem Bett, stelle fest, dass mein Kopf mindestens eine Tonne wiegt, schleppe mich zum Tischchen mit der Waschschüssel und dem Krug, schütte mir über den Kopf, was an Wasser übrig ist. Offenbar war das Glas Milch am frühen Morgen nicht genug, genauso wenig wie der Schlaf. Der Wecker auf dem Nachttisch, eine Erinnerung an andere Zeiten, zeigt an, dass es fast sieben ist, bald wird es dunkel. Ich muss los, bevor es Nacht wird.
»… ich misstraue der Liebe und traue dem Spiel, wo man mich einlädt, wird’s mir nie zu viel …«
Ich singe falsch wie ein Hund, ich weiß, aber ein wenig Musik in der Einsamkeit des Zimmers heitert mich auf. Und es übertönt – beinahe – das Kreischen der misshandelten Geige im Zimmer nebenan.
»… und bleib auch, wo ich überflüssig bin. Gehör zur Partei von allen, und mit allen …«
Man kann sagen, was man will, aber Gardel läuft dieser Schwuchtel Corsini allmählich den Rang ab. Sobald ich kann, schaue ich mir Lichter von Buenos Aires noch mal an, solange er noch läuft. Vielleicht sollte ich mir doch ein Radio zulegen, geht es mir durch den Kopf – einer dieser typischen Gedanken, wenn man einen Kater hat, wenn man am Ende ist. Ein Radio ist was für Leute, die das Handtuch geworfen haben, einsame Hausfrauen, alte Ehepaare. Stattdessen hätte ich lieber ein Grammofon, um die Musik zu hören, die ich mag, aber so was kostet, jedenfalls mehr als ich habe. Fünf Mäuse pro Platte, die spinnen. Ich hab die Schnauze voll von dieser Pechsträhne, die seit Monaten anhält. Und dann diese Spiegel, überall Spiegel. Wie der an meiner Wand, über der Waschschüssel, und darin ich, ein Schreckgespenst zur Geisterstunde. Augenringe, dunkle Bartstoppeln, durchscheinende Knochen. Wenigstens habe ich noch alle Zähne. Sobald die ersten schwarzen Lücken da sind, oder schlimmer noch, der goldene Glanz der Kronen, ist es an der Zeit, meinen zweiten Selbstmord zu planen.
»… mag weder altes Pflaster noch liegt mir das Moderne; und bin ich krank, dann schlaf ich auch sehr gerne …«
Ich schärfe das Rasiermesser an dem Lederriemen. Ich würde töten, um mir den Bart bei einem Barbier im Viertel rasieren lassen zu können, eine hübsche Massage, aber es ist nicht der Moment, um große Brötchen zu backen, nicht mal klitzekleine, sagt mein Portemonnaie – und man lässt mich nicht mal mehr anschreiben. Seufzend nehme ich den Pinsel, schlage den Schaum mit der gelben Gran-Federal-Seife, die nach sauberen armen Leuten riecht. Mit der linken Hand fasse ich den unteren Teil meines Halses, erinnere mich an die Rasurlektionen meines Alten, verziehe das Gesicht zu einer Clowngrimasse, um die Haut zu straffen, recke das Kinn vor und schabe mit dem Messer in der rechten Hand hartnäckig über meine Kinnpartie. Ich singe nicht mehr.
Als ich fertig bin, wasche ich mir das Gesicht mit dem schmutzigen Wasser aus der Schüssel und trockne mich mit einem früher einmal weißen Handtuch ab. Auch für ein trockenes Handtuch, eins ohne muffigen Geruch, würde ich töten – ich würde für alles Mögliche töten, wenn ich nur wüsste, wen. Anschließend wickle ich mir das Handtuch um die Hüften, schlüpfe in die Pantoffeln, trete in den Flur und schlurfe zum Bad. Höchstwahrscheinlich habe ich es um diese Uhrzeit für mich allein. Während ich den Flur entlanggehe und für alle Fälle mein Handtuch festhalte, versuche ich mich zu erinnern oder zu begreifen, wie ich auf die Idee kommen konnte, ich wäre in der Lage, Gorrión aus der Patsche zu helfen. Irgendwo zwischen Los 36 Billares, Avenida de Mayo und La Martona muss mir was eingefallen sein.
Es ist merkwürdig, wenn ein Gedanke zurückkehrt: Manche kommen wie Bomben, explodieren, und alles liegt da, andere sind wie scheue Ratten, zeigen erst die Schnauze, dann den Schwanz, man muss sie allmählich erahnen. Dieser ist eher rattenhaft, aber am Ende gelingt es mir, ihn wieder hervorzuziehen. Natürlich kann ich ihm helfen – und nebenbei etwas Geld machen. Das ist der Punkt: Geld machen.
Es dämmert, als ich endlich das Tortoni betrete – mein weißes Hemd, mein eleganter Boater mit dem roten Band, mein zuversichtliches Lächeln. Was soll bloß aus mir werden, wenn mir eines Tages dieses Lächeln nicht mehr gelingt?
»Guten Abend, Manolo.«
»Nabend, Rivarola. Dein Freund sitzt da hinten.«
Das Gran Café Tortoni ist eine andere Welt: die einer fast schon vornehmen Bohème. Es genügt, auf die Herrentoilette zu gehen, gleich hinter dem Tresen mit der Registrierkasse und ihren funkelnden Tasten, beim Öffnen des Reißverschlusses einen Blick auf die bronzenen Rohre an den Urinalen zu werfen, um sich daran zu erinnern, dass das Tortoni diesen Anspruch hat, den manche immer noch als Klasse bezeichnen.
»Du bist ein Trottel, Rivarola. Die einzige Klasse hier ist die Arbeiterklasse. Selbst Renegaten wie du werden das eines Tages kapieren … Wenn wir euch nicht vorher an der nächsten Laterne aufgeknüpft haben.«
Sagt Jordi Señorans und zwinkert mir grinsend zu. Señorans ist so blond wie die Blonden, die nicht blond sind – mit einer Farbe auf dem Kopf, die nach gar nichts aussieht. Außerdem hat er ein rundes Milchgesicht, einen Schnurrbart, der so spärlich wächst, dass er den heiligen Namen nicht verdient, ein vielversprechendes Doppelkinn.
»Apropos Laternen, wusstest du, dass sie Yrigoyen wieder verhaftet haben?«
»Na ja, verhaftet … Hausarrest, oder?«
»Ja, Riva, aber das ist ein großer Mann. Armes Gürteltier, armer Don Hipólito, wer hätte das gedacht. Vor nicht mal drei Jahren war er noch Präsident, und jetzt das …«
»Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet du ihn mal verteidigst, Katalane.«
Sage ich, und Señorans verstrickt sich in eine viel zu lange Erklärung, versucht, zu rechtfertigen, warum er und seine Partei Yrigoyen während dessen gesamter Regierungszeit unermüdlich attackiert haben und ihn jetzt plötzlich verteidigen. Ich warte am Ausgang der Rechtfertigung auf ihn:
»Aber bei deiner Zeitung hat sich nichts geändert, die drischt weiter auf ihn ein.«
»Das ist nicht meine Zeitung, Junge. Das ist die Zeitung von Señor Botana, diesem kolossalen Hurensohn. Ich bin nur ein …«
»Söldner?«
»Ein Spion, könnte man sagen, ein Maulwurf des Klassenkampfes …«
»… der für den Feind schreibt.«
Wir brechen in Gelächter aus und senken dann die Stimme, um uns über die jüngsten Gerüchte auszutauschen: dass die Radikalen hier und da Aufstände planen, dass die Polizei vor drei Tagen in Corrientes mehr als hundert Menschen verhaftet hat, dass in Córdoba bestimmt was passieren wird, vielleicht auch in Rosario. Señorans ist einer dieser Journalisten, die so tun, als hätte alles Wichtige mit ihnen selbst zu tun, als wüsste keiner mehr als sie, als wären sie der Mittelpunkt des Mittelpunkts. Manchmal beneide ich sie, manchmal verachte ich sie.
»Man hat mir erzählt, die Oligarchen machen sich vor Angst schon in die Hose.«
»Ja, nichts als Panik, ich hab’s gesehen. Die rennen zitternd durch die Straßen.«
»Wann wachst du endlich auf, Rivarola?«
»Sobald du mir ein Schlaflied singst. Apropos singen: Hast du schon gehört, wie Gardel die ›Milonga del 900‹ singt?«
»Sag nicht, du fällst auf diesen Lackaffen rein? Das reinste Theater, Riva, nichts als Fassade, bemaltes Pappmaché. Der Typ geht nach Paris, um ein paar Filmchen zu drehen, als wäre er hier, ein paar Gauchos mit Hüten, exotische Pampa für Franzosen, alles heiße Luft. Nichts, ein Geck, der sich hinter seinen Filmen versteckt, weil er nicht singen kann. Der arme Junge hat sich für ein paar Pesos verkauft, und jetzt ist er falscher als Dulce de leche aus Polen.«
»Apropos süß und aus Polen …«
»Leck mich, Rivarola.«
Manchmal weiß ich nicht, ob Señorans es wirklich ernst meint oder ob er mich nur verarscht. Das ist so ein Moment. Aber es ist mir egal – und der Katalane hat es nicht anders verdient. Warum muss er auch so einen Mist über Gardel erzählen?
»Hast du sie mal gesehen in letzter Zeit?«
»Warum sollte ich …?«
Señorans’ Ton ist leiser geworden, fast gepresst. Vielleicht war es keine gute Idee, die Russin zu erwähnen. Stille tritt ein. In der Stille verbirgt sich ein Schatten mit fast roten Haaren, grünlichen Augen, Sommersprossen. In der Stille verbirgt sich eine Geschichte, an die ich mich kaum und an die er sich viel zu gut erinnert. In der Stille verbergen sich Drohungen.
»Noch einen Wermut, Rivarola?«
»Geht der auf dich?«
»Weil heute mein Tag ist. Ich hab da ein kleines Ding am Laufen …«
Sagt Señorans, und mehr sagt er nicht. Ich warte, fordere ihn mit Blicken auf, aber er fährt nicht fort. Er hat schon immer gern geheimnisvoll getan, gezeigt, wer Herr über Zeit und Themen ist. Und er hat schon immer gern geklungen wie einer von hier, wie ein echter porteño. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es nicht ganz klappt und er deshalb nicht beendet, was er sagen will.
»Und? Verrätst du mir auch, worum es bei diesem kleinen Ding geht?«
»Nein, che, kann ich nicht. Nicht jetzt. Wart’s ab, ich werd’s dir schon erzählen, ein Sechser im Lotto. Das große Los.«
Señorans hat zwanzig von seinen vierzig und noch was Jahren in Argentinien verbracht, aber immer noch einen katalanischen Akzent, der klingt wie ein Witz. Wie die meisten Bewohner dieser Stadt ist er immer noch ein Fremder. Oder anders gesagt: jemand, der gelernt hat, an einem fremden Ort in einer fremden Sprache zu sprechen.
»Und du?«
»Und ich was?«
»Hast du was gefunden?«
»Nein, Katalane, wie soll ich denn was finden, die Krise …«
»Ja, ja, die Krise. Zum Glück gibt es die Krise. Wohinter würdest du dich sonst verstecken, Pibe.«
Sagt er zum hundertsten Mal, und er muss mein Gesicht sehen, denn er sagt, dass er es nicht noch mal sagt, dass es das letzte Mal ist: dass ich Journalist werden soll.
»Ich helf dir, was zu finden. Ich kann dir was besorgen, che, in drei Tagen hast du einen neuen Job.«
»Danke, Katalane, aber ich bin kein Journalist. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Ich bin kein Journalist. Ich hab keine Ahnung davon.«
»Glaubst du, ich etwa? Journalist sein ist das reinste Kinderspiel. Das ist keine Wissenschaft. Du hörst von irgendwas und schreibst darüber, auf Spanisch oder irgendeiner Sprache, die so ähnlich klingt. Mehr ist es nicht, Andrés. In drei Tagen arbeitest du wie ein feiner Herr.«
»Wäre eine anständige Arbeit nicht besser?«
Wir lachen, aber ich weiß, dass es bei mir vor allem an der Angst liegt: Vielleicht hat der Katalane ja recht. Vielleicht aber auch nicht, und ich will nichts anfangen, das wieder zu nichts führt. Ich will nicht wieder scheitern, das würde ich nicht verkraften.
»Das wäre nicht gut für dich, Jordi. Wer besorgt dir dann die Geschichten, wenn ich Journalist bin?«
»Du meinst, wer sie für mich erfindet?«
Am Nebentisch sehen zwei Frauen – etwas über dreißig, glattes, halblanges Haar, das Rot der Lippen zu rot – zu uns herüber und lachen. Señorans sieht sie an, ich sehe ihn an, Señorans verneint mit einem Blick. Dann fragt er, ob ich wirklich etwas Interessantes für ihn habe, und ich frage, ob ich ihn jemals enttäuscht hätte, und er, mehr als einmal, und ich, er soll mir nicht auf den Sack gehen.
»Los, Riva, mach schon, red nicht länger um den heißen Brei herum.«
Ich lasse ihn noch etwas schmoren – einen Moment lang habe ich die Macht. Ich schlucke den roten Rest des Cinzano hinunter, schnalze mit der Zunge, starre ins Leere, lächle der am nächsten zu mir sitzenden Halblanghaarigen zu. Als mir nichts mehr einfällt, liefere ich:
»Du weißt, wer Bernabé Ferreyra ist.«
»Rivarola, ich bin zwar Katalane, aber nicht komplett bescheuert.«
»Dann weißt du auch, dass er sich nach Junín verdrückt hat, dass er abgehauen ist.«
»Ich lese Zeitung. Sogar meine eigene. Nenn es Berufskrankheit. Und manchmal schreibe ich sogar für diese Zeitungen.«
»Das merkt man, Katalane. Gut, was du nicht weißt, ist, dass der Junge hier einen ziemlichen Schlamassel hinterlassen hat.«
»Was für einen Schlamassel? Noch so eine Weibergeschichte?«
»Nein. Oder weiß ich nicht, das ist nicht mein Bier. Er hat einen Haufen Schulden hinterlassen.«
»Bei der Kohle, die er verdient?«
»Bei der Kohle, die er ausgibt. Und zwar für Koks. Das ist die Geschichte. Interessiert? Ich kenn den Kerl, der es ihm verkauft, ich kann’s dir in allen Einzelheiten erzählen.«
Señorans blickt mich spöttisch an, von oben herab. Ich werde nervös, habe den Eindruck, er weiß Bescheid und macht sich über mich lustig.
»So, so, Bernabé nimmt also Drogen.«
»Ja, Katalane, als wäre er Rudolph Valentino.«
»Und das hast du erst jetzt mitgekriegt, Rivarola? Das weiß doch jeder.«
»Was soll das heißen, jeder? In der Zeitung stand nichts davon.«
»Ich habe gesagt, dass jeder davon weiß, nicht, dass alle darüber schreiben. Keiner schreibt darüber. Die einen nicht, weil sie von ihm leben, die anderen, weil sie Angst vor ihm haben. Also schreibt keiner darüber. Außerdem, hast du eine Ahnung, wozu diese Regierung fähig ist, wenn du so was veröffentlichst?«
»Die Regierung? Was hat denn die Regierung damit zu tun? Erzähl mir bitte nicht, dass die Regierung jetzt auch noch schuld daran ist, wenn Bernabé Ferreyra Drogen nimmt. Ihr wisst wirklich nicht, was ihr noch erfinden sollt …«
Ich versuche der anderen, der Erfahreneren, zuzulächeln. Die Frau schaut weg wie jemand, den man ertappt hat.
»Reg dich ab, Rivarola. Ich will damit nur sagen, dass die Regierung die jungen Leute bei Laune halten muss. Wenn du ihnen die Luft aus dem Ball lässt, können sie schnell sauer werden.«
»Das sagt der alte Marx über Fußball? Sei nicht albern, Katalane. Du siehst schon überall Gespenster.«
»Über meine Gespenster diskutieren wir ein andermal. Oder über deine, wenn dir das lieber ist. Leider muss ich dir trotzdem sagen, dass die Geschichte nichts taugt. Aber keine Sorge, Rivarola, die Wermuts gehen auf mich. Und komm wieder, wenn du wirklich frisches Fleisch hast.«
Das hat gesessen, ich steh da wie ein Trottel. Um irgendwas zu sagen, frage ich, was für Fleisch er denn gerne hätte – ganz der aufmerksame Kellner, was wünschen der Herr. Was über Gouverneur Fresco, sagt Señorans, was über Rocas Sohn, was über Tita Merello, ja sogar was über Gardel, aber ich soll ihm nicht länger mit vergammeltem Fisch die Zeit stehlen.
»Bernabé Ferreyra!«
Sagt er seufzend. Ich setze mein schönstes Geprügelter-Hund-Gesicht auf. Was mir nicht schwerfällt – ich fühle mich wie ein geprügelter Hund.
»Ich dachte, die Geschichte taugt was. Und ich hab die Kohle gebraucht, Katalane, ich brauche sie.«
Señorans zieht ein Päckchen Particulares hervor, hält mir eine Zigarette hin, steckt sich auch eine an. Er denkt nach. Vielleicht Cuitiño, sagt er plötzlich.
»Was sagst du, Katalane?«
»Ich sage, vielleicht Cuitiño, dass Cuitiño vielleicht Interesse hat.«
Er erklärt es mir: Manuel Cuitiño ist ein hohes Tier bei River Plate, so was wie der Stellvertreter von Américo Liberti. Die beiden und ihre Kollegen versuchen verzweifelt, den Flüchtigen zurückzuholen, und vielleicht nützen ihnen ja ein paar zuverlässige Informationen, mit denen sie ihn unter Druck setzen können, so was wie, wenn du morgen nicht zurückkommst, erzähle ich das und das der ganzen Welt.
»Aber hast du nicht gesagt, keiner würde das veröffentlichen?«
»Ja, aber das weiß ja Bernabé nicht. Wenn es konkrete Hinweise gibt, Namen, Adressen, könnte der Typ es mit der Angst bekommen und akzeptieren, was man ihm anbietet.«
»Verstehe, Katalane. Und wo finde ich diesen Cuitiño?«
Señorans schaut auf seine Uhr – quadratisch, klein, die Uhr eines eitlen Marxisten – und sagt, heute nicht, heute sei es schon zu spät, aber morgen früh sei er bestimmt im Schlachthof.
»Wo?«
»Da, wo dein Steak herkommt, Pibe, im städtischen Schlachthof in der Avenida de los Corrales. Cuitiño ist Großhändler, kauft und verkauft Rinder. Da findest du ihn, jeden Morgen. Der Typ kennt mich, du kannst dich auf mich berufen.«
Ich war noch nie im Schlachthof – hatte es auch nie vor. Fleisch, das wild durcheinandergewürfelt in einem Tier steckt, eingeschlossen in einen Ledersack, kommt mir obszön vor. Ich hole tief Luft, bedaure mein Schicksal. Ich schaue zum Himmel auf, sehe aber nur die verzierte Decke und die Kronleuchter des Tortoni.
»Und was kann ich bei diesem Cuitiño rausholen?«
»Keine Ahnung, Rivarola. Ist das nicht dein Fachgebiet?«
Ich versuche, ihn anzusehen, als würde ich ihm verzeihen – aber ich weiß gar nicht, was ich ihm verzeihen soll. Es ist längst Nacht, und den vergammelten Fisch bin ich nicht losgeworden. Wenn ich noch was essen will, bleiben mir zwei Möglichkeiten: Entweder ich bestelle mir eine Mozzarella-Pizza und zwei Gläser Muskateller bei Las Cuartetas, alles zusammen für dreißig Mäuse, oder ich mache mich auf den Weg zu meiner Alten.
»Mutter, bist du da?«
Ich hatte die halbe Nacht vor mir – bis vier musste ich mir die Zeit vertreiben, sie vertrödeln. Fünf, halb sechs, wenn es hell wurde, das sei die beste Zeit, um Cuitiño zu treffen, hatte Señorans gesagt. Die Fahrt zum Schlachthof würde eine Stunde dauern. Ich hatte weder Geld noch Kraft, um eine weitere Nacht mit Saufen, Billard oder leerem Geschwätz zu verbringen. Zuerst hatte ich überlegt, die Russin zu suchen, in der Confitería Ideal, im Richmond oder im Theater der Sociedad Hebraica, aber wenn ich sie gefunden hätte, wäre es bestimmt noch schlimmer gewesen. Dann dachte ich an einen schönen Teller Eintopf, oder, wer weiß, ein paar Nudeln mit dieser fantastischen Tomatensoße.
»Mach auf, Mutter!«
»Ich komm ja schon, mein Junge, ich komm ja schon.«
Hier zu stehen, ist harter Stoff: vor der Tür meines Hauses, vor dem Haus meiner Kindheit. Der Gehweg ist gefliest, doch die Fliesen sind fast alle kaputt. Die Straße ist inzwischen gepflastert. Gegenüber steht eine Laterne, die alles in gelbes Licht taucht. Die Tür ist aus Holz, weiß gestrichen, die bronzenen Beschläge haben mit den Jahren etwas an Glanz verloren.
»Mein Junge, was für eine Überraschung.«
Meine Alte, Señora Gaetana Pollini, Witwe von Rivarola, trägt ein schwarzes Kleid, das aussieht, als wäre es immer dasselbe, und wahrscheinlich ist es das auch, hat weißes Haar, ein Gesicht, das nur aus Runzeln und Falten zu bestehen scheint, und trübe, sehr blaue Augen. Sie ist winzig, wird immer winziger – jedes Mal vergesse ich es, jedes Mal erinnere ich mich wieder. Als sie mich umarmt, reicht ihr Gesicht gerade einmal bis zu meinem Bauchnabel. Aber sie mag es nicht, wenn ich mich zu ihr hinunterbeuge.
»Wie geht’s dir, Mama?«
»Wie soll es mir schon gehen, Junge? Eine Vogelscheuche bin ich und todmüde. Das Haus ist zu groß für mich, zu viel Arbeit. Und dann noch dein Bruder, der mir seine Kinder dagelassen hat, als wäre das hier ein Tierheim und …«
Ich kenne die Leier, es ist immer die gleiche. Ich seufze und frage mich – wie jedes Mal –, ob es nicht ein Fehler war, hierherzukommen. Doch meine Mutter beweist mir, dass es keiner war:
»Du musst hungrig sein, wenn du dich hier blicken lässt, mein Junge. In der Küche ist noch ein Rest Schmorbraten.«
»Aber nur, wenn es keine Mühe macht …«
»Tu nicht so, mein Junge.«
»Du hast recht, ich hör auf damit.«
Sage ich lächelnd. Wir gehen hinein: zuerst der lange Innenhof, rote Fliesen, wuchernde Pflanzen; rechts, unter einem Vordach, die Türen zu den Zimmern, und hinten die Küche.
»Komm, leiste mir ein bisschen Gesellschaft, während ich das Essen aufwärme.«
Die Küche wird von derselben Glühbirne erhellt, die von der nackten Decke über demselben Tisch baumelt; darauf dieselbe Wachstuchdecke mit denselben rot-weißen Rechtecken, drum herum dieselben vier Stühle. Auf der einen Seite der schlichte, gusseiserne Kohleherd. Ihm gegenüber, auf einem Bord, das angeschaltete Radio. Meine Mutter bückt sich, um mit einem Holzspan und Zeitungspapier die Kohle anzuzünden. Anschließend stellt sie die Kasserolle auf den Herd und rührt um.