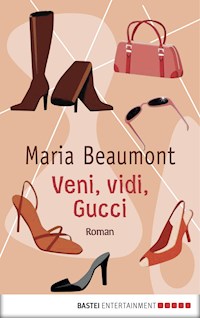
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie kam, sah und siegte: Fran hat ein einzigartiges Talent, Stimmen zu imitieren. Als Synchronsprecherin machte sie Karriere und fand die große Liebe. Jetzt imitiert sie Stimmen zur Freude ihrer beiden Kinder - nur was sie selbst bewegt, hat sie verlernt zu sagen. Und es kommt noch schlimmer: Fran entdeckt, dass ihr Gatte eine Affäre mit der Marketingleiterin von Gucci hat. Wenn sie nicht zukünftig als Desperate Housewife Karriere machen möchte, sollte sie vielleicht häufiger ihrem Mann tief in die Augen schauen als den Boden ihres Weinglases zu betrachten. Point of no return? Mitnichten. Nach ein paar Umdrehungen zu viel schafft es Fran, ihr Leben in den Griff zu kriegen und die Konkurrenz liebevoll in die Tasche zu stecken...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2007 by Maria Beaumont
Die englische Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel
Motherland bei Hodder & Stoughton,
a division of Hodder Headline, London
© für die deutschsprachige Ausgabe: 2007 by
Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Bianca Sebastian
Titelillustration: © getty-images/Greg Paprocki
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-0034-2
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Dieses Buch ist allen Müttern gewidmet,
Wenn wir jung sind – und zwar sehr jung, so zwei oder drei Jahre alt –, hat unser Aussehen keine Bedeutung. Aber dann kommt die Eitelkeit und wird mit jedem Jahr größer, bis wir das Teenageralter erreichen und das Aussehen zur wichtigsten Sache der Welt wird. Dieser Geisteszustand wird übrigens von denselben Hormonen gesteuert, die unsere Gesichter mit Akne verunstalten, was man erst als Weltuntergang empfindet, später einfach nur als unnötig grausam.
Mit der Zeit lässt die Sorge um das Aussehen wieder nach – genau wie die Pickel –, und andere Dinge werden wichtiger, bis das Aussehen nur noch an neunzehnter oder zwanzigster Stelle in der Prioritätenliste steht, über »Zahnarzt anrufen«, aber weit unter »Waschmittel kaufen«.
21
Ich bin so sehr in Gedanken versunken, dass ich, als ich das Gesicht der Frau wahrnehme, im ersten Moment Mitleid verspüre. Als mir gleich darauf klar wird, dass ich gerade mein eigenes Spiegelbild sehe, weicht das Mitleid purem, nacktem Entsetzen.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich gehöre nicht einer Gemeinschaft wie den Amish People an, bei denen alles, worin man sich spiegeln kann, verboten ist. Ich weiß, wie ich aussehe; es ist nur so, dass ich es nicht glauben kann. Mein Spiegelbild hat mich eiskalt erwischt, und ich bin fassungslos. Die nach unten zeigenden Mundwinkel, die bläulich grauen Tränensäcke, der Ansatz eines Doppelkinns, die Haare … vor allem die Haare! Ich ziehe meine Mütze tiefer ins Gesicht, um die spröden Borsten, die zornig hervorragen, zu verdecken. Ich richte gerade meinen Kragen, der halb nach oben und halb nach unten geklappt ist, als mich eine Stimme zusammenfahren lässt.
»Ich sagte, Verzeihung«, bemerkt ein junger Mann – der noch ein Schuljunge sein könnte – offenbar nicht zum ersten Mal. Mir wird bewusst, dass ich mitten vor einem Ladeneingang stehe. »Alles in Ordnung?«, fragt er. Er trägt ein Namensschild. Ich nehme an, er arbeitet in diesem Geschäft. »Es ist nur so, dass Sie schon eine ganze Weile hier stehen und auf unser Schild starren.«
»Ach so, ja, sorry«, murmle ich, ohne zu wissen, wofür ich mich entschuldige und wovon er redet.
Dann sehe ich es. Hinter meinem Spiegelbild in der Schaufensterscheibe hängt ein Schild mit der Aufschrift »Räumungsverkauf«. In der Auslage liegen Sportschuhe. Allerdings verkaufen die hier keine richtigen Sportschuhe, sondern farbenfrohe Parodien mit mangelhaftem Knöchelschutz und Plateauabsätzen der Siebziger. Zum Totlachen. Weshalb soll ich darüber traurig sein, dass ein Laden schließt, der Pseudo-Turnschuhe mit Glitzersteinen und Schnürsenkeln in allen Regenbogenfarben verkauft? Ganz richtig, genau meine Meinung.
Erst letzte Woche habe ich wie eine Besessene den Schuhschrank ausgemistet und sämtliche Modeturnschuhe weggeworfen. Fünf Paar, zehn Schuhe. Danach fühlte ich mich wesentlich besser. Ich habe das getan, weil ich es wollte, und nicht, weil ein Kind in der Schule neulich genau solche Turnschuhe anhatte, wie ich sie auch besaß, und eine der anderen Mütter bemerkte, dass die »Schuhmode für Teenies« immer alberner werde.
»Übrigens, Ihre Mütze.« Der junge Verkäufer sieht mich immer noch an. »Limited Edition, nicht wahr? Für so eine würde meine Schwester glatt unsere Oma umbringen. Wo haben Sie die her?«
»Von Selfridges«, antworte ich und ziehe unbewusst den Schirm meiner strassbesetzten Missy-Elliott-Mütze tiefer ins Gesicht, um meine Lüge zu verbergen.
»Sie machen einen Witz, nicht? Die Kollektion war doch sofort ausverkauft. Haben Sie vielleicht besondere Connections oder so?«
Gestatten, Fran Clark, Muse von Missy Elliott. Es ist nur wenigen bekannt, dass Missy (wie ihre engsten Freunde sie nennen) das Design der exklusiven, mit Strass verzierten Baseballmütze anhand eines Modells von Frans Kopf entworfen hat.
Wohl kaum.
Die Wahrheit ist, dass mein Mann sich die Mütze unter den Nagel gerissen hat, um sie mir zu schenken (wie auch meine ganzen »Turnschuhe«, die ich weggeschmissen habe). Er arbeitet nämlich für eine Marketingfirma, zu deren Kunden Adidas zählt – deren Werbepartnerin Missy Elliott ist. Schon paradox, dass ein Designerstück aus einer limitierten Sonderkollektion, das für – und zwar ausschließlich für – modebewusste Teens entworfen wurde, auf dem Kopf einer nicht mehr ganz so jungen Mutter landet. Meine unverdienten Privilegien waren mir auf einmal peinlich. Die Schwester dieses Jungen würde bereitwillig eine enge Verwandte umbringen für ein modisches Accessoire, um das ich nie gebeten hatte und das ich – wie Trinny und Susannah immer hämisch bemerken – definitiv nicht tragen sollte.
Einen Moment lang überlege ich, ob ich sagen soll, dass ich tatsächlich über die richtigen »Connections« (Modedealer, nicht Drogendealer) verfüge, lasse es dann aber. Ich murmle schließlich: »Nein, ich hatte wohl Glück, schätze ich.«
Der Junge grinst mich an und zeigt mir seine Zahnspange. Wie alt mag er sein? »Und Sie sind sicher, dass alles in Ordnung ist?«, fragt er. »Sie wirken nämlich ein bisschen, na ja, verloren.«
Ich sehe ihn an, und er wirkt so niedlich und verletzlich, dass mir die Ungerechtigkeit dieser Welt mit einem Mal bitter aufstößt. Er trägt eine Zahnspange, und in Kürze – wahrscheinlich sobald das letzte Paar Schuhe zum Schleuderpreis verramscht wurde – wird er arbeitslos sein.
»Hier, nehmen Sie.« Ich nehme die Mütze ab, ohne mich um meine Frisur zu kümmern. »Geben Sie sie Ihrer Schwester.«
»Sie verarschen mich, oder?«
»Nein, im Ernst. Außerdem bin ich dafür schon zu alt.«
Ich schenke ihm ein Lady-Di-Lächeln mit gesenktem Blick und leicht schräger Kopfhaltung und warte darauf, dass er sich wie ein Kavalier verhält.
»Aber so eine Mütze können auch ältere Frauen tragen. Missy Elliott ist ja selbst das beste Beispiel dafür.«
Während er lacht, denke ich kurz über seine Bemerkung nach. In der Tat, er hat mich soeben eine ältere Frau genannt. Wer auch immer gesagt hat, dass die Jugend von den Jugendlichen vergeudet wird, war höchstwahrscheinlich schon älter. Bis dieser Knabe hier weiß, wie man »Kavalier« buchstabiert, wird er seine hingeworfene Bemerkung, die der »älteren Frau« einen schlimmen Stich versetzt hat, längst vergessen haben. Mit einem Mal komme ich mir total dämlich vor und möchte nur noch rasch verschwinden. Ich drücke dem Jungen die Mütze in die Hand.
»Aber Sie können sie mir doch nicht einfach schenken«, sagt er und streicht ehrfürchtig über den schwarzen Filz, als würde er die Hiphop-Queen höchstpersönlich streicheln.
»Betrachten Sie es einfach als ein Geschenk von einer Fremden«, sage ich in meiner besten Marlene-DietrichImitation. Fragen Sie nicht, warum. Es schien mir an dieser Stelle passend. Danach drehe ich mich um und trete wieder aus seinem Leben.
Eigentlich habe ich zu tun, und vor einem Schaufenster über mein Spiegelbild grübeln steht sicher nicht auf meinem Tagesprogramm. Haha, mein Tagesprogramm. Das habe ich bereits umgeworfen. Ich sollte im Moment nämlich ganz woanders sein, doch offensichtlich bin ich dort nicht. Aber es macht keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, oder? Schließlich ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Nein, am besten, ich gehe einfach weiter. Und genau das mache ich gerade. Ich entferne mich von dem Sportschuhladen und nähere mich Geschäften, in denen ich vielleicht fündig werde. Nachdem ich mein Vormittagsprogramm komplett über den Haufen geworfen habe, besteht meine einzige Hoffnung, den Tag noch zu retten, darin, wenigstens ein paar nützliche Einkäufe zu erledigen. Meine Einkaufsliste:
Geschenk für Richards SchwesterWinterjacke für MollyParty-Outfit für mich
Natürlich in dieser Reihenfolge.
Vor einer halben Stunde stand ich kurz davor, für Richards Schwester ein Geschenk zu kaufen. Mein Plan war, kurz bei Liberty hineinzuhuschen und meiner schrecklichen Schwägerin irgendwas zu kaufen, das möglichst teuer aussieht. Aber als ich vor dem Laden stand, zog mich die Carnaby Street magisch an, wie ein Staubsauger.
Der Mensch, der ich früher war, liebte die Carnaby Street – in den guten alten Zeiten. Vor zehn Jahren arbeitete Richard in einem gläsernen Büroturm gleich um die Ecke auf der Great Pultney Street. Durch meine Arbeit war ich häufig in Soho, und dann trafen wir uns immer in der Mittagspause … Wie gesagt, der Mensch, der ich früher war. Eine Frau, die unbefangen trendige Baseballcaps trug, ohne sich um die Blicke der anderen zu kümmern.
Aber diese Frau ist eine Million Meilen weit weg von der, die sich über Turnschuhe mit Plateausohlen lustig macht und sich fragt, was aus der Welt geworden ist. Während ich mich zwinge, zu Liberty zurückzugehen, wird mir bewusst, dass nicht die Welt sich verändert hat, sondern ich mich. Vor zehn Jahren habe ich viel Geld für alberne Klamotten ausgegeben, um meine Individualität auszudrücken. Damals stand das Aussehen noch an zweiter oder dritter Stelle auf meiner Prioritätenliste. »Waschmittel kaufen« tauchte übrigens noch gar nicht auf.
Nachdem ich mich einmal dazu durchgerungen habe, ist es ganz einfach, ein Geschenk für Fiona zu finden: zu Liberty gehen, ein völlig überteuertes (Fiona legt auf so etwas Wert), ledergebundenes Fotoalbum aussuchen, es als Geschenk verpacken lassen – Mission erfüllt. Mollys Jacke ist sogar noch einfacher. Ich betrete H & M in der Absicht, mir die erste pinkfarbene Plüschjacke zu schnappen, die mir ins Auge sticht. Fünf Minuten später verlasse ich den Laden wieder und gratuliere mir insgeheim dazu, dass es mir gelungen ist, eine Jacke zu finden, die sowohl plüschig als auch pinkfarben ist. Nun habe ich sogar noch Zeit, um nach einem Outfit für mich zu schauen, bevor ich die Kinder von der Schule abholen muss. Kurz darauf stehe ich vor Karen Millen – wo ich sicherlich keine modischen Geschmacksverirrungen finden werde, wie ich sie früher getragen habe, aber wenn ich schon einmal hier bin, kann ich doch auch mal nach etwas Vernünftigem Ausschau halten, oder?
Doch offensichtlich hat das keinen Zweck. Ich starre auf die unbestreitbar schöne und elegante Kleidung in der Auslage und gerate stark ins Zweifeln. An einem Model mögen solche Sachen ja gut aussehen, aber an mir?
Vielleicht sollte ich mir die Idee, ein neues Kleid zu kaufen, wieder aus dem Kopf schlagen und stattdessen irgendeinen ollen Fummel zu der Party anziehen; schließlich ist das meine Party, und den anderen kann es egal sein, wie ich herumlaufe. Aber widerspricht das nicht dem Sinn und Zweck einer Party? Eigentlich versucht man doch, sich möglichst gut in Szene zu setzen: Hey, seht mich an, ich bin zwar wieder ein Jahr älter geworden, aber sehe ich heute nicht sogar noch besser aus als vor zwanzig Jahren? Sagen Sie ehrlich, wer sieht schon besser aus als vor zwanzig Jahren?
Ich kehre Karen Millen den Rücken und gehe stattdessen in den Starbucks gleich nebenan, wo ich mir einen Riesenbecher Kaffee mit Milchschaum und Schokoladensplittern bestelle. Anschließend gehe ich wieder nach draußen, setze mich an einen kleinen Plastiktisch und koste meine kleine Trotzreaktion aus.
Richard meidet Starbucks. Er behauptet, Starbucks, McDonald’s und Gap wären die Vorboten des Armageddon. Oder er schimpft etwas weniger hysterisch über die Globalisierung, die Schuld daran ist, dass die Innenstädte veröden. Ich weiß, ich weiß, das ist wirklich ein starkes Stück von einem, der von Adidas und anderen weltweit agierenden Unternehmen bezahlt wird. Klar, in seiner Topposition kann er Starbucks verdammen. Er muss sich ja nicht einmal selbst um seinen Kaffee kümmern. Aber woher will er wissen, dass seine Assistentin ihm nicht einen Kaffee serviert, der aus einem Plastikbecher stammt? Ha! Das nenne ich Gerechtigkeit, entkoffeiniert.
Richard sollte von seinem hohen Ross heruntersteigen, denn er darf eines nicht vergessen: Vor Starbucks war es praktisch in ganz Großbritannien unmöglich, einen anständigen Kaffee zu bekommen. Und was Richards Hass auf McDonald’s betrifft, kann ich nur sagen: Wenn es das Happy Meal nicht gäbe, hätten Tausende von Müttern bereits ihre Kinder ermordet – und ihren Ehemann wahrscheinlich gleich mit. DAS HAPPY MEAL RETTET LEBEN.
Es ist äußerst sinnvoll, hier draußen zu sitzen und mich über Richard aufzuregen. So muss ich mich nicht auf die wahren Probleme konzentrieren, nämlich a) dass ich ganz offensichtlich nicht dort war, wo ich vor mehreren Stunden hätte sein sollen, und b) dass ich zudem immer noch kein Kleid für die Party habe. Jetzt reicht die Zeit nämlich gerade noch für den Kaffee und eine Zigarette. Eigentlich will ich ja mit dem Rauchen aufhören, aber vorhin in der U-Bahn-Station habe ich mir eine neue Schachtel gekauft. Der Gedanke an eine Zigarette heitert mich grundsätzlich auf, auch wenn die Zigarette selbst das nicht unbedingt tut. Ich zünde mir eine an und nehme einen langen, tiefen Zug. Ah, welch ein Luxus, eine halbe Stunde nur für mich zu haben …
Aber es macht keinen Sinn, mir Zeit zu geben, weil ich die größte Zeitverschwenderin der Welt bin, wie auch mein Nichterscheinen vor ein paar Stunden deutlich belegt – ich verschwende nicht nur meine eigene Zeit, sondern, als Folge, auch die der anderen. Ich darf mir nicht so viele Gedanken darüber machen – das Kind, der Brunnen usw. Ich forme die Lippen zu einem O und stoße einen beinahe perfekten Rauchring aus. Ältere Frau hat der Bursche vorhin gesagt? Von wegen.
Ich bin früh dran. Und zwar so früh, dass ich als Erste vor dem geschlossenen Schultor stehe. Ich überlege, ob ich mir eine anzünden soll, aber das wäre vermessen. Hier in der Gegend raucht man als Frau besser nur da, wo einen keiner sieht. Mit brennender Kippe vor dem Schultor zu stehen ist fast genauso verwerflich, wie auf einer Krebsstation zu rauchen.
Gleich darauf rollt Sureya mit einem leeren Zwillingsbuggy heran, und obwohl sie keine Kippe im Mund hat, muss ich daran denken, wie sie, als ich sie das erste Mal sah, in eine Diskussion verstrickt war, weil sie sich eine angezündet hatte. Das war auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio. Ich bin dort Mitglied geworden, um mein soziales Umfeld zu erweitern. Nach einem Jahr habe ich immerhin mit meiner Yogamatte Freundschaft geschlossen. Als ich nach einer dieser Stunden, in denen ich versuchte, meine spirituelle Seite zu entdecken (sprich: sinnlos in den Tag hineinzuträumen), das Studio verließ, sah ich auf dem Parkplatz Sureya, die selbstsicher tönte: »Ich habe sie ja nicht drinnen angezündet, sondern erst hier draußen. Was zum Teufel ist Ihr Problem?«
Eine Frau in einem teuren Sportanzug von Ellesse brüllte zurück: »Sie standen mit brennender Zigarette im Eingangsbereich, und Sie haben mir Ihren Rauch direkt ins Gesicht geblasen. Die Hausordnung besagt ausdrücklich –«
»Wissen Sie was? Lecken Sie mich am Arsch.«
»Wie bitte?«
»Sie haben mich richtig verstanden. Für so was habe ich keine Zeit. Ich muss mich jetzt um einen Drogendeal kümmern.«
Dann wandten beide die Köpfe zu mir, weil ich laut lachen musste – sie konnten mich hören, obwohl ich knapp fünfzig Meter entfernt stand. Die Ellesse-Schnepfe stapfte daraufhin wieder zurück ins Studio, wahrscheinlich um ihre Wut abzureagieren und die Folgen des Passivrauchens aus ihrem Körper zu eliminieren. Ich ging zu meinem Wagen, der praktischerweise direkt neben dem von Sureya stand.
»Sorry, es geht mich zwar nichts an«, sagte ich, »aber das war richtig so. Wenn Sie mich fragen, sollte man den Leuten viel öfter sagen, dass sie einem am A … lecken können.«
»Ehrlich, ich weiß gar nicht, wie mir das herausrutschen konnte«, sagte Sureya mit entsetztem Gesicht – als wäre sie diejenige, die sich die Beleidigung hatte anhören müssen. »Normalerweise rede ich nicht so vulgär.«
»Manche Menschen lassen uns eben keine andere Wahl«, erwiderte ich.
»Kann schon sein … Schätze, wenn einem die Argumente ausgehen und man den Boden unter den Füßen verliert, bleibt einem wohl nur noch, den anderen zu beschimpfen, oder?«
Wir schlossen gleichzeitig unsere Wagen auf.
»Müssen Sie sofort los, um Ihren Deal abzuwickeln?«, fragte ich.
»Nein, für einen Kaffee reicht die Zeit noch. Haben Sie Lust?«
Mag sein, dass Sureya mittlerweile das Rauchen und das Kaffee trinken aufgegeben hat, aber ihr Lächeln ist immer noch genauso herzlich wie damals.
»Hi, Fran«, sagt sie jetzt. »Du bist aber früh dran. Bist du heute Morgen gleich hier geblieben, nachdem du die Kinder abgesetzt hast?«
»Das hätte ich mal besser getan. Das wäre nämlich sinnvoller gewesen.«
»Es gibt manchmal einfach solche Tage, nicht?«, entgegnet sie, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Sureyas Tage sich mit meinen vergleichen lassen. Ein bedeutender Unterschied ist zum Beispiel, dass sie im Gegensatz zu mir berufstätig ist. Sie gibt Theaterstunden. »Also, was ist los?«
Ich überlege, ob ich ihr erzählen soll, dass ich heute Vormittag nicht dort war, wo ich hätte sein sollen, aber da ich Sureya gegenüber von der ganzen Sache kein Wort erwähnt habe, wozu ihr jetzt was sagen? Sie braucht das nicht zu wissen. Sie braucht auch nicht zu wissen, dass ich versäumt habe, mir ein Kleid für die Geburtstagsfeier zu kaufen. Sosehr Sureya auch immer wieder beteuert, sich auf die Feier zu meinem Siebenunddreißigsten zu freuen, glaube ich nicht, dass dieses Ereignis sie so sehr beschäftigt wie mich. Ich weiß, dass ich mir etwas vormache, wenn ich glaube, dass ein teures neues Kleid mich auf wunderbare Weise verwandelt. Ich kann die ungeliebten grauen Haare nicht verstecken, genauso wenig, wie ich behaupten kann, dass das in meinem Gesicht alles Lachfalten sind – was habe ich schon zu lachen? –, und mein Bauch lässt sich nicht mehr einziehen, da kann ich noch so tief Luft holen. Mein viertes Lebensjahrzehnt rieselt mir durch die Finger wie Sand in einer Eieruhr, und ich kann nichts dagegen tun. Siebenunddreißig. Nur noch drei Jahre bis zu der legendären Schwelle, wo, wie man sagt, das richtige Leben beginnt. Wenn ich das nur glauben könnte.
»Hast du die Petition schon unterschrieben?«, fragt Sureya, nachdem ich ihre vorherige Frage mit einem Achselzucken beantwortet habe.
Sureya engagiert sich aktiv in der Lokalpolitik. Sie schreibt regelmäßig Briefe an Parlamentsmitglieder, organisiert Unterschriftenlisten und geht demonstrieren. Manchmal gelingt es ihr, mich auf eine Demo mitzuschleifen. Wie beim letzten Mal, wo wir dagegen protestierten, dass im Park ein Funksendemast aufgestellt wird. Ich kam mir total scheinheilig vor, als wir Beschimpfungen gegen Vodafone oder Orange oder wen auch immer brüllten. Verstehen Sie, eigentlich war ich sogar für den Sendemast. Der Empfang hier in der Gegend ist nämlich unter aller Sau. Und wenn die Handystrahlen allmählich unser Gehirn zerfressen, na und? Wenn die uns nicht alle machen, dann die Terroristen. Oder die Autoabgase. Oder das FCKW. Statt unsere Zeit damit zu verplempern, gegen alles zu protestieren, was uns umbringt, sollten wir da nicht besser erst einmal ein Leben führen, für das es sich zu kämpfen lohnt? Aber ich hielt den Mund. So etwas könnte ich nie laut sagen, und schon gar nicht zu Sureya. Sie ist meine Freundin, und wahre Freundschaft verlangt eben Geduld und Toleranz.
Sureyas neuestes Feindbild ist McDonald’s, das die Eröffnung einer Filiale auf dem Broadway plant. Sie kramt in ihrer Tasche und zieht ein Bündel loser Seiten hervor, die von einer Papierklammer zusammengehalten werden. Sie scheint bereits mehrere tausend Unterschriften gesammelt zu haben, was mich nicht überrascht. Hier in der Gegend hätte Al Kaida bessere Chancen, ein Rekrutierungsbüro zu eröffnen, als McDonald’s ein Restaurant. Obwohl ich eigentlich nicht unterschreiben möchte – Sie kennen ja bereits meine Meinung zur McGlobalisierung –, tue ich es dennoch. Geduld und Toleranz, wissen Sie noch?
»Danke, Süße«, sagt Sureya, während der Hausmeister in diesem Moment das Schultor aufschließt. »Ich muss mich jetzt um meinen Nachwuchs kümmern. Bis später.«
Ich beobachte, wie Sureya ihren Buggy in Richtung Arlington-Kindergarten schiebt, der sich neben dem Hauptgebäude befindet. Ich geselle mich zu den anderen Müttern, die sich mittlerweile eingefunden haben, und wir schlendern gemeinsam in Richtung Grundschule. Gleich darauf spüre ich eine Hand auf meiner Schulter und drehe mich um. Es ist Cassie, Cassie von der hiesigen Moralapostelfraktion.
»Francesca, wie schön, Sie zu sehen. Ich habe gehofft, dass wir uns heute treffen. Ich möchte Sie nämlich um einen Gefallen bitten.« Cassie wartet meine Antwort nicht ab. »Vielleicht haben Sie schon gehört, dass ich in diesem Jahr für die Garderobe verantwortlich bin«, verkündet sie wichtigtuerisch.
»Richtig, gut«, entgegne ich. »Und, äh, stimmt mein Outfit?«
»Wie bitte?«
»Nun, Sie sagten doch, Sie sind für die Garderobe verantwortlich …«
Cassie starrt mich verständnislos an.
»Oh, sorry, Sie meinten damit gar nicht Garderobe allgemein?«
Das war ein Scherz, auch wenn ich mir nicht sicher bin, wo ich den hergeholt habe. Früher habe ich ständig Witze gerissen. Aber offenbar bin ich aus der Übung, denn Cassie verzieht keine Miene. Ich zwinge mich zu einem Lächeln. »Das war nur ein Scherz, Cassie. Was wollten Sie mir sagen?«
»Ach so, ja, ich mache dieses Jahr die Kostüme für Der Zauberer von Oz. Die Weihnachtsaufführung. Von der AREI haben sich bis jetzt drei Freiwillige gemeldet, aber wir brauchen noch eine vierte.«
Die AREI: die Arlington-Road-Elterninitiative, ein Spitzenteam, das von Cassie auf bewundernswerte Weise (wenn man auf die schikanöse Tour steht) geführt wird und sich der Mission verschrieben hat, im Namen der Nächstenliebe Geld für die Schule zu sammeln. Ich bitte Sie, Arlington ist kein Sozialfall. Gut, es ist eine staatliche Schule, aber sie wird ausschließlich von Kindern besucht, deren Eltern über ein sechsstelliges Einkommen verfügen, den obligatorischen Geländewagen fahren und ihren Urlaub in der Toskana verbringen. Beschwört der Begriff Nächstenliebe nicht Bilder von bis auf das Skelett abgemagerten afrikanischen Kindern mit lauter Fliegen im Gesicht herauf statt von pausbäckigen kleinen Engeln, die in Markenklamotten herumtoben?
Aber das Sammeln von Spenden für unsere wunderbare Schule ist nichts, worüber man sich lustig machen darf. Wenn man also von Cassie gefragt wird, ob man bereit ist, die Garderobensondertruppe zahlenmäßig zu verstärken, muss man den Drang unterdrücken, ihr eine ablehnende Antwort zu geben, und stattdessen lächeln. Und nicken. Und bereitwillig seine Hilfe anbieten.
»Natürlich helfe ich gerne«, sage ich daher zu ihr.
»Das wäre wundervoll«, erwidert sie, wobei sie nichts anderes erwartet hat. »Ich dachte, das ist genau das Richtige für Sie, bei Ihrem Talent.«
»Talent?« Sie spricht in Rätseln.
»Haben Sie nicht einmal beim Fernsehen gearbeitet … oder so ähnlich?«
Ah, sie glänzt mit ihrem Halbwissen.
»Nein. Ich habe überwiegend für den Rundfunk gearbeitet. Obwohl – ich habe auch mal bei Spitting Image mitgemacht.«
»Diese Satireshow mit den Puppen?« Aus Cassies Mund klingt es wie die Show für Drogensüchtige, Geldwäscher und Pädophile.
»Ja, richtig.« Ich lächle.
»Und welche Kostüme haben Sie gemacht?«
Oh, ich verstehe. Cassie denkt, ich habe die für die Latexpuppen gemacht.
»Ich kann mit Nadel und Faden nicht umgehen«, entgegne ich. »Ich habe die Stimmen gemacht.«
Ich lasse diesen Satz kurz wirken, aber mir wird schnell klar, dass Cassie nicht sagen wird: »Wow, wie interessant!« oder: »Mein Gott, was für eine Begabung!«, geschweige denn überhaupt etwas. Sie hat diesen toten Gesichtsausdruck, als wären ihr mehrere Liter Botox unter die Haut gespritzt worden und als hätte sie keine Kontrolle mehr über ihre Gesichtsmuskeln.
»Stimmen«, wiederholt sie schließlich, um wenigstens etwas zu sagen.
Ich lache verlegen. »Ich weiß. Das ist ein seltsames Talent, nicht wahr?«
In der normalen Welt, sagen wir bei einem Treffen mit Bekannten in einer Kneipe, wäre diese winzige Information der perfekte Eisbrecher gewesen. Statt mit langweiligem Smalltalk würde man mich mit Namen bombardieren, in der Hoffnung, jemanden zu erwischen, den ich nicht imitieren kann. Namen wie Madonna, Marilyn Monroe, Micky Maus, Marge Simpson und sogar Marlene Dietrich. Und das sind nur die, die mit M anfangen. Wie bereits erwähnt, ein seltsames Talent, aber was soll ich sagen? Das ist nun einmal meine spezielle Begabung.
Cassie bittet mich allerdings nicht darum, meine Jade aus Big Brother zum Besten zu geben oder vielleicht sogar meine Judi Dench, nicht in einer Million Jahren. Nein, das wäre ja wie ein Eingeständnis, dass es sie interessiert. Was nicht der Fall ist.
»Wir brauchen Hüte«, teilt sie mir kurz und bündig mit, bevor sie weitergeht. »Ich gebe Ihnen noch eine Liste mit der genauen Anzahl der jeweiligen Hutformen.«
»Wie auch immer … du eingebildete Schlange«, würde ich am liebsten sagen, verkneife es mir aber.
Ich suche Mollys Klassenzimmer auf und stelle fest, dass ich mittlerweile spät dran bin, obwohl ich als Erste vor dem Schultor stand. Mrs Poulson starrt mich zornig an, als sie mir meine Tochter überreicht. Mit schlechtem Gewissen schnappe ich Mollys Hand und ziehe sie nach draußen in Richtung Sportplatz, wo wir, wie ich weiß, Thomas finden werden. Dort ist er nämlich immer, um bis zur letzten Minute mit dem Ball zu spielen, bevor es nach Hause geht zu den Schulaufgaben. Als wir uns nähern, tut er so, als würde er uns nicht bemerken, und ich beschließe, ihm noch fünf Minuten zu geben. Ich sehe ihm zu, wie er den Ball mit den Füßen, den Oberschenkeln, der Brust und dem Kopf jongliert und Tricks hervorzaubert, die mich immer noch in Ehrfurcht versetzen. Was soll ich sagen? Das ist nun einmal seine spezielle Begabung.
Molly zerrt an meinem Ärmel. »Mummy, machst du für mich Mrs Gottfried?«
»Nein, Herzchen, nicht hier.«
»Oh bitte. Die doofe Mrs Gottfried. Biii-tte.«
Ich bin schnell weichzukriegen. Ich gehe in die Knie und sage zu Molly im Flüsterton: »Du gibst jetzt keinen einzigen Mucks mehr von dir, bis die Stunde beendet ist«, mit dem leichten deutschen Akzent, den alle Schüler bereits in der ersten Klasse kennen und fürchten lernen. Ich warte auf Mollys Kichern, aber es bleibt aus.
»Mrs Clark, wir müssen dringend miteinander reden, vorausgesetzt, Sie haben Zeit.«
Oh mein Gott. Das war nicht ich. Oder doch? Nein. Und wenn ich es nicht war, dann kann es nur …
»Mrs Gottfried«, stoße ich hervor, während ich zu ihr hochschaue, wobei ich wegen der tief stehenden Septembersonne die Augen mit der Hand abschirmen muss. »Ja, sicher … Äh, worüber denn?«
Hat sie mich gerade gehört? Droht jetzt Ärger? Wahrscheinlich steht auf »die Konrektorin nachäffen« Tod durch den Strang. Ich bin verloren, ganz sicher. Meine Knie schlottern, als ich mich wieder aufrichte. Ich spüre, wie Molly neben mir zittert, und lege beschützend den Arm um sie.
»Geht es um Thomas?«, frage ich unnötigerweise. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich vor der Schulleitung für meinen »anspruchsvollen« Sohn rechtfertigen muss.
»Dies hier ist nicht der geeignete Ort«, entgegnet Mrs Gottfried mit schnarrender Stimme, »aber wir müssen uns bald unterhalten. Rufen Sie mich an, und wir machen einen Termin aus.«
Ihre Augen funkeln mordlüstern, auch wenn nicht klar ist, ob sie mir oder dem armen Thomas nach dem Leben trachtet. »Ich melde mich bei Ihnen«, sage ich und eile auf den Sportplatz, um meinen zehnjährigen Sohn einzusammeln und in Sicherheit zu bringen.
20
Ich schlage die Decke auf, und Molly klettert dankbar in ihr | Bett. Sie liebt es, schlafen zu gehen. Ich decke sie bis zum Kinn zu, während sie die beiden Teddys, die sie heute Abend ausgesucht hat, links und rechts neben sich drapiert. Ihre Haare, genauso schwarz wie die ihres Vaters, sind wie ein Fächer auf dem Kopfkissen ausgebreitet. Ihr Gesicht ist eine Oase unberührter Schönheit. Bei einem solchen Anblick weiß man plötzlich, dass alles gut wird.
»Gute Nacht, mein Engel«, sage ich und beuge mich hinunter, um ihr einen Kuss zu geben.
»Mummy, kannst du nicht noch mal Bart machen –«
»Genug für heute. Es ist schon spät, Engelchen, schlaf jetzt.«
Ich stehe auf und gehe rückwärts aus dem Zimmer. Die Tür lasse ich wie immer weit auf, wie Molly es gern hat. Danach gehe ich in Thomas’ Zimmer. Da er fünf Jahre älter ist, darf er im Bett noch lesen, bis er müde ist. Meistens etwas pädagogisch Wertvolles, beispielsweise die Anleitung für sein neues Playstation-Spiel.
»Mrs Gottfried will sich mit mir unterhalten, Tom«, sage ich. »Kannst du mir sagen, warum?«
Ich muss den Hals verrenken, um meinen Sohn zu sehen, und das liegt nicht daran, dass er sich unter seiner Bettdecke in Tarnfarben verkrochen hat. Das Bett ist nämlich einen Meter achtzig hoch und sieht nicht aus wie ein gewöhnliches Bett, sondern ähnelt einer Raumkapsel auf Stelzen im Ikea-Design. Unter der Plattform, auf der die Matratze liegt, befindet sich die integrierte Arbeitsstation samt Frachtraum mit allen möglichen Ablagefächern und Schubladen. Ein Wunderwerk schwedischer Innenarchitektur zum Schleuderkurs. Von den Schweden kann sich die NASA noch etwas abschauen.
»Thomas?«, frage ich.
Widerwillig taucht er unter der Decke hervor, eine Infrarot-Lesebrille um den Kopf, die Spieleanleitung für Duke Nukem: Time to Kill in der Hand. Er sieht richtig zum Fürchten aus, und ich mache unwillkürlich einen Schritt rückwärts.
Meine Fantasie gaukelt mir kurz vor, dass Thomas skandiert »Redrum, redrum, redrum.«
Aber in Wahrheit sagt er bloß: »Was?«
»Mrs Gottfried will mit mir sprechen. Ist heute etwas in der Schule vorgefallen?«
»Nö, nichts.« Er dreht das Gesicht zur Wand und starrt auf den Arsenal-Wimpel auf dem Poster von Cesc Fábregas. Unterhaltung beendet.
»Okay. Gibt es etwas, das du mir erzählen möchtest?«, hake ich nach.
»Nein. Bitte geh. Ich bin beschäftigt.«
Und schon taucht er wieder ab. Unter seine Bettdecke, um seine Lektüre fortzusetzen. Woran im Grunde nichts verkehrt ist. Seit wir Thomas die Playstation 2 geschenkt haben, hat er zwei Lesekurse übersprungen. Es kann also nicht verkehrt sein.
»Nacht, mein Liebling«, sage ich laut und schließe die Tür, sodass es im Zimmer wieder stockdunkel ist, wie er es gern hat.
Ich frage mich, wie ich zwei so unterschiedliche Kinder in die Welt setzen konnte. Ich muss mal mit Richard ein ernstes Wort reden. Ich erwarte von ihm einige Erklärungen, da ich langsam Zweifel habe, ob wirklich ich die leibliche Mutter von den beiden bin.
Ich gehe nach unten ins Wohnzimmer. Richard ist noch nicht da, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Mit etwas Glück wird es heute Abend besonders spät, und wenn er dann total erledigt von einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt, liege ich bereits im Bett und schlafe. Sehen Sie, ich war heute nicht dort, wo ich hätte sein sollen – ich glaube, das habe ich bereits erwähnt. Richard wird darüber gar nicht glücklich sein. Besser, ich schlafe schon, bevor er mir das mitteilt.
Ich mache es mir auf der Couch bequem, schnappe mir die Fernbedienung und zappe mit der einen Hand durch die Programme, während ich mit der anderen eine Zigarette aus der Schachtel fische. Gerade als ich mir die Zigarette zwischen die Lippen stecke, dreht sich der Schlüssel im Haustürschloss. Gleich darauf steht Richard im Türrahmen und starrt mich an. Seine Krawatte ist gelockert, sein Hemdkragen steht offen, und sein Gesicht strahlt pure Enttäuschung aus.
»Was zum Teufel war los?«, kommt er direkt auf den Punkt.
»Es tut mir wirklich leid«, flüstere ich beinahe lautlos.
»Ist dir klar, wie viele Leute du heute versetzt hast? Das kostet Geld, Fran. Sie mussten das Studio für zwei weitere Stunden mieten, weil sie erst einen Ersatz für dich auftreiben mussten.« Richards Zähne sind zusammengebissen, wie kleine, elfenbeinfarbene Dämme, die seine Wut zurückhalten. Ich wünschte, er würde sie stattdessen herauslassen, damit ich es hinter mir habe.
Richard redet von einer Sprechrolle. Seine Firma will auf eigene Kosten eine Werbung für irgendein angesagtes neues Bier testen. Dafür brauchten sie eine Stimme, die die sieben Wörter am Schluss spricht. Mein Auftritt.
»Dann haben sie einen Ersatz gefunden?«, frage ich, immer noch flüsternd.
»Ja, Lisa I’Anson.«
»Sie ist gut.«
»Für diesen Auftrag war sie die Falsche. Aber immerhin arbeitet sie professionell und erscheint wenigstens zu ihren Terminen.«
Aber was erwartet er? Schließlich bin ich seit Jahren raus aus dem Job, und es mangelt mir an Übung. Aber ich sage nichts. Ich hätte von vornherein wissen müssen, dass ich das nicht packe. Ich hätte niemals zusagen sollen.
Dabei hätte ich es fast geschafft. Ich stand bereits vor dem Tonstudio Saunders & Gordon, wo ich schon hundertmal war, allerdings ist das schon über zehn Jahre her, blieb aber auf der Eingangstreppe wie angewurzelt stehen. Es sind nur sieben kleine Worte, sagte ich mir. Das brachte mich immerhin bis zum Eingang, und ich legte die Hand auf den Türgriff.
Aber. Ich. Konnte. Mich. Einfach. Nicht. Überwinden.
Ich bin jetzt Fran, die Mutter. Fran, die Hausfrau. Gelegentlich – eher selten in Anbetracht von Richards Terminkalender – bin ich Fran, die Ehefrau. Mir ist viel zu spät bewusst geworden, dass ich nicht mehr Fran, die Stimmenimitatorin, bin.
Darum bin ich weggelaufen. Die ganze Strecke bis zum Einkaufsviertel.
Obwohl ich genau wusste, dass ich hinterher dafür bezahlen muss.
Hinterher heißt jetzt im Moment.
»Weißt du, im Grunde hast du nur dir selbst geschadet … Vergiss es, das ist Blödsinn«, explodiert Richard schließlich. »Du hast vor allem mir geschadet. Ich habe mich für dich ins Zeug gelegt. Ich habe all die blöden Sprüche in der Firma überhört, von wegen Vetternwirtschaft und so. Ist doch egal, habe ich mir gesagt, Hauptsache, der Auftrag wird ordentlich erledigt. Was allerdings voraussetzt, dass man zum Termin erscheint und seinen Job macht. Also, sag mir, Fran, was zum Teufel war los?«
Ich zucke zusammen, weil Richard mich so scharf anfährt.
»Ich bin nur … Hör zu, ich wollte es wirklich machen, ich schwöre … aber ich konnte einfach nicht.«
»Du konntest einfach nicht.«
»Ja. Du hast ja keine Vorstellung, wie … wie viel Angst ich hatte.«
»Entschuldige bitte, aber seit wann hast du Angst vor einer kleinen Sprechrolle? Das waren doch gerade mal sieben Wörtchen. Es war nicht mal eine Kamera dabei. Kein Mensch wird sehen, wer diese verdammten sieben Worte spricht. Du hättest die Sache ganz locker geschaukelt, Fran. Du bist schließlich erstklassig. Das ist doch genau dein Ding. Das ist das, was du machst.«
Nein, Richard, was ich mache, ist Kochen, Putzen und Pausenbrote vorbereiten. Genau das ist jetzt mein Ding. Ich weiß, wir haben end lose Diskussionen darüber geführt, mich wieder in die richtige Welt zurückzuführen. Aber woher hätte Richard wissen sollen, dass die richtige Welt derart Furcht einflößend ist? Mir war ja selbst nicht klar, wie viel Angst ich haben würde.
»Fran, rede mit mir«, lässt Richard nicht locker. »Was zum Teufel war heute Morgen mit dir los?«
»Ich weiß es nicht, Richard. Wahrscheinlich ging mir einfach die Düse.«
»Aber warum denn? Schließlich ist das dein verdammter Beruf«, sagt er, und Verzweiflung scheint ihn zu übermannen.
»Das war mal mein Beruf.«
»Nun, vielleicht hättest du mal erwähnen können, dass du dich zur Ruhe gesetzt hast, als ich dich gefragt habe, ob du den Auftrag machst. Was sagen denn deine Freundinnen dazu? Ich meine, Sureya zum Beispiel muss dich doch für total bescheuert halten.«
»Sie hat nichts gesagt … aber ich habe ihr auch nichts davon erzählt.«
»Natürlich nicht. Warum auch, wenn du schon von vornherein gewusst hast, dass du nicht die Nerven dazu hast!« Er unterbricht sich und fährt sich durch die Haare. Er versucht sich zu beruhigen. Dann sieht er mich an und merkt, dass ich gerade zu einer Erklärung ansetzen will. »Hör zu, komm mir jetzt nicht wieder mit diesem ›Ich bin nur Hausfrau‹-Quatsch«, sagt er. »Das zieht bei mir nicht mehr.«
Das ist kein Quatsch, das entspricht den Tatsachen!, würde ich am liebsten brüllen, lasse es aber. »Hör mal, es tut mir wirklich leid«, stammle ich stattdessen im Bemühen, Richard zu besänftigen. »Es wird nicht wieder vorkommen, versprochen.«
Er hört mir gar nicht richtig zu und starrt ins Leere. »Weißt du was? Mir reicht’s. Ich bin es endgültig leid, mich für dich einzusetzen und dich zu motivieren. Es wird sich ohnehin nichts ändern, oder? Also finden wir uns damit ab, dass du keinen Wert darauf legst, aus deinem Trott mal auszubrechen.«
»Nein, es wird sich was ändern. Es ist zwar nicht leicht, aber ich werde definitiv –«
»Hör auf. Sei jetzt bitte still. Das habe ich schon zu oft von dir gehört. Bitte, lass es, du beleidigst nur meine Intelligenz.«
Du beleidigst meine Intelligenz. Genau die Worte, die Michael Corleone zu seinem Schwager sagt … kurz bevor er ihn umbringt.
Richard streift seine Schuhe ab, und ich warte darauf, dass er fortfährt, aber offenbar ist die Unterhaltung beendet. Anscheinend hat er es endgültig mit mir aufgegeben, denn er legt jetzt eine DVD ein und lässt sich anschließend auf die Couch fallen. Die Sopranos. Richard hat ein Faible für Mafiafilme, und Die Sopranos ist seiner Meinung nach die beste Fernsehserie der Welt. Eine Serie, die das Leben von kriminellen Weiberhelden schildert, die wie Parasiten auf Kosten der ehrlichen und hart arbeitenden Gesellschaft leben. Was sagt das über Richard aus?, frage ich mich.
Aber ich bin nicht in der Position, Kritik zu üben – jedenfalls nicht heute Abend. Ich sitze still da und starre auf die Mattscheibe, ohne zu murren. Ich habe das verzweifelte Bedürfnis, mich nochmals zu entschuldigen. Und nochmals. Aber da wir uns eine DVD anschauen, gibt es nicht einmal eine Werbeunterbrechung, in der ich Richard erneut um Verzeihung bitten könnte. Und bis die DVD zu Ende ist, werde ich nicht mehr den Willen haben, das Thema erneut anzuschneiden. Ich kann nicht behaupten, dass Entschlossenheit zu meinen Stärken zählt.
Tu es einfach … und mach dir nicht so viele Gedanken, wenn es nicht klappt.
Während der Vorspann läuft, nehme ich die Zigarette wieder in die Hand, die ich anzünden wollte, als Richard nach Hause kam. Als sie brennt, wedelt Richard den Rauch von sich fort. Wieder ein Stein des Anstoßes.
»Kaffee?«, frage ich mit ruhiger Stimme.
Er grunzt ein Nein. Ich stehe auf, um in die Küche zu gehen und mir einen Kaffee zu machen, wobei ich die Zigarette mitnehme.
Erst im letzten Moment entscheide ich mich für ein Glas Wein, da die Flasche bereits geöffnet ist.
19
Mittwoch. Normalerweise lasse ich das Mittagessen immer ausfallen. Heute jedoch breche ich gerne mit dieser Tradition.
»Und, wie läuft es bei dir?«, frage ich, den Mund voller Grünzeug, das mit Balsamico beträufelt ist. Nicht begossen oder willkürlich besprenkelt, sondern beträufelt. Selbstredend.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























