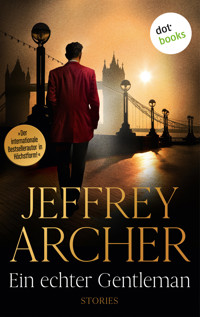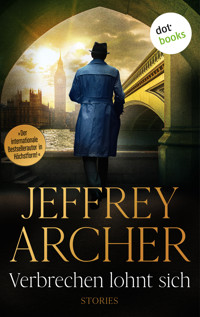
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vierzehn meisterhafte Erzählungen des Sensationsautors voll schillernder Persönlichkeiten und unerwarteter Enthüllungen: »Clevere Plots, glänzender Stil … Archer spielt ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Leser«, urteilt die New York Times. Ein hochrangiger Staatsbeamter spekuliert mit Steuergeldern – für einen guten Zweck. Ein Millionär erklärt überraschend seinen Bankrott – seine Freunde und Familie ahnen nicht, dass sie damit zu den Spielfiguren eines genialen Coups werden … Ein Kriegsveteran ist nach dem Dienst für sein Land desillusioniert. Und erkennt: Verbrechen zahlt sich weit mehr aus als ehrliche Arbeit … Spannend, überraschend und voll britischem Humor erzählt Jeffrey Archer von all den großen Träumern und kleinen Gaunern, die über kurz oder lang im Gefängnis landen, wo sie garantiert einen Zuhörer für ihre außergewöhnlichen Geschichten finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein hochrangiger Staatsbeamter spekuliert mit Steuergeldern – für einen guten Zweck. Ein Millionär erklärt überraschend seinen Bankrott – seine Freunde und Familie ahnen nicht, dass sie damit zu den Spielfiguren eines genialen Coups werden … Ein Kriegsveteran ist nach dem Dienst für sein Land desillusioniert. Und erkennt: Verbrechen zahlt sich weit mehr aus als ehrliche Arbeit …
Spannend, überraschend und voll britischem Humor erzählt Jeffrey Archer von all den großen Träumern und kleinen Gaunern, die über kurz oder lang im Gefängnis landen, wo sie garantiert einen Zuhörer für ihre außergewöhnlichen Geschichten finden.
Über den Autor:
Jeffrey Archer (geboren 1940 in London) ist ein britischer Bestsellerautor und gehört zu den erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Nach seinem Studium in Oxford schlug er eine bewegte unternehmerische und politische Karriere, die in einem Skandal endete. Nachdem er 2001 wegen Meineids inhaftiert wurde, wandte er sich voll und ganz der Schriftstellerei zu und hat seitdem zahlreiche internationale Bestseller geschrieben. Jeffrey Archer ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt in abwechselnd in London, Cambridge und auf Mallorca.
Die Website des Autors: www.jeffreyarcher.com/
Der Autor bei Facebook: www.facebook.com/JeffreyArcherAuthor/
Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/jeffrey_archer_author/
Bei dotbooks als eBook erhältlich sind seine hochkarätigen Anthologien »Der perfekte Dreh«, »Falsche Spuren«, »Ein echter Gentleman«, »Der gefälschte König« und »Verbrechen lohnt sich«. »Der perfekte Dreh« und »Falsche Spuren« sind auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Außerdem erscheinen bei dotbooks der Thriller »Die Stunde der Fälscher« und der Kurzroman »Das Evangelium nach Judas«.
***
eBook-Neuausgabe Mai 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2000 unter dem Originaltitel »To Cut a Long Story Short« bei HarperCollins.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2000 by Jeffrey Archer
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2003 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/Frédéric Prochasson, See Less By Mr. PNG
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-946-5
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jeffrey Archer
Verbrechen lohnt sich
Stories
Aus dem Amerikanischen von Lore Strassl
dotbooks.
WIDMUNG
VORBEMERKUNG
ES SPRICHT DER TOD
DER SACHVERSTÄNDIGE ALS ZEUGE
DAS ENDSPIEL
DER BRIEF
VERBRECHEN LOHNT SICH
VERSCHIEDEN WIE TAG UND NACHT
DER BEKEHRTE
ZU VIELE ZUFÄLLE
LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK
BEIDE SEITEN GEGEN DIE MITTE
EIN UNVERGESSLICHES WOCHENENDE
UMSONST IST DER TOD ...
SELBSTLOSE MÜHEN
DIE LIEGENDE
DIE KIRSCHEN IN NACHBARS GARTEN
LESETIPPS
WIDMUNG
Für Stephan, Alison und David
VORBEMERKUNG
Ehe Sie anfangen, diesen Kurzgeschichtenband zu lesen, möchte ich Sie – wie bei meinen früheren Kurzgeschichtensammlungen – darauf aufmerksam machen, dass einige Storys auf wahren Begebenheiten beruhen. Sie sind auf der Inhaltsseite mit * gekennzeichnet.
Bei meinen Weltreisen, auf denen ich stets Ausschau nach Skizzen halte, die ein Eigenleben haben könnten, stieß ich auf »Es spricht der Tod«. Diese Ministory bewegte mich so sehr, dass ich sie als Auftakt zu meiner neuen Kurzgeschichtensammlung verwenden möchte.
Die Geschichte wurde ursprünglich aus dem Arabischen übersetzt, doch trotz intensiver Nachforschungen waren nirgendwo Hinweise auf den Verfasser zu finden, obwohl die Geschichte einen Platz in Somerset Maughams Drama Sheppey fand und später zum Vorwort von John O’Haras Treffpunkt in Samara wurde.
Selten bin ich auf ein besseres Beispiel der schlichten Kunst des Geschichtenerzählens gestoßen. Diese Gabe wahrer Vorurteilslosigkeit hat nichts mit Herkunft, Bildung oder Erziehung zu tun, wie beispielsweise Joseph Conrad und Sir Walter Scott, John Buchan und O. Henry, H. H. Munro und Hans Christian Andersen bewiesen haben.
In diesem Kurzgeschichtenband, meinem vierten, habe ich mein Glück unter anderem mit zwei sehr kurzen Exemplaren dieser Gattung versucht: »Der Brief« und »Liebe auf den ersten Blick«.
Zuerst aber lassen wir den Tod sprechen.
ES SPRICHT DER TOD
Einst lebte in Bagdad ein Kaufmann, der seinen Diener zum Markt schickte, um dort Lebensmittel zu kaufen. Viel zu rasch kehrte der Diener mit weißem Gesicht und am ganzen Leibe zitternd zurück. »Gebieter«, sagte er, »als ich soeben auf dem Marktplatz war, rempelte eine Frau in der Menge mich an, und als ich mich umwandte, erkannte ich, dass es der Tod in weiblicher Gestalt war. Er blickte mich an und machte eine drohende Gebärde. Leiht mir Euer Ross, Gebieter, damit ich dieser Stadt den Rücken kehren und meinem Geschick entgehen kann! Ich werde nach Samara reiten, dort wird der Tod mich nicht finden.« Der Kaufmann borgte ihm sein Pferd, der Diener saß auf, stieß dem Tier die Sporen in die Flanken und galoppierte davon, so schnell das Pferd ihn zu tragen vermochte. Darauf begab der Kaufmann sich selbst zum Markt und sah mich, den Tod, in der Menge stehen. Er kam zu mir und sagte: »Warum habt Ihr meinen Diener mit einer drohenden Gebärde erschreckt, als Ihr ihn heute Morgen gesehen habt?«
»Das war keine drohende Gebärde«, entgegnete ich. »Ich bin vor Überraschung zusammengezuckt, ihn hier in Bagdad zu sehen, da ich ihn doch heute Abend in Samara treffen wollte.«
DER SACHVERSTÄNDIGE ALS ZEUGE
»Ein verdammt guter Schlag«, lobte Toby, als er beobachtete, wie der Ball seines Gegners durch die Luft sauste. »Dürften zweihundertdreißig, wenn nicht zweihundertfünfzig Meter sein«, fügte er hinzu. Er beschirmte die Augen vor der Sonne und beobachtete, wie der Golfball mitten auf dem Fairway hüpfte.
»Danke.« Harry freute sich.
»Was hattest du heute zum Frühstück, Harry?«, fragte Toby, als der Ball schließlich liegen blieb.
»Streit mit meiner Frau«, lautete die lakonische Antwort. »Sie wollte, dass ich diesen Vormittag mit ihr einkaufen gehe.«
»Wenn die Freuden und Leiden des Ehelebens mein Golfspiel so sehr verbessern würden, könnte ich fast in Versuchung kommen, ebenfalls zu heiraten.« Toby wandte sich dem Golfball zu. »Verdammt!«, fluchte er einen Augenblick später. Sein Schlag war verunglückt; der Ball war keine hundert Meter weit im dichten Rough gelandet.
Tobys Spiel war den ganzen Vormittag schwach, doch als sie zum Lunch ins Clubhaus zurückkehrten, warnte er seinen Gegner: »Nächste Woche hole ich mir im Gerichtssaal meine Revanche.«
»Hoffentlich nicht«, entgegnete Harry lachend.
»Wieso?«, fragte Toby beim Betreten des Clubhauses.
Harry grinste. »Weil ich von deiner Seite als Sachverständiger geladen bin.« Sie setzten sich an einen Tisch.
»Seltsam«, murmelte Toby. »Ich hätte schwören können, dass du Sachverständiger für die Gegenseite bist.«
Sir Toby Gray, prominenter Strafverteidiger und Anwalt der Krone, und Professor Harry Bamford standen im Gerichtssaal nicht immer auf derselben Seite.
»Alle Personen, die sich vor dem Lordoberrichter in der nun zu verhandelnden Rechtssache eingefunden haben, mögen näher treten.« Der Leeds Crown Court hatte Platz genommen. Richter Fenton führte den Vorsitz.
Sir Toby musterte den ältlichen, im Staatsdienst ergrauten Juristen. Er hielt ihn für einen liebenswürdigen und gerechten Mann; allerdings war seine Verhandlungsführung mitunter ein wenig umständlich.
Richter Fenton nickte Toby zu.
Sir Toby erhob sich, um mit der Verteidigung zu beginnen. »Eure Lordschaft, werte Geschworene, ich bin mir meiner großen Verantwortung bewusst. Einen Angeklagten zu verteidigen, der des Mordes beschuldigt wird, ist nie leicht. Es erschwert den Fall zusätzlich, wenn es sich bei dem Opfer um die Frau des Angeklagten handelt, mit der er über zwanzig Jahre glücklich verheiratet war. Das ist der Krone bekannt; sie hat es formell bekundet.«
»Meine Aufgabe wird auch dadurch nicht leichter, Mylord«, fuhr Sir Toby fort, »dass mein verehrter Kollege, Mr Rodgers, bei seiner Eröffnungsrede gestern die Indizienbeweise so geschickt aufführte, dass der Angeklagte schuldig zu sein schien. Ich jedoch beabsichtige«, Sir Toby schob die Daumen in seinen schwarzen Seidentalar und wandte sich den Geschworenen zu, »einen Zeugen aufzurufen, dessen Name als Sachverständiger wohl jedem ein Begriff ist. Ich bin zuversichtlich, dass er Ihnen, meine Damen und Herren Geschworenen, kaum eine andere Wahl lässt, als den Angeklagten für nicht schuldig zu befinden. Ich bitte nun Professor Harold Bamford in den Zeugenstand.«
Ein elegant in blauem Doppelreiher, weißem Hemd und der Krawatte des Yorkshire County Cricket Clubs gekleideter Herr betrat den Gerichtssaal und nahm seinen Platz im Zeugenstand ein. Nachdem der Gerichtsdiener ihm das Neue Testament hingelegt hatte, sprach er die Vereidigungsformel mit einer Selbstverständlichkeit, die unter den Geschworenen keinen Zweifel daran ließ, dass dies nicht sein erster Auftritt in einem Mordfall war.
Sir Toby zupfte seinen Talar zurecht, während er durch den Gerichtssaal zu seinem Golfpartner blickte.
»Professor Bamford«, begann er, als hätte er diesen Mann nie zuvor gesehen, »um uns Ihrer Sachkenntnisse zu vergewissern, wird es nötig sein, Ihnen zuerst einmal ein paar Fragen zu stellen, die vielleicht ein wenig unbequem sind. Aber es ist von größter Wichtigkeit, dass ich den Damen und Herren Geschworenen Ihre Befähigung nachweisen kann, soweit es diesen besonderen Fall betrifft.«
Harry nickte ernst.
»Professor Bamford, Sie haben in Leeds das Gymnasium besucht.« Sir Toby blickte auf die ausschließlich aus Yorkshire stammenden Geschworenen. »Wo Ihnen ein Stipendium für ein Jurastudium auf dem Magdalen College gewährt wurde ...«
Wieder nickte Harry und sagte: »So ist es«, während Toby scheinbar auf seine Notizen blickte – was völlig unnötig war, da er das Ganze bereits in einigen früheren Fällen mit Harry durchexerziert hatte.
»Aber Sie haben dieses Stipendium nicht angenommen«, fuhr Sir Toby fort, »weil Sie es vorzogen, hier in Leeds zu studieren. Stimmt das?«
»Ja«, antwortete Harry. Diesmal nickten die Geschworenen beifällig. Es gibt nichts Loyaleres oder Stolzeres als einen Yorkshirer, wenn es um irgendetwas Yorkshirisches geht, dachte Sir Toby zufrieden.
»Und haben Sie Ihr Studium an der Universität von Leeds – ich ersuche Sie nur zur Bestätigung um Antwort – mit Auszeichnung abgeschlossen?«
»Ja.«
»Und bot Ihnen die Harvard University, eine der bedeutendsten amerikanischen Universitäten, nicht einen Studienplatz an, damit Sie dort Ihren Magister- und danach Ihren Doktortitel machen konnten?«
Harry nickte knapp und bestätigte es. Wie gern hätte er gesagt: »Nun mach schon weiter, Toby«, doch er wusste, dass sein alter Sparringspartner so viel wie nur möglich aus diesem Gespräch herausholen wollte.
»Und Sie wählten für Ihre Doktorarbeit das Thema ›Handfeuerwaffen bei Mordfällen‹?«
»So ist es, Sir Toby.«
»Ist es auch so«, führ der Strafverteidiger fort, »dass Ihre Dissertation ein solches Interesse beim Prüfungsausschuss erweckte, dass die Harvard University Press diese Arbeit veröffentlicht hat, und dass sie nun jedem empfohlen wird, der sich auf forensische Wissenschaft spezialisiert?«
»Es ist sehr freundlich von Ihnen, es so zu formulieren«, sagte Harry und gab Toby damit das Stichwort für den nächsten Satz.
»Nicht ich habe es so formuliert«, entgegnete Sir Toby. Er erhob sich zur vollen Größe und blickte die Geschworenen eindringlich an. »Dies sind die Worte von keinem Geringeren als Richter Daniel Webster vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Aber gestatten Sie mir, weiterzumachen. Verlassen wir Harvard und kehren nach England zurück. Kann ich zu Recht sagen, dass Sie in einen Gewissenskonflikt gerieten, als die Oxford University Ihnen den ersten Lehrstuhl für forensische Wissenschaft anbot? Aber Sie schlugen auch dieses Angebot aus und zogen es vor, zu Ihrer Alma Mater zurückzukehren, zunächst als Dozent und später als Professor – habe ich Recht, Professor Bamford?«
»Sie haben Recht, Sir Toby«, antwortete Harry.
»Diese Professorenstelle haben Sie nun seit elf Jahren inne, obwohl Ihnen die renommiertesten Universitäten der Welt lukrative Angebote unterbreitet haben. Dann aber hätten Sie Ihr geliebtes Yorkshire verlassen müssen, und das wollten Sie nicht.«
An dieser Stelle blickte Richter Fenton, der das alles ebenfalls nicht zum ersten Mal hörte, vom Richtertisch hinunter und unterbrach Toby: »Ich würde sagen, Sir Toby, Sie haben ausreichend deutlich gemacht, dass Ihr Zeuge ein brillanter Sachverständiger ist. Könnten wir jetzt fortfahren und uns mit dem vorliegenden Fall befassen?«
»Mit Vergnügen, Mylord, vor allem nach Euren großzügigen Worten. – Es wird nicht mehr nötig sein, weiteres Lob auf die Schultern des verehrten Professors zu häufen.« Wie gern hätte Sir Toby dem Richter gesagt, dass er bereits am Ende seiner Vorstellung angelangt war, kurz bevor der Richter ihn unterbrochen hatte.
»Da ich die Jury nun mit Professor Bamford bekannt gemacht habe, werde ich – mit Eurer Erlaubnis, Mylord – zum vorliegenden Fall kommen.« Kurz wandte er sich wieder dem Professor zu und tauschte einen verstohlenen Blick mit ihm.
»Zu Beginn der Verhandlung erörterte mein geschätzter Kollege, Mr Rodgers, als Ankläger kenntnisreich den Tatbestand. Er ließ keinen Zweifel daran, dass dieser Fall nur auf einem einzigen Beweisstück beruht, nämlich ›der rauchenden Feuerwaffe, die nie rauchte‹.«
Es war eine Wendung, die Harry schon viele Male aus dem Mund seines alten Freundes gehört hatte und zweifellos in Zukunft noch des Öfteren hören würde.
»Ich spreche von der Pistole mit den Fingerabdrücken des Angeklagten, die neben der Leiche seiner bedauernswerten Gemahlin, Mrs Valerie Richards, gefunden wurde. Die Anklage geht davon aus, dass der Angeklagte, nachdem er angeblich seine Frau getötet hatte, voller Panik aus dem Haus rannte und die Handfeuerwaffe mitten im Zimmer liegen ließ.« Sir Toby schwang zu den Geschworenen herum. »Auf der Grundlage dieses einzigen dürftigen Indizes – und ich werde Ihnen noch zeigen, wie dürftig es ist –, sollen Sie, meine Damen und Herren Geschworenen, einen Mann des Mordes für schuldig befinden und ihn für den Rest seines Lebens hinter Gitter bringen.« Er legte eine Pause ein, um den Geschworenen Zeit zu geben, sich der Bedeutung dieser Worte klar zu werden.
»Nun komme ich wieder zu Ihnen, Professor Bamford, und möchte Ihnen – als brillantem Sachverständigen auf Ihrem Fachgebiet, um Mylords Charakterisierung Ihres Status zu benutzen – eine Reihe von Fragen stellen.«
Harry erkannte, dass das Vorgeplänkel vorüber war.
»Lassen Sie mich mit der Frage beginnen, Professor, ob es Ihrer Erfahrung nach wahrscheinlich ist, dass ein Mörder, nachdem er sein Opfer erschossen hat, die Mordwaffe am Tatort zurücklässt?«
»Nein, Sir Toby, das ist äußerst unwahrscheinlich«, antwortete Harry. »In neun von zehn Fällen, in denen eine Handfeuerwaffe benutzt wurde, konnte sie nicht gefunden werden, weil der Mörder sich ihrer geschickt entledigte.«
»Richtig«, bestätigte Sir Toby. »Und in dem einen von zehn Fällen, in dem die Waffe entdeckt wird – ist es da üblich, dass diese Mordwaffe über und über mit Fingerabdrücken bedeckt ist?«
»Das kommt praktisch nie vor«, erwiderte Harry. »Es sei denn, der Mörder ist ein völliger Dummkopf oder wird in flagranti ertappt.«
»Der Angeklagte mag vieles sein«, erklärte Sir Toby, »aber ganz gewiss kein Dummkopf. Genau wie Sie besuchte er ein Gymnasium, und er wurde nicht am Tatort verhaftet, sondern im Haus eines Freundes, am anderen Ende der Stadt.« Sir Toby fügte nicht hinzu, worauf der Staatsanwalt in seiner einleitenden Erklärung mehrmals hingewiesen hatte: dass der Angeklagte im Bett seiner Geliebten vorgefunden worden war, die ihm, wie sich herausstellte, als Einzige ein Alibi verschaffen konnte.
»Jetzt möchte ich zu der Waffe kommen, Professor, einer Smith & Wesson K4217B.«
»Um genau zu sein, handelt es sich eine K4127B«, verbesserte Harry seinen alten Freund.
»Ihre Sachkenntnis versetzt mich immer wieder in Erstaunen.« Toby war erfreut über die Wirkung, die sein kleiner Fehler auf die Geschworenen hatte. »Doch kehren wir zu der Pistole zurück. Das Polizeilabor fand die Fingerabdrücke des Mordopfers auf der Waffe?«
»So ist es, Sir Toby.«
»Und können Sie, als Sachverständiger, irgendwelche Schlüsse daraus ziehen?«
»Ja. Die Fingerabdrücke von Mrs Richards befanden sich unverkennbar am Abzug und Schaft der Pistole, was zu der Annahme führt, dass sie die Waffe als Letzte in der Hand gehalten hat. Tatsächlich lässt es darauf schließen, dass sie auf den Abzug gedrückt hat.«
»Ich verstehe«, sagte Sir Toby. »Aber könnte es nicht sein, dass der Mörder Mrs Richards die Waffe in die Hand drückte, um die Polizei irrezuführen?«
»Ich würde diese Theorie in Betracht ziehen, hätte die Polizei nicht auch Mr Richards’ Abdrücke auf dem Abzug gefunden.«
»Ich fürchte, ich verstehe nicht recht, was Sie damit sagen wollen, Professor«, behauptete Sir Toby, der es ganz genau wusste.
»In fast jedem Fall, mit dem ich vertraut bin, hat der Mörder zuerst seine eigenen Fingerabdrücke abgewischt, ehe er die Mordwaffe dem Opfer in die Hand drückte.«
»Ich verstehe. Aber verbessern Sie mich, falls ich mich täusche«, sagte Sir Toby. »Die Pistole wurde nicht in der Hand des Opfers gefunden, sondern zwei Meter siebzig von der Leiche entfernt, wo der Mörder, wie der Ankläger behauptet, sie fallen ließ, als er panikartig aus seinem ehelichen Zuhause floh. Lassen Sie mich deshalb fragen, Professor Bamford: Wenn sich ein Selbstmörder eine Pistole an die Schläfe hält und auf den Abzug drückt, wo würden Sie dann erwarten, dass die Pistole anschließend zu liegen kommt?«
»Zwei bis drei Meter von seiner Leiche entfernt«, antwortete Harry. »Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Opfer nach erfolgtem Suizid die Waffe in der Hand behalten, wie es häufig in schlecht recherchierten Filmen und Fernsehsendungen zu sehen ist. Bei Selbstmord löst sich die Waffe durch die Heftigkeit des Schusses aus der Hand des Opfers und schnellt gute zwei Meter durch die Luft. In den dreißig Jahren, in denen ich mich mit Freitod durch Erschießen beschäftigt habe, kam mir nicht ein einziger Fall unter, in dem eine Schusswaffe in der Hand des Opfers verblieb.«
»Nach Ihrer Meinung als Sachverständiger, Professor, deuten Mrs Richards’ Fingerabdrücke und die Lage der Waffe demnach eher auf Selbstmord als auf Mord hin.«
»So ist es, Sir Toby.«
»Eine letzte Frage noch, Professor«, sagte der Verteidiger und zupfte an seinen Revers. »Wenn Sie bisher in Fällen wie diesem als Zeuge der Verteidigung ausgesagt haben, welcher Prozentsatz der Geschworenen stimmte dann für nicht schuldig?«
»Mathematik war nie meine starke Seite, Sir Toby, aber einundzwanzig von vierundzwanzig Fällen endeten mit einem Freispruch.«
Sir Toby wandte sich bedächtig zuerst den Geschworenen und dann dem Richter zu. »Einundzwanzig von vierundzwanzig Fällen«, sagte er, »endeten also mit einem Freispruch, nachdem Professor Bamford seine Aussage als Sachverständiger gemacht hatte. Ich glaube, das sind etwa fünfundachtzig Prozent, Mylord. Keine weiteren Fragen.«
Toby holte Harry auf der Treppe im Gericht ein. Er klopfte seinem alten Freund auf die Schulter. »Du hast dich wieder mal selbst übertroffen, Harry. Es wundert mich nicht, dass das Gericht es sich nach deinen Ausführungen noch einmal überlegt hat – ich habe dich nie in besserer Form gesehen. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Morgen beginnt für mich ein neuer Prozess im Bailey. Wir sehen uns am Samstag um zehn Uhr am ersten Loch. Das heißt, wenn Valerie es gestattet.«
»Du wirst mich schon viel früher sehen«, murmelte der Professor, als Sir Toby in einem Taxi Platz nahm.
Sir Toby warf einen Blick auf seine Notizen, während er auf seinen ersten Zeugen wartete. Der Fall machte ihm ziemlich zu schaffen. Der Ankläger hatte eine Menge Beweise gegen seinen Mandanten vorgebracht, die er nicht widerlegen konnte. Nicht gerade mit Begeisterung sah er dem Kreuzverhör einer Reihe von Zeugen entgegen, die diese Beweise zweifellos bekräftigen würden.
Der Vorsitzende bei diesem Prozess, Richter Fairborough, nickte dem Ankläger zu. »Rufen Sie Ihren ersten Zeugen auf, Mr Lennox.«
Desmond Lennox erhob sich bedächtig von seinem Platz. »Jawohl, Mylord. Ich rufe Professor Harold Bamford in den Zeugenstand.«
Überrascht blickte Sir Toby von seinen Notizen auf und sah seinen alten Freund selbstsicher zum Zeugenstand schreiten. Die Londoner Geschworenen blickten ein wenig spöttisch auf den Mann aus Leeds.
Sir Toby musste zugeben, dass Mr Lennox seinen Sachverständigen sehr geschickt vorstellte – ohne auch nur ein einziges Mal auf Leeds hinzuweisen. Danach stellte der Ankläger Harry eine Reihe von Fragen, die Sir Tobys Mandanten als eine Mischung aus Jack the Ripper und Dr. Crippen erscheinen ließen.
Schließlich sagte Mr Lennox: »Keine weiteren Fragen, Mylord«, und nahm mit selbstzufriedener Miene Platz.
Richter Fairborough blickte zu Sir Toby hinunter. »Möchten Sie diesen Zeugen befragen?«
»Das möchte ich allerdings, Mylord«, entgegnete Toby und stand auf. »Professor Bamford«, begann er, als hätten sie noch nie zuvor miteinander zu tun gehabt, »ehe ich zum vorliegenden Fall komme, muss ich fairerweise sagen, dass mein geschätzter Kollege, Mr Lennox, sein Bestes tat, Ihre Befähigung als Sachverständiger darzulegen. Sie werden mir nachsehen müssen, dass ich darauf zurückkomme, um die ein oder andere Einzelheit klarzustellen, die mich ein wenig verwundert.«
»Gewiss, Sir Toby«, antwortete Harry.
»Sie erwarben Ihren ersten akademischen Grad an der ... o ja, Universität Leeds. In welchem Fach?«
»Geographie«, erwiderte Harry.
»Wie interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass dies zur Vorbereitung für jemanden gehört, der Sachverständiger für Handfeuerwaffen wird. Aber«, fuhr er fort, »gestatten Sie mir, auf Ihren Titel als Dr. phil. hinzuweisen, den Sie von einer amerikanischen Universität bekamen. Darf ich fragen, ob er von englischen Hochschulen anerkannt wird?«
»Nein, Sir Toby, aber ...«
»Bitte beschränken Sie sich darauf, die Fragen zu beantworten, Professor Bamford. Wird dieser akademische Titel beispielsweise von der Universität Oxford anerkannt?«
»Nein, Sir Toby.«
»Ich verstehe. Und wie Mr Lennox betonte, kann die Entscheidung in diesem Fall sich durchaus auf Ihre Anerkennung als Sachverständiger stützen.«
Richter Fairborough blickte stirnrunzelnd zum Verteidiger hinunter. »Es liegt an den Geschworenen, die Entscheidung auf der Grundlage der ihnen vorgetragenen Tatsachen zu treffen, Sir Toby.«
»Gewiss, Mylord. Ich möchte nur feststellen, inwieweit die Damen und Herren Geschworenen sich nach der Aussage des Sachverständigen der Krone richten können.«
Wieder runzelte der Richter die Stirn.
»Aber wenn Ihr der Ansicht seid, Mylord, dass ich das bereits dargelegt habe, werde ich fortfahren.« Sir Toby wandte sich wieder seinem alten Freund zu.
»Nun, Professor Bamford, Sie erklärten den Damen und Herren Geschworenen – als Sachverständiger –, dass Selbstmord in diesem Fall auszuschließen ist, weil die Waffe in der Hand des Opfers vorgefunden wurde.«
»Das stimmt, Sir Toby. Es ist ein weitverbreiteter Irrtum – wie er häufig in schlecht recherchierten Filmen und Fernsehsendungen begangen wird –, die Opfer nach erfolgtem Suizid mit der Waffe in der Hand zu zeigen.«
»Ja, ja, Professor Bamford. Wir erfuhren bereits von Ihrer Kenntnis banaler Fernseh-Seifenopern, als mein geschätzter Kollege Sie befragt hat. Immerhin, auf dem Gebiet sind Sie Sachverständiger. Aber ich sollte jetzt wohl wieder zum Fall zurückkehren. Ich kann doch davon ausgehen, Professor Bamford, dass Sie nicht behaupten wollen, die Angeklagte hätte ihrem Gatten die Pistole in die Hand gedrückt? Denn wenn Sie das behaupten würden, Professor Bamford, wären Sie nicht Sachverständiger, sondern Hellseher.«
»Eine solche Andeutung habe ich nicht gemacht, Sir Toby.«
»Ich freue mich, in dieser Hinsicht Ihre Unterstützung zu haben. Sagen Sie mal, Professor Bamford, sind Sie während Ihrer Laufbahn als Sachverständiger je auf einen Fall gestoßen, in dem der Mörder seinem Opfer die Waffe in die Hand drückte, um einen Selbstmord vorzutäuschen?«
Harry zögerte einen Augenblick.
»Lassen Sie sich Zeit, Professor Bamford. Der Rest des Lebens einer Frau könnte von Ihrer Antwort abhängen.«
»Ich bin auf Fälle dieser Art gestoßen ...« Wieder zögerte er. »Und zwar dreimal.«
»Dreimal?«, wiederholte Sir Toby und bemühte sich, möglichst überrascht dreinzuschauen, obwohl er an allen drei Prozessen beteiligt gewesen war.
»Ja, Sir Toby«, sagte Harry.
»Und haben die Damen und Herren Geschworenen in diesen drei Fällen für nicht schuldig entschieden?«
»In zwei Fällen.«
»Was war mit dem dritten Fall?«, erkundigte sich Sir Toby.
»Der Mann wurde des Mordes für schuldig befunden.«
»Und verurteilt ...?«, fragte Sir Toby.
»Zu lebenslänglicher Haft.«
»Ich würde gern ein wenig mehr über diesen Fall erfahren, Professor Bamford.«
»Führt das irgendwohin, Sir Toby?«, warf Richter Fairborough ein und blickte den Verteidiger finster an.
»Das werden wir gleich erfahren, Mylord«, antwortete Sir Toby und wandte sich den Geschworenen zu, deren Blicke nun alle auf dem Sachverständigen hafteten. »Ich ersuche Professor Bamford, das Hohe Gericht über Einzelheiten dieses Falles zu unterrichten.«
»In diesem Fall der Krone gegen Reynolds«, erläuterte Harry, »hat Mr Reynolds elf Jahre seiner Strafe abgesessen, ehe durch neue Beweise herausgefunden wurde, dass er die Tat gar nicht begangen haben konnte. Er wurde später begnadigt.«
»Ich hoffe, Sie verzeihen mir die nächste Frage, Professor Bamford, aber der Ruf einer Frau, von ihrer Freiheit ganz zu schweigen, steht bei diesem Prozess auf dem Spiel.« Er machte eine Pause und blickte seinen alten Freund durchdringend an. »Sind Sie in dem erwähnten Fall als Zeuge der Anklage aufgetreten?«
»Ja, Sir Toby.«
»Als Sachverständiger der Krone?«
Harry nickte. »Ja, Sir Toby.«
»Und ein Unschuldiger wurde für ein Verbrechen verurteilt, das er nicht begangen hatte, und saß deshalb elf Jahre im Gefängnis?«
Wieder nickte Harry. »Ja, Sir Toby.«
»Kein ›Aber‹ in diesem besonderen Fall?«, fragte Sir Toby. Er wartete auf eine Antwort, doch Harry schwieg. Er wusste, dass er im vorliegenden Fall als Sachverständiger nicht mehr vollkommen glaubwürdig war.
»Eine letzte Frage noch, Professor Bamford. Sind die Geschworenen in den beiden anderen Fällen auf der Grundlage Ihrer Interpretation der Beweislage zu einem einstimmigen Urteil gekommen?«
»Ja, Sir Toby.«
»Wie Sie wissen, Professor Bamford, hat die Krone hervorgehoben, dass Ihr Sachverständigenurteil in bisherigen ähnlichen Fällen von größter Bedeutung gewesen ist. Um Mr Lennox zu zitieren: ›Ausschlaggebend, den Fall der Krone zu beweisen.‹ Doch nun müssen wir erfahren, dass Sie in den drei Fällen, in denen eine Waffe in der Hand des Opfers gefunden wurde, als Sachverständiger des Gerichts eine Fehlerquote von dreiunddreißig Prozent hatten.«
Harry antwortete nicht, wie Sir Toby es erwartet hatte.
»Und als Folge verbrachte ein Unschuldiger elf Jahre hinter Gittern.« Sir Toby wandte seine Aufmerksamkeit den Geschworenen zu und sagte gerade noch verständlich: »Hoffen wir, Professor Bamford, dass angesichts der Meinung eines Sachverständigen, der in dreiunddreißig Prozent der Fälle zu wenig Sachverstand beweist, keine Unschuldige den Rest ihres Lebens im Gefängnis schmachten muss.«
Mr Lennox sprang auf, um sich diese Behandlung seines Zeugen zu verbieten, und Richter Fairborough hob tadelnd den Finger. »Das war eine unzulässige Bemerkung, Sir Toby«, wies er ihn zurecht.
Doch Sir Tobys Blicke wichen nicht von den Geschworenen, die nicht mehr am Mund des Sachverständigen hingen, sondern nun miteinander flüsterten.
Bedächtig nahm Sir Toby seinen Platz wieder ein. »Keine weiteren Fragen, Mylord.«
»Verdammt guter Schlag«, lobte Toby, als Harrys Ball in der Mulde des achtzehnten Lochs verschwand. »Ich fürchte, der Lunch geht wieder auf mich.«
»Ist dir klar, dass ich dich seit Wochen nicht mehr geschlagen habe, Harry?«
»Oh, das würde ich nicht sagen, Toby«, entgegnete sein Golfpartner, während sie zum Clubhaus zurückkehrten. »Wie würdest du es nennen, was du am Donnerstag vor Gericht mit mir angestellt hast?«
»Ja, dafür muss ich mich entschuldigen, alter Junge. Aber du weißt ja, dass es nicht persönlich gemeint war. Ich muss schon sagen, es war verdammt unüberlegt von Lennox, dich als Sachverständigen zu berufen.«
»Das stimmt.« Harry nickte. »Dabei habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, dass keiner mich besser kennt als du, aber Lennox interessierte es nicht, was oben in Leeds geschehen ist.«
»Es hätte mir nicht so viel ausgemacht«, gestand Toby, als er sich zum Lunch setzte, »wenn nicht ...«
»Wenn nicht was ...?«, wiederholte Harry fragend.
»Bei dem Fall in Leeds und dem im Baily – wie die Geschworenen in beiden Fällen hätten erkennen müssen – meine Mandanten so schuldig waren, wie man nur sein kann.«
DAS ENDSPIEL
Vor seinem nächsten Zug zögerte Cornelius Barrington und studierte das Brett mit größter Aufmerksamkeit. Das Spiel dauerte bereits mehr als zwei Stunden, und Cornelius war zuversichtlich, dass er bis zum Matt nur noch sieben Züge benötigte. Dessen war sein Gegner sich höchstwahrscheinlich ebenfalls bewusst.
Cornelius blickte auf und lächelte Frank Vincent zu, der sein ältester Freund war und sich im Lauf der Jahre als Familienanwalt als sein bester Berater erwiesen hatte. Die beiden Herren hatten viel gemein: ihr Alter (beide waren über sechzig), ihren Background (beide waren mittelmäßige Söhne erfolgreicher Väter) und ihre Ausbildung (beide waren zur selben Schule und auf dieselbe Universität gegangen). Aber dort endeten die Gemeinsamkeiten, denn Cornelius war von Natur aus ein Unternehmer, der Risiken nicht scheute und in Südafrika und Brasilien ein Vermögen im Bergbau gemacht hatte. Frank war von Beruf Anwalt, vorsichtig, pedantisch, bedächtig bei seinen Entscheidungen.
Cornelius und Frank unterschieden sich auch in ihrem Äußeren. Cornelius war von großer, kräftiger Statur und hatte volles, silbergraues Haar, um das ihn viele seiner oft nur halb so alten Freunde und Bekannten beneideten. Frank war schmächtig, mittelgroß und kahl, von einem Kranz dünner grauer Haare abgesehen.
Cornelius war nach vierzig Jahren glücklicher Ehe verwitwet. Frank war überzeugter Junggeselle.
Zu den Dingen, die ihre enge Freundschaft erhalten hatten, gehörte ihre unerschütterliche Liebe zum Schach. Frank besuchte Cornelius jeden Donnerstagabend in dessen Haus, The Willows, um eine Partie zu spielen, die manchmal mit einem Remis, viel öfter jedoch mit einem Patt endete.
Die Abende begannen gewöhnlich mit einem leichten Supper, zu dem sie sich nur je ein Glas Wein einschenkten, denn beide nahmen das Schachspielen sehr ernst. Nach dem Spiel setzten sie sich ins Wohnzimmer und gönnten sich einen Cognac und eine Zigarre. Heute jedoch wollte Cornelius von diesem gewohnten Ablauf abweichen.
»Glückwunsch.« Frank blickte vom Brett auf. »Ich glaube, diesmal hast du mich geschlagen. Ich fürchte, da ist nichts mehr zu machen.« Er lächelte, legte den König aufs Brett, erhob sich und schüttelte seinem engsten Freund die Hand.
»Gehen wir ins Wohnzimmer, und gönnen wir uns einen Cognac und eine Zigarre«, schlug Cornelius vor, als würden sie das nicht ohnehin an jedem Schachabend tun.
»Danke, gern«, erwiderte Frank, als sie das Arbeitszimmer verließen.
Als Cornelius am Bild seines Sohnes David vorbeiging, setzte sein Herz einen Schlag aus; daran hatte sich in den vergangenen dreiundzwanzig Jahren nichts geändert. Wenn sein einziges Kind am Leben geblieben wäre, hätte er die Firma nie verkauft.
Beim Betreten des geräumigen Wohnzimmers begrüßte sie ein prasselndes Feuer im Kamin, für das Cornelius’ Haushälterin Pauline gesorgt hatte, nachdem sie den Tisch abgeräumt und das Geschirr gespült hatte. Pauline legte ebenfalls großen Wert auf ein geregeltes Dasein; deshalb würde auch ihr geordnetes Leben bald heftig erschüttert werden.
»Ich hätte dich schon ein paar Züge früher erledigt«, sagte Cornelius, »aber du hast mich überrascht, als du meinen Damen-Springer geschlagen hast. Das hätte ich eigentlich vorhersehen müssen«, fügte er hinzu, während sie zum Sideboard gingen. Zwei große Cognacschwenker und zwei Monte-Cristo-Zigarren warteten auf einem Silbertablett auf sie. Cornelius griff nach der Zigarrenschere. Er reichte sie seinem Freund, zündete ein Streichholz an, beugte sich hinüber und beobachtete, wie Frank paffte, bis er überzeugt war, dass seine Zigarre brannte. Dann zündete auch er sich die Monte-Cristo an und machte es sich in seinem Lieblingssessel am Feuer bequem.
Frank hob sein Glas. »Gut gespielt, Cornelius.« Er verbeugte sich knapp, obgleich er über die Jahre hinweg einen Vorsprung vor Cornelius hatte.
Cornelius gestattete Frank ein paar weitere Züge, ehe er ihn in seinen schockierenden Plan einweihen wollte. Es bestand kein Grund zur Eile; schließlich hatte er diesen Augenblick seit Wochen vorbereitet. Er hatte sich seinem ältesten Freund nur nicht anvertrauen wollen, ehe alles genauestens durchdacht war.
Entspannt in der Gesellschaft des Anderen schwiegen beide eine Zeit lang. Schließlich setzte Cornelius seinen Cognacschwenker auf einem Beistelltischchen ab und begann: »Frank, wir sind seit über fünfzig Jahren Freunde. Genauso wichtig ist für mich, dass du dich als unersetzlicher Rechtsberater und sehr geschickter Anwalt erwiesen hast. Seit Millicents viel zu frühem Ableben gibt es niemanden mehr, auf den ich mich so verlassen würde.«
Frank sog an der Zigarre, ohne seinen Freund zu unterbrechen. Cornelius’ Gesichtsausdruck entnahm er, dass dieses Kompliment nicht viel mehr war als ein Gambit, und vermutlich würde er eine Weile warten müssen, ehe Cornelius den nächsten Zug offenbarte.
»Als ich vor dreißig Jahren die Firma gründete, hast du den ganzen Papierkram übernommen. Von da an habe ich keinerlei rechtsverbindliche Schriftstücke unterzeichnet, die du nicht vorher unter die Lupe genommen hast – was zweifellos in hohem Maße zu meinem Erfolg beitrug.«
»Es ist sehr großherzig von dir, dass du das sagst«, entgegnete Frank, bevor er einen weiteren Schluck Cognac nahm, »aber Tatsache ist, dass es immer dein Ideenreichtum und dein Unternehmungsgeist waren, die für das Wachstum der Firma sorgten – eine Begabung, mit der die Götter mich leider nicht beglückt haben. Immerhin hat es mir die Wahl erspart, etwas anderes werden zu wollen als Anwalt.«
»Du hast deinen Beitrag zum Erfolg der Firma stets unterschätzt, Frank, aber ich bin mir deines Wertes in all diesen Jahren durchaus bewusst.«
»Was führst du im Schilde?«, fragte Frank mit einem Lächeln.
»Geduld, mein Freund«, antwortete Cornelius. »Ich muss noch ein paar Züge machen, bevor ich meine Strategie offenbaren möchte.« Er lehnte sich zurück und sog gedankenvoll an seiner Zigarre. »Als ich die Firma vor vier Jahren verkaufte, wollte ich zum ersten Mal seit vielen Jahren ein wenig kürzer treten, wie du weißt. Ich hatte Millie eine lange Reise nach Indien und in den Fernen Osten versprochen ...« Er machte eine Pause. »Aber dazu ist es leider nicht mehr gekommen.«
Frank nickte verständnisvoll.
»Ihr Tod hat mich daran gemahnt, dass auch ich sterblich bin und vielleicht nicht mehr lange zu leben habe.«
»Nein, nein, mein Freund«, widersprach Frank. »Du hast noch viele Jahre vor dir.«
»Da magst du Recht haben.« Cornelius nickte. »Aber seltsamerweise hast gerade du mich dazu gebracht, mir ernste Gedanken über die Zukunft zu machen ...«
»Ich?« Frank blickte ihn verwundert an.
»Ja. Erinnerst du dich nicht? Vor ein paar Wochen hast du in diesem Sessel hier gesessen und gemeint, dass es an der Zeit wäre, mein Testament zu ändern.«
»Ja, schon. Aber doch nur, weil du fast alles Millie vermacht hattest.«
»Das ist mir klar. Nun, es hat mir jedenfalls den nötigen Anstoß gegeben. Weißt du, ich stehe immer noch jeden Morgen um sechs Uhr auf, aber da ich kein Büro mehr habe, in das ich gehen muss, verbringe ich zu viele Stunden mit quälenden Grübeleien, wie ich mein Vermögen aufteilen könnte, nun, da Millie nicht mehr die Haupterbin sein kann.«
Cornelius nahm einen weiteren langen Zug an seiner Zigarre, ehe er fortfuhr: »Seit ungefähr einem Monat habe ich mir Gedanken über die Menschen um mich herum gemacht – meine Verwandten, Freunde, Bekannten und ehemaligen Angestellten –, und ich habe mich gefragt, wie sie sich mir gegenüber verhalten haben. Das führte mich zu der Frage, wer von ihnen mir die gleiche Verehrung, Aufmerksamkeit und Loyalität zukommen ließe, wäre ich kein vielfacher Millionär, sondern ein mittelloser alter Mann.«
Frank lachte. »Hast du auch mich gewogen? Und für zu leicht befunden?«
»Nein, nein, mein lieber Freund«, rief Cornelius rasch. »Wenn ich bei dir auch nur die leisesten Zweifel hätte, würde ich dich nicht ins Vertrauen ziehen.«
»Aber sind solche Überlegungen nicht ein wenig unfair deiner Familie gegenüber, ganz zu schweigen von ...«
»Vielleicht, aber ich will nichts dem Zufall überlassen. Deshalb habe ich beschlossen, die Wahrheit selbst zu ergründen, denn alles andere wäre unbefriedigend.« Wieder machte Cornelius eine Pause und paffte an seiner Zigarre, ehe er fortfuhr: »Ich brauche deine Mithilfe, um meinen Plan in die Tat umzusetzen. Aber lass mir dir zuerst nachschenken.« Cornelius erhob sich, griff nach dem leeren Cognacschwenker seines Freundes und ging zum Sideboard.
»Wie ich schon sagte«, Cornelius reichte Frank das neu gefüllte Glas, »habe ich mir in letzter Zeit Gedanken gemacht, wie meine Mitmenschen sich verhalten würden, wenn ich ein armer Teufel wäre. Und nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, das herauszufinden.«
Frank nahm einen tiefen Schluck, ehe er fragte: »Was hast du vor? Einen vorgetäuschten Selbstmord?«
»Nichts so Dramatisches«, antwortete Cornelius. »Aber fast, denn ...« Wieder legte er eine Pause ein. »Ich beabsichtige, Bankrott zu machen.« Er starrte durch den Rauch und hoffte, die Reaktion seines Freundes zu erkennen. Doch wie so oft blieb die Miene des alten Anwalts undeutbar, zumal er erkannte, dass sein Freund zwar einen überraschenden Zug gemacht hatte, aber das Spiel noch lange nicht zu Ende war.
»Und wie willst du diese Sache durchziehen?«
»Ich möchte, dass du morgen Vormittag den fünf Personen schreibst, die das größte Anrecht auf mein Vermögen haben: meinem Bruder Hugh, seiner Frau Elizabeth, ihrem Sohn Timothy, meiner Schwester Margaret und meiner Haushälterin Pauline.«
»Und was soll ich schreiben?« Frank bemühte sich, nicht zu skeptisch zu erscheinen.
»Erklär ihnen, dass ich mich aufgrund einer überstürzten Investition nach dem Tod meiner Frau einer hohen Schuldenlast gegenübersehe. Dass ich ohne ihre Hilfe wahrscheinlich Konkurs anmelden muss.«
»Aber ...«, protestierte Frank.
Cornelius hob eine Hand. »Lass mich zu Ende reden«, bat er, »denn dir fällt die entscheidende Rolle in diesem Spiel zu. Sobald du sie überzeugt hast, dass sie keinerlei finanzielle Unterstützung von mir erwarten können, werde ich die zweite Phase meines Plans in die Tat umsetzen. Dabei dürfte sich herausstellen, ob sie sich etwas aus mir machen oder nur aus den Reichtümern, die sie sich von mir erhoffen.«
»Jetzt bin ich aber gespannt«, gestand Frank.
Cornelius blickte in sein fast leeres Glas.
»Wie du weißt, hat jede der fünf genannten Personen mich vor einiger Zeit um ein Darlehen gebeten. Ich habe mir keine Schuldscheine dafür geben lassen, sondern die Rückzahlung der Beträge als Ehrensache betrachtet. Diese Darlehen bewegen sich zwischen 100.000 Pfund für meinen Bruder Hugh, damit er den gepachteten Laden kaufen konnte – der, wie ich hörte, recht gut geht –, bis hinunter zu 500 Pfund als Anzahlung für einen Gebrauchtwagen, den meine Haushälterin Pauline erworben hat. Sogar der junge Timothy brauchte 1000 Pfund, um einen Kredit an die Universität zurückzahlen zu können. Er scheint in seinem Beruf recht gut voranzukommen; es dürfte also nicht zu viel verlangt sein, ihn und die anderen zu bitten, das Geld zurückzugeben.«
»Und der zweite Test?«, wollte Frank wissen.
»Seit Millies Tod hat jeder von ihnen mir bestimmte Gefälligkeiten erwiesen, die sie gern getan haben und die ihnen keine Mühe bereiteten – behaupten sie jedenfalls. Ich möchte herausfinden, ob sie bereit sind, sich diese Mühe auch für einen mittellosen alten Mann zu machen.«
»Aber wie willst du das mit Sicherheit feststellen?«, gab Frank zu bedenken.
»Es dürfte im Lauf der nächsten Wochen von selbst offensichtlich werden. Außerdem habe ich noch einen dritten Test, der keinen Zweifel mehr lassen wird, da bin ich mir sicher.«
Frank blickte zu seinem Freund hinüber. »Es hat wohl keinen Sinn zu versuchen, dir diese verrückte Idee auszureden?«
»Nein«, antwortete Cornelius ohne zu zögern. »Ich bin fest entschlossen. Natürlich weiß ich, dass ich ohne deine tätige Hilfe den ersten Zug nicht machen kann, geschweige denn, das ganze Spiel bis zum Ende durchziehen.«
»Wenn du es wirklich willst, Cornelius, werde ich deine Anweisungen wunschgemäß ausführen, wie ich es immer getan habe. Doch in diesem besonderen Fall stelle ich eine Bedingung.«
»Und die wäre?«, fragte Cornelius.
»Ich werde kein Honorar nehmen, damit ich ehrlichen Gewissens antworten kann, dass ich von diesem verrückten Vorhaben nicht profitiert habe, falls jemand mich fragt.«
»Aber ...«
»Kein Aber, alter Freund. Ich habe mit meinen Aktien einen ordentlichen Gewinn gemacht, als du das Unternehmen verkauft hast. Betrachte es als kleinen Versuch, dir zu danken.«
Cornelius lächelte. »Im Gegenteil, ich muss dir dankbar sein, und ich bin mir auch deiner unschätzbaren Hilfe bewusst, wie stets in all den Jahren. Du bist mir wirklich ein guter Freund, und du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass ich dir alles vermachen würde, wärst du nicht Junggeselle und wüsste ich nicht, dass du deine Lebensweise niemals auch nur einen Deut ändern würdest.«
»Da hast du völlig Recht.« Frank grinste. »Würdest du mir dein Hab und Gut vermachen, müsste ich meine zukünftigen Hinterbliebenen einer ebensolchen Prüfung unterziehen wie du.« Nach kurzer Pause fragte er: »Also, was ist dein erster Zug?«
Cornelius erhob sich aus dem Sessel. »Ich möchte, dass du morgen fünf Schreiben abschickst, in denen du die Betroffenen informierst, dass ich vor dem Konkurs stehe und um die möglichst umgehende Rückzahlung der Außenstände bitten muss.«
Frank kritzelte bereits in dem kleinen Notizbuch, das er stets bei sich trug. Zwanzig Minuten später, nachdem er Cornelius’ letzten Punkt für den Tag eingetragen hatte, steckte er das Notizbuch ein, leerte seinen Schwenker und drückte die Zigarre aus.
Als Cornelius ihn schließlich zur Haustür begleitete, fragte Frank: »Verrätst du mir jetzt, was der dritte Test ist, von dem du so überzeugt bist, dass er ausschlaggebend sein wird?«
Der alte Anwalt hörte aufmerksam zu, während Cornelius ihm mit wenigen Worten seinen genialen Plan erklärte. Frank war überzeugt, dass den Opfern gar nichts anderes übrig blieb, als Farbe zu bekennen.
Am Samstagmorgen erhielt Cornelius den ersten Anruf von seinem Bruder Hugh, der gleich nach Erhalt des Schreibens zum Telefon gegriffen haben musste. Cornelius hatte das sichere Gefühl, dass jemand mithörte.
»Ich habe soeben einen Brief von deinem Anwalt bekommen«, begann Hugh. »Ich kann es einfach nicht glauben. Bitte sag mir, dass das Ganze ein Irrtum ist.«
»Ich fürchte, es ist keiner«, entgegnete Cornelius. »Ich wünschte, es wäre so.«
»Aber du warst doch sonst immer so geschäftstüchtig! Wie konnte ausgerechnet dir das passieren?«
»Auch ich werde nicht jünger«, erwiderte Cornelius. »Ein paar Wochen nach Millies Tod hat man mich überredet, eine große Summe in eine Firma zu investieren, die darauf spezialisiert war, die Russen mit Fördermaschinen zu beliefern. Wir haben alle von den unerschöpflichen Erdölvorkommen der Russen gelesen, und dass man nur herankommen müsse. Deshalb war ich überzeugt, dass meine Investition eine ordentliche Rendite bringt. Doch letzten Freitag habe ich erfahren, dass die Firma pleite ist.«
»Aber du hast doch sicher nicht alles in diese eine Firma gesteckt?«, fragte Hugh, noch ungläubiger als zuvor.
»Ursprünglich natürlich nicht«, antwortete Cornelius. »Aber ich fürchte, ich ließ mich jedes Mal aufs Neue überreden, wenn sie wieder mal Kapital brauchten. Schließlich musste ich immer mehr hineinstecken, weil es mir die einzige Möglichkeit schien, meine ursprüngliche Investition zurückzubekommen.«
»Hat diese Firma denn kein Anlagevermögen, das du rechtlich beanspruchen kannst? Was ist mit all den Maschinen?«
»Sie verrosten irgendwo in der Tunguska, und wir haben noch keinen Milliliter Öl gesehen.«
»Warum hast du dich nicht aus diesem Geschäft zurückgezogen, als die Verluste sich noch in Grenzen hielten?«, fragte Hugh.
»Aus Stolz, nehme ich an. Ich wollte nicht einmal mir selbst gegenüber zugeben, dass ich aufs falsche Pferd gesetzt habe. Außerdem glaubte ich insgeheim, dass meine Investition schließlich doch noch einigen Gewinn abwerfen würde.«
»Aber diese Leute müssen doch irgendeine Entschädigung bieten«, sagte Hugh verzweifelt.
»Keinen Penny«, entgegnete Cornelius. »Ich kann es mir nicht einmal mehr leisten, hinzufliegen und ein paar Tage in Russland zu verbringen, um mir selbst ein Bild zu machen.«
»Wie viel Zeit hat man dir gegeben?«
»Der Konkurs wurde bereits angemeldet. Es hängt also alles davon ab, wie viel Geld ich so kurzfristig auftreiben kann.« Cornelius legte eine Pause ein. »Es tut mir Leid, dass ich dich daran erinnern muss, Hugh, aber du hast sicher nicht vergessen, dass ich dir vor längerer Zeit 100.000 Pfund geliehen habe. Deshalb hoffe ich ...«
»Aber du weißt doch, dass wir die gesamte Summe in den Laden gesteckt haben, und da das Geschäft noch nie so schlecht ging wie zurzeit, glaube ich nicht, dass ich momentan mehr als ein paar Tausender zusammenkratzen kann.«