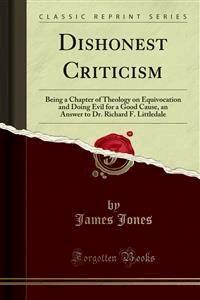12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Ein weltberühmter Klassiker der amerikanischen Nachkriegsliteratur, der seinen Siegeszug um die Welt antrat und kurz nach Erscheinen verfilmt wurde. Erzählt wird die Geschichte des einfachen amerikanischen Soldaten Priwitt, der mit seiner Kompanie auf Hawaii stationiert ist. Weil er glaubt, auch als Soldat ein Anrecht auf eine menschliche Behandlung zu haben, beginnt eine erbitterte Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem Vorgesetzten. ›Verdammt in alle Ewigkeit‹ zeichnet ein schonungsloses Porträt der amerikanischen Armee auf Hawaii kurz vor der Katastrophe. Mit dem Fall japanischer Bomben auf Pearl Harbor tritt Amerika in den Zweiten Weltkrieg ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1689
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
James Jones
Verdammt in alle Ewigkeit
Roman
Über dieses Buch
Hawai kurz vor dem Angriff auf Pearl Harbour: In diesem weltberühmten Klassiker der Weltliteratur erzählt James Jones die Geschichte des Soldaten Prewitt, der grausam schickaniert wird, als er sich weigert, in die Boxstaffel der Kompanie einzutreten. James Jones erzählt von einem Soldatenleben zwischen Auflehnung und Gehorsam und zeigt beispielhaft, dass der Einzelne in der brutalen Welt der Uniformierten keine Chance hat.
Spannend, knallhart und anklagend: ›Verdammt in alle Ewigkeit‹ schockierte bei seinem Erscheinen die Öffentlichkeit in den USA. Der Roman wurde ein internationaler Bestseller und 1953 mit Frank Sinatra, Montgomery Clift, Burt Lancaster und Deborah Kerr verfilmt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
James Jones, 1921 in Robinson im amerikanischen Bundesstaat Illinois geboren, stammt aus einer verarmten bürgerlichen Familie. Von 1939 bis 1944 war er Soldat auf Hawaii. Während eines Fronteinsatzes liest er Thomas Wolfe und beginnt selber zu schreiben. Der Verlag Scribner in New York erkennt sein Talent und fördert seine Arbeit an dem Roman ›Verdammt in alle Ewigkeit‹, der als Buch und Kinofilm zu seinem größten Erfolg wird. James Jones starb 1977 in Southampton, New York.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Die Sphinx muß ihr [...]
Verlorene Söhne durchbummeln die [...]
Erstes Buch - Die Versetzung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Zweites Buch - Die Kompanie
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Drittes Buch - Die Weiber
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Viertes Buch - Das Militärgefängnis
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
Fünftes Buch - Das Lied fängt wieder an
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
Dreißigender-Melodie
Wenn ich jetzt zurückblicke, [...]
Die Sphinx muß ihr eigenes Rätsel lösen.
Wenn die Gesamtheit der Geschichte
im einzelnen Menschen vorhanden ist,
dann kann alles aus der Erfahrung
des einzelnen heraus erklärt werden.
Emerson, Essays
Hab Dein Brot gegessen und auch Dein Salz,
Deine Wasser getrunken und Deine Weine,
Deinen Tod oft gesehn im Vorübergehn
Und Dein Leben gelebt, als wär es das meine.
Rudyard Kipling
Verlorene Söhne durchbummeln die Zeit
Verdammt in alle Ewigkeit.
Erbarm Dich, Herr, unserer Wenigkeit
Bah! Yah! Yah!
Rudyard Kipling
Aus Gentlemen Rankers in Barrack-room Ballads
Erstes BuchDie Versetzung
1
Als er mit Packen fertig war, wischte er sich den Staub von den Händen und ging hinaus auf die Veranda des dritten Stocks der Kaserne, ein sauber und etwas schmächtig wirkender junger Mann in seiner Sommeruniform, die noch die Frische des frühen Morgens an sich hatte.
Er legte seine Ellenbogen auf das Geländer und schaute durch die Fliegenfenster auf die ihm so bekannte Szene des Kasernenhofes unter ihm, umgeben von den dreistöckigen Gebäuden mit ihren dunklen Umgängen vor den hellen Betonwänden. Wie sehr er an dem guten Posten hing, den er aufgab, wurde ihm jetzt erst klar.
Unter ihm keuchte das Viereck des Kasernenhofes unter den Schlägen der Februarsonne, schutzlos, wie ein erschöpfter Boxer. Durch das Flimmern der Hitze und den feinen spätmorgendlichen Dunst des ausgetrockneten roten Staubes kam das gedämpfte Gewirr von Geräuschen: das Scheppern von stahlbereiften Karren, das Schlappen geölter Gewehrriemen, der schlürfende Takt verbrannter Schuhsohlen, die heiseren Flüche gereizter Unteroffiziere.
Irgendwann im Laufe deines Lebens sind diese Dinge zu deinem Besitz geworden. Mit jedem Ton, den du hörst, wirst du selbst gesteigert. Und du kannst sie nicht verleugnen, ohne mit ihnen den Zweck deiner eigenen Existenz zu leugnen. Trotzdem, so sagte er sich selbst, negierst du sie dadurch, daß du den Posten aufgibst, den man dir gegeben hat.
Auf dem ungepflasterten Platz in der Mitte des Quadrats quälte sich eine Maschinengewehrkompanie gelangweilt durch die Übungen des Ladedrills.
Hinter ihm in dem hohen Raume hing wie ein wehender Vorhang das gedämpfte Geräusch, das entsteht, wenn Männer gerade erwachen und anfangen, sich zu bewegen. Er lauschte auf diese Töne, hörte auch Schritte näher kommen, während er daran dachte, wie angenehm es für ihn als Mitglied des Musikzuges gewesen war, jeden Morgen lange schlafen zu können und sich erst von den Geräuschen der draußen exerzierenden Kompanie wecken zu lassen. »Du hast doch meine guten Schuhe nicht eingepackt?« fragte er die Schritte. »Die bekommen so leicht Kratzer.«
»Beide Paare stehen auf dem Bett«, sagte die Stimme hinter ihm. »Zusammen mit den sauberen Uniformen, die du nicht zerdrückt haben wolltest. Deine Feldstiefel hab ich im zweiten Sack verstaut.«
»Das ist dann wohl alles, glaube ich«, sagte der junge Mann. Er richtete sich auf und seufzte, wie man seufzt, wenn eine seelische Spannung nachläßt. »Gehen wir essen«, sagte er. »Ich hab noch eine Stunde Zeit, ehe ich mich bei der 6. Kompanie melden muß.«
»Ich denk noch immer, du machst einen schweren Fehler«, sagte der Mann hinter ihm.
»Ja, ich weiß, du hast’s mir gesagt. Zwei Wochen lang täglich. Du verstehst das einfach nicht, Red.«
»Vielleicht nicht«, sagte der andere. »Ich bin kein Gefühlsexperte. Aber eins weiß ich. Ich bin ein guter Hornist und bin stolz darauf. Aber an dich reiche ich nicht ran. Du bist der beste Hornist im Regiment. Vielleicht der beste in den Schofield-Kasernen überhaupt.«
Der junge Mann stimmte gedankenvoll zu. »Das stimmt.«
»Na ja, warum willst du’s dann aufgeben und läßt dich versetzen?«
»Ich will’s ja gar nicht, Red.«
»Aber du läßt dich doch versetzen.«
»O nein, ich laß mich nicht. Du vergißt. Ich werde versetzt. Das ist ein Unterschied.«
»Nu hör aber mal zu«, sagte Red hitzig.
»Hör du zu, Red. Gehen wir rüber zu Choys, und frühstücken wir was. Ehe die ganze Bande hinkommt und seinen Vorrat auffrißt.«
Er machte eine Kopfbewegung nach dem erwachenden Schlafraum hin.
»Du benimmst dich wie ein Kind«, sagte Red. »Du wirst genausowenig versetzt wie ich. Wenn du nicht hingegangen wärst zu Houston und dein Maul aufgerissen hättest, wäre gar nichts passiert.«
»Stimmt.«
»Vielleicht hat Houston dir wirklich seinen jungen Affen als ersten Hornisten vor die Nase gesetzt. Und wenn schon? Das ist eine Formalität. Du hast noch immer deinen Rang. Der Scheißkerl kann höchstens den Zapfenstreich bei Beerdigungen blasen, das ist alles, was er davon hat.«
»Das ist alles.«
»Es wäre anders, wenn Houston dich hätte degradieren lassen und dem Jüngling deine Stellung gegeben hätte. Dann würd ich dir keinen Vorwurf machen. Aber du hast ja noch immer deinen Rang.«
»Nein, den hab ich nicht mehr. Nicht mehr, seit Houston den Alten gebeten hat, mich zu versetzen.«
»Wenn du jetzt zum Alten gehst, wie ich dir’s sage, kostet es dich nur ein Wort, und du hast deinen Rang zurück. Mit und ohne Chefhornist Houston.«
»Stimmt. Und Houstons junger Affe wäre trotzdem noch erster Hornist. Außerdem sind die Papiere schon durch. Gelesen, genehmigt und unterschrieben.«
»Zum Teufel«, sagte Red angewidert. »Mit unterschriebenen Papieren kannst du dir, du weißt schon was, abwischen; mehr sind die nicht wert. Du kannst das Ding drehen, Prew.«
»Willst du mit mir essen«, sagte der junge Mann, »oder willst du nicht?«
»Ich bin pleite«, sagte Red.
»Hab ich dich darum gebeten, zu zahlen? Das geht auf meine Kosten. Ich werde ja versetzt, nicht du.«
»Du sparst besser dein Geld. Die können uns in der Küche was geben.«
»Ich hab keine Lust, diesen Dreck zu fressen, wenigstens nicht heute morgen.«
»Es gab Spiegeleier heute morgen«, verbesserte ihn Red. »Wir können sie noch heiß erwischen. Da, wo du hingehst, wirst du dein Geld brauchen.«
»Ja, ja, von mir aus«, sagte der junge Mann. »Aber laß mir doch den Spaß. Ich will einen ausgeben, weil ich weggehe. Weiter nichts. Willst du nu, oder willst du nicht?«
»Gut«, sagte Red angewidert.
Sie gingen die Treppen hinunter und dann den Fußweg, entlang der A-Kompanie, wo der Musikzug Quartier hatte, überquerten die Straße und gingen am Stabsgebäude vorbei zum Kaserneneingang. Die Sonnenhitze fiel über sie her und drückte sie nieder, als sie die Veranda verließen, und ebenso schnell verschwand sie, als sie den Tunnel betraten, der durch das Stabsgebäude ging und jetzt ›Ausfalltor‹ genannt wurde zur Erinnerung an alte Festungszeiten. Er war in den Farben des Regiments angestrichen und beherbergte in einem lackierten Kasten die größten Sporttrophäen des Regiments.
»Das ist mir ne dumme Geschichte!« sagte Red zögernd. »Du kommst noch in den Ruf, ein Bolschewik zu sein. Du machst unnötigen Ärger, Prew.«
Das Restaurant war leer. Choy Vater und Sohn klapperten hinter der Theke. Der weiße Bart und das schwarze Käppchen verschwanden sofort nach hinten in die Küche, und Choy junior, der junge Sam Choy, bediente sie.
»Hallo, Prew«, sagte Choy junior. »Ich hören, du gehen irgendwann bald auf andere Seite Straße, wie?«
»Genau«, sagte Prew. »Heute.«
»Heute!« Choy junior grinste. »Versetzung heute?«
»Jawohl«, sagte er brummend. »Heute.«
Choy junior, noch immer grinsend, schüttelte traurig seinen Kopf. Er schaute Red an. »Verrückter Hund. Will richtigen Dienst tun, statt Trompete blasen.«
»Hör mal«, sagte Prew, »was hältst du davon, uns unser Essen ranzuschaffen?
»Gut, gut.« Choy junior grinste. »Bringen sofort.«
Er ging hinter die Theke zu der Schwingtür, die in die Küche führte.
Prew sah ihm nach. »Scheiß-Chinese«, sagte er.
»Choy junior ist in Ordnung«, sagte Red.
»Sicher. Auch Choy senior ist in Ordnung.«
»Will nur helfen.«
»Natürlich. Wie andere auch.«
Red zuckte verlegen mit den Schultern, und schweigend saßen sie in der dämmerigen Kühle, lauschten auf das faule Summen des elektrischen Ventilators hoch oben an der einen Wand, bis Choy junior die Eier und den Schinken und den Kaffee brachte. Durch die Flügeltür wehte eine schwache Brise die verschlafen regelmäßigen Glockentöne gleichmäßig bewegter Gewehrschlösser herein, der Ladedrill der Kompanie, ein geisterhafter Vorgeschmack, der Prew den Genuß daran verdarb, während des Morgendienstes anderer zu faulenzen.
»Du prima Nummer«, sagte Choy junior, als er grinsend und seinen Kopf traurig schüttelnd zurückkam. »Du Kapitulantenmaterial.« Prew lachte. »Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich bin ein ›Dreißigender‹!«
Red war dabei, ein Ei zu zerschneiden. »Was wird deine Wahina sagen, dein Hawaii-Mädchen? Besonders, wenn sie rausbekommt, daß du deine Tressen loswirst durch die Versetzung?«
Prew schüttelte den Kopf und begann zu kauen.
»Alles stellt sich gegen dich«, sagte Red vernünftig, »selbst deine Wahina.«
»Ich wollte nur, sie tät’s, grad jetzt in diesem Augenblick richtig gegen mich gepreßt«, grinste Prew.
Red ließ sich nicht zum Lachen bringen. »Private Liebchen wachsen nicht auf Bäumen«, sagte er. »Huren sind in Ordnung. Im ersten Jahr. Für Anfänger. Aber ein gutes Privatliebchen ist schwer zu finden. Zu schwer, als daß man riskieren könnte, es zu verlieren. Du wirst nicht mehr jede Nacht nach Hawaii gehen können, wenn du gewöhnlichen Dienst in einer Infanteriekompanie tust.«
Prew starrte auf seinen runden Schinkenknochen, ehe er ihn in die Hand nahm und das Mark aussaugte. »Ich denke, sie wird sich selbst entscheiden müssen, Red. Wie jeder Mensch es schließlich tun muß. Du weißt, diese Sache lag schon lange in der Luft. Nicht nur, weil Houston seinen kleinen Engel als ersten Hornisten über mich gesetzt hat.«
Red studierte sein Gesicht. Houstons Vorliebe für junge Männer war allgemein bekannt, und Red fragte sich, ob Houston vielleicht versucht hatte, mit Prew vertraulich zu werden. Das konnte es aber nicht sein. Prew würde ihn halb totgeschlagen haben – Obermusikmeister oder nicht.
»Ein guter Witz«, sagte Red bitter, »sich selbst entscheiden. Wo sitzt ihr Verstand? In ihrem Kopf oder weiter unten zwischen den Beinen?«
»Halt dein gottverdammtes Maul. Seit wann geht dich mein Privatleben überhaupt was an? Damit du’s weißt: Ihr Verstand ist zwischen ihren Beinen, und so gefällt’s mir, verstehst du mich?«
Ich Lügner, dachte er.
»Schon gut«, sagte Red. »Reg dich ab. Was liegt mir schon daran, ob du dich versetzen läßt?« Er nahm ein Stück Brot und tat die ganze Geschichte damit ab, daß er mit dem Brot das Eigelb von seinem Teller wischte, es in den Mund steckte und das ganze mit Kaffee hinunterspülte.
Prew zündete sich eine Zigarette an und wandte den Kopf, um einpaar Kompanieschreiber zu beobachten, die gerade hereingekommen waren. Sie hockten in einer Ecke und tranken Kaffee, obwohl sie eigentlich in der Personalabteilung bei der Arbeit hätten sein sollen. Sie glichen alle einander, waren alle spindeldürr, mit zerbrechlichen Gesichtern, die für nichts anderes als die durchgeistigte Überlegenheit der Büroarbeit geschaffen schienen. Er hörte die Worte ›Van Gogh‹ und ›Gauguin‹. Ein Langer sprach eine kleine Weile, und die anderen warteten darauf, ihre eigene Meinung anbringen zu können, dann, während einer Atempause, bemächtigte sich ein anderer des Wortes, und der erste schaute ärgerlich drein, und von neuem warteten alle anderen. Prew grinste.
Merkwürdig, dachte er, wie man immer gezwungen wird, solche Sachen zu entscheiden. Man entschied eine Sache mit größter Anstrengung richtig und dachte, man könne sich nun eine Zeitlang treiben lassen. Am nächsten Tag aber hatte man etwas Neues zu entscheiden. Und solange man sich richtig entschied, mußte man fortfahren, sich zu entscheiden. Jeder Tag tausend Jahre lang, dachte er. Und auf der anderen Seite waren Red und die jungen Leute da drüben, die aller weiteren Entscheidungen enthoben waren, weil sie einmal falsch entschieden hatten. Red war für gesicherte Bequemlichkeit durch Anpassung. Gewöhnlich gewann diese Art von Bequemlichkeit das Rennen. Red konnte sich zurückziehen und seinen Gewinn genießen. Red würde nicht einen Druckposten wie den Musikzug aus gekränktem Stolz aufgeben. Manchmal war er selbst verwirrt und konnte sich nicht ganz genau erinnern, was der Grund war, die Notwendigkeit, die am Anfang dieser endlosen Kette neuer Entscheidungen gestanden hatte.
Red versuchte es mit der Logik. »Du bist Gefreiter und Spezialist vierter Klasse. Du übst zwei Stunden am Tage, und die übrige Zeit gehört dir. Du führst ein angenehmes Leben.«
»Jedes Regiment hat seinen Musikzug. Das ist Standard. ’s ist genau wie ein Handwerk draußen. Wir schöpfen den Rahm ab, weil wir was Besonderes können.«
»Das Handwerk draußen schöpft nicht den Rahm ab. Die sind froh, wenn sie überhaupt Aufträge kriegen.«
»Das ist’s nicht, worauf’s ankommt«, sagte Red angewidert. »So ist’s nur, wenn die Geschäfte schlecht gehen … was glaubst du, warum ich in der Scheiß-Armee bin?«
»Ich weiß nicht. Warum bist du drin?«
»Weil«, sagte Red triumphierend, »– aus genau dem gleichen Grund wie du. Weil ich drin besser leben kann als draußen. Ich war nicht gerade begeistert vom Hungern.«
»Das ist logisch«, grinste Prew.
»Verdammt richtig. Ich bin logisch. Das sagt mir einfach mein gesunder Menschenverstand. Was glaubst du denn, warum ich in diesem Musikzug bin?«
»Weil’s logisch ist«, sagte Prew. »Nur, daß das nicht der Grund ist, warum ich in der Armee bin. Und ich bin sicher, daß es auch nicht der Grund ist, warum ich im Musikzug bin oder – besser – war.«
»Ich weiß«, sagte Red. »Jetzt fängt gleich der Quatsch von dem ›Dreißigender‹ an.«
»Jawohl«, sagte Prew. »Und was könnte ich Besseres sein? Ich? Ein Mann muß einen Platz haben, wo er hingehört.«
»Gut«, sagte Red. »Wenn du aber ein ›Dreißigender‹ bist und gern das Horn bläst, warum gibst du’s dann auf? Du bist eben kein wirklicher ›Dreißigender‹.«
»Richtig«, sagte Prew. »Wollen wir dich mal ansehen. Seit die Depression vorüber ist und sie angefangen haben, Material herzustellen, um es für diesen Krieg nach England zu schicken, seit sie begonnen haben, im Frieden Leute einzuziehen, sitzt du da drinnen hinter deinem gesunden Menschenverstand wie ein Affe hinterm Gitter. Deine frühere Stellung wartet auf dich, aber du kannst dich nicht mal mehr freikaufen, nachdem sie die Dienstpflicht eingeführt haben.«
»Ich trete auf der Stelle«, erklärte ihm Red. »Ich habe nicht gehungert, seit es diese Haubitzen gibt, und ehe wir in diesen gottverdammten Krieg eintreten, ist meine Dienstpflicht um, und ich bin zu Hause, und zwar in einer schönen, sicheren Stellung, wo ich Periskope für Panzer baue, während ihr ›Dreißigender‹ die Ärsche abgeschossen bekommt.«
Während Prew zuhörte, verwandelte sich das bewegliche Gesicht vor ihm in einen kampfgeschwärzten Schädel, als wäre ein Flammenwerfer über ihn hinweggegangen, hätte ihn mit seinem Kuß gestreift und sich entfernt. Der Schädel fuhr fort, mit ihm über seine Gesundheit zu sprechen. Und er erinnerte sich jetzt, weshalb er so dringend die richtige Entscheidung treffen mußte. Es war wie bei einer Jungfrau. Eine einzige falsche Entscheidung genügte, um alles zu verderben. Eine einzige Entscheidung, und man war niemals wieder der gleiche. Ein Mann, der zuviel aß, wurde fett, und wenn er sich davor schützen wollte, mußte er aufhören, viel zu essen. Für ehemalige Athleten gab es keine Ausrede mit elastischen Korsetts, patentierten Rudermaschinen oder synthetischer Diät … nicht, wenn man zuviel aß. Wenn man mit dem Leben Karten spielte, mußte man das Kartenspiel des Lebens benutzen, nicht sein eigenes.
Sein Problem war, daß er Musiker werden wollte. Red konnte gut Signale blasen, weil er kein Musiker war. Es war wirklich sehr einfach, so einfach, daß er überrascht darüber war, es nicht zuvor bemerkt zu haben. Er mußte den Musikzug verlassen, weil er ein Musikant war. Red brauchte ihn nicht zu verlassen. Er aber mußte ihn verlassen, weil er mehr als alle anderen bleiben wollte.
Prew stand auf und schaute auf die Uhr. »Es ist Viertel vor neun«, sagte er. »Ich muß um halb zehn bei der G-Kompanie antreten.«
Er grinste, als er die letzten Worte sagte, und verzog seinen Mund, wie es ein schlecht versilberter Spiegel mit Gesichtern macht.
»Setz dich noch einen Augenblick«, sagte Red. »Ich wollte eigentlich nicht darüber sprechen, aber ich sehe mich dazu gezwungen.«
Prew schaute auf ihn hinab und setzte sich wieder. Er wußte, was Red sagen würde. »Mach schnell«, sagte er. »Ich muß gehn.«
»Du weißt, wer der Chef der G-Kompanie ist, nicht wahr, Prew?«
»Natürlich weiß ich es.«
Red konnte keine Ruhe geben. »Hauptmann Dana E. Holmes«, sagte er. »Dynamit-Holmes. Der Boxtrainer des Regiments.«
»Jawohl«, sagte Prew.
»Ich weiß genau Bescheid, warum du dich letztes Jahr hierher versetzen ließest«, sagte Red. »Ich weiß Bescheid über Dixie Wells. Du hast mir’s nie erzählt, aber ich weiß es doch. Jeder weiß es.«
»Gut«, sagte Prew. »Es ist mir egal, wer es weiß. Ich habe nicht erwartet, daß es ein Geheimnis bleiben würde«, sagte er.
»Du hast das 27ste verlassen«, sagte Red. »Als du aus der Boxriege ausgetreten bist und es ablehntest, wieder in den Ring zu gehen, hast du dich versetzen lassen müssen. Weil sie dich nicht in Ruhe ließen, nicht zuließen, daß du in Frieden das Boxen aufstecktest. Sie verfolgten dich und setzten dich unter Druck. Bis du dich versetzen ließt.«
»Ich tat, was ich tun wollte«, sagte Prew.
»Wirklich?« sagte Red. »Kapierst du denn nicht, was los ist?« sagte er. »Sie werden dich immer wieder verfolgen. In unserer Zeit kann keiner friedlich seinen Weg gehen. Nicht, wenn er nicht bereit ist, sich anzupassen.
Vielleicht konnte einer in den guten alten Tagen, in der Zeit der Pioniere, noch das, was er wirklich wollte, in Frieden tun. Aber damals hatte er die Wälder und konnte in die Wälder gehen und allein leben. Im Wald konnte er gut leben. Und wenn man ihm aus diesem oder jenem Grund folgte, so konnte er einfach weiterwandern. Immer lagen noch mehr Wälder vor ihm. Heute aber kann er das nicht tun. Er muß sich anpassen. Alles muß er durch zwei teilen.
Ich hab’s dir gegenüber niemals erwähnt«, fuhr Red fort. »Aber ich hab dich letztes Jahr in der Bowl boxen sehen. Ich und mehrere tausend andere. Auch Holmes hat dich gesehen. Ich hab geschwitzt, wenn ich daran dachte, daß er dich jeden Augenblick drankriegen könnte.«
»Ich auch«, sagte Prew. »Ich glaube einfach, er hat niemals herausgefunden, daß ich hier bin.«
»Er wird’s aber nicht auf Formular 20 übersehen, wenn du in seiner Kompanie bist. Er wird dich für seine Boxriege haben wollen.«
»’s gibt keine Vorschrift, daß einer boxen muß, wenn er nicht will.«
»Komm, komm«, spottete Red. »Denkst du, das Armee-Reglement wird ihn stören? Wenn der Große Weiße Vater die Meisterschaft behalten will? Denkst du, er wird einen Boxer von deinem Format einfach im Winterschlaf versauern lassen? In seiner eigenen Kompanie? Ohne für das Regiment zu kämpfen? Nur, weil du dich einmal dafür entschieden hast, nicht mehr in den Ring zu gehn? Nicht einmal ein Genie wie du kann so blöd sein und das glauben.«
»Ich weiß nicht«, sagte Prew. »Häuptling Choate ist in seiner Kompanie. Häuptling Choate war einmal Schwergewichtsmeister in Panama.«
»Ja«, sagte Red. »Aber Häuptling Choate ist des Großen Weißen Vaters Liebling, weil er der beste Baseballspieler der Hawaii-Gruppe ist. Holmes kann ihn nicht groß unter Druck setzen. Trotzdem, Häuptling Choate ist jetzt schon vier Jahre in der Kompanie und immer noch Unteroffizier.«
»Aber«, sagte Prew, »wenn Häuptling Choate sich versetzen ließe? In jeder anderen Kompanie könnte er Feldwebel werden. Wenn es zu dick wird, denke ich, kann ich mich jederzeit wieder versetzen lassen.«
»Wirklich?« sagte Red. »Du glaubst das? Weißt du, wer Spieß der G-Kompanie ist?«
»Klar«, sagte Prew. »Warden.«
»Richtig, Mensch«, sagte Red. »Milton Anthony Warden. Der früher einmal Feldwebel in der A-Kompanie war. Der gemeinste Schweinehund in der ganzen Schofield-Kaserne. Und der haßt dich wie Gift.«
»Komisch«, sagte Prew. »Ich habe nie gemerkt, daß Warden mich haßt. Ich hasse ihn nicht.«
Red lächelte bitter. »Nach all den Krächen, die du mit ihm gehabt hast? Nicht einmal du kannst so blöd sein.«
»Es lag nicht an ihm«, sagte Prew. »Das verlangte der Dienst.«
»Was der Dienst verlangt, hängt immer noch davon ab, was einer gerne will«, sagte Red. »Und jetzt ist er nicht bloß Feldwebel. Jetzt hat er zwei Streifen mehr. Hör zu, Prew. Alles ist gegen dich. Du spielst ein Spiel, in dem alle Trümpfe in der anderen Hand sind.«
Prew nickte. »Ich weiß«, sagte er.
»Geh rauf und sprich mit dem Alten«, bat Red. »Heute früh ist noch Zeit dazu. Ich rate dir schon nichts Falsches. Mein ganzes Leben lang hab ich manövrieren müssen, wenn ich was haben wollte. Ich spür’s im Knie, in welche Richtung eine Sache läuft. Du brauchst gar nichts zu tun als den Alten aufsuchen. Er wird die Papiere zerreißen.«
In diesem Augenblick stand Prew auf, und wie er so dastand und in das ängstliche Gesicht seines Freundes schaute, konnte er die Kraft der Aufrichtigkeit spüren, die aus Reds Augen strömte … ihn überströmte mit der konzentrierten Energie eines Wasserstrahls aus einem Feuerwehrschlauch. Und irgendwie erstaunte es ihn, daß es diese Kraft da gab und er sie sehen konnte, wie sie ihn anflehte.
»Ich kann’s nicht tun, Red«, sagte er.
Als ob er nun zum erstenmal tatsächlich alles aufgebe und wirklich an das Unabänderliche glaube, sackte Red auf seinem Stuhl zusammen; die Energie war verschwendet und verbraucht im Anprall gegen diese Wand, die er nicht begriff.
»Es ist furchtbar für mich, daß du gehst«, sagte er.
»Ich kann einfach nichts daran ändern«, sagte Prew.
»Meinetwegen«, sagte Red. »Mach was du willst. Es ist dein Begräbnis.«
»So ist es«, sagte Prewitt.
Reds Zunge strich langsam tastend über seine Zähne. »Was machst du mit der Gitarre, Prew?«
»Behalt sie. Sie gehört dir sowieso zur Hälfte. Ich werd sie nicht brauchen können«, sagte Prew.
Der andere hustete. »Zumindest müßte ich dir deine Hälfte bezahlen. Bloß bin ich ausgerechnet jetzt pleite«, fügte er hastig hinzu. Prewitt grinste. Das war wieder Red, wie er ihn kannte. »Ich schenk dir meine Hälfte, Red. Bedingungslos. Oder? Willst du sie nicht?«
»Sicher. Aber?«
»Dann behalt sie. Wenn dich dein Gewissen plagt, kannst du dir ja sagen, ’s ist dafür, daß du mir beim Packen geholfen hast.«
»Das möchte ich aber nicht.«
»Na schön«, sagte Prew, »denk eben, daß ich ab und zu rüberkomme. Ich verschwinde ja nicht. Ich komme ab und zu rüber und spiele drauf.«
»Nein, du kommst nicht«, sagte Red. »Das wissen wir beide. Wenn einer geht, dann geht er ganz und gar. Die Entfernung spielt dabei keine Rolle.«
Vor dieser harten Wahrheit mußte Prew die Augen senken. Red hatte recht, und Prew wußte es, und Red wußte, daß er es wußte. Eine Versetzung in der Armee war wie ein Umzug im Zivilleben von einer Stadt in eine andere. Die Freunde zogen entweder mit, oder man verlor einander. Selbst wenn er von einer Stadt, die er liebte, in eine Stadt zog, in der er ein Fremder war. Die Abenteuer, die solche Wanderungen boten, wurden im Film ungeheuer übertrieben, und beide wußten es. Es waren keine Abenteuer, die Prewitt suchte. Red sah, daß Prew sich keine Illusionen darüber machte.
»Der beste Hornist im ganzen Regiment«, sagte er hilflos. »Der gibt nicht einfach auf und kloppt wieder gewöhnlichen Dienst. Das tut man einfach nicht.«
»Die Gitarre gehört dir«, sagte Prew. »Und ich komme zurück und spiel von Zeit zu Zeit auf ihr«, log er. Er wandte sich schnell ab, so daß er Reds Blicken nicht begegnen mußte. »Ich muß gehen.«
Red folgte ihm mit den Augen bis zur Tür, und aus Mitgefühl widersprach er ihm nicht. Nie war es Prew gelungen, überzeugend zu lügen.
»Viel Glück!« rief Red ihm nach. Er beobachtete ihn, bis sich die Tür schloß. Dann nahm er seine Kaffeetasse hinüber zur Theke, wo Choy junior bei dem dampfbeschlagenen Nickelkessel der Kaffeemaschine mit ihren Hähnen und Glasröhren betriebsam schwitzte. Er wünschte, daß es fünf Uhr wäre und er anstatt des Kaffees ein Bier bekommen könnte.
Draußen beim Kaserneneingang setzte Prew seine Feldmütze auf, tief in die Stirn, hinten hoch, ein ganz klein wenig zur Seite gerückt. Steif wie ein Brett saß die Mütze auf seinem Kopf, eine frisch aufgebügelte Krone, das stolze Zeichen seines Standes.
Einen Augenblick stand er vor dem lackierten Trophäenkasten, fühlte die schwache Brise, die sich in dem schattigen Kaserneneingang sammelte, wie Regen sich in einem Trichter sammelt. Unter anderen Bechern und Statuen, auf dem Ehrenplatz, stand der Wanderpreis der Hawaiischen Abteilung, den Holmes’ Leute im vergangenen Jahr gewonnen hatten … zwei goldene Boxer in einem Ring aus goldenen Seilen.
Er trat hinunter aufs Trottoir, schritt katzengleich auf den Ballen seiner Füße in der Art, wie ein Boxer schreitet, den Kopf leicht geneigt, sauber, fleckenlos, entschieden … das Bild eines Soldaten.
2
Robert E. Lee Prewitt hatte Gitarre spielen gelernt, lange bevor er das Horn geblasen oder geboxt hatte. Er lernte es als Junge, und gleichzeitig lernte er auch eine Menge trauriger und klagender Lieder. In den Bergen von Kentucky, an der Grenze von West-Virginia, führte das Leben schnell zu dieser Art von Musik. Und das war lange bevor er daran gedacht hatte, Berufssoldat zu werden.
In den Bergen von Kentucky, entlang der Grenze von West-Virginia, wird Gitarrespielen nicht, wie anderswo, als etwas Besonderes betrachtet. Jeder anständige Junge lernt seine Akkorde auf der Gitarre greifen, auch wenn er noch so klein ist, daß er sie wie eine Baßgeige halten muß. Der junge Prewitt liebte die Lieder, weil sie ihm eine erste Ahnung gaben, daß Schmerz nicht sinnlos zu sein braucht, wenn man ihn nur in etwas Neues verwandeln kann. Er behielt die Lieder, aber das Gitarrespielen selber sagte ihm nichts. Es ließ ihn kalt, war nicht das, wozu er berufen war.
Auch zum Boxen war er nicht gemacht. Er war aber äußerst schnell und hatte eine unglaubliche Schlagkraft, die er entwickelte, weil er als Landstreicher, bevor er Soldat wurde, darauf angewiesen war. Das blieb nicht verborgen, zumal derartige Fähigkeiten sich leicht offenbaren, und ganz besonders beim Militär, wo der Sport als tägliche Nahrung und das Boxen als der männlichste Sport gilt. Bier ist beim Militär der Wein des Lebens.
Um die Wahrheit zu sagen, fühlte er sich auch zum Soldaten nicht berufen. Mindestens damals nicht. Als unzufriedener Sohn eines Bergarbeiters in Harlan County trieb er ganz von selbst in den Hafen des einzigen Berufs, der ihm offenstand.
Tatsächlich fühlte er sich bis zu dem Zeitpunkt, als er das erstemal ein Horn in die Hand bekam, zu gar nichts berufen.
Es begann als ein Scherz bei einem Bataillonsabend, und es geschah nicht mehr, als daß er das Horn hielt und zweimal darauf blökte. Dennoch wußte er sofort, daß dies ein besonderes Ereignis in seinem Leben war.
Einen Augenblick lang hatte er wilde Visionen … daß er einst für eine Krönung die Trompete des Herolds geblasen, daß er die Legionen um die rauchenden Lagerfeuer im alten Palästina zur Ruhe gerufen habe. Damals kam ihm zum Bewußtsein, daß die traurigen und klagenden Lieder seiner Kindheit vielleicht doch nicht sinnlos waren. Mit einem Male war es ihm klar, während er das Horn in der Hand hielt, warum er überhaupt zum Militär gegangen war, ein Problem, dessen Lösung ihm bis zu diesem Augenblick nicht gelungen war. So viel bedeutete ihm plötzlich das Horn. Er erkannte, daß er eine Berufung hatte.
Als Junge hatte er viel vom Militär gehört. Er pflegte mit den Männern auf der geländerlosen Veranda zu hocken, wenn der lange, müde Abend die Straßen zwischen den Hütten auswischte, und ihren Erzählungen zu lauschen. Sein Onkel John Turner, groß, grobknochig und hager, war als Junge durchgebrannt und aus Abenteuerlust zum Militär gegangen. Bei dem Aufstand auf den Philippinen war er Unteroffizier gewesen.
Prewitts Vater und alle anderen waren nie aus ihren Bergen herausgekommen, und in der Vorstellung des Jungen, der sich instinktiv schon damals gegen die Propaganda der Schlackenhalden wehrte, verlieh die Tatsache, daß er beim Militär gewesen war, Onkel John Turner einen einzigartigen Glanz.
Der große Mann hockte in dem kleinen Hof auf seinen Fersen – der Kohlenstaub lag zu dick überall auf dem Boden, als daß man sich hätte setzen können –, und in dem fruchtlosen Versuch, den Geschmack an dem zu zerstören, was das Lexikon ›Schwarze Diamanten‹ nannte, erzählte er ihnen Geschichten, die schlüssig bewiesen, daß hinter den Schlackenhalden und den Bäumen mit den immer schwarzbestaubten Blättern eine andere Welt existiere.
Onkel John erzählte etwa von den Moro Juramentados, die sich, ehe sie Amok liefen, Hoden und Glied in nasses Rohleder zwängten, so daß der Schmerz der Kontraktion sie in wilde Raserei versetzte. Das war der Grund, so sagte Onkel John, warum die Armee die 45er Pistole einführte. Denn selbst sechs Kugeln aus einer 38er waren nicht imstande, einen Juramentado umzulegen. Und natürlich mußte man ihn – in der Lage, in der er sich befand – umlegen, um ihn zum Halten zu bringen. Die 45er legte garantiert jeden Mann um, selbst wenn man damit nur die Spitze seines kleinen Fingers traf, oder man bekam sein Geld zurück. Und die Armee, sagte Onkel John, hat diese Pistole seither immer mit viel Erfolg verwendet.
Der junge Prewitt bezweifelte die Sache mit dem kleinen Finger, aber die Erzählung gefiel ihm. Es beeindruckte ihn, wie diese Geschichten gebaut waren. Geschichten, wie die über den jungen Hugh Drum und über den jungen John Pershing und über die Expedition auf Mindanao und über den Zug um die Ufer des Lanao-Sees. Diese Geschichten bewiesen, daß die Moros ganze Kerle waren, würdige Gegner für seinen Onkel John. Manchmal, wenn sein Onkel John genug ›weißes Feuer‹ intus hatte, sang er das Lied ›In Zanboauba hab’n die Affen keine Schwänze‹, das war sein Regimentslied gewesen.
Was geschah, geschah auf ganz andere Art.
Als der junge Prewitt in der siebten Klasse war, starb seine Mutter an Auszehrung. In diesem Winter gab es einen langen Streik, und mitten in diesem Streik starb sie. Hätte man ihr die Wahl gelassen, sie hätte sich eine bessere Zeit aussuchen können. Ihr Mann, einer der Streikenden, lag mit zwei Stichwunden in der Brust und einem Schädelbruch im Gefängnis. Und ihr Bruder – Onkel John – war tot, von Polizisten erschossen. Jahre später wurde über diesen Tag eine Moritat verfaßt und gesungen. Es hieß, daß an diesem Tage in den Straßengräben von Harlan tatsächlich Blut wie Regenwasser geflossen sei. Man schrieb Onkel John Turner die Hauptrolle zu, doch das hätte er bestimmt mit aller Kraft abgelehnt.
Der junge Prewitt sah diese Schlacht, wenigstens sah er sie so, wie überhaupt jemand eine Schlacht sehen kann. Das einzige, was er sah und woran er sich erinnern konnte, war sein Onkel John. Er und zwei andere Jungens standen in einem Hof, um zuzusehen, bis einer der beiden anderen von einer verirrten Kugel getroffen wurde. Da rannten sie nach Hause und sahen den Rest nicht mehr.
Onkel John hatte seine 45er gehabt und damit drei Polizisten erschossen, zwei davon in dem Augenblick, in dem er selber fiel. Nur dreimal mußte er feuern. Der Junge hätte gerne einen Beweis für die garantierte Schußkraft der 45er gehabt; da aber alle drei in den Kopf getroffen waren, wären sie ohnehin gefallen. Keinen von ihnen hatte Onkel John an der Spitze des kleinen Fingers getroffen.
Als seine Mutter starb, war also niemand da, der ihn zurückgehalten hätte, außer seinem Vater im Gefängnis. Da sein Vater ihn aber wieder geschlagen hatte, und zwar gerade zwei Tage vor der Schlacht, nahm er an, daß auch sein Vater nicht zählte. Nachdem er seinen Entschluß gefaßt hatte, nahm er die zwei Dollars, die in dem Marmeladeglas waren, wobei er sich sagte, daß seine Mutter das Geld ja nun nicht mehr brauchte und daß es seinem Vater recht geschehe und dazu beitragen würde, sie quitt zu machen, und dann ging er. Die Nachbarn veranstalteten eine Sammlung für das Begräbnis seiner Mutter, aber er wollte nicht dabeisein.
Als seine Mutter im Sterben lag, hatte sie ihm ein Versprechen abgenommen. »Versprich mir eines, Robert«, keuchte sie. »Von deinem Vater hast du Stolz und Ausdauer bekommen, und ich weiß, du wirst sie brauchen. Aber einer von euch würde den andern umgebracht haben, wenn ich nicht gewesen wäre. Und nun werde ich nicht mehr zwischen euch stehen.«
»Ich verspreche alles, was du willst, Mama – was du mir sagst, daß ich versprechen soll –, alles, was du willst …«, sagte hölzern der Junge, der die Frau vor sich sterben sah und trotz des Nebels seines Unglaubens nach einem Zeichen von Unsterblichkeit Ausschau hielt.
»Ein Versprechen am Totenbett ist das Heiligste, was es gibt, und ich will, daß du mir dieses Versprechen auf meinem Totenbett gibst. Versprich mir, nie jemand zu verletzen, wenn es nicht unbedingt nötig ist, wenn es nicht einfach sein muß.«
»Ich verspreche es dir«, gelobte er, noch immer darauf wartend, daß die Engel erscheinen würden. »Hast du Angst?« sagte er.
»Gib mir deine Hand darauf, Junge. Es ist ein Totenbettversprechen, und du wirst es niemals brechen.«
»Ja, Mama«, sagte er und gab ihr seine Hand, zog sie aber schnell wieder zurück, aus Angst, den Tod, den er in ihr sah, zu berühren, unfähig, irgend etwas Schönes oder Erbauliches oder geistig Aufrichtendes in dieser Rückkehr zu Gott zu finden. Noch eine Weile hielt er Ausschau nach Zeichen der Unsterblichkeit. Aber keine Engel kamen, es gab kein Erdbeben, keine Sintflut, und erst nachdem er lange über diesen ersten Tod, an dem er teilgenommen, nachgedacht hatte, entdeckte er, was das einzig Aufrichtende daran war. In ihrer letzten großen Angst hatte seine Mutter an seine Zukunft gedacht, nicht an die ihre. Oft fragte er sich später, wie wohl sein eigener Tod kommen, wie er ihn empfinden und wie es sein werde, wenn man wußte, daß dies der letzte Atemzug war. Es war schwer, sich vorzustellen, daß er, der die Achse seines eigenen Universums war, aufhören würde zu existieren, aber es war unvermeidbar, und er wich dem Gedanken nicht aus. Er hoffte nur, dem Tod mit der gleichen großartigen Gleichgültigkeit begegnen zu können, mit der seine Mutter ihm begegnet war. Denn darin, so schien ihm, lag die Unsterblichkeit verborgen, die er nicht entdeckt hatte.
Sie war eine Frau aus einer früheren Zeit, in eine spätere Welt geworfen und abgeschlossen von ihr durch die Berge. Hätte sie die Auswirkung des Versprechens geahnt, das sie ihrem Sohn abforderte, die Wirkung auf sein Leben, sie hätte ihn nicht darum gebeten. Solche Versprechen gehören zu einer älteren, einfacheren, weniger komplizierten und naiveren, vergessenen Zeit.
Drei Tage nach seinem siebzehnten Geburtstag wurde er in die Armee aufgenommen. Weil er zu jung gewesen war, hatte man ihn schon ein paarmal an verschiedenen Stellen im Lande zurückgewiesen. Dann war er wieder auf die Walze gegangen und hatte es in einer anderen Stadt versucht. Es war an der Ostküste, als er angenommen wurde, und man schickte ihn nach Fort Myer. Das war im Jahre 1936. Damals meldeten sich eine Menge Männer.
Im Fort Myer lernte er boxen, was etwas anders war als raufen. Er war wirklich sehr schnell, selbst für einen Bantamgewichtler, und angesichts seiner Schlagkraft, die in keinem Verhältnis zu seiner Größe stand, schien es ihm, als liege seine Zukunft beim Militär. Im ersten Jahre seiner Dienstzeit wurde er Gefreiter, was im Jahre 1936 bei jedem Soldaten, der seine zweiten drei Jahre angerissen hatte, als charakterverderbende Sünde galt und deutlich zeigte, wieviel er konnte.
In Myer war es auch, wo er zum erstenmal das Horn in die Hand bekam. Er verließ sofort die Boxriege und wurde Schüler im Musikzug. Wenn er wirklich etwas für richtig hielt, verlor er niemals Zeit, und da er damals noch weit davon entfernt war, ein erstklassiger Boxer zu sein, schien es dem Trainer nicht der Mühe wert, ihn zu halten. Die ganze Riege sah ihn scheiden, ohne ein Gefühl von Verlust, weil man dachte, daß er nicht das nötige Stehvermögen habe, daß alles zu hart für ihn sei, daß er niemals ein Meister werden würde wie Lew Jenkins von Fort Bliss und wie man es selber werden wollte, und so strich man ihn von der Liste.
Er war damals zu beschäftigt, um sich weiter darum zu kümmern, was sie dachten. Angetrieben durch seine Berufung, arbeitete er anderthalb Jahre lang hart und gewann sich neue, völlig andere Anerkennung. Am Ende dieser anderthalb Jahre hatte er’s zur höchsten Einstufung gebracht und war gut, so gut, daß er am Waffenstillstandstag in Arlington, dem Mekka aller Armeehornisten, den Zapfenstreich blasen durfte. Er war wirklich berufen.
Arlington war der Höhepunkt und eine großartige Sache. Er hatte endlich seinen Platz gefunden, den Platz, auf den er gehörte, und er war zufrieden damit. Seine erste Dienstperiode war damals beinahe beendet, und er beabsichtigte, sich von neuem in Myer zu verpflichten. Er hatte vor, die gesamten dreißig Jahre in diesem Musikzug zu verbringen. Er konnte es klar und deutlich vor sich sehen, wie glatt alles gehen und wie erfüllt sein Leben sein würde. Das war, bevor die anderen sich hineinzumischen begannen.
Bis dahin war er nur er selbst gewesen. Bis dahin war es ein privater Wettstreit zwischen ihm und seinem eigenen Ich. Kaum irgendein anderer hatte etwas damit zu tun. Nachdem aber die Menschen sich eingemischt hatten, war er ein anderer geworden. Alles änderte sich, und er war nicht länger die Jungfrau mit ihrem Recht auf platonische Liebe. Das Leben zerstört mit der Zeit jede Jungfernschaft, und wenn sie sie austrocknen läßt. Bis dahin war er der junge Idealist gewesen. Aber das konnte er nicht bleiben. Nicht, nachdem andere Leute in sein Leben eingedrungen waren.
In Myer verbrachte man seinen Wochenendurlaub in Washington, und auch er tat das. Dort traf er ein Mädchen der Gesellschaft. In einer Bar machte er ihre Bekanntschaft, oder sie machte die seine. Es war seine erste Berührung mit der ›großen Welt‹, das heißt außerhalb des Kinos. Sie war hübsch und unbedingt große Klasse und besuchte ein College in Washington, um Journalistin zu werden. Es war nicht die große Liebe oder etwas Ähnliches; zur Hälfte war es, für ihn wie für sie, nur die Tatsache, daß der Sohn des Bergarbeiters im Ritz dinierte, so wie man es im Film sah. Sie war ein nettes Mädchen, aber sehr verbittert, und die beiden hatten miteinander ein zufriedenstellendes Liebesverhältnis. Für sie gab es keine ›Reiche-Mädchen-Probleme‹, weil es ihn nicht genierte, ihr Geld auszugeben, und sie sich keine Sorgen über eine nicht standesgemäße Ehe machten. Sechs Monate lang hatten sie viel Spaß miteinander, bis er sich bei ihr einen Tripper holte.
Als er aus dem Hospital kam, hatte er seinen Posten verloren und damit auch seinen Dienstgrad. Damals kannte die Armee noch keine Sulfa-Behandlung – sie konnte sich bis zum Krieg nicht dazu entschließen, das zweifelhafte Zeug einzuführen –, und es war ein langer und schmerzhafter Heilungsprozeß. Einer seiner Leidensgenossen war schon zum viertenmal im Hospital.
Inoffiziell störte sich kaum jemand an einem Tripper. Für die, die ihn nie gehabt oder schon überstanden hatten, war er ein Witz. Nicht schlimmer als eine böse Erkältung, behaupteten sie. Offensichtlich wurde er nur dann nicht als ein Witz betrachtet, wenn man ihn gerade hatte. Statt an Ansehen zu verlieren, stieg man eine Stufe empor, als hätte man eine Auszeichnung für eine Verwundung erhalten. Wie es hieß, hatte man früher in Nicaragua sogar das Verwundeten-Abzeichen dafür bekommen.
Offiziell aber schadete es einem, und man verlor automatisch seinen Dienstgrad. Es blieb ein dunkler Punkt. Als Prewitt wieder in den Musikzug aufgenommen werden wollte, mußte er feststellen, daß dort plötzlich alle Stellen überbesetzt waren. Für den Rest seiner Dienstzeit tat er allgemeinen Dienst. Schon hatten die anderen begonnen, sich einzumischen.
Als seine Zeit um war, versuchte man, ihn für den gleichen Truppenteil in Myer neu zu verpflichten. Er wollte den 150-Dollar-Bonus haben, aber gleichzeitig wollte er so weit weg von Myer wie irgend möglich. Deshalb wählte er Hawaii.
Ehe er ging, besuchte er noch einmal das Mädchen der Gesellschaft. Andere hatten geschworen, daß sie jedes Mädchen umbringen würden, das sie ansteckte, oder daß sie ausgehen und mit ihrem Tripper jede Frau anstecken würden, die sie ins Bett bringen konnten. Oder sie würden sie so verprügeln, daß sie wünschte, tot zu sein. Ihm hatte sein Tripper nicht alle Frauen verleidet. Es war ein Risiko, das man mit jeder Frau einging, ob sie weiß, schwarz oder gelb war. Was ihn enttäuschte und was er nicht verstand, war, daß es ihn sein Horn gekostet hatte, obwohl er es besser denn je spielen konnte, und daß gerade ein Mädchen der Gesellschaft ihn angesteckt hatte. Es machte ihn wütend, daß sie ihn nicht gewarnt hatte, ihm nicht die Wahl gelassen hatte, denn dann wäre es nicht ihre Schuld gewesen. Bei diesem letzten Besuch stellte es sich heraus, daß sie überhaupt nichts davon gewußt hatte. Als sie sah, daß er sie nicht schlagen würde, weinte sie, und es tat ihr sehr leid. Sie war von einem Jungen der Gesellschaft, den sie seit ihrer Kindheit kannte, angesteckt worden. Auch sie war enttäuscht. Und sie hatte es verflucht schwer mit ihrer eigenen Kur, die sie heimlich durchführen mußte, damit ihre Eltern nichts merkten. Und es tat ihr wirklich sehr leid.
Als er in der Schofield-Kaserne ankam, war er noch immer sehr erbittert über den Verlust seines Horns. Deshalb kehrte er hier, in der Ananasarmee, wo das Boxen noch einträglicher als in Myer war, zum Sport zurück. Das war sein Irrtum; aber damals konnte er das noch nicht wissen. Der Ärger wegen des Horns, zusammen mit all den anderen Ärgernissen seines Lebens, machte etwas Besonderes aus ihm. Außerdem war er schwerer geworden und sein Körper besser ausgepolstert, so daß er nun ein Weltergewichtler war. Er gewann die Regimentsmeisterschaft des 27. und bekam dafür die Unteroffizierstressen. Dann, als die Divisionskämpfe begannen, gelang es ihm, in die Spitzengruppe zu kommen und den zweiten Platz der Weltergewichtsriege zu belegen. Dafür, und da man erwartete, daß er im folgenden Jahre Sieger werden würde, erhielt er einen Streifen mehr. Auch schien seine Bitterkeit ihn auf eine eigenartige Weise beliebter zu machen, obwohl er dies nie ganz verstehen konnte.
Das alles wäre wahrscheinlich für immer so weitergegangen – besonders nachdem er sich eingeredet hatte, daß ihm sein Horn nichts mehr bedeute –, wäre nicht das Versprechen gewesen, das ihm seine Mutter auf dem Totenbett abgenommen hatte, und hätte es nicht Dixie Wells gegeben. Tatsächlich geschah es auch, als die Boxsaison schon vorüber war. Vielleicht lag es nur an seinem Temperament; auf jeden Fall aber sah es so aus, als richte sich die Ironie des Schicksals besonders gegen ihn.
Dixie Wells war ein Mittelgewichtler, der eine Leidenschaft für das Boxen hatte und fürs Boxen lebte. Er hatte sich zum Militär gemeldet, weil es ihm als Boxer während der Depression nicht sehr gut ging und weil er Zeit brauchte, um seinen Stil wachsen und reifen zu lassen, ohne sich in obskuren Kämpfen zu verausgaben und ohne hungern zu müssen. Er hatte die Absicht, nach seiner Entlassung unmittelbar in die Spitzengruppe seiner Gewichtsklasse einzutreten. Viele von ›draußen‹ hatten ein Auge auf ihn geworfen, und er trat schon in Boxkämpfen im ›Bürgerauditorium‹ in Honolulu auf.
Dixie arbeitete gern mit Prewitt, weil er schnell war, und Prewitt lernte eine Menge von Dixie. Die beiden trainierten oft zusammen. Dixie war schweres Mittelgewicht, aber andererseits war Prewitt ein schwerer Weltergewichtler. In solchen Dingen ist die Armee sehr professionell. Da wird mit jedem Pfund gewuchert, das nur herausgequetscht werden kann. Man dörrt einen Mann aus, bevor er zur Bestimmung seiner Gewichtsklasse eingewogen wird, und dann, sobald das geschehen ist, füttert man ihn mit Steaks und viel Wasser.
Dixie selbst hatte ihn darum gebeten, mit ihm zu arbeiten, weil er sich auf einen Kampf in der Stadt vorbereiten wollte. Dixie wiederum war es gewesen, der Sechs-Unzen-Handschuhe benutzen wollte, und einen Kopfschutz trugen sie ohnehin niemals.
Solche Dinge passieren häufiger, als man denken sollte. Prew wußte das, und er hatte keinen Grund, sich schuldig zu fühlen. In Myer hatte er einen Leichtgewichtsmeister gekannt, der ebenfalls eine große Zukunft gehabt hatte. Bis er eines Nachts halb betrunken in eine städtische Turnhalle geriet und dort boxte. Man benutzte neue Handschuhe, und der Mann, der sie ihm anzog, vergaß, die Metallspitzen an den Senkeln abzuschneiden. Oft löst sich die Verschnürung der Handschuhe. Eine Bewegung mit dem Handgelenk schleuderte das Metall wie einen Pfeil in das Auge des Leichtgewichtsmeisters. Das Auge lief aus, und er mußte ein Glasauge kaufen, und seine Laufbahn als Leichtgewichtsmeister war zu Ende. Solche Dinge passieren eben von Zeit zu Zeit.
Prew stand fest auf seinen Füßen, als er Dixie mit einem nicht außergewöhnlich harten Querschlag traf. Zufällig stand Dixie gerade auch fest auf den Füßen. Als Prew sah, wie er fiel … ein Stein, ein fallender Klotz oder ein Sack Mehl, der vom Heuboden stürzt, den ganzen Schober erschüttert und in allen Nähten platzt … wußte er, was geschehen war. Dixie fiel mit dem Gesicht nach unten und drehte sich nicht. Boxer landen nicht auf dem Gesicht, ebensowenig wie Judokämpfer. Prews Hand zuckte zurück, und er starrte sie an wie ein Kind, das einen heißen Ofen berührt hat. Dann ging er und holte den Arzt.
Eine Woche lang lag Dixie Wells bewußtlos, aber schließlich erholte er sich etwas. Er war blind, das war alles. Der Arzt im Lazarett sagte etwas von einer Gehirnerschütterung und einem Schädelbruch, von einer Verletzung an einem Nerv. Prew besuchte ihn zweimal, aber nach dem zweiten Male konnte er nicht mehr hingehen. Beim zweiten Besuch waren sie in ein Gespräch über Boxen geraten, und Dixie weinte. Es waren die Tränen aus diesen blinden Augen, die ihn nicht mehr wiederkommen ließen.
Dixie haßte ihn nicht und machte ihm keine Vorwürfe, er war einfach unglücklich. Dieses letzte Mal sagte er Prew, daß man ihn, sobald er transportfähig war, nach den Staaten zurückschicken werde, in ein Heim für alte Soldaten, oder – was noch schlimmer war – in eines der Hospitäler für Kriegsversehrte.
Prew hatte viel Derartiges gesehen. Wenn man lange genug mit einem Beruf zu tun hat, erfährt man auch das, worüber die Eingeweihten nie öffentlich sprechen. Aber mit dem bloßen Sehen war es hier das gleiche wie beim Verwundetwerden. Die Armstümpfe ohne Hände haben keine Beziehung zu einem selber. Es geschieht dem anderen, niemals einem selbst.
Er kam sich vor wie jemand, der sein Gedächtnis verloren hat und in einem fremden Lande aufwacht, in dem er nie zuvor gewesen war, aufwacht und eine Sprache hört, die er nicht verstehen kann, und nichts als eine vage traumgehetzte Vorstellung davon besitzt, wie er überhaupt dorthin kam. Wie kommst du hierher? fragt er sich, unter diese fremden sonderbaren Menschen? und hat dabei Angst vor der Antwort, die sein Selbst ihm gibt.
Mein Gott, bin ich ein Sonderling? fragte er sich. Keinen der andern stört, was mir passiert. Warum sollte ich so verschieden von ihnen sein? Aber das Boxen war nie seine Berufung gewesen, das Hornblasen war es. Warum dann war er hier und spielte den Boxer?
Wahrscheinlich mußte es nach der Sache mit Dixie Wells so kommen, auch wenn das Versprechen, das er seiner Mutter gegeben hatte, ihn nicht geplagt hätte. Aber der altmodische baptistische Schwur an der Bahre gab den letzten Ausschlag. Weil der unerfahrene Junge es nicht wie ein Baptist ausgelegt, sondern wörtlich genommen hatte.
Bei der ganzen Boxerei, so dachte er, wird immer jemand auf die eine oder andere Art verletzt, und zwar absichtlich und ohne Not. Zwei Männer, die nichts gegeneinander haben, steigen in den Ring und versuchen nun, sich gegenseitig weh zu tun, nur um anderen Leuten, die weniger Schneid haben als sie, ein angenehmes Gefühl der Angst zu geben. Und um dem Kind einen Namen zu geben, nannte man es Sport und schloß Wetten ab. Nie zuvor hatte er es in diesem Licht betrachtet, und wenn es etwas gab, das er nicht ertragen konnte, so war es das Bewußtsein, betrogen zu werden.
Da die Boxsaison schon vorüber war, hätte er bis zum nächsten Dezember warten können, ehe er seinen Entschluß bekanntgab. Er hätte seinen Mund halten und sich auf seinen hart erkämpften Lorbeeren ausruhen können, bis die Zeit kam, um sein Recht geltend zu machen.
Als er ihnen erklärte, warum er das Boxen aufgeben wollte, glaubten sie ihm zunächst nicht. Dann, als sie sahen, daß er es ernst meinte, brachen sie den Stab über ihn, sagten, er sei nur des Profits halber ein Sportler gewesen, liebe das Boxen nicht wie sie, und degradierten ihn, in rechtschaffener Entrüstung. Später, als er immer noch nicht einlenkte, verstanden sie ihn wirklich nicht mehr. Sie versuchten, sein Selbstbewußtsein zu wecken, begannen, ihn zu ermahnen, sprachen mit ihm von Mann zu Mann, sagten ihm, wie gut er sei, erklärten ihm, ›welche Hoffnung wir auf Sie setzen‹ und ›Sie werden uns doch nicht im Stich lassen‹, wiesen darauf hin, was er dem Regiment schuldig sei, hielten ihm vor, wie er sich schämen müsse. Damals begannen sie, ihm wirklich keine Ruhe mehr zu lassen. Worauf er sich versetzen ließ.
Er wählte dieses andere Regiment, weil es über den besten Musikzug verfügte. Er hatte keine Schwierigkeiten. Sobald er ihnen vorgeblasen hatte, taten sie, was sie konnten, um seine Versetzung schnell durchzubekommen. Sie hatten sich wirklich und ehrlich einen guten Hornisten gewünscht.
3
Am gleichen Morgen um acht Uhr, als Prewitt noch beim Packen war, trat Hauptfeldwebel Milton Anthony Warden aus der Schreibstube der G-Kompanie. Die Schreibstube lag an einem gut gewachsten Korridor, der von der Kasernenhofseite der Veranda zu dem nach der Straße gelegenen Aufenthaltsraum ging. Warden blieb am Eingang stehen und lehnte sich gegen den Türpfosten. Eine Zigarette im Mund, die Hände tief in die Taschen geschoben, beobachtete er das Antreten der Kompanie, die sich, umgeschnallt und mit Gewehren, im staublosen frühen Morgen zum Ordnungsdienst aufstellte. Einen Augenblick stand er in den Sonnenstrahlen, die schräg auf ihn fielen, und empfand noch die Kühle, die schon zu weichen begann. Die Frühjahrsregenzeit würde nun bald beginnen, aber davor lag ein heißer und trockener Februar, so heiß und trocken wie der Dezember. Später, in der Regenzeit, würde es sehr feucht werden und kühl bei Nacht, und man würde die Sattelseife hervorholen und verzweifelt gegen den Schimmel auf dem Lederzeug ankämpfen. Er hatte gerade das Krankenbuch und den Morgenbericht fertiggemacht und beides weggeschickt, und nun rauchte er faul eine Zigarette, beobachtete – froh darüber, daß er nicht mitmußte – das Ausrücken der Kompanie, ehe er in die Kammer ging, um dort hart zu arbeiten, obwohl er es weiß Gott nicht nötig hatte.
Milton Anthony Warden war vierunddreißig Jahre alt. In den acht Monaten, die er jetzt Spieß der G-Kompanie war, hatte er sich diesen Truppenteil angeeignet wie einen Gürtel und sein Hemd darüber zugeknöpft. Von Zeit zu Zeit dachte er mit Stolz an diese Tatsache. Er war ein wahrhafter Arbeitsteufel; auch daran erinnerte er sich gerne, und daran, wie er diesen schlampigen Haufen aus dem Sumpf eines nachlässigen Dienstbetriebes gezogen hatte. In der Tat, wenn er darüber nachdachte – und er tat das oft –, niemals hatte er jemanden getroffen, der so erstaunlich geschickt in allem war, was er unternahm – niemanden außer Milton Anthony Warden.
»Der Mönch in seiner Zelle«, witzelte er, während er durch die offene Seite der Doppeltür eintrat. Nach dem strahlenden Sonnenlicht mußte er seine Augen erst an den fensterlosen Lagerraum gewöhnen, in dem zwei Glühbirnen, die wie brennende Tränen von der Decke hingen, die Dunkelheit eher noch verstärkten. Schränke, die bis zur Decke reichten, Gestelle und Stapel von Kisten umdrängten das selbstgezimmerte Pult, an dem der Gefreite Leva saß, mühsam mit einem Finger tippend, krumm und blutlos, als wäre die ewige Düsterkeit seines Reichs in seine Adern gedrungen, seine dünne Nase ein Fettfleck in der Lichtpfütze der Tischlampe. »In einem Gewand aus Sackleinen und einem Zuber voll Asche«, sagte Warden, den seine liebende Mutter nach dem heiligen Antonius genannt hatte, »könntest du morgen kanonisiert werden, Niccolo.«
»Geh zum Teufel«, sagte Leva, ohne aufzuschauen, aber mit dem Tippen aufhörend. »Ist der Zugang schon da?«
»Heiliger Niccolo von Wahiawa«, quälte Warden ihn. »Wann bist du dieses Lebens einmal satt? Ich wette, du hast Schimmel auf den Eiern.«
»Ist er da oder nicht?« sagte Leva. »Ich hab seine Papiere fertig.«
»Noch nicht«, Warden legte seine Ellenbogen auf die Theke, »und von mir aus braucht er niemals zu kommen.«
»Warum nicht?« fragte Leva unschuldig. »Ich hab gehört, er ist ein verdammt guter Soldat.«
»Er ist ein Dickschädel«, sagte Warden. »Ich kenne ihn. Ein verdammter Dickschädel. Warst du in der letzten Zeit mal drüben in Wahiawa bei der dicken Sue? Ihre Mädchen werden dir den Schimmel schon wegbringen. Sie haben gute Sattelseife, selbstgemachte.«
»Wie kann ich dahin«, sagte Leva. »Mit dem Geld, das ihr mir zahlt? Ich habe gehört, daß dieser Prewitt ein ziemlicher Boxer ist und fein in Dynamits Menagerie paßt.«
»Und daß er ein nutzloses Maul mehr ist, das ich füttern muß«, sagte Warden. »Hast du das auch gehört? Warum auch nicht? Ich bin ja daran gewöhnt. Wie schade, daß er bis zum Februar, bis zum Schluß der Boxsaison, gewartet hat. Jetzt wird er bis zum nächsten Dezember warten müssen, ehe er Feldwebel wird.«
»Du armer, armer unglücklicher Mann«, sagte Leva, »jeder nützt dich aus.« Er lehnte sich zurück und zeigte mit der Hand auf die Stöße von Ausrüstungsgegenständen, die überall aufgestapelt waren und an denen er die letzten drei Tage gearbeitet hatte. »Wie froh bin ich, daß ich eine hübsche, leichte, gutbezahlte Stellung habe.«
»Ein verdammter Dickschädel«, klagte Warden grinsend, »ein nichtsnutziger Kentuckymann, der in sechs Wochen Unteroffizier sein wird, der aber trotzdem ein gottverdammter nichtsnutziger Dickschädel ist.«
»Aber ein guter Hornist«, sagte Leva. »Ich hab ihn gehört. Ein verdammt guter Hornist. Der beste Hornist im Standort«, sagte er grinsend.
Warden schlug mit der Faust auf die Theke. »Dann hätt er im Musikzug bleiben sollen«, schrie er, »anstatt meinen Verein zu versauen.« Er warf den Thekendeckel zurück, stieß mit dem Fuß die Sperrholztür auf und ging hinter die Theke, wobei er durch Haufen von Hemden und Hosen und Gamaschen watete, die auf dem Boden lagen.
Leva senkte von neuem den Kopf zur Schreibmaschine und begann zu tippen, wobei er leise durch seine lange Nase schnaufte.
»Hast du jetzt diese verdammte Bestandsaufnahme fertig?« polterte Warden.
»Was zum Teufel denkst du, was ich bin?« fragte Leva, der immer noch innerlich lachte.
»Ein scheißverdammter Schreiber, dessen Arbeit es wäre, endlich fertig zu werden, statt sich über Versetzungen das Maul zu zerreißen. Schon vor zwei Tagen hätte es fertig sein müssen.«
»Das kannst du dem Kammerunteroffizier O’Hayer sagen«, sagte Leva. »Ich bin bloß Schreiber.«
Warden hörte mit seinem Wüten ebenso plötzlich auf, wie er damit begonnen hatte, schaute Leva mit einem Blick abschätzender Schlauheit an, kratzte sein Kinn und grinste: »War dein illustrer Meister O’Hayer heute morgen schon hier?«
»Na, was meinst du?« sagte Leva, wand seinen ausgedörrten Körper hinter dem Pult hervor und zündete sich eine Zigarette an.
»Nun«, sagte Warden, »ich würde dazu neigen, nein zu sagen. Einfach geraten.«
»Tja«, sagte Leva, »du würdest den Nagel auf den Kopf treffen.«
Warden grinste ihn an. »Nun, es ist immerhin erst acht Uhr. Du kannst das von einem Manne seines Standes und mit seinen Sorgen nicht erwarten, daß er um acht Uhr aufsteht, zusammen mit den Angestellten, wie du einer bist.«
»Für dich ist’s ein Witz«, sagte Leva mürrisch, »du kannst darüber lachen. Für mich ist’s kein Witz.«
»Vielleicht zählt er seine Spieleinnahmen von gestern«, grinste Warden, »vom Spiel in den Hallen. Ich wette, du hättest selbst gerne ein so hübsches leichtes Leben.«
»Ich wollte, ich hätte zehn Prozent von dem Zaster, den er an jedem Zahltag in den Hallen gewinnt«, sagte Leva, wobei er an die Reparaturhallen – gegenüber dem Aufenthaltsraum auf der anderen Seite der Straße – dachte, wo jeden Monat, nachdem man die 37-Millimeter-Geschütze und die Maschinengewehrkarren und alles andere hinausgeschoben hatte, das meiste Geld des Lagers zusammenströmte und wo O’Hayer immer den dicksten Gewinn machte.
»Ich dachte«, sagte Warden, »er gibt dir fast soviel, damit du seine Arbeit hier tust.«
Leva strafte ihn mit einem vernichtenden Blick, und Warden kicherte. »Das sieht dir ähnlich!« sagte Leva. »Am Ende willst du noch einen Anteil von mir haben oder läßt mich degradieren.«
»Das ist eine gute Idee«, grinste Warden; »ich wär selber nie darauf gekommen.«
»Eines Tages wird das Ganze gar nicht mehr so verdammt komisch sein«, sagte Leva. »Wenn ich mich nämlich von hier versetzen lasse und dir die Kammer zurücklasse mit keinem, der die Arbeit tun kann, außer O’Hayer, der Formblatt 32 nicht von 33 unterscheiden kann.«
»Du wirst dich nie versetzen lassen«, spottete Warden. »Wenn du vor Sonnenuntergang hinausgehen müßtest, du würdest blind wie eine Fledermaus. Dieser Lagerraum ist dir ins Blut gegangen. Selbst wenn du müßtest, du könntest ihn nicht aufgeben.«
»Ach«, sagte Leva. »So ist das also? Ich hab’s satt, alle Arbeit zu machen, und O’Hayer hat die Ehre und das Geld davon, weil er Dynamits bestes Leichtschwergewicht ist und im Stab irgend jemand bezahlt, um die Spielhölle weiterlaufen zu lassen. Er ist noch nicht einmal ein guter Boxer.«
»Aber ein guter Spieler ist er«, sagte Warden gleichgültig. »Das zählt.«
»Ja, das ist er. Ich möcht bloß wissen, wieviel er außer dem Stab jeden Monat an Dynamit zahlt.«
»Niccolo«, lachte Warden. »Du weißt doch, daß so etwas laut Vorschrift nicht erlaubt ist.«
»Ich scheiß auf die Vorschrift«, sagte Leva mit rotem Gesicht. »Ich sag’s dir, eines Tages hat er mich zur Raserei gebracht. Ich könnte mich morgen versetzen lassen und eine Kammer für mich bekommen. Ich hab mich erkundigt. Die M-Kompanie sucht einen Kammerbullen, Milt.« Er brach plötzlich ab im Bewußtsein, daß er ungewollt ein Geheimnis preisgegeben und daß Warden ihn dazu gebracht hatte. Schreck und Verdrießlichkeit malten sich auf seinem Gesicht, als er sich schweigend wieder dem Pult zuwandte.
Warden, der den flüchtigen Ausdruck in Levas Gesicht erfaßt hatte, merkte auf bei dieser neuentdeckten Gefahr, die er bekämpfen mußte, wenn er seine Kammer in Ordnung halten wollte, trat dann zu Leva ans Pult und sagte:
»Reg dich nicht auf, Niccolo. Das geht schon nicht immer so weiter. Ich habe selber ein paar Eisen im Feuer«, sagte er bedeutungsvoll. »Du solltest längst befördert sein und du wirst’s auch. Du tust die ganze Arbeit. Ich werde dafür sorgen, daß du befördert wirst«, sagte er beschwichtigend.
»Aber es wird dir nicht gelingen«, sagte Leva unzufrieden. »Nicht, solange Dynamit Kompanieführer ist. Und solange O’Hayer in seiner Boxriege ist und dem Regiment seine Miete zahlt.«
»Soll das heißen, daß du mir nicht traust?« sagte Warden entrüstet. »Hab ich dir nicht gesagt, daß ich noch ein paar Eisen im Feuer habe?«
»Ich bin kein Rekrut mehr«, sagte Leva. »Ich traue niemand. Ich bin seit dreizehn Jahren in dieser herrlichen Armee.«
»Wie kommst du mit dem Zeug voran?« fragte Warden und deutete auf die Stöße von Formularen. »Brauchst du Hilfe?«