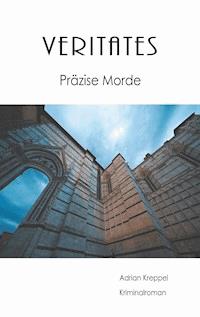
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dies ist der erste Band der Reihe VERITATES um Commissaria Gardini und Thomas Kay, einem Professor für Informatik, der für die italienische Polizei in der Toskana ein Seminar über Computerkriminalität durchführt. Im Zusammenhang mit einem Kunstdiebstahl lernt er die leicht reizbare und häufig übermüdete Commissaria Gardini kennen, die mit der Aufklärung des Falles betraut ist und sich in ständigem Disput mit ihren zänkischen inneren Stimmen befindet. Kay, von der Routine des Seminarbetriebs gelangweilt, bietet ihr seine Hilfe an. Unterstützung bekommen beide von Don Greppo, dem Besitzer eines Weingutes, und Erik Eklund, Kays Freund aus vergangenen Hackerzeiten. Bald zeigt sich, dass die Diebstähle mit einer Mordserie in Verbindung stehen. Eines der Opfer ist ein Mitglied des Aufsichtsgremiums der Vatikanbank, der zusammen mit einem bekannten Journalisten im Beichtstuhl einer kleinen Kirche ermordet aufgefunden wird. Die weiteren Ermittlungen, die von zahlreichen mit Ironie und Humor erzählten Nebenhandlungen begleitet werden und in deren Verlauf Kay und Gardini auf einen Meisterdieb und einen Profikiller treffen, führen sie bis in die Vatikanbank, wo sie den entscheidenden Hinweis für die Lösung der Fälle erhalten ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Kay, ein international tätiger Professor für Informatik, hält sich als Gastdozent im Rahmen eines Seminars für die italienische Polizei in der Toskana auf. Im Zusammenhang mit einem Kunstdiebstahl lernt er Francesca Gardini kennen, eine leicht reizbare und häufig übermüdete Commissaria, die mit der Aufklärung des Falles betraut ist und sich in ständigem Disput mit ihren zänkischen inneren Stimmen befindet. Kay, von der Routine des Seminarbetriebs gelangweilt, bietet ihr seine Hilfe an. Unterstützung bekommen beide von Don Greppo, dem Besitzer eines Weingutes, und Erik Eklund, Kays Freund aus vergangenen Hackerzeiten.
Bald zeigt sich, dass die Diebstähle mit einer Mordserie in Verbindung stehen. Eines der Opfer ist Kardinal Moretti, ein Mitglied des Aufsichtsgremiums der Vatikanbank, der zusammen mit einem bekannten Journalisten im Beichtstuhl einer kleinen Kirche ermordet aufgefunden wird.
Die weiteren Ermittlungen, die von zahlreichen mit Ironie und Humor erzählten Nebenhandlungen begleitet werden und in deren Verlauf Kay auf einen Meisterdieb und einen Profikiller trifft, führen ihn schließlich bis in die Vatikanbank, wo er den entscheidenden Hinweis für die Lösung erhält…
Inhaltsverzeichnis
15 Jahre zuvor
Kapitel 1
Drei Jahre zuvor
Kapitel 2: VATIKANSTADT
Montag
Kapitel 3: ROCCALBEGNA, TOSKANA
Dienstag
Kapitel 4: MONTEMILANO, TOSKANA
Kapitel 5: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 6: MONTEMILANO, TOSKANA
Mittwoch
Kapitel 7: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 8: LUZERN, SCHWEIZ
Kapitel 9: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 10: QUESTURA, GROSSETO
Kapitel 11: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 12: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 13: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 14: ROCCALBEGNA, TOSKANA
Kapitel 15: ROM
Kapitel 16: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 17: ROCCALBEGNA, TOSKANA
Kapitel 18: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 19: GROSSETO, TOSKANA
Donnerstag
Kapitel 20: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 21: QUESTURA, GROSSETO
Kapitel 22: MONTEMILANO, TOSKANA
Kapitel 23: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 24: ROM
Kapitel 25: SIENA, TOSKANA
Kapitel 26: QUESTURA, GROSSETO
Kapitel 27: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 28: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 29: TOSKANA
Kapitel 30: MONTEMILANO, TOSKANA
Freitag
Kapitel 31: ROCCALBEGNA, TOSKANA
Kapitel 32: ROCCALBEGNA, TOSKANA
Kapitel 33: ROCCALBEGNA, TOSKANA
Kapitel 34: GROSSETO, TOSKANA
Kapitel 35: VATIKANSTADT
Kapitel 36: ROCCALBEGNA, TOSKANA
Kapitel 37: MONTEMILANO, TOSKANA
Kapitel 38: MONTEMILANO, TOSKANA
Kapitel 39: ROM
Kapitel 40: GROSSETO, TOSKANA
Samstag
Kapitel 41: MONTEMILANO, TOSKANA
Kapitel 42: Rom
Kapitel 43: Grosseto, Toskana
Kapitel 44: ROM + VATIKANSTADT
Kapitel 45: MONTEMILANO, TOSKANA
Kapitel 46: QUESTURA, GROSSETO
Kapitel 47: MONTEMILANO, TOSKANA
Kapitel 48: ROM + VATIKANSTADT
Kapitel 49: MONTEMILANO, TOSKANA
Kapitel 50: ROM
Kapitel 51: MONTEMILANO, TOSKANA
Sonntag
Kapitel 52: ROM + VATIKANSTADT
Kapitel 53: MONTEMILANO, TOSKANA
Kapitel 54: ROM
Kapitel 55: MONTEMILANO, TOSKANA
Kapitel 56: GROSSETO, TOSKANA
Montag
Kapitel 57: MONTEMILANO, TOSKANA
Kapitel 58: QUESTURA, GROSSETO
Dienstag
Kapitel 59: ROM
Kapitel 60: GROSSETO, TOSKANA
Epilog
Finis
Personen
15 Jahre zuvor…
1
Bei nicht wenigen Menschen der von der westlichen Kultur geprägten Welt erzeugt der 14. Februar das beunruhigende Gefühl, eine ihnen nahestehende Person könne erwarten, mit Blumen oder Schokolade beschenkt zu werden. Andere erinnert dieser Tag an eine tiefe Enttäuschung, weil sie von jemandem, den sie bis dahin als ihnen nahestehend angesehen hatten, nicht mit Blumen oder Schokolade beschenkt worden waren. Wieder andere verbinden mit diesem Datum die Freude über den Profit aus dem Verkauf von Blumen und Schokolade.
Und obwohl fast allen die Bezeichnung „Valentinstag“ für diesen Tag geläufig ist, wissen doch nur wenige, dass Kaiser Claudius II. den Bischof Valentin von Terni am 14. Februar im Jahre 269 enthaupten ließ und so der katholischen Kirche - wenn auch nicht Blumen und Schokolade - doch immerhin einen weiteren Märtyrer schenkte.
Es gibt aber auch Menschen, die der 14. Februar an ein anderes Ereignis erinnert: Am 14. Februar 1995 wurde einer der damals wohl besten Hacker der USA, Kevin Mitnick, von Beamten des FBI unter Mitwirkung eines der damals wohl besten Sicherheitsexperten der USA, Tsutomu Shimomura, in Raleigh, North Carolina, gefasst. Die einen nannten es den Sieg der Demokratie gegen ein verbrecherisches Element der Gesellschaft, die anderen einen Schlag gegen die Freiheit des Internets.
Mitnick hatte den Sicherheitsexperten am 25. Dezember 1994 herausgefordert, indem er in Shimomuras Rechner eingedrungen war und dessen Emails gestohlen hatte. Zu seinem Pech hatte Shimomura die Herausforderung angenommen.
Noch Jahre später wurde dieser Fall in den Medien immer wieder aufgegriffen, wenn über einen neuerlichen gewagten Hackerangriff zu berichten war, wobei nie versäumt wurde, den Erfolg Shimomuras und die Verhaftung Mitnicks als gerechte Strafe für das Eindringen in Shimomuras Privatsphäre zu bezeichnen. Aber ungeachtet aller Bemühungen, die öffentliche Meinung zu lenken, gibt es noch immer Menschen, die die Reaktion von Shimomura als überzogen und wenig sportlich ansehen.
Inzwischen haben Regierungsinstitutionen der meisten Staaten ihre Freude am Hacken entdeckt und es als eine wichtige Disziplin in die Spiele um Überwachung, Manipulation, Kriegstreiberei und das Aufrechterhalten der Angst vor terroristischen Angriffen - also in die alltägliche Geheimdiensttätigkeit - integriert. In deren Umfeld bilden sich seitdem unaufhaltsam weitere kriminelle Hackergruppen, die jedoch nicht unter dem Deckmantel einer staatlichen Behörde arbeiten, sondern sich zu ihrer Gier nach Geld und Macht bekennen.
Angesichts dieser Entwicklungen wird es zunehmend schwerer, einen Hackerangriff als ‚sportlich’ zu bewerten. Aber glücklicherweise gibt es auch weiterhin Hacker, die nicht von krimineller Energie oder dem Wunsch nach Unterdrückung getrieben sind, sondern sich dieser Materie verschrieben haben, um die versteckten Wahrheiten ans Licht zu bringen. Ganz nebenbei beschäftigen sie auf diese Weise die Geheimdienste und halten sie dadurch zumindest ein wenig davon ab, noch mehr Unfrieden zu stiften.
* * *
Als sich Thomas Kay und Erik Eklund zu Beginn ihres Informatikstudiums kennenlernten, verbrachten die meisten ihrer Kommilitonen den Großteil ihrer Tage und Nächte damit, neue Algorithmen zu programmieren, an Open Source Projekten mitzuarbeiten, Computerspiele zu entwerfen oder die damals gerade entstehenden virtuellen Realitäten zu entwickeln. Kay und Eklund hingegen hatten es von Anfang an vorgezogen, mit der tatsächlichen Realität zu spielen. Innerhalb kurzer Zeit hatten sie darin eine beachtliche Kunstfertigkeit entwickelt, falls man die Fähigkeit, sich ins Verteidigungsministerium hacken zu können und dort Nachweise dafür zu finden, dass die Regierung entgegen aller Beteuerungen Waffenlieferungen in Krisengebiete unterstützt, oder die Fähigkeit, in die Rechner eines Forschungslabors eindringen zu können und dort geheime Studien darüber zu finden, dass ein neues Düngemittel radioaktiv verseucht ist, so bezeichnen wollte.
Eklund jedenfalls tat es. Er ging diese Themen mit viel Ernst, manchmal geradezu verbissen an, während sich Kay ungezwungener und verspielter verhielt. Gemeinsam wurden sie in den internationalen Hackerkreisen bald für ihr gewagtes Eindringen in zivile und militärische Einrichtungen berühmt.
Obwohl Kay derjenige war, der von den Beiden diese Kunst noch um einiges besser beherrschte, verlor er bald das Interesse daran. Eklund hingegen geriet zusehends in einen Rausch und schließlich erging es ihm wie so vielen Menschen, die einer gefährlichen Sucht verfallen waren: Er wurde übermütig und unvorsichtig.
Als er endlich bemerkte, dass ihm nationale und internationale Geheimdienste auf den Fersen waren, war es schon fast zu spät. Wäre ihm Kay nicht zu Hilfe gekommen, hätte Eklund bestenfalls einige Jahre im Gefängnis zugebracht; viel wahrscheinlicher aber wäre er von der Bildfläche verschwunden und niemand hätte je wieder von ihm gehört. Gemeinsam aber war es ihnen gelungen, innerhalb nur weniger Stunden alle Spuren, die auf Eklund hindeuteten, derart geschickt zu manipulieren, dass niemand mehr zu sagen vermochte, ob Der Wikinger, wie er in der Szene genannt wurde, ein Spion im Auftrag einer Regierung, ein Hacker, ein Genie oder einfach nur eine Fantasiegestalt war. Als Folge von Kays Eingreifen stießen die gefährlichsten von Eklunds Häschern wenige Tage später auf eindeutige Beweise, dass der Wikinger ein Verräter in den eigenen Reihen war. Fieberhaft beschäftigten sie sich von da ab mit sich selbst, um diesem Verdacht - natürlich unter Wahrung höchster Geheimhaltung - nachzugehen. Interessant war, dass einige von ihnen den Wikinger tatsächlich innerhalb ihrer Organisation fanden.
Bei Eklund bewirkte dieses Ereignis eine spontane Heilung seiner Sucht. Eher um ihn zu beschäftigen und somit vor einem Rückfall zu bewahren als aus Angst vor einer weiteren Verfolgung, entwickelten er und Kay ein Kommunikationssystem für Notfälle. Dieses System nutzte kleine Lücken in den Datenströmen der Funknetze, um Nachrichten auszutauschen, ohne dass Sender und Empfänger ermittelt werden konnten. Das Besondere daran war ein kleines Gerät, das wie ein Ring am Finger getragen wurde und einem modernen Schmuckstück nicht unähnlich war. Im Notfall oder - was die Regel war - nur zum Spaß konnte man mit diesen Ringen unauffällig Nachrichten austauschen. Die Eingabe der Texte erfolgte in der Art eines optimierten Morsecodes durch Berühren der Fassung. Für die Ausgabe gab es ein kleines Display, das in der Fassung eingelassen war und einem plan geschliffenen Onyx ähnelte.
Im Laufe der folgenden Jahre erweiterten sie die Funktionen und überarbeiteten das Design, obwohl sie es längst nicht mehr nutzten, da es inzwischen interessantere Techniken und Geräte für diese Zwecke gab. Wenn überhaupt, dann trugen sie es als Schmuckstück und in Erinnerung an die alten Zeiten.
Drei Jahre zuvor…
2
VATIKANSTADT
In den Hallen und Gängen unterhalb den der Öffentlichkeit zugänglichen Bereichen der vatikanischen Museen befindet sich der Arbeitsplatz einiger der besten Restaurateure der Welt, deren Hauptaufgabe darin besteht, die Kunstschätze des Vatikan zu pflegen, die sichtbar gewordenen Zeichen des Alterns wieder rückgängig zu machen und sie vor weiterem Verfall zu bewahren. Eine Arbeit, die ihnen kaum Zeit lässt, sich den Inhalten hunderter Kisten unterschiedlichster Größen und Formen zu widmen, die in zahlreichen, von den Hauptgängen abzweigenden stollenartigen Lagerräumen aufgestapelt sind. Seit Jahrzehnten wird daran gearbeitet, die darin enthaltenen Schätze zu restaurieren und zu katalogisieren, aber noch ist nicht abzusehen, wann diese Arbeit beendet sein wird. Allein die mittlerweile erfassten Kunstwerke stellen ein Vermögen von unschätzbarem Wert dar. Doch niemand weiß, welche Kostbarkeiten noch immer darauf warten, aus ihrem oft viele Jahrhunderte währenden Schlaf erweckt zu werden.
Othello Spada hatte nicht die Absicht, irgendetwas oder irgendjemanden aus dem Schlaf zu wecken, als er lautlos durch einen der Lagerstollen schlich.
Es war der Auftrag eines ihm bis dahin unbekannten Kunden, der ihn hergeführt hatte. Manche seiner Kunden waren sehr spezifisch und bestellten ein ganz bestimmtes Objekt. Andere ließen ihm mehr Freiraum und orderten eine beliebige Arbeit aus ihrer Lieblingsepoche oder von einem besonders geschätzten Künstler. Und dann gab es noch diejenigen, die überhaupt keinen Bezug zu den bildenden Künsten hatten und diese lediglich als Statussymbole ansahen, die sie entweder für sich selbst zur Aufwertung ihres gesellschaftlichen Ansehens oder als ein ausgefallenes Geschenk benötigten. In diesen Fällen nahm sich Spada die Zeit für eine ausführliche Beratung, in der er den beabsichtigten Zweck und die Solvenz des Kunden, überwiegend führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Showbusiness, mit den beschaffbaren Kunstwerken abglich.
Othello Spada war Kunstdieb. Mit seinem Wissen, das demjenigen renommierter Kunsthistoriker in nichts nachstand, seinem scharfen Verstand und der Konstitution eines Leichtathleten war er auch nach nunmehr fünfundzwanzig Jahren, während der er seiner Profession nachging, noch immer der beste Kunstdieb Italiens und vielleicht sogar ganz Europas.
Er hatte Kontakt zu einer der besten Organisationen, die mit detaillierten Informationen über die verschiedensten Gebäude handelten. Informationen, die von einem einfachen Grundriss bis zu den Codes zum Deaktivieren der Sicherheitssysteme reichten. Von diesen hatte er ausführliche Pläne über die Lage der einzelnen Gebäude des Vatikan und deren Zugänge, den unterirdischen Gängen und Gewölben sowie über die vorhandenen Sicherheitseinrichtungen erhalten. Aber trotz aller Informationen und elektronischer Hilfsmittel sowie seiner hohen Professionalität, die eine akribische Vorbereitung einschloss, war ein nicht unerheblicher Teil seines Erfolges auf seine körperlichen Fähigkeiten zurückzuführen. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen war er überzeugt davon, dass Beweglichkeit und Schnelligkeit noch immer von größter Bedeutung in seinem Geschäft waren. Nicht nur wenn es darum ging, eine Fassade zu erklettern oder durch einen Lüftungsschacht zu kriechen - was viel seltener die Wege waren, auf denen sich Menschen wie er Zutritt zu einem Gebäude verschafften als allgemein angenommen wurde - gab es ihm bei seinem zumeist nächtlichen Tun immer das beruhigende Gefühl, das wichtigste, was er benötigen würde, bei sich zu haben: Sich selbst.
Sein aktueller Auftrag lautete, eine Ikone aus dem Besitz des Vatikanischen Museums zu beschaffen. Welche, war seinem Auftraggeber egal. Es gab nur eine Bedingung, nämlich, dass die Ikone nicht aus einer aktuellen Ausstellung stammen durfte, da sie ein Geschenk werden und der Beschenkte nicht durch die Medien von dem Diebstahl erfahren sollte. Solche Anliegen waren Spada nicht unbekannt. Sie wurden häufig von Kunden geäußert, die mit einem kostbaren und einzigartigen Geschenk einen Politiker oder höheren Verwaltungsbeamten dazu bewegen wollten, seine Meinung in einer bestimmten Angelegenheit zu überdenken.
Durch einen in Vergessenheit geratenen Zugang hatte Spada vor einer halben Stunde eines der teilweise tausende Jahre alten Tunnelsysteme betreten, die wie ein riesiges, sich über viele Ebenen erstreckendes Labyrinth die Teile einer Stadt verbanden, die sich unter dem Vatikanstaat befand und neben den aktuell vorwiegend als Labore und Lagerstätten benutzten Bereichen auch solche umfasste, in die seit Jahrzehnten niemand einen Fuß gesetzt hatte und die auf ihre Wiederentdeckung warteten. Über Verbindungsgänge und versteckte Luken war er bis zu einem engen Durchschlupf vorgedrungen. Durch diesen gelangte er in einen Lagerstollen und von dem aus betrat er nun den zu dieser nächtlichen Stunde menschenleeren Hauptgang des Restaurationsbereiches.
Geräuschlos bewegte er sich in dem spärlichen Licht der Notbeleuchtung, bis er eine große Halle erreichte, auf deren einen Seite Statuen restauriert wurden und auf deren gegenüberliegenden Seite in mächtigen Regalen unzählige Gemälde lagerten. Zielsicher ging er auf eines der Regale zu, das sich am Ende der Halle unweit eines Verbindungsganges zum nächsten Raum befand. Dann blieb er einen Moment bewegungslos stehen und schloss die Augen. Spada liebte die nächtliche Stille großer Museen und Galerien, während er seiner Arbeit nachging. Manchmal hatte er das Gefühl, als wären die Meisterwerke in der nächtlichen Stunde bereit, sich ihm zu offenbaren und ihre Geheimnisse zu verraten, die ihre Herkunft oder das Leben des Künstlers betrafen, der sie erschaffen hatte. Wie gewöhnlich fehlte ihm jedoch auch heute die Zeit dafür. Aber irgendwann in den nächsten Jahren - so hatte er sich vorgenommen - würde er einige Nächte in seinen Lieblingsmuseen verbringen, nur um diesem Gefühl nachzugehen. Und sollte eines der Exponate dann in Plauderstimmung sein, würde er in aller Ruhe den Anekdoten lauschen.
Während Spada damit beschäftigt war, sich eine Ikone auszuwählen, wurde er von einigen sehr alten Statuen unterschiedlicher Größe aus einer Nische auf der gegenüberliegenden Seite der Halle beobachtet. Die Älteste von ihnen hatte vor etwas mehr als fünfzig Jahren in der Stille eines der vielen Stollen ihren dreitausendsten Geburtstag gefeiert. Erst vor wenigen Wochen war sie zusammen mit den anderen aus verschiedenen Abteilungen der Vatikanischen Museen und dem weit verzweigten Lager in diese Halle für Restaurierungsmaßnahmen gebracht worden. Damit die chemischen Mittel, mit deren Hilfe die Wiederherstellung der ursprünglichen Farben eingeleitet worden war, einwirken konnten, war jede der Statuen in eine durchsichtige Folie eingepackt.
Die steinernen Mienen, mit der sie durch die Folie hindurch zu Othello Spada hinübersahen, ähnelten den unbeweglichen Gesichtszügen des Mannes, der hinter der ältesten Statue kauerte ohne zu ahnen, dass diese auf den Tag genau dreitausend Jahre älter war als er selbst. In der linken Hand hielt er eine Kamera, deren Objektiv auf Spada gerichtet war. Er hatte auf Spadas Eintreffen gewartet und beobachtete nun jede seiner Bewegungen.
Othello Spada sah sich um. Er verspürte eine ungewohnte innere Anspannung.
Er wendete sich wieder dem Regal zu und entschied sich für eine handliche Ikone aus dem frühen fünfzehnten Jahrhundert. Er verstaute sie in dem flachen Behälter, den er für diesen Zweck bei sich führte, und schnallte ihn auf seinen Rücken.
Dann wurde es gleißend hell.
Zwei Scheinwerfer waren auf Spada gerichtet. Obwohl er über außerordentlich gute Nerven verfügte, zuckte er doch kurz zusammen. In all den Jahren war bis auf einmal, als er in einem herrschaftlichen Palazzo einen Bewegungsmelder übersehen hatte, woraufhin aber lediglich die Beleuchtung in einem fensterlosen Flur aktiviert worden war, niemals etwas Unvorhergesehenes geschehen.
Heute, daran bestand kein Zweifel, war die Lage ernst. Er wusste, er würde rasch handeln müssen, wenn er entkommen wollte. Er verschwendete keine Zeit damit festzustellen, wie viele Menschen sich in dem Raum befanden, an welchen Positionen sie waren und was sie vorhatten. Stattdessen machte er einen Sprung in die Richtung des neben ihm beginnenden Verbindungsganges, der nach wenigen Metern eine Biegung machte und im Moment die einzige Möglichkeit zu sein schien, aus dem blendenden Licht in die schützende Dunkelheit zu gelangen. Aber noch während er den ersten Satz machte, gingen weitere Scheinwerfer an, die nicht nur ihn, sondern auch einen Mann mittleren Alters in der Uniform eines Gendarmen beleuchteten, der sich in dem Verbindungsgang hinter der Biegung verborgen gehalten hatte und jetzt mit gezogener Waffe vor ihm stand.
Der entschlossene Gesichtsausdruck des Gendarmen sagte Spada, dass er verloren hatte. Langsam hob er seine Hände. Er hörte, wie jemand hinter ihn trat. Dann wurden seine Arme ergriffen, nach hinten gezerrt und Handschellen darum geschlossen. Ein Packband wurde über seinen Mund geklebt und über seinen Kopf ein modrig riechender Sack gestülpt.
* * *
Nachdem Spada durch zahllose Gänge und Räume geführt worden war und einige Treppen überwunden hatte, befahl ihm eine dunkle Stimme, sich zu setzen. Gleichzeitig drückte ihn jemand nach hinten auf einen ungepolsterten Stuhl. Der Sack wurde von seinem Kopf gezogen, und das Licht einer auf ihn gerichteten Lampe stach in seine an die Dunkelheit gewöhnten Augen. Es dauerte einige Sekunden, ehe er hinter der Lampe schemenhaft zwei Männer erkannte.
„Wir haben Sie seit Ihrem widerrechtlichen Betreten der Vatikanstadt beobachtet“, sagte die dunkle Stimme, von der Spada annahm, dass sie dem Gendarmen gehörte, „und ihren Diebstahlversuch gefilmt. Auch dieses Gespräch wird gerade aufgezeichnet.“
Spada schwieg. Nach einer kurzen Pause erklärte die Stimme, dass sie über ihn und seine Arbeit Bescheid wisse, aber aus christlicher Nächstenliebe bereit wäre, ihn laufen zu lassen, wenn er im Namen Gottes schwören würde, niemals wieder einen Diebstahl zu begehen.
Wenngleich sich Spada nicht sicher war, was gerade vor sich ging, spürte er doch, dass er keine andere Wahl hatte, als auf das Angebot einzugehen.
Die Stimme erklärte weiter, dass, sollte er jemals wieder einen Diebstahl begehen, alle Aufzeichnungen dieses Vorfalls der italienischen Polizei übergeben werden würden, zusammen mit zahlreichen Details über weitere von ihm begangene Diebstähle.
„Die Kamera ist jetzt ausgeschaltet“, sagte die dunkle Stimme nach einer Weile. „Das Video wird vervielfältigt, und ich kann Ihnen versichern, dass es nicht einmal Ihnen gelingen wird, alle Kopien zu stehlen. So, und nun zu dem inoffiziellen Teil unseres Treffens. Zunächst sollten Sie wissen, dass wir keinesfalls von Ihnen verlangen, Ihren Beruf aufzugeben. Ganz im Gegenteil.“
Die Stimme machte wieder eine Pause. Spada schwieg weiterhin.
„Ich möchte mit Ihnen eine Abmachung treffen. Eine Abmachung, die aus zwei sehr einfachen Teilen besteht“, fuhr die Stimme endlich fort. „Erstens werden sie niemals wieder den Vatikan betreten und zweitens“, wieder machte er eine unheilvolle Pause, „werden Sie von nun ab auch für uns arbeiten.“
„Wie?“ fragte Spada verwundert.
„Wir sagen Ihnen, was Sie stehlen sollen und wo es sich befindet. Wir sagen Ihnen sogar, wann die beste Gelegenheit dazu ist. Es werden überwiegend Gemälde sein, die Sie aus Kirchen für uns beschaffen werden. Wenn möglich und falls nötig, liefern wir Ihnen Informationen über die Sicherheitseinrichtungen und wie man sie am besten umgehen oder deaktivieren kann.“
„Wie soll ich das verstehen? Wollen Sie, dass ich von nun ab nur noch für Sie arbeite?“
„Nein, natürlich nicht. Aber rechnen Sie vorerst von unserer Seite mit fünf bis zehn Aufträgen pro Jahr. Selbstverständlich werden wir Sie bezahlen.“
„Selbstverständlich?“ Spada war irritiert.
„Ja. Es wird sich dabei um einen von uns festgesetzten Betrag handeln, über den nicht verhandelt wird. Aber seien Sie versichert, dass der Betrag angemessen sein wird. Wir sind nicht kleinlich.“
Spada nahm sich vor, zum Schein auf die Bedingungen einzugehen. Aber wenn er erst wieder in Sicherheit wäre, würde er alles daransetzen, sich dem Kontrakt zu entziehen.
„Falls Sie glauben, Sie könnten uns entkommen, haben Sie sich getäuscht“, sagte die dunkle Stimme, als hätte sie seine Gedanken gelesen. „Sie müssen wissen, dass wir nicht darauf angewiesen sind, mit den Videos zur italienischen Polizei zu gehen. Das ist nur eine von mehreren Optionen. Zugegebenermaßen eine sehr bequeme Option.“
Die Stimme verstummte wieder für einige Sekunden, ehe sie fortfuhr:
„Wir haben für die Behandlung von Menschen, die uns hintergehen wollen, eine spezielle Abteilung. Die Mitarbeiter dieser Abteilung sind weltweit tätig. Die katholische Kirche ist nicht nur das älteste Unternehmen der Welt, sie hat auch den ältesten global agierenden Geheimdienst. Das sage ich Ihnen nur, damit sie sich diesbezüglich erst gar keine Gedanken machen.“
Spada hatte das Gefühl, dass der Sprecher seine Rede genoss.
„Glauben Sie mir“, setzte die Stimme ihren Monolog fort, „Sie können sich uns nur dadurch entziehen, dass Sie das irdische Leben beenden. Man könnte sagen: Nur der Weg zu Gott bringt Ihnen die Freiheit. Wobei ich mich angesichts Ihrer Berufswahl frage, ob sie ohne Umwege zu ihm gelangen werden.“
Spada meinte, ein leises Kichern gehört zu haben. Dann wurde die Stimme wieder kalt und schneidend:
„Ich darf Ihnen versichern, dass Sie nicht der Erste wären, den wir aktiv dabei unterstützen, vor unseren Schöpfer zu treten.“
"Warum ich?" fragte Spada. „Warum haben Sie ausgerechnet mich ausgewählt?“
"Wir kennen keinen Besseren", gab die Stimme zur Antwort.
Das war das erste Mal in Spadas Leben, dass er sich wünschte, er hätte es mit seinem Drang zur Professionalität etwas entspannter angehen lassen.
"Und noch eine Kleinigkeit“, unterbrach die Stimme Spadas Gedanken, „Sie werden bei den Aufträgen, die Sie von uns bekommen, von jemandem unterstützt werden."
"Ich arbeite nur alleine", wagte Spada zu widersprechen.
"Das ist uns bekannt. Aber entweder Sie arbeiten mit unserem Mann zusammen oder Sie arbeiten überhaupt nicht mehr."
"Warum ist Ihnen das so wichtig?"
"Eine Frage der eigenen Sicherheit. Aber seien Sie unbesorgt: Unser Mann wird sich in Ihre Tätigkeit nicht einmischen. Er wird lediglich dafür sorgen, dass Sie nicht überrascht werden. Wir legen keinen Wert darauf, Sie vorzeitig zu verlieren. Wir sind eine sehr traditionsbewusste Institution und seit jeher an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert."
„Sehr großzügig“, bemerkte Spada, dem klar geworden war, dass gegenwärtig keine akute Gefahr mehr für ihn bestand.
* * *
Der Mann, der ihn bei den Diebstählen für seine neuen Auftraggeber begleitete, hatte sich als Fabio Renzo vorgestellt und entpuppte sich als etwas naiver aber harmloser Zeitgenosse. Auf Spadas Frage, wie er in die Geschichte hineingeraten sei, hatte Renzo nur ausweichend geantwortet, und Spada hatte es dabei belassen. Spada gewann den Eindruck, dass Renzo unter chronischem Geldmangel litt und vermutete, dass er aus diesem Grund in die Fänge von Spadas Auftraggeber geraten war.
In dem darauffolgenden Jahr hatte Spada acht Diebstähle für die unbekannten Auftraggeber im Vatikan begangen. Allesamt waren relativ leicht zu bewerkstelligen gewesen, und die Bezahlung war besser, als er erwartet hatte. Die Unfreiheit machte ihm zunächst zu schaffen, aber irgendwann gewöhnte er sich daran.
Eines Tages erreichte ihn die Nachricht, dass er zusammen mit Renzo in Rom in einer Filiale der ihm bis dahin unbekannten Banco di Firenze erwartet werde. Dort hatte Spada eine Unterschrift zu leisten, und es wurde ihm mitgeteilt, er sei nun Mitglied der „Gesellschaft zur Erhaltung Sakraler Künste“, für die er offiziell als Experte für Restaurierungen beratend tätig werde. Außerdem musste er ein Konto bei dieser Bank eröffnen.
Von da ab erhielt er die Aufträge für die Diebstähle zusammen mit einer Vorausüberweisung des Honorars auf sein neues Konto.
In den folgenden Jahren war die Anzahl der Aufträge kontinuierlich gestiegen. Spada vermutete zunächst, dass seine Auftraggeber die Gemälde für eine eigene Sammlung stehlen ließen, bis ihm auffiel, dass es meist nicht die wertvollsten Stücke waren, die er zu beschaffen hatte. Außerdem ließ die Auswahl der Gemälde keine thematischen Gemeinsamkeiten feststellen. Spada akzeptierte auch diese Ungereimtheit und entschloss sich, keine weiteren Vermutungen anzustellen und erst recht keine Fragen zu stellen.
Montag
3
ROCCALBEGNA, TOSKANA
Es war eines der Jahre, in denen der Sommer beschloss, sich nicht an die in ihn gesetzten Erwartungen zu halten, und die Tatsache ignorierte, dass er den Beschreibungen unzähliger Romane und Spielfilme nicht gerecht wurde. Es schien fast so, als wäre er es leid, dem Klischee des trockenen und warmen, aber nicht zu heißen toskanischen Sommers entsprechen zu müssen. Vielleicht war er aber auch nur gelangweilt und wollte sich und den Menschen eine kleine Abwechslung verschaffen.
Jedenfalls hatte der Sommer in diesem Jahr mit einer ungewöhnlich langen und kühlen Regenperiode begonnen. Dann, endlich, hatte er auf das Jammern der Menschen und deren missmutige Gesichter reagiert und sich in eine trockene Hitze mit Temperaturen, die in der Tagesmitte an vielen Orten vierzig Grad überschritten, verwandelt.
Aber die anfängliche Freude über das Licht und die wärmenden Temperaturen hatte sich schnell gelegt und war einem angestrengten Stöhnen gewichen, das besonders laut aus den aufgeheizten Städten zu ihm drang. Viele der Einwohner flohen in die Berge, wann immer sich ihnen die Möglichkeit dazu bot. Selbst in den Kirchen, in deren massiven Gemäuer man gewöhnlich eine Abkühlung von der sommerlichen Hitze erwarten durfte, wurden die Besucher von einer schwülen Wärme empfangen. In vielen Gemeinden hielten nicht nur die Gotteshäuser, sondern auch andere öffentliche Gebäude in den frühen Morgenstunden und ab dem späten Nachmittag bis in die tiefe Nacht hinein alle Fenster und Türen geöffnet, um jeden Hauch von Kühle einzufangen.
* * *
Seit Kardinal Moretti in die Kardinalskommission der Vatikanbank berufen worden war, hatte sich sein Privatleben auf ein Minimum reduziert, und die schwarze Soutane mit den hellroten Knöpfen war zu seinem meistgetragenen Kleidungsstück geworden. Entsprechend ungewohnt fühlte sich der hellgraue Anzug an, den er für den heutigen Tag ausgewählt hatte. Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen verzichtete er auf eine Krawatte und ließ die beiden oberen Knöpfe seines weißen Hemdes geöffnet, was ihm ein fast vergessenes Gefühl von Freiheit und einen Hauch lasziver Lässigkeit vermittelte. Aber trotz dieser positiven Empfindungen mochte die melancholische Grundstimmung, die er seit seinem Erwachen am heutigen Morgen verspürte, auch jetzt nicht weichen, da er in Roccalbegna, einem beschaulich an einem Hang in der südlichen Toskana gelegenen und um den pittoresk aufragenden Felsen Rocca Aldobrandesca herum erbauten Städtchen, angekommen war. Seinen Wagen hatte er am nördlichen Ortseingang auf einem kleinen Parkplatz neben einem schlicht als „Ape“ bezeichneten dreirädrigen Kleinstlastwagen abgestellt, auf dessen Ladefläche einige von geflochtenem Korb ummantelte Ballonflaschen standen. Der Fahrer, ein in die Jahre gekommener aber noch rüstiger Mann in beigefarbener Leinenhose und ehemals weißem, inzwischen aber angegrautem Hemd, füllte mit hochgekrempelten Ärmeln die letzte der Flaschen an einem kleinen Brunnen, dessen Wasser munter aus einem einfachen Messingrohr plätscherte.
Im Vorbeigehen nickte Kardinal Moretti ihm grüßend zu.
„Das Wasser müssen Sie unbedingt kosten“, forderte der Moretti auf und zeigte auf einen Becher, der neben dem Trog stand. „Ich bin jetzt zweiundachtzig Jahre alt“, sagte er stolz und richtete sich auf. „Seit über dreißig Jahren trinke ich ausschließlich dieses Wasser und war in dieser Zeit nicht ein einziges Mal krank.“
Er füllte den Becher und reichte ihn dem Kardinal.
Der Glaube kann Berge versetzen, dachte Moretti, während er den Becher dankend entgegennahm und das köstlich frische Wasser trank.
Vom Parkplatz folgte er der kaum befahrenen Hauptstraße und nur wenige Meter weiter bot sich ihm der Blick auf einen unterhalb der Straße gelegenen Sportplatz, wo zwei Damenmannschaften Fußball spielten.
Die Welt verändert sich, dachte er bei sich, und zum ersten Mal an diesem Tag fand ein zufriedenes Lächeln den Weg in sein Gesicht.
Kardinal Moretti gehörte zu den reformwilligen Mitgliedern der Kurie. Er sah die Kirche mit all ihren inneren Kämpfen und den mühevoll versteckten, hässlichen Wahrheiten als einen Spiegel der Gesellschaft an. Das war der Grund, warum sie ihn mit innerer Zufriedenheit erfüllten, die Veränderungen, die in der Gesellschaft, in der Politik und sogar auf dem Fußballplatz in Roccalbegna zu beobachten waren. Er war überzeugt davon, dass die Kirche diesen Änderungen folgen musste, wenn sie nicht an Bedeutung verlieren und schließlich untergehen wollte. Er selbst hatte sich lange Zeit politisch im Hintergrund gehalten. Doch mit der Annahme des Amtes in der Kardinalskommission hatte er den Ring betreten, in welchem der Kampf um die Reformierung der Kirche ausgetragen wurde.
Sein Weg führte ihn an einer Bar vorbei. Zwei Tische und ein paar Stühle standen davor, aber die Gäste zogen die Kühle im Inneren des Gebäudes der nachmittäglichen Hitze vor. Ihre Gespräche vermischten sich mit den aus den Lautsprechern eines an der Wand hängenden Fernsehers dröhnenden Stimmen, die den Familienmitgliedern einer beliebten Seifenoper gehörten.
Er blieb stehen und beobachtete durch die weit geöffnete Tür das Geschehen in der Bar wie auf einem großen Bildschirm. Die Gäste waren die Akteure einer Szene, und ihre Rolle bestand darin, die Handlungen der Schauspieler in der Seifenoper zu beobachten und zu kommentieren.
Warum beschäftigen sich die Leute mit den Dramen anderer, anstatt an der Lösung der eigenen Probleme zu arbeiten? fragte er sich.
Seit Tausenden von Jahren werden Schauspiele geschrieben und aufgeführt, um den Menschen ihre Probleme bewusst zu machen und ihnen zu zeigen, dass die Umwelt ein Spiegel ist, in welchem man die eigene Situation und letztlich sich selbst erkennen kann. Aber die Zuschauer konsumieren sie als Unterhaltung, gehen nach Hause und leben weiter wie zuvor.
Er sah den Gästen noch einige Momente dabei zu, wie sie in ihrer eigenen Seifenoper lebten, dann setzte er seinen Weg fort.
Genau genommen bin ich auch nicht anders, fuhr er mit seinen schwermütigen Gedanken fort. So wie die Leute in der Bar dem Geschehen auf dem Bildschirm folgen ohne zu erkennen, dass sich darin ihr eigenes Leben spiegelt, betrachte ich aus meinem wohlbehaltene, weltabgeschiedenen Leben die menschliche Gesellschaft und glaube hochmütig, ich könne von ihr nichts für mich lernen.
Er schüttelte den Kopf. Er war es nicht gewohnt, mit solchen Gedanken umzugehen.
So fühlt sich wohl eine Depression an, dachte er resigniert. Dann lächelte er plötzlich angesichts der kleinen freundlichen Winke des Lebens, als sein Blick auf ein Schild vor der Bar fiel, auf dem in großen Lettern Birra Moretti zu lesen war.
* * *
Morettis Ziel war eine auf einem Hügel am östlichen Rand von Roccalbegna gelegene kleine Kirche, die heute fast ausschließlich als Museum genutzt wurde.
Als er im Zentrum des Städtchens an der Hauptkirche vorbeikam, beschloss er spontan hineinzugehen. In der Hoffnung, dass ihn ein kleines Gebet auf andere Gedanken bringen würde, erklomm er die Stufen zum Eingang, fand die Türen jedoch verschlossen.
Wozu haben wir all die riesigen Kirchen, wenn die Gläubigen sie nicht benutzen können? Nachdenklich kehrte er um und wendete sich nach rechts in eine schmale Gasse, die ihn zu dem Museum führte.
Als er wenige Minuten später vor seinem Ziel stand, kam er sich albern vor. Da stand er, ein Kurienkardinal aus Rom, vor dieser kleinen Kirche, von deren Existenz er bis zum gestrigen Tag nichts gewusst hatte, in einem Ort, dessen Namen er nie zuvor gehört hatte, um sich mit jemandem zu treffen, den er nicht kannte.
Er wusste lediglich, dass er mit einem Journalisten verabredet war, der ihm Informationen über Personen und Institutionen geben wollte, die seit Jahren die Reformierung der Vatikanbank torpedierten. Moretti hatte in den letzten Monaten bereits Beachtliches herausgefunden und meinte ungefähr zu wissen, wer seit Jahrzehnten von der Undurchsichtigkeit der Vatikanbank profitierte und alles unternahm, um die lukrativen Geschäfte auch weiterhin ungestört betreiben zu können. Vor wenigen Tagen erst war er auf Hinweise gestoßen, dass so etwas wie ein Notfallplan existierte, um zumindest einen Teil der illegalen Geschäfte, die aktuell über die Vatikanbank getätigt wurden, auf anderen Wegen weiterführen zu können, falls die Reformer sich durchsetzen und dem illegalen Treiben ein Ende setzen würden. Noch wusste er nicht genau, was es damit auf sich hatte, aber es sah ganz danach aus, als wenn für diesen Fall ein weiteres Geldinstitut geschaffen worden wäre. In der Hoffnung, mehr darüber zu erfahren, hatte er sich auf die heutige Verabredung eingelassen.
* * *
Das Treffen zwischen Moretti und dem Journalisten war von einer Gruppierung innerhalb des Vatikans arrangiert worden, die offiziell nicht existierte und keinen Namen hatte. Jedes der Mitglieder kannte nur einige wenige andere, und höchst wahrscheinlich gab es so etwas wie eine gewöhnliche Mitgliedschaft überhaupt nicht. Es schien eher eine Art Interessensgemeinschaft zu sein, bei der jeder selbst entscheiden konnte, ob er sich als dazugehörig betrachten wollte oder nicht.
Irgendwann waren Gerüchte über die Existenz dieser Gruppierung aufgekommen, und inzwischen sprach man von ihnen als den „Wahrheitssuchern“, wobei noch immer niemand zweifelsfrei sagen konnte, ob diese Gruppe wirklich existierte.
Tatsache aber war, dass einige der möglicherweise nicht existierenden Wahrheitssucher sehr darum bemüht waren, gegen jedes illegale Verhalten von Mitgliedern katholischer Einrichtungen im Vatikan vorzugehen. Eines ihrer aktuell vorrangigen Ziele war dafür zu sorgen, dass im Namen der Vatikanbank keine moralisch unvertretbaren Finanzgeschäfte mehr getätigt wurden. Ein Vorhaben, das - darüber waren sich die Wahrheitssucher im Klaren - bei den meisten Menschen ein lautes Lachen hervorriefe, wenn sie davon erführen, denn moralisch vertretbare Finanzgeschäfte schienen ein Widerspruch in sich zu sein.
Ungeachtet dessen beabsichtigten die Wahrheitssucher, die Vatikanbank zu einer Vorzeigebank zu machen. Einer Bank, die ethische Maßstäbe setzt. Um diesem Ziel zuzuarbeiten, hatten sie dafür gesorgt, dass der als unbestechlich geltende Kardinal Moretti in die Kardinalskommission berufen und mit der vage formulierten Aufgabe betraut worden war, mehr Transparenz in die Geschäfte der Vatikanbank zu bringen. Eine Aufgabe, an der bisher jeder seiner Vorgänger gescheitert war.
* * *
Moretti ging auf die Tür des Museums zu. Kurz bevor seine Hand die Klinke berührte, hielt er inne. Wenn in diesem Ort sogar die Hauptkirche verschlossen war, würde diese kleine Kirche erst recht abgeschlossen sein. Froh darüber, sich an diesem Tag eine weitere Enttäuschung erspart und nicht nochmals vergebens an einer verschlossenen Tür gerüttelt zu haben, ließ er seine Hand wieder sinken. Angesichts seiner Gemütsverfassung erschien es ihm sowieso besser, unter freiem Himmel auf das Eintreffen des Journalisten zu warten, anstatt in der abgestandenen Luft der kleinen Kirche einem weiteren Stimmungstief entgegenzusteuern.
Fast automatisch sah er auf die Uhr und stellte beruhigt fest, dass er nicht mehr lange würde warten müssen. Er begab sich in den Schatten einer dem Eingang gegenüberliegenden Mauer und wollte die verbleibende Zeit nutzen, um die Ursache für seine gedrückte Stimmung zu ergründen, als ihn plötzlich ein Gedanke durchzuckte. Er riss seinen Arm hoch und starrte nochmals auf seine Uhr in der Hoffnung, er habe sich geirrt. Dann schlug er sich mit der flachen Hand gegen die Stirn.
Ich habe Silvio vergessen, sagte er sich und hätte laut geflucht, wenn ihm solche Gefühlsäußerungen nicht im Priesterseminar vor langer Zeit ebenso schmerzhaft wie erfolgreich abgewöhnt worden wären. Er empfand eine Mischung aus Unglauben und Verärgerung darüber, dass ihm die Verabredung mit seinem Bruder entfallen war. Er klopfte seine Taschen ab, in der Hoffnung, sein Telefon würde sich darin befinden, obwohl er schon auf der Herfahrt bemerkt hatte, dass er es in seinem Büro vergessen hatte. Er fragte sich, warum er so unkonzentriert gewesen war. Die möglichen Antworten reichten von einem einmaligen zufälligen Ereignis aufgrund berufsbedingter Erschöpfung bis zu den ersten Anzeichen eines beginnenden Gedächtnisverlustes. Jedenfalls war keine der Antworten geeignet, seine melancholische Stimmung aufzuhellen. Er beschloss, den Journalisten sogleich um dessen Telefon zu bitten und seinen Bruder anzurufen.
Ein dumpfer Schlag, begleitet von einem unterdrückten Stöhnen und gefolgt von einem Poltern, riss ihn aus seinen Gedanken. Die Geräusche kamen ohne jeden Zweifel aus dem Museum. Morettis erster Gedanke war, der Journalist sei doch bereits vor ihm angekommen und warte drinnen auf ihn, wo er in dem vermutlich schlecht beleuchteten Gebäude gestolpert war.
Er ging zu dem Eingang hinüber und drückte auf die Klinke, die quietschend nachgab. Ein kräftiger Stoß ließ die unverschlossene Tür aufschwingen, dann trat er in das Halbdunkel ein. Nur wenige Schritte entfernt stand ein ihm unbekannter Mann mittleren Alters, der ihn überrascht, aber nicht unfreundlich ansah.
„Kardinal Moretti?“ wollte er wissen.
Der Kardinal bejahte.
„Kommen Sie herein“, sagte der Unbekannte und zeigte auf einen rechts neben dem Eingang stehenden Beichtstuhl. „Ich gehe davon aus, dass da keine Abhöranlage installiert ist und hoffe, Sie werden der kleinen Zweckentfremdung zustimmen.“
Moretti empfand die Sorge, abgehört zu werden, zwar als übertrieben, aber er hätte auch nicht zu sagen vermocht, was es einen Beichtstuhl interessieren sollte, welcher Art die Gespräche waren, die in ihm geführt wurden. Der Unbekannte zog den Vorhang beiseite und bat Moretti mit einer einladenden Handbewegung, darin Platz zu nehmen.
Der Kardinal war im Begriff einzutreten, als sein Blick nach unten fiel. Seine Augen hatten sich inzwischen soweit an die Lichtverhältnisse gewöhnt, dass er eine zu seinen Füßen liegende Gestalt ausmachte. Ihr zertrümmerter Hinterkopf war die letzte visuelle Wahrnehmung in Morettis irdischem Leben, das jetzt von dem Unbekannten mit routinemäßiger Präzision beendet wurde.
Hätte in diesem Moment jemand auf dem kleinen Platz vor dem Museum gestanden, so hätte er einen dumpfen Schlag vernommen, begleitet von einem unterdrückten Stöhnen und gefolgt von einem Poltern.
Dienstag
4
MONTEMILANO, TOSKANA
Cesare Don Greppo saß vor seinem Haus und schaute über die sanften Hügel der Toskana. Zur rechten sah er den auf einer benachbarten Anhöhe liegenden Ort Montemilano und zur linken boten seine Weinreben im Licht des späten Nachmittags einen verheißungsvollen Anblick. Wenn die trockene Hitze weiter anhielt, würden die Trauben ein außergewöhnlich konzentriertes Aroma entwickeln und die hohe Qualität seiner erlesenen Weine und der exquisiten Grappe nochmals steigern.
Alles sah nach einem friedlichen Abend im Paradies aus, den er mit einem edlen Tropfen angemessen zu würdigen beabsichtigte. Er machte sich auf den Weg zu seinem Weinkeller, der sich unter einem aus grobem Stein gemauerten Gebäude befand, in dem der ehemalige Eigentümer des Weingutes eine kleine, damals sehr beliebte Osteria betrieben hatte. Inzwischen war daraus eine moderne Probierstube geworden, in der Don Greppo zweimal jährlich einem ausgewählten Publikum die von ihm erzeugten Weine präsentierte.
Wenige Minuten später kehrte er mit einer Flasche in der Hand zurück. Aus den Augenwinkeln bemerkte er am Fuße des Hügels eine sich nähernde Staubwolke. Ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Fahrzeug den von der Landstraße in mehreren Windungen zu seinem Anwesen führenden Schotterweg herauffuhr.
Don Greppo erwartete heute keinen Besuch mehr. Ursprünglich wollte Francesca im Laufe des Abends zu ihm kommen, aber sie hatte am Mittag angerufen und gesagt, sie werde in Grosseto bleiben, weil sie zu viel zu tun habe. Angesichts des jetzt herannahenden Fahrzeugs keimte in Don Greppo die Hoffnung auf, sie habe es sich anders überlegt. Aber nur wenige Augenblicke später wurde dieser Keim von den breiten Reifen eines bulligen Geländewagen überrollt, der statt Francescas filigranem rotem Sportwagen der Staubwolke voraneilte.
Don Greppo beschloss, die Zeit bis zur Ankunft des Besuches zu nutzen. Er ging in die Küche und dekantierte den Wein, der dem heutigen Tag einen genussvollen Ausklang geben würde, wenngleich er nur ein schwacher Trost für Francescas Abwesenheit sein würde.
Der Geländewagen kam nur wenige Meter vor den breiten Stufen, die zu Don Greppos Villa hinaufführten, zum Stehen. Der Motor wurde abgestellt, und ein schwarz gekleideter Mann entstieg dem Fond. Der Fahrer blieb sitzen und starrte mit leerem Blick durch die Frontscheibe, auf deren Außenseite sich die Abendsonne spiegelte, die dem gerade wieder aus seinem Haus tretenden Don Greppo den freundlichen Gruß zusandte, den ihm der leblos wirkende Fahrer verweigerte.
„Guten Abend, Monsignore Caprese. Was verschafft mir die Ehre Ihres unerwarteten Besuches?“, begrüßte Don Greppo den Ankömmling.
Neben anderen kleineren Aufgaben war Monsignore Caprese für die Beschaffung der kulinarischen Köstlichkeiten zuständig, die bei besonderen Anlässen im Vatikan den Gästen mit dem bescheidenen Hinweis des jeweiligen Gastgebers dargereicht wurden, dass die exklusiven Speisen und Getränke ausschließlich für den Vatikan hergestellt würden und nirgendwo sonst auf der Welt erhältlich seien. Einige der Gastgeber, allesamt hochrangige Mitglieder der Kurie, betrachteten es als ihr persönliches Privileg, die von Caprese beschafften Spezialitäten gelegentlich für den eigenen Genuss zu konsumieren, wobei sie großen Wert darauf legten, dass außer ihm niemand davon erfuhr. Denn innerhalb der engen Gemeinschaft der vatikanischen Glaubensbrüder war jeder darum bemüht, sich keine Blöße zu geben, die von den politischen oder spirituellen Gegnern ausgenutzt werden könnte.
Caprese zeigte sich in dieser Hinsicht äußerst verschwiegen, weshalb er zu manchem hohen Würdenträger ein gutes, man könnte fast sagen vertrautes Verhältnis hatte, kannte er doch deren geheimste kulinarische Wünsche und sorgte für deren Befriedigung. Als Gegenleistung hatte er für sich einige Freiheiten erwirkt. So musste er keine Rechenschaft über sein Tun ablegen und konnte kommen und gehen, wann er wollte. Das gab ihm nicht nur die Gelegenheit, häufig zu verreisen, sondern er hatte auch ausreichend Zeit, um seine Position innerhalb der Kurie zu festigen und seine politische Karriere voranzubringen.
„Guten Abend. Ich war gerade in der Nähe und dachte mir, ich könnte die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen eine Kleinigkeit, die beschäftigt, persönlich zu besprechen“, antwortete Caprese freundlich und wechselte dann in einen geschäftsmäßigen Tonfall:
„Aber zunächst einmal möchte ich feststellen, dass ich heute Abend nicht bei Ihnen bin und wir das folgende Gespräch niemals geführt haben. Können Sie mir diesbezüglich Ihre Verschwiegenheit als Ehrenmann zusichern?“
„Solange Sie mir kein Verbrechen gestehen wollen, können Sie sich auf meine Verschwiegenheit verlassen“, antwortete Don Greppo.
Monsignore Caprese gehörte zu den Menschen, denen jeglicher Sinn für Humor fehlte.
„Nein, ich habe kein Verbrechen begangen“, fuhr er leicht irritiert fort. „Der Grund, weswegen ich zu Ihnen gekommen bin, ist folgender: Stimmt es, dass Sie mit Avvocato Silvio Moretti und dessen Bruder, Kardinal Frederico Moretti, befreundet sind?“
„Den Kardinal sehe ich nur selten, aber mit Silvio bin ich sehr gut befreundet. Sie sind aber nicht hergekommen, um mich das zu fragen, oder?“
„Natürlich nicht“, erwiderte Caprese und tat so, als würde er sich überlegen, wie er sein Anliegen am besten formulieren könnte.
„Leider darf ich Ihnen über die Hintergründe nichts verraten, da die internen Untersuchungen offiziell noch nicht einmal begonnen haben. Aber weil wir uns schon so lange kennen, möchte ich Ihnen zumindest so viel sagen: Es besteht der begründete Verdacht, dass Kardinal Moretti und vielleicht auch sein Bruder in eine Sache verwickelt sind, die sich nachteilig für den Vatikan auswirken könnte.“
Don Greppo sah den Monsignore wortlos an.
„Jetzt fragen Sie sich vermutlich, warum ich Ihnen das erzähle. Nun, die Sache ist die: Wir benötigen alle Informationen, die wir bekommen können. Wir möchten nicht Gefahr laufen, einem Gerücht aufzusitzen und jemanden zu Unrecht zu verdächtigen. Deshalb wäre es für uns wichtig zu wissen, ob Ihnen insbesondere an Kardinal Moretti in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Irgendeine Veränderung in seinem Verhalten zum Beispiel.“
„Wie schon gesagt: Ich bin eher mit Silvio befreundet als mit seinem Bruder“, antwortete Don Greppo ausweichend.
„Trotzdem könnte Ihnen ja etwas aufgefallen sein: Neue Bekannte, seltsame Treffen, irgendwelche herumliegende Schriftstücke...“
„Sie erwarten von mir hoffentlich nicht ernsthaft, dass ich meine Freunde bespitzele“, entgegnete Don Greppo empört.
„Nein, natürlich nicht“, antwortete Caprese in beschwichtigendem Tonfall. „Uns ist - wie gesagt - nur daran gelegen, alles in Erfahrung zu bringen, was zu deren Entlastung beitragen könnte. Sollte Ihnen also zufällig irgendetwas auffallen, wäre es sinnvoll, wenn Sie mich - und nur mich - davon unterrichten würden. Sie müssen wissen, dass ich voll hinter den Tätigkeiten von Kardinal Moretti stehe und nicht möchte, dass er einer Intrige zum Opfer fällt.“
Don Greppo glaubte dem Monsignore kein Wort. Er war sich noch nicht einmal sicher, ob es überhaupt einen Verdacht gegen Kardinal Moretti gab oder ob es sich um eines jener komplizierten Ränkespiele handelte, in die der Monsignore verwickelt war. Aber er war davon überzeugt, dass Capreses Besuch mit Kardinal Morettis Tätigkeit in der Kardinalskommission und dessen Versuch, Licht in die Geschäfte der Vatikanbank zu bringen, in Zusammenhang stand. Vielleicht, dachte er, geht es um Informationen, die im Besitz von Kardinal Moretti sind und von denen sich der Monsignore einen politischen Vorteil verspricht.
In der Tat hatte man Caprese nur wenige Stunden zuvor vertraulich mitgeteilt, man vermute, Moretti habe brisante Informationen gesammelt, die einigen einflussreichen Personen im Vatikan gefährlich werden könnten. Man munkelte weiter, Moretti plane, diese Informationen zu seiner eigenen Sicherheit an Außenstehende weiterzugeben. Der Monsignore hatte sofort reagiert und versuchte herauszufinden, ob dieses Gerücht auf Tatsachen beruhte und falls ja, ob es ihm gelingen könnte, die Weitergabe der Informationen zu verhindern. Er ging davon aus, dass ihm das die eine oder andere Tür nach oben öffnen würde, denn spätestens seit der in der Öffentlichkeit als ‚Vatileaks’ diskutierten Affäre um die aus dem Vatikan geschmuggelten und dann veröffentlichten vertraulichen Dokumente, war man in diesen Angelegenheiten sehr empfindlich.
Nach dem Austausch einiger Höflichkeitsfloskeln und dem Versprechen, Don Greppo in diesem Jahr seine gesamte Grappaproduktion abzukaufen, verabschiedete sich der Monsignore.
Don Greppo beschattete seine Augen mit der Hand, als er dem in Richtung der tiefstehenden Abendsonne davonfahrenden Wagen nachdenklich hinterherblickte.
5
GROSSETO, TOSKANA
In den frühen Abendstunden betrat ein sympathisch aussehender Mann den Dom San Lorenzo in Grosseto. Seine sicheren Bewegungen zeugten von innerer Ausgeglichenheit. Der offene Blick seiner hellblauen Augen gab ihm zusammen mit einem leichten Lächeln, das Teil seiner Wesensart zu sein schien, da es seine Mundwinkel auch dann umspielte, wenn er sich unbeobachtet fühlte, einen lebensbejahenden und jugendlichen Ausdruck. Man mochte ihn auf Mitte dreißig schätzen, auch wenn die ruhige, distinguierte Art, die seine Erscheinung ausstrahlte, an die Reife eines älteren Mannes erinnerte.
Er wendete sich nach rechts, blieb am äußeren Ende der letzten Bankreihe stehen und ließ seinen Blick schweifen, ehe er eine kleine Kamera aus seiner Hemdtasche nahm und scheinbar wahllos einige Fotos in verschiedene Richtungen schoss. Anschließend durchstreifte er den gesamten der Öffentlichkeit zugänglichen Teil des Doms und fotografierte von vielerlei Positionen heraus das Kircheninnere. Die Gemälde lichtete er mehrmals ab, wobei er jeweils unterschiedliche Einstellungen an der Kamera wählte.
Zwischen halbhohen Messingständern hängende rote Seile verhinderten den Zutritt zu den beiden Flügeln des Querschiffs und machten sie für die Öffentlichkeit nahezu uneinsehbar. Nur wer ganz nahe an die Absperrung des linken Querflügels herantrat, konnte mit ausgestrecktem Arm eine Kamera in diesen Gebäudeteil halten. Wer dann den Auslöser betätigte, würde anschließend auf dem Foto erkennen, dass die breite Tür am Ende dieses Flügels geöffnet war und den Blick in einen kleinen Innenhof preisgab, in dessen Zentrum ein reich verzierter Brunnen stand. Wer die Prozedur wiederholte und den Brunnen mit einem optischen Zoom formatfüllend ablichtete, konnte sogar die Initialen des Künstlers sehen, der diesen Brunnen dereinst gestaltet hatte. Genau das tat der sympathische Mann, ehe er sich wieder den Gemälden zuwandte.
Kurz darauf trat ein schwarz gekleideter Herr aus eben diesem Seitenflügel, setzte sich auf einen Stuhl in der Apsis hinter dem Hauptaltar und schien eine mitgebrachte Broschüre zu studieren. Tatsächlich aber spähte er über den Rand des Textes hinaus und ließ den Besitzer der Kamera nicht aus den Augen.
* * *
Nach seinem Besuch im Dom schlenderte Thomas Kay wie viele andere Touristen und Einwohner durch die Innenstadt von Grosseto und genoss die abendliche Stimmung. Er kam an einer kleinen Bar vorbei und nahm kurz entschlossen an einem freien Tisch Platz, bestellte einen Montecucco, lehnte sich zurück und nahm seine Kamera aus der Hemdtasche. Es war ein Geschenk von Dr. Leith, einem Psychiater, der sich mit ihm angefreundet und es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Kay von seinen Psychosen zu befreien. Das Problem bestand einzig darin, dass nach Kays Ansicht nicht er sondern Dr. Leith unter Psychosen litt.
Kay blätterte durch die Fotos, die er gerade im Dom gemacht hatte. Es war ihm als ein guter Ort erschienen, um die Fähigkeiten der Kamera im Umgang mit schwierigen Lichtverhältnissen zu testen. Nicht, dass er sich viel aus dem Fotografieren gemacht hätte. Genaugenommen hatte er vor Jahren vollständig damit aufgehört, für sich und andere visuelle Beweise seiner Existenz anzufertigen, wie er es nannte. Er war der Ansicht, was man nicht aus seiner Erinnerung wieder vor sein geistiges Auge ziehen könne, sei es nicht wert, aufbewahrt zu werden. Leith aber war der Meinung, Kay mache deshalb keine Fotos, weil er seine eigene Vergangenheit und damit sich selbst verleugne, was wiederum ein Ausdruck traumatischer Erlebnisse in Kays Kindheit sei, an die er sich nicht erinnern wolle. Wenn ihm Kay dann erklärte, dass er über ein gutes Gedächtnis verfüge und sich an alle wichtigen Ereignisse aus seiner Kindheit erinnern könne, entgegnete Leith, dies sei ein eindeutiger Beweis für die tiefe emotionale Verletzung, die in ihm schlummere, da er sich ganz offensichtlich die damit in Zusammenhang stehenden Erlebnisse trotz seines vordergründig intakten Erinnerungsvermögens nicht wieder in sein Gedächtnis zurückzurufen vermochte.
Die Bedienung brachte den Wein und stellte ihn auf den aus rohem Holz gefertigten kleinen Bistrotisch. Kay ließ die Kamera wieder in seine Hemdtasche gleiten und nahm einen Schluck des etwas zu warmen Rotweins. Während er dem Geschmack, der an einen guten Chianti erinnerte, nachspürte, hielt er den Blick zum Himmel gerichtet. Vor seinem geistigen Auge sah er sich in das Fernsehstudio zurückversetzt, in dem er vor wenigen Stunden gesessen hatte.
Als man am Vortag mit der Frage an ihn herangetreten war, ob er für ein Interview zur Verfügung stünde, hatte er spontan abgelehnt, weil ihn das Beantworten trivialer Fragen, die lediglich zur Unterhaltung der Zuschauer gestellt wurden, langweilte. Nur wegen der Beharrlichkeit des Moderators und einer persönlichen Einladung seitens des Polizeichefs hatte er schließlich zugestimmt. Im Nachhinein hatte der Moderator seine Hartnäckigkeit vermutlich bereut, dachte Kay.
Begleitet von dem erdigen Geschmack des Weines und einem stillen Lächeln ließ er das Interview Revue passieren...
„Meine Damen und Herren, die vorangegangene Einführung gab Ihnen einen Überblick über die Erfolge, die Titus Brogi erreicht hat, seit er das Amt des Generaldirektors für öffentliche Sicherheit begleitet. Als Chef der Staatspolizei ist er unter anderem für die Koordination aller italienischen Polizeieinheiten zuständig. Er hat sich zum Ziel gesetzt, deren Zusammenarbeit zu verbessern und legt Wert darauf, die Öffentlichkeit über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Auf seine Anregung hin haben wir heute einen besonderen Studiogast zu uns eingeladen. Neben mir sitzt Dottore Thomas Kay. Er ist Professor für Informatik und lehrt an verschiedenen renommierten Universitäten weltweit. Seine Kindheit verbrachte er im deutsch-sprachigen Raum, lebte in England, bereiste verschiedene Teile Asiens und hat glücklicherweise auch einige Zeit in Italien verbracht - was seine guten Kenntnisse unserer Sprache erklärt.
Er ist ein international anerkannter Spezialist für Datensicherheit, Computerkriminalität und Kryptographie und konnte als Dozent für ein Fortbildungsseminar unserer Ermittlungsbehörden, das gegenwärtig in Grosseto stattfindet, gewonnen werden.
Meine Damen und Herren, genug der einführenden Worte, lassen wir nun unseren Gast zu Wort kommen.“
Der Moderator wandte sich an Kay:
„Professore, wie Sie wissen, befassen sich die Sicherheitskräfte dieses Landes intensiv mit dem Thema Internetkriminalität. Auch wenn es der Polizei noch immer nicht gelungen ist, die bestehenden Strukturen der Mafia zu zerschlagen, soll mit allen Mitteln verhindert werden, dass das Internet von mafiösen Organisationen übernommen wird. Wie ist Ihre Meinung dazu? Kann es gelingen?
Kay saß in einem bequemen Sessel dem Moderator gegenüber und hielt ein Glas Wasser zwischen seinen Händen. Er beendete die Beobachtung der Wasseroberfläche, auf der die Reflexionen der Studioscheinwerfer im Rhythmus der kleinsten Bewegungen seiner Hände tanzten, und fragte:
„Ist es dafür nicht längst zu spät?“
„Wie meinen Sie das?“
„Wir leben in einer Zeit, in der das Internet zu einem der größten Wirtschaftsfaktoren weltweit geworden ist. Fast alle Unternehmen wickeln ihre Geschäfte direkt oder indirekt über das Internet ab. Je größer das Unternehmen, desto größer ist sein Bemühen, das Internet mit seinen Informationen zu infiltrieren - das nennen wir Werbung - und zu verhindern, dass für das Unternehmen nachteilige Informationen verbreitet werden - das nennen wir Manipulation.“
„Verstehe ich Sie richtig? Sie bezeichnen die großen Unternehmen als kriminell, weil sie im Internet werben?“
„Nicht alle, aber die meisten. Schauen Sie sich einmal unvoreingenommen die Werbung an. Bei jedem beworbenen Produkt stellen sie sich dann die Frage, ob die behaupteten Eigenschaften zu 100 Prozent zutreffen. Wirkt eine Kopfschmerztablette tatsächlich gegen alle Arten von Kopfschmerz? Sind die angepriesenen Verbrauchswerte eines beworbenen Automobils korrekt? Ist eine beworbene Holzlasur tatsächlich gesundheitlich völlig unbedenklich?
Sehen Sie sich die Werbung an, und sie werden feststellen, dass fast immer übertrieben wird, häufig wird sogar ganz offensichtlich die Unwahrheit gesagt. Es werden Eigenschaften zugesagt, die wissentlich nicht der Wahrheit entsprechen, einzig, um die Menschen zum Kauf zu überreden. Juristisch gesehen erfüllt das den Tatbestand der arglistigen Täuschung und ist insofern eine kriminelle Handlung. Wenn nun aber jemand herausfindet, dass die Eigenschaften eines Produktes nicht zutreffen und dies publik macht, wird er verklagt, unglaubwürdig gemacht oder bedroht, gerne auch alles zusammen.“
„Meinen Sie nicht, dass sie da etwas übertreiben? So funktioniert Werbung eben nun einmal. Man versucht zu beschönigen. Das ist normal.“
„Da stimme ich Ihnen zu. Aber nur weil es normal ist, bedeutet das nicht, dass es nicht kriminell ist. Wenn die Unwahrheit auch noch so klein ist, kann man sie - von einem abstrakten Standpunkt aus betrachtet - als einen Samen für eine kriminelle Handlung sehen. Wenn dieser Samen auf einen arglosen Konsumenten oder Geschäftspartner fällt, der genau wegen dieser kleinen Übertreibung dieses Produkt dem eines Wettbewerbers vorzieht, dann ist aus diesem Samen eine kriminelle Handlung erwachsen. Natürlich weiß auch ich, dass die Welt nun einmal genau so funktioniert und natürlich kann ich mich darin bewegen und natürlich falle ich auf den Großteil der Werbung nicht herein. Aber Sie können es drehen und wenden wie sie wollen: Es ist eine absichtliche Täuschung und somit kriminell.“
„Das trifft aber nicht nur für das Internet zu. Unsere Wirtschaft funktioniert schon immer mit dieser Art Werbung, die Sie als Keim krimineller Handlungen bezeichnen. Meine eingangs gestellte Frage bezog sich aber speziell auf die Kriminalität, die erst durch das Internet möglich ist. Und in diesem Bereich stellt sich die Frage, ob das Internet von kriminellen Strukturen zunehmend in Besitz genommen wird oder ob es den Regierungen dieser Welt möglich sein wird, das zu verhindern“, entgegnete der Moderator.
Kay lächelte wissend.
„Mir ist klar, was Sie meinten. Aber es kann nie schaden, zuerst den Blick zu schärfen. Jetzt sehen wir nämlich, dass die Definition des Begriffes ‚Internetkriminalität’ schon deshalb schwierig ist, weil wir noch nicht einmal genau wissen, was ein normales oder besser ein geduldetes Verhalten in unserer Kultur ist und wo die Kriminalität anfängt. Das heißt, dass wir über etwas reden, das wir noch nicht einmal klar definieren können.
Aber lassen Sie uns dessen ungeachtet einen anderen Aspekt Ihrer Frage betrachten, nämlich ob es gelingen kann, den Datendieben und Datenmanipulatoren, beispielsweise den Kreditkartenbetrügereien, Einhalt zu gebieten. Diese Frage zu beantworten ist für mich nicht sonderlich spannend, denn natürlich könnte es gelingen, wenn man es wirklich wollte. Aber solange Regierungen gestohlene Daten kaufen, also Datendiebe für ihre kriminellen Taten belohnen, und solange in deren Auftrag Programme entwickelt werden, die sich in die Rechner von unbescholtenen Bürgern einnisten und deren Aktivitäten an ihrem Rechner und im Internet protokollieren, was ohne Zweifel die Persönlichkeitsrechte verletzt, kann ich den klaren Willen nicht erkennen. Die Regierungen dieser Welt sind selbst viel zu sehr in kriminelle Tätigkeiten verwickelt und ziehen Nutzen daraus.“
Der Moderator blickte unbehaglich in die Kamera. „Ich denke, da gehen Sie aber nun wirklich etwas zu weit.“
„Sicher? Haben Sie einmal darüber nachgedacht, dass sämtliche Geheimdienste dieser Welt das Internet zu einem ihrer wichtigsten Instrumente gemacht haben? Sie übertragen über das Internet unter anderem Daten für militärische Einsätze, und sie nutzen es häufig über die zulässigen gesetzlichen Regelungen hinaus, um Informationen über potentielle Verdächtige zu sammeln und in ihrem Sinne auszuwerten, was jeden zu einem potentiellen Verdächtigen machen kann. Darüber hinaus gibt es Institutionen, die sich darauf spezialisiert haben, Daten auf illegale Weise von Internetnutzern zu sammeln und diese Daten an die Geheimdienste zu verkaufen, was ebenfalls das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. Ich denke es genügt, wenn ich die Begriffe ‚social networks’, ‚online shops’ und ‚Suchmaschinen’ nenne, wobei dies nur die offensichtlichsten Beispiele sind.
„Vielleicht haben Sie recht damit, aber Ich glaube dennoch, dass Sie die Dinge zu sehr verallgemeinern und vereinfachen“, warf der Moderator ein.
„Zugegeben, aber ich rede hier über diejenigen, die den größten Einfluss auf unser Leben haben. Selbst wenn wir utopisch veranlagt wären und annähmen, dass 95 Prozent aller Politiker, Anwälte, Berater, Lobbyisten, internationalen Unternehmen, aller militärischen Einrichtungen und sogar aller Geheimdienste ausschließlich im Dienste und zum Wohle der Allgemeinheit handelten, ohne jegliche Eigeninteressen, dann genügt uns ein Blick in die uns umgebende Welt um zu erkennen, dass es nicht diese 95 Prozent sind, die unser Leben bestimmen. Es sind die anderen 5 Prozent. Und nur wenn man deren Praktiken kennt, kann man versuchen, sich von ihnen befreien. Wer noch nicht einmal bemerkt, dass er gefesselt ist, wird kaum auf den Gedanken kommen, seine Fesseln abstreifen zu wollen.
Nur ein Beispiel: Erst seit verhältnismäßig wenigen Jahren wissen oder ahnen viele Menschen, dass die Mitglieder und Mitarbeiter der nationalen und internationalen Bankenaufsichtsbehörden sich genau durch zwei Eigenschaften auszeichnen: Sie sind hochgradig unfähig oder sie stehen unter dem Einfluss der Banken, die sie beaufsichtigen sollen. Häufig beides.“
Kay sah den Moderator eindringlich an und fuhr fort:
„Genau dieses Wissen ist nötig, um etwas zu ändern. Erst seit das Vertrauen in das westliche Finanzsystem erschüttert ist, beginnt man darüber nachzudenken und – wenn auch zaghaft – Alternativen zu erproben. Aber auch hier gilt: Die Dinge, die in der breiten Öffentlichkeit diskutiert werden, sind nur die Spitze des Eisberges.
Und leider hat kaum einer den Mut, in das kalte Wasser zu springen und sich den Eisberg einmal näher anzusehen.“
Der Moderator sah auf Uhr.
„Leider ist unsere Sendezeit gleich zu Ende. Ich habe aber noch eine abschließende Frage: Professore Kay, sind sie ein Pessimist?“





























