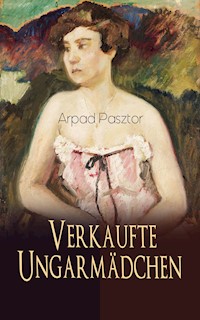1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem Werk 'Verkaufte Ungarmädchen' wirft Arpad Pasztor einen schonungslosen Blick auf die dunklen Seiten des Menschenhandels im mittel- und osteuropäischen Raum. Das Buch, welches in einem nüchternen, aber dennoch mitfühlenden Stil gehalten ist, führt den Leser durch die erschütternden Erlebnisse von jungen Frauen, die von skrupellosen Menschenhändlern ausgenutzt werden. Pasztor schafft es, die Grausamkeit dieser Realität ohne Sensationslust darzustellen, was dem Buch eine ergreifende Authentizität verleiht. Die historischen und sozialen Kontexte, die Pasztor geschickt einwebt, machen 'Verkaufte Ungarmädchen' zu einem wichtigen literarischen Werk, das zum Nachdenken anregt. Arpad Pasztor, selbst Ungar, bringt eine persönliche Perspektive in das Buch ein, die sein Engagement für das Thema deutlich macht. Als ehemaliger Journalist hat er ein feines Gespür für die Wahrheit und für die relevante Berichterstattung. Seine Erfahrungen in der investigativen Recherche spiegeln sich in der akribischen Detailgenauigkeit wider, mit der er die Geschichten der Ungarmädchen erzählt. 'Verkaufte Ungarmädchen' ist ein Buch, das dringend gelesen werden muss. Es öffnet die Augen für die Grausamkeit des Menschenhandels und ruft zu einem Umdenken in der Gesellschaft auf. Zwar sind die Geschichten, die Pasztor erzählt, erschütternd, aber sie sind auch ein Aufruf zur Solidarität und zur Handlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Verkaufte Ungarmädchen
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Rußland ...
Ich zählte etwa einundzwanzig Jahre. Meine Abende verbrachte ich gewöhnlich im Sprechzimmer und zwischen den Kulissen des alten Volkstheaters. Das Pester Bühnenkulissenleben war zu jener Zeit schon im Niedergange, nicht mehr so wie einst, als einige Grafen aus der ungarischen Lebewelt es laut und bunt und berüchtigt machten. Frau Pálmai war schon ins Ausland gegangen, ihre Magnaten waren längst ruiniert, die Herren aus dem Nationalkasino erschienen nur mehr selten in der ersten Bankreihe des Parterres. Die schweren Börsen, die Lebemänner, die für ihre Liebeshändel das Geld mit vollen Händen verstreuten und dadurch die Sitten dieses ganzen kleinen Budapest aufwühlten, -- so daß die bürgerliche Mittelklasse sie mit blassem Neide betrachtete, während der ärmste Pöbel sie wie ein Zirkus-Spektakel anstaunte -- diese Leute waren längst verflossen. Das Primadonnentum ward immer mehr zu einem Geschäft; anstatt der Vertreter des Hochadels sah man reiche Kaufmannssöhne aus der Leopoldstadt und Journalisten zwischen den Kulissen sich herumtreiben.
Die arme Aranka Hegyi hatte damals ihre jugendlich schlanke Gestalt schon eingebüßt; Klara Kücy hatte das leichte französische Vaudeville aufgegeben und geizte nach dem Ruhm der klassischen Helena. Die Stadt Budapest war wie von einem bösen Zauber heimgesucht: es häuften sich die Sorgen, das Leben ward schwieriger, der Kampf ums Dasein gewaltsamer und stürmischer. Aus dem gemütlichen Pest der reich gewordenen Handelsherren und der mit ihren Rennställen prunkenden Grandseigneurs war ein schweißtriefendes Budapest geworden! Doch mit meinen jungen Augen und meiner glücklichen Unerfahrenheit dachte ich damals nicht daran, all dies wahrzunehmen und zu beobachten; heute, da fünfzehn Jahre mich von jener Zeit trennen, stehen die damaligen Ereignisse in einem weit schärferen Lichte vor mir ...
Seither habe ich gelernt, die Welt mit tiefer dringenden Augen und aus mannigfachen Gesichtspunkten zu betrachten. Jetzt erst begreife ich Dinge, die mir einstmals nur flüchtige Erscheinungen waren. Die damaligen Äußerlichkeiten erklären mir heute das Wesentliche jener Zeit; die Erinnerungen lassen mich die wirkliche Welt erkennen, in der ich lebte und die ich durcheilte, ohne sie zu beachten.
Rußland!
Erst jetzt verstehe ich so recht den Inhalt dieses Wortes. Erst jetzt, da ich darüber schreibe, begreife ich die Bedeutung des damals phantastisch scheinenden Ereignisses, als eines Abends die Schwestern Mondschein im Sprechzimmer ankündigten, daß der Mann aus Rußland da sei und daß sie am nächsten Morgen mit ihm die Reise nach Petersburg antreten würden. Nervöse Aufregung ergriff das ganze Theater. An jenem Abend wurde der »Zigeunerbaron« gegeben. Ich und einige meiner Freunde unter den jungen Journalisten machten den Ballettratten eifrig den Hof. Ich stand, wie gewöhnlich, vor der schmalen Gitterpforte des Zuganges der Bühne, in traulichem Gespräch mit meiner kleinen Freundin, die mir in ihrer feschen Husarenuniform noch mutwilliger und liebreizender erschien als sonst ... Ihre Beine staken in einer knappen roten Hose, dazu trug sie Lackstiefelchen, um die Schultern hing die Manta; ihren Tschako hatte sie im Ankleideraume gelassen, das üppige rotschimmernde Haar war in einem Knoten hoch aufgesteckt: so stand das anmutvolle Geschöpf vor mir. Ich konnte es mir nicht versagen, von Zeit zu Zeit, wenn uns niemand störte, sie an mich zu drücken und ihr einen langen Schmatz aufzusetzen. Aus dem Zuschauerraum tönte die liebliche Straußsche Musik heraus, und Jóska Németh, der den Zsupan gab, sang mit seinem breiten Lächeln:
Das Schreiben und das Lesen Ist nie mein Fach gewesen ...
Meine kleine Freundin vergaß meine Küsse zu erwidern; sie war an diesem Abend nachdenklich und zerstreut.
»Was gibt es denn?« fragte ich sie.
»Der Mann aus Rußland ist da,« antwortete sie. »Für mich ist die Gelegenheit da, mein Glück zu machen. Mein Freund wird mich doch nicht heiraten ... Was soll ich hier zu Hause anfangen? Ich kann doch nicht ewig Tschardasch tanzen und in den Gruppen der Mama Hans (das war die Ballettmeisterin) figurieren. Das beste wäre, mit dem Manne aus Rußland abzufahren ...«
Ich wußte ihr nichts zu antworten. Denn was half das Leugnen, ich war doch nur ihre Liebe, nicht ihr Freund. Ihr Freund war derjenige, der sie »doch nicht heiraten kann«. Ein Herr aus der Provinz, der allwöchentlich auf zwei, drei Tage nach Budapest kam. Dieser Herr war das Geschäft, das ernste Leben, ich war nur die Liebe. Man weiß ja, daß jedes Theatermädel, das etwas auf sich hält, einen Freund hat, von dem sie lebt, und einen Journalisten oder Schauspieler, kurz einen Künstler, den sie liebt. Beide zusammen -- die Schauspielerin und der Liebhaber -- hassen den ernsten Freund, aber sie halten krampfhaft fest an ihm.
»Und was soll dann aus mir werden?« fragte ich endlich erschrocken.
Denn ich liebte meine kleine Kameradin; ich verlebte mit ihr die schöne Zeit der sorglosen, übermütigen Liebe. Unsere geheimen Zusammenkünfte in dem Stübchen, für das ich der Frau Zwillinger vierzig Kronen Monatsmiete bezahlte, unsere verstohlenen Küsse, der betrogene Freund aus der Provinz, die vielen kleinen Bosheiten des Ballettkorps, das mütterlich wohlwollende Lächeln der Primadonna, mit welchem sie zehnmal an einem Abend bei uns vorüberging; der Sonnenstrahl, der unsere glückliche Jugend vergoldete: all das hatte uns so sehr aneinander gewöhnt, daß mein Herz wahrhaftig zusammenzuckte, als Nuschi mir erklärte, sie müsse fort, denn der Mann aus Rußland sei da ...
Doch sie reiste nicht; ihr Freund erhöhte ihre Monatsapanage. Aber das geschah erst einige Tage später; an jenem Abend herrschte in den Korridoren und im Sprechzimmer des Volkstheaters »russische« Stimmung. Die Schwestern Mondschein packten ihre Sachen und nahmen Abschied von ihren Kolleginnen. Sie verteilten ihre restlichen Vorräte an Gesichts- und Lippenschminke und gaben ihre Spiegel und Schubfächer ab. Mutter Hans legte ihnen ans Herz, acht zu geben und zu sparen, denn »Jugend vergeht, nur Geld besteht«.
Die Schwestern Mondschein saßen auf einem Bänkchen im Sprechzimmer und zeigten das bunte, mit Silberflitter reichlich verzierte Kostüm herum, das die Theaterschneiderin, Frau Topolanszky, für sie »komponiert« hatte. Die jüngere, Serene, erzählte, daß sie zwei Lieder und einen Tschardasch einstudiert hätten. In Petersburg würden sie Geschwister Luna, in Moskau Sisters Diana heißen ... Das ganze Theaterpersonal stand rings umher. Alte Choristen, die als Zigeuner kostümiert waren, verlangten Glücksgeld von den Geschwistern Luna und den Sisters Diana, die von den Kollegen Abschied nahmen. Die Choristinnen, die ewigen Feindinnen des Ballettkorps, standen geheimnisvoll zischelnd in einer Ecke beisammen und berieten, ob man die Schwestern Mondschein nicht dem Theatersekretär verraten sollte, da sie ja mitten im Jahr das Theater verlassen wollten. Doch schließlich begnadigten sie die beiden Mondschein ... Man kann nicht wissen ... Vielleicht wollen wir selbst einmal nach Rußland ... Halten wir lieber zusammen ...
Mein Liebchen ließ mich vor dem Gitterpförtchen stehen; an jenem Abend kümmerte sich niemand um die Liebhaber und Freunde der Theaterdamen. Rußland, das ferne und geheimnisvolle, das mir nur aus »Eugen Onegin« bekannt war, beherrschte die Bühne und das Sprechzimmer ... Die Theatermädel waren zerstreut und befangen ... Nach dem ersten Aufzuge rannten sie wie die Ratten die Treppe zu dem Ankleidesaal hinauf, der im zweiten Stock, am Ende eines langen Korridors, lag. Da half unser Pochen nichts, die Tür ward nicht geöffnet. Die Garderobefrauen schleppten in Zubern das Schminkwasser hinaus; nach dem zweiten Aufzuge schminkten die Mädel noch vor dem Finale sich ab, um so rasch wie möglich hinwegeilen zu können.
Gelangweilt harrten wir im Sprechzimmer, ob die feschen Husaren vielleicht doch herabkommen würden. Lächelnd blickten wir uns an, als ein alter Chorist, ein typischer Gelegenheitsmacher, einem reichen jungen Kaufmann aus der Leopoldstadt, in der Hoffnung auf ein gutes Souper, die kleine Gisela Farkas vorstellte ... Endlich ertönte die Klingel des Regisseurs: das Ballettkorps ward gerufen. Die Ballettmädel eilten direkt auf die Bühne, ohne uns eines Blickes zu würdigen ... Aus dem ersten Gäßchen der Kulisse betrachteten wir die Werbeszene und den klassischen Zittertanz der genialen Aranka Hegyi, dann nach dem Werbetanz den Aufmarsch der Ballettmädel auf die Brücke, von der herab sie betrübte Blicke auf uns warfen ... Wir waren eben in dem Alter der jungen und romantischen Liebe.
Dann ging der Aufzug zu Ende. Die vielen Zigeuner und Husaren strömten von der Bühne heraus, strömten die Treppe zu den Ankleideräumen hinauf. Auf der Bühne blieben nur die Solisten zurück und harrten des Beifallssturmes des Publikums, um sich bei hochgezogenem Vorhang dankend zu verneigen.
Ballett und Chor waren im dritten Aufzug nicht beschäftigt. Vor der Loge des Portiers erwarteten wir die Mädchen. Auf die Straße hinaus wagten wir uns nicht, denn dort wartete der wirkliche Freund, der zahlende ... Endlich erschienen die Mädchen, eines nach dem andern. In der Loge des Portiers gab es noch ein Briefchen, einen Kuß, einen Händedruck ... Auf der Straße wartete der legitime Herr, der seiner Freundin den Arm reichte und mit ihr im Dunkel der Nacht verschwand ...
Jetzt kam Nuschi; unter Hunderten hörte ich ihren leichten Schritt heraus.
»Gehen Sie nun wirklich nach Rußland?« fragte ich sie, während ich meine Tränen nur mit Mühe zurückdrängen konnte.
»Vielleicht ... Ich weiß es nicht ...« antwortete sie, indem sie mir die Hand drückte.
Jetzt kamen mit lautem Gelächter die Schwestern Mondschein herab, hinter ihnen die Garderobefrau, Mama Weiß, mit einem großen Bündel. Draußen erwartete sie ein Fiaker. Einige Kolleginnen gaben ihnen das Geleit bis zum Wagen.
Und Geschwister Luna, Sisters Diana, traten ihre Reise nach Rußland an ...
So geschehen vor fünfzehn Jahren ... Seither verging so manches Jahr, so manche Liebe und die Dinge gestalteten sich ganz anders, als wie sie früher waren. Ich habe seither Petersburg und Moskau gesehen ... Die Schwestern Mondschein sind seither heimgekehrt ... Sie sind beleibte Jüdinnen geworden, ihre Söhne sind Zeitungsjungen ...
Rußland! ...
Kapitel 2
Sie wohnten in der Feuerwehrstraße, draußen in der Franzstadt. Eine Tafel unter der Toreinfahrt zeigte unter andern folgenden Zettel in einer plumpen, ungelenken Schrift: Witwe Desider Ladány, III. 18. Die Wohnung bestand aus einem Zimmer nebst Küche; Frau Ladány zahlte dafür 480 Kronen Jahresmiete. Im Hause hieß sie allgemein »die Frau Professor«. Der gleichfalls schon verstorbene ältere Bruder ihres seligen Gatten war Universitätsprofessor gewesen, darum ließ sich Frau Ladány die Verwechslung gern gefallen; ja, in gewissen Amtsstuben, wo man ohne Verantwortlichkeit reden darf, gab sie sich selbst ohne Scheu diesen Titel. Ihre bescheidene Pension von monatlich 120 Kronen zeigte aber leider, daß der Gottselige nur Mittelschullehrer gewesen und gar kein Vermögen hinterlassen habe, allerdings auch keine Schulden. Was in der Welt der Mittelschullehrer selten genug ist.
Witwe Desider Ladány verstand es, das Erbe ihres verstorbenen Gatten zu erhalten und hütete sich gleichfalls davor, Schulden zu machen. Sie war einst ein frohes, rundliches Mädchen gewesen, allein die strenge, nach der Uhr geregelte Lebensweise hatte die Fülle ihres Körpers allmählich völlig aufgezehrt. Eine hagere Frau mit gelber Gesichtsfarbe war aus ihr geworden, die immer schwarz gekleidet war und einen Klemmer auf der Nase trug. Ihr Busen und ihre Hüften waren längst verschwunden; wer sie sah, dachte nicht daran, eine Frau vor sich zu haben. Ihr karg bemessenes Ruhegehalt gestattete ihr nicht, sich modern zu kleiden. Wenn sie ausging, zog sie einen einfachen, glatten, schwarzen Rock an; über dem alten, vielfach geflickten, eckigen Mieder eine enge, allmählich zu kurz gewordene Taille, deren vorn eingefallene, fast verschwundene Spitze erraten ließ, daß diese Taille einst für eine Frau angefertigt wurde. Den Hals bedeckte ein schwarzes, im Basar erstandenes Spitzentüchlein, auf dem glatt gekämmten, schon ergrauenden Haupthaar saß ungebärdig schief ein ärmliches Hütchen mit flachen Rändern. Die Nase war dünn, etwas lang, die Augen wasserblau.
Vierzig Kronen monatlich waren für den Mietzins bestimmt, fünfzig Kronen mußten für Nahrung und Zerstreuung genügen. Frau Ladány ging nämlich am sechzehnten Tage eines jeden Monats in irgendein Theater, stets auf die letzte Galerie. Die restlichen dreißig Kronen wurden von den Kosten der Erziehung und Bekleidung ihrer Tochter Therese aufgezehrt. Eine Krone und siebzig Heller verblieb den beiden täglich für ihre Ernährung: das war wenig, aber noch nicht so schlimm. Zum Frühstück konnte man sich ein Täßchen Kaffee leisten, zu Mittag ein wenig Suppenfleisch mit Gemüse, am Abend einen Bissen Wurst zum Brot. Immer dasselbe, ohne Abwechslung.
Therese war ein frisches anmutiges Mädchen. Sie trug stets ein sehr einfaches, schmuckloses Kleidchen von wohlfeilem Zeug; doch was immer sie anzog, saß ihr schön, ihr strahlender Frohsinn vergoldete ihr ganzes Wesen. Leicht schritt sie nach dem Rhythmus der Musik ihrer sorglosen Seele durch das Leben. Ihre Lehrer in der Bürgerschule gewannen sie lieb; sie lernte niemals, machte dennoch ihre Klassen durch, und da sie die Waise eines Professors war, behandelte man sie mit Nachsicht und Wohlwollen. Ihre Mutter hatte so sehr jeden eigenartigen Zug verloren, war so sehr »Individuum« geworden, daß man die Tochter nicht mit der Mutter vergleichen konnte; doch Therese behauptete immer, daß sie ihrem Vater, dem ehemaligen Professor der Geschichte und der ungarischen Sprache, nachgerate. In ihrem Zimmer hing die Photographie des Gottseligen in schwarzem, mit schmaler Goldleiste geziertem Rahmen; auf der bescheidenen Kommode, an die Wand gelehnt, einige aus Anlaß der Reifeprüfung aufgenommene Gruppenbilder der Schülerinnen; unter den Stößen der Weißwäsche lagen sorgfältig aufbewahrt drei Jahresberichte der Schule, mit den einleitenden Artikeln Desider Ladánys: »Petöfis wahre und Listnyais gesuchte Volkstümlichkeit«; »Das Verschwinden der Ode«, und »Kann der Pädagog zugleich ein Schöpfer sein?« Ferner zwei alte Nummern des illustrierten Wochenblattes »Versárnapi Ujság« (Sonntagszeitung) mit den vom Vater verfaßten Gedichten: »Am Traualtar« und »Meine Schülerinnen«.
Das war alles, was von der Wirksamkeit Desider Ladánys übrig geblieben, aber gerade genug, damit Therese im geheimen für Literatur schwärmte und ihre ganze freie Zeit mit der Lektüre von Romanen verbrachte. Es war ihr gleich, was ihr in die Hand geriet, wenn es nur ein Roman, ein Buch war. Solange sie noch die Bürgerschule besuchte, fehlte es ihr nie an Romanen, die Schülerinnen betrieben einen lebhaften Austausch von Büchern. Für einen Zoltán Ambras ward ein Emil Zola eingetauscht, für einen Zola ein Alexander Bródy. Herczeg und Gárdonyi waren auch in der Schulbibliothek zu haben; dagegen konnten die Werke Maupassants, Ludwig Biros und Franz Molnárs nur im geheimen gelesen werden. Große Aufregung gab es in der IV/b-Klasse, als man sich ein Exemplar des konfiszierten » Ssanin« zu verschaffen wußte. Während der Unterrichtspause hielt die Schülerin Blanka Gaßner Wache vor der Tür, das Buch wurde in 35 gleiche Teile zerrissen und die einzelnen Teile in der Reihenfolge des Alphabets unter die 35 Schülerinnen der Klasse verteilt. Die, die mit ihrem Teil früher fertig war, tauschte mit einer anderen. Dies geschah ganz systemlos, aber nach zwei Tagen hatte die ganze Klasse das Buch fertig gelesen.
Und vollends das Theater! Wer ein neues Stück gesehen hatte, mußte den Kolleginnen darüber Bericht erstatten. Man wußte von jeder Schauspielerin, wer ihr »Verhältnis« war; die in Vorbereitung befindlichen neuen Stücke sämtlicher Theater waren den Schülerinnen bekannt. Große Sensation gab es in der Bürgerschule der Pratergasse, als anläßlich eines Schulfestes die gefeierte Künstlerin des Nationaltheaters Therese Csillag erschien und Viktor Hugos Gedicht »Das Nest im Turme« vortrug. An jenem Abend deklamierte auch Therese Ladány ... »Meine Schülerinnen«, Gedicht von Desider Ladány. Mutter Ladány weinte, die gefeierte Künstlerin Therese Csillag streichelte der Schülerin die Wange und sagte mit einem stereotypen Lächeln, während sie an ganz andere Dinge dachte:
»Wahrhaftig, das Kind hat viel Talent!«
Diese Szene gehörte zu den schönsten Erinnerungen, welche Therese Ladány nach Erledigung der sechs Bürgerschulklassen mit nach Hause nahm. Diese Erinnerung lebte in ihr fort wie ein im Traum gehörter, rufender, silberheller Klang einer Glocke. Wenn sie abends das Lämpchen ausgelöscht hatte und zur Ruhe ging, wiederholte sie sich im stillen: »Fürwahr, das Kind hat viel Talent!«
In ihrem siebzehnten Lebensjahr war Therese Ladány zu einem sehr schönen Mädchen herangewachsen. Nach einer Beratung mit ihrer Mutter beschloß sie, die Handhabung der Schreibmaschine zu erlernen, weil sie nicht länger dreißig Kronen von Mamas Pension in Anspruch nehmen wollte. Auch sei es schon an der Zeit, daß sie sich besser kleide und an ihre Heiratsausstattung denke. War sie erst fertige Maschinenschreiberin, würde sie ohne Schwierigkeit eine Stelle mit hundert Kronen Monatsgehalt finden. Sechzig Kronen wollte sie für ihre Toilette verwenden, und auch für Zerstreuungen würde sie mehr als bisher ausgeben dürfen. Was in solcher Weise von der Pension erübrigt wurde, sollte zur Aufbesserung der Beköstigung dienen, und nach allen diesen Ausgaben könnte die kleine Familie noch jährlich ein Sümmchen von vierhundertundachtzig Kronen ersparen. Das würde nach fünf Jahren mit den Zinsen dreitausend Kronen betragen. Das war dann schon etwas.
So malten sich Mutter und Tochter die zufriedene, sorgenfreie Zukunft aus, und damit der Traum so bald wie möglich zur Wirklichkeit werde, ließ sich Therese am nächsten Tage in die Schreibmaschinenschule der Paula König in der Wesselényigasse aufnehmen.
Im ersten Stock eines weitgestreckten, flachen Gebäudes mit geräumigem Hofe befand sich die Anstalt, wo männliche und weibliche Zöglinge in die Geheimnisse des Maschinenschreibens eingeweiht wurden. Auf das Anläuten öffnete eine schmutzige kleine Magd die Tür; ein herber Küchengeruch empfing den Eintretenden, -- denn in diesem Hause wurden fast täglich »Krautflackerl« gekocht. Im Vorzimmer stand ein großer Kleiderrechen, dessen grüne Tuchverkleidung von den Motten arg mitgenommen war. Die Schreibmaschinenschule des Fräuleins Paula König war keine Luxusstätte, die von solchen Mädchen besucht wurde, denen das Maschinenschreiben nur ein Vorwand ist, um über ein Bureau hinweg nach ihrer Art zur Geltung zu kommen. Diese Schule ward von schwerfälligen Judenmädchen besucht, die, von des Daseins Sorgen gedrückt, einen Erwerb zu erlangen trachteten, der ihnen ein Einkommen von achtzig bis hundert Kronen monatlich sicherte.
»Ich habe nur eine Schule, nichts anderes,« pflegte Fräulein Paula König zu sagen.
Sie war ein beleibtes, fleißiges Weib, trug stets ein dunkelblaues Kleid von englischem Zuschnitt, das glatt gescheitelte, in der Mitte abgeteilte Haar bildete einen strengen Rahmen um ihr Antlitz. Sie duldete in ihrer Schule keinen Flirt und keine Liebeleien. Sie erteilte nur Unterricht im Maschinenschreiben. Maschinenschreiben in dreißig Stunden! Das war ihr Motto. Wer in dreißig Stunden das Maschinenschreiben nicht erlernte, ward nicht mehr aufgenommen, denn er war entweder unfähig oder nachlässig. Die Bürgerschule lieferte zahlreiche Schülerinnen, die Schüler waren zumeist ehrgeizige Ladenschwengel, die mit Hilfe der Schreibmaschine vom Pult hinweg in die Korrespondenz gelangen wollten. Darum waren denn auch am Vormittag nur wenige Schüler zu sehen, größtenteils Kaufmannssöhne, die anderen kamen nach acht Uhr, zum Abendkursus. Am Abend hingegen gab es weniger Schülerinnen.
In diese Anstalt ließ Frau Ladány ihre Tochter Therese aufnehmen. Sie tat es auf Anraten einer Nachbarin, deren zwei Töchter gleichfalls den Königschen Lehrkursus durchgemacht hatten. Unter den vielen frühreifen, übermäßig lebhaften, mit fetter Kost genährten, vollbusigen Mädchen erschien Therese als Vertreterin einer ganz anderen Klasse. Ihre Sauberkeit, ihre Leichtigkeit, ihre angeborene Anmut unterschieden sie von der ganzen Gesellschaft, und die Zöglinge des Vormittagskurses interessierten sich vom ersten Augenblick für sie mit jener lebhaften Sehnsucht, mit jener unwiderstehlichen Begierde, wie beispielsweise die Neger nach weißen Frauen Verlangen tragen.
Therese bemerkte nichts von alledem. Nicht, als ob sie an junge Männer und an Liebe nicht gedacht hätte. Die Unterrichtspausen in der Bürgerschule, die intimen Zusammenkünfte mit den Freundinnen, die geheime Lektüre in den Lexikons und in den Lehrbüchern über die Anatomie des Menschen hatten auch sie über alles belehrt, was ein Mädchen wissen will. Allein die »Liebe« oder »der junge Mann« blieb für sie ein romantisches Gefühl, die Verkörperung des Auszuges aus den verschlungenen vielen Romanen. Die jungen Leute aber, die sie in der Anstalt der Paula König sah, kamen für sie nicht in Betracht.
In ruhiger, unzugänglicher Reinheit saß sie in dem kleinen Zimmer, wo etwa dreißig Zöglinge hinter kleinen Tischen zusammengepfercht waren. Es gab in dem Raume acht bis zehn Schreibmaschinen; auf dem Katheder thronte Fräulein Paula König, damit beschäftigt, einen Typewriter zu zerlegen, um den Zöglingen die einzelnen Bestandteile der Maschine zu zeigen. Jeder muß erlernen, wie eine Maschine beschaffen ist.
»Diese Kenntnis«, so pflegte sie zu sagen, »ist für Sie gerade so wichtig, wie für den Schutzmann die Kenntnis der ersten Hilfeleistung bei Unfällen. Sie sind die Hüter der Schreibmaschine; wenn irgendein Unfall geschieht, haben Sie die erste Hilfe zu bringen.«
Dann schrieb sie auf einer großen Tafel die Schriftzeichen der einzelnen Tasten der Maschine auf; jeder Zögling mußte auswendig lernen, in welcher Reihe und an der wievielten Stelle die verschiedenen Typen und Interpunktionszeichen sitzen.
»Zuerst alles im Kopfe, nachher alles auf der Maschine,« war das zweite Motto der Meisterin. »Wenn Sie -- was Gott verhüte! -- Ihr Augenlicht einbüßen, werden Sie Ihr Brot dennoch nicht verlieren.«
Therese ging ernst und entschieden an die Arbeit. Sie hatte sich auch mit zwei Lüsterärmeln versehen, die sie bei der Arbeit über die Ärmel ihrer Bluse zog, um diese nicht zu beschmutzen. Sie wußte genau Bescheid mit den Bestandteilen der Schreibmaschine und hatte bald die Anordnung der Typen und Zeichen im Kopfe. Das hinderte aber nicht, daß sie die ganze Geschichte öde und langweilig fand.
Sie war ein junges Mädchen, schön und heiteren Gemütes. Gern verweilte sie vor den Schaufenstern der prächtigen Geschäftsläden und oft dachte sie daran, wie die herrlichen Hüte der Putzmacherin Mademoiselle Charlotte ihr passen würden. Mit neidischer Sehnsucht betrachtete sie die Brautausstattungen, die in der Joelschen Wäschehandlung zur Schau ausgelegt waren. Wenn sie den Stefanie-Korso aufsuchte, geschah es nicht, um sich dort zu ergehen, sondern um die Menschen zu betrachten, die in prächtigen Kutschen fuhren. Sie sah, daß das Leben reich, schön, voll von Genüssen sei, und dachte mit Schrecken und Unmut daran, was ihrer harrte.
Sie war seit einer Woche Schülerin der Paula Königschen Schreibmaschinenschule und konnte die ihr vorgelegten Drucksachen schon ganz geläufig kopieren, so daß die Meisterin sie vor den übrigen Zöglingen öffentlich belobte.
»Sehen Sie, meine Damen und Herren! Ich bin keine Christin, aber Wahrheit bleibt Wahrheit: eine Christin ist doch etwas ganz anderes ...«
Die anderen Zöglinge belobten sie gleichfalls und schmeichelten ihr, und als sie nach Hause ging, schloß sich ein junger Mann ihr an. Er hieß Paul Kemenes und hatte eine Handelsschule absolviert. Seine Eltern betrieben das Schneidergewerbe; er selbst wollte das Maschinenschreiben erlernen und dann in das Geschäft seines Vaters eintreten.
Es war zu Beginn des Monats September, gegen halb fünf Uhr nachmittags. Die Sonne neigte sich zu den Ofner Bergen herab und sandte einen fahlen, rostbraunen Streifen über die ganze Rákóczistraße. In der wollüstig lauen Luft zitterte der Sommer nach, der Turm der Rochuskapelle schimmerte heiter in der klaren Luft.
Bei der Nußbaumgasse holte Paul Kemenes Therese ein.
»Verzeihen Sie, Fräulein, daß ich Ihnen gefolgt bin,« sagte er. »Ich sitze in Ihrer Nähe, nur um zwei Maschinen weiter und habe mich Ihnen schon vorgestellt.«
»Gewiß ... ich kenne Sie ja,« antwortete Therese lachend ... »Aber ich gehe immer allein.«
»Wollen Sie nicht einmal eine Ausnahme machen?« fragte Paul leise.
Therese fand die Situation eigentümlich; seltsam und ergötzlich zugleich. Noch niemals hatte ein junger Mann auf der Straße sie angesprochen, obgleich ihr dies manchmal nicht unlieb gewesen wäre. Dieser Paul Kemenes war ihr ganz gleichgültig, obzwar er der vornehmste unter den Zöglingen der Königschen Schule war. Er war kein Handlungsgehilfe, auch kein armer Student. Er kleidete sich gut aus dem Laden seines Vaters und hatte sich zu dieser Begegnung vielleicht vorbereitet: ein buttergelber Handschuh bedeckte seine Linke und aus dem Seitentäschchen seines Rockes lugte der Zipfel eines Seidentüchleins hervor.
Therese fand die Sache so vergnüglich, daß sie fast hell auflachte. Sie kämpfte mit sich selbst, wie sie sich entschließen solle. Sollte sie dem jungen Manne den Abschied geben und allein nach der Feuerwehrgasse heimkehren? ... Dieser junge Mann war ihr ja so ganz nebensächlich, und es war ganz gleichgültig, ob er mitging oder blieb. Aber die Sache war immer etwas sonderbar. Sie verzog ein wenig den Mund und sagte plötzlich:
»Sie können mitgehen.«
Sie befanden sich jetzt vor dem Volkstheater.
»Ich danke,« erwiderte der junge Mann erfreut, und während sie über den Fahrdamm schritten, beschirmte er sie mit einer gewissen sorgfältigen Überlegenheit.
Hinter dem Tinóely-Monument hielten einige Fiaker. Die Räder der auf elastischen Federn sich schaukelnden Wagen waren mit fester Pneumatik bereift, die Rosse nagten hart an den Gebissen, auf dem Sitze lagen zusammengefaltet die großgemusterten Fußdecken. Therese dachte, wie schön es wäre, in einem solchen Wagen Platz zu nehmen und eine Spazierfahrt auf der Stefaniestraße zu machen; und plötzlich -- sie wußte selbst nicht wie es kam -- wandte sie sich an Kemenes mit den Worten:
»Lassen Sie uns eine Wagenfahrt machen!«
Nun reute den jungen Mann dieses ganze Abenteuer. Sein ganzes Vermögen bestand in zehn Kronen. Das würde für die Wagenfahrt zwar ausreichen, aber es tat ihm doch leid, das Geld so auszugeben -- ohne jede Gegenleistung. Dieses unerwartete Verlangen überraschte ihn und brachte ihn auf den Gedanken, daß dieses Mädchen doch nicht so ehrbar sei, wie es sich gab. Diese Wendung der Sache war ihm angenehm, aber die Geldausgabe schien ihm bedenklich. Es gab aber keinen Rückzug mehr und er betrachtete die Spazierfahrt als einen Vorschuß auf die Zukunft. All dies hatte er in einem Augenblick überdacht und er schloß:
»Gut, fahren wir!«
Der Fiakerkutscher grüßte: »Küss' die Hand, gnädiger Herr, wohin fahren wir?« und ließ den Taxameter spielen. Der Apparat zeigte die Anfangstaxe: 1 Krone 60 Heller; und während Paul antwortete: »Auf die Stefaniestraße« -- las er zugleich vom Apparat ab: nach weiteren 600 Metern je 20 Heller.
Von der Ringstraße bog der Wagen in die Andrássystraße ein. Therese sprach wenig, es schwindelte ihr gleichsam von der Luft, von dem Geräusch der Wagen und der elektrischen Straßenbahn und von dem Gefühl, daß zwei Rosse sie entführen, hinaus nach dem Stadtwalde. Sie dachte nicht daran, daß ihr einfaches Kleidchen und Jäckchen für die Stefaniestraße nicht passen; die Freude darüber, daß auch sie dort sein dürfe, verdrängte den elementaren weiblichen Instinkt: »Bin ich auch gut gekleidet?« In feierlicher Stimmung klopfte ihr Herz, als sie bei dem Millenniumsdenkmal in die Stefaniestraße einbogen und der Wagenlenker seinen Rossen freien Lauf ließ. Sie dachte nicht daran, daß jemand neben ihr sitze.
Von den Bäumen der Allee fielen die vergilbten Blätter schon ab, auf dem seichten Wasser des Teiches schwammen gelbe, langstielige Platanenblätter, ein einsamer Kahnfahrer bahnte sich mit seiner Sandoline einen Weg durch die Blätter; auf dem Fußsteig vor der Halle der Schlittschuhläufer standen Leute, auf der anderen Seite saßen viele auf Stühlen, doch all dies waren für Therese nur Nebelbilder, gleichsam Visionen. Andere Wagen glitten an ihr vorüber und darin saßen vornehme Herren und elegant gekleidete Damen ...
Erst bei diesem Anblick fuhr sie zusammen und schämte sich ob ihrer ärmlichen Erscheinung in dieser Umgebung. Aber anderseits freute sie sich, daß sie dennoch da sei und bei den Klängen der Militärmusik, die in dem Kolegowszky-Kiosk spielte, spazieren fahren dürfe.
Paul Kemenes wußte nicht, was er dem Mädchen sagen solle. Ihn quälte die geheime Angst, daß sein Papa, der alte Klein, der um diese Stunde in einem schlechten Rumpelkasten seine hygienische Ausfahrt zu machen pflegte, ihn erblicken könnte. Therese erwartete aber auch gar nicht, daß man zu ihr spreche; mit offenem Munde saß sie da, um bei dem raschen Trab der Pferde die Luft besser einsaugen zu können.
»Ist das nicht göttlich?« flüsterte sie.
Es war ein regelrechter Budapester Wagenkorso: Die Leute, die täglich ihre Tour um den Wasserturm machen, der diese herrliche Avenue abschließt. Die Kartenspieler der Kasinos, einige in Mode befindliche Schauspieler, die eine solche Fahrt zu ihren Erfolgen zählen, Leute, die von heut auf morgen leben, die gerade nur so viel Geld haben, um den Wagen zu bezahlen und dann noch ein Fünfkronenstück für einen Einsatz im Bakkaratspiel übrig behalten; Journalisten, die am Vormittag ihrer Zeitung mit vieler Mühe den täglichen Vorschuß erpreßt haben; der Herausgeber eines berüchtigten Winkelblattes mit den von ihm ausgehaltenen Freunden, der Patron eines bekannten Freudenhauses, Orpheumsdamen und die Frauen von Börsejobbern, nur wenige Magnaten: alles zusammen das armselige und großtuerische Schaufenster von Budapest, hinter welchem nichts ist als ein leerer Laden ...
Therese aber fand dies göttlich schön, neu und großartig. Sie hatte ein Gefühl, als wäre ihre Seele befreit worden. Mit funkelnden Blicken betrachtete sie den wallenden Federnschmuck auf den Hüten der Damen, und jeden vorüberfahrenden Herrn hielt sie zumindest für einen Grafen.
Paul Kemenes versuchte die Dinge zu erklären und redete wirres Zeug durcheinander. Therese hörte ihm nicht zu und der junge Mann ward immer mehr zerstreut, weil die Ziffern des starren Taxameters mit unbarmherziger Pünktlichkeit heraussprangen. Um sich dennoch zu entschädigen, drückte Kemenes, vom herabsinkenden Abenddunkel begünstigt, das Mädchen an sich ...
Therese tat, als bemerkte sie nichts. Ihre Stimmung hatte plötzlich umgeschlagen; sie fröstelte und fühlte einen Ekel vor dem Leben. An der Ecke der Üllöerstraße stieg sie aus dem Wagen, denn sie wollte nicht im Fiaker in der Feuerwehrgasse eintreffen. Ohne sich eigentlich von Kemenes zu verabschieden, hüpfte sie auf das Straßenpflaster und verschwand. Eine lahme Zeitungsverkäuferin, die ihre Abendblätter ausbot, bemerkte zu einer Hökerin, die vor ihrem Obststande saß:
»Ha, da ist eine, die bisher zu Fuße gegangen ist! ...
Therese drängte sich rasch durch die Menge der Passanten und eilte atemlos die Treppen empor.
»Wo bist du so lange geblieben?« fragte die Mutter streng.
»Ich hatte ein langes Konzept abzuschreiben ...«
»Es ist die höchste Zeit, daß du unser Abendbrot holst. Heut ist Freitag, da gibt es frische Grieben. Nimm für dreißig Heller.«
Kapitel 3
Am anderen Morgen regnete es. Therese hatte die Nacht sehr unruhig verbracht; sie konnte nur schwer einschlafen; es war ihr, als wäre in ihrem Dasein ein Wandel eingetreten. Sie maß dem Geheimnis, das sie in ihrem Innern barg und das sie gestern ableugnete, keine Bedeutung bei, obschon ihr Leben bis dahin so ereignislos dahingeflossen war, daß sie sich durch diese kleine Lüge bedrückt fühlte. Des Morgens war sie um halb sieben Uhr noch schläfrig, ihre Augen brannten, sie hatte das Bedürfnis zu schlafen und dennoch war sie froh, daß der helle Tag da war und sie aufstehen und die Wohnung in Ordnung bringen konnte. Ihre Schuhe waren gereinigt, denn sie durfte nicht schlafen gehen, ehe diese Arbeit getan war; ihr Bett war im Nu in Ordnung gebracht, an die Wand geschoben und mit einer roten Decke versehen. Sodann ging sie in Strümpfen und Pantoffeln in die Küche, wo das frische Wasser, das ihre Mutter vom Korridor hereingebracht, schon im Lavoir vorbereitet war. Als sie mit der Reinigung zu Ende war, blickte sie prüfend in den auf dem Fenster hängenden Spiegel. Sie betrachtete sich, trocknete mit zärtlicher Sorgfalt ihre Hüften und dachte daran, wie ein mit Spitzen besetztes Batisthemd, eine schöne, moderne Toilette sie wohl kleiden würde. Diesen Morgen liebte sie ihren Leib mehr als sonst.
»Was gibt's denn, Therese?« fragte die Mutter. Wie lange willst du dich denn waschen? Es ist bald acht Uhr.«
Therese gab ihr keine Antwort; sie ordnete eilig, mit geschickter Hand ihre Haare und langte nach dem Frühstück. Es gab zwei Tassen Kaffee und vier Kipfel; dieses bescheidene Frühstück führte jeden Morgen Mutter und Tochter zusammen; der ungedeckte Tisch, auf welchem sie es verzehrten, war ein Überbleibsel vergangener guter Zeiten; wohl war die Politur stellenweise schon rissig, doch die Beine hielten noch stand.
»Heute ist der Zehnte des Monats,« meinte die Mutter, mit dem Kipfel im Kaffee herumrührend. »Noch zwanzig Tage, dann müssen wir uns nach einem Posten umsehen. Wirst du bis dahin das Schreiben erlernen?«
»Wie denn nicht, es geht ja schon jetzt ganz gut.«
»Nun, und willst du in eine Bank oder lieber zu einem Advokaten gehen?«
Sie biß in das vom Kaffee triefende Gebäck. Wenn sie aß, ließ die Strenge ihrer Miene etwas nach, als würde sie etwas wie Lebensfreude empfinden. Sie war nicht mehr so steif und saß, der Ruhe pflegend, zufrieden da.
Therese trank nachdenklich ihren Kaffee und sagte endlich:
»Es wird sich schon etwas für mich finden ... Für sechzig bis achtzig Kronen wird irgendein Amt meine Arbeit schon erkaufen.«
»Achtzig Kronen, das ist viel Geld für jemand, der mit einer Pension von hundertzwanzig Kronen ein kümmerliches Dasein fristet,« antwortete die Alte.
Hiermit nahm das Morgengespräch ein Ende. Therese eilte zu Paula König. Als sie bei ihr anläutete, öffnete sich die Tür nicht sogleich, erst nach dem zweiten Klingeln kam die kleine schmutzige Magd zum Vorschein. Fräulein Ladány wollte hinein, allein die kleine Schmutzige übergab ihr einen Brief.
»Den Brief schickt die gnädige Frau und sie läßt Ihnen sagen, Sie möchten ihn draußen lesen.«
Therese ging hinaus und hielt ein mit der Maschine beschriebenes Kuvert in der Hand, in dem Geldmünzen klirrten. Der Briefumschlag war wie folgt adressiert: Fräulein Therese Ladány, hier.
Sie öffnete das Kuvert und entnahm ihm sechs Kronen sechsundsechzig Heller und einen mit der Schreibmaschine geschriebenen Brief. Sie wollte ihren Augen kaum trauen, als sie ihn las:
»P. T. Anbei habe ich die Ehre, von dem zehn Kronen betragenden Lehrgeld den nach Abzug von zehn Tagen verbleibenden Rest zurückzusenden, weil ich zu meinem größten Bedauern nicht in der Lage bin, Sie weiter als Frequentantin meiner Schreibmaschinenschule zu betrachten. Sie kennen den Hauptgrundsatz meiner Schule: Nur Maschinenschreiben, sonst gar nichts! Nun sind Sie aber, P. T., gestern abends in der Gesellschaft eines meiner männlichen Schüler auf der Stefaniestraße herumkutschierend gesehen worden, und da dies den guten Ruf des Instituts König schädigen kann, muß ich P. T. bitten, Ihre Schreibmaschinenstudien anderswo zu beenden. Ich werde wahrscheinlich noch diesen Herbst Parlament-Tippfräulein sein und meine Zukunft Ihretwegen nicht aufs Spiel setzen.
Achtungsvoll Paula König.«
Im ersten Augenblick wußte Therese selbst nicht, was sie anfangen sollte. Sie geriet in Wut und wollte mit der Faust auf die Tür schlagen; sie brach in ein Gelächter aus und rief laut: »Tiere, Tiere!« Sie wollte fortgehen, blieb jedoch stehen, um anzuläuten und Paula König ihre Meinung zu sagen. Sie besann sich aber eines andern und wendete sich zum Gehen. Es lohnte nicht! Sie zerriß den Brief und verstreute die kleinen Papierfetzen unterwegs auf der Treppe. Die kleine dicke Klara Guttmann kam ihr entgegen.
»Nun, Fräulein Ladány, Sie gehen schon fort? Sie haben da einen herzigen Mantel ...«
Sie ließ die Wesselényigasse mit der Schreibmaschinenschule der Paula König hinter sich zurück und ging langsamen Schrittes gegen die Ringstraße zu. Vor dem Schaufenster des Yost-Geschäftes stehend, sah sie da oft nette Mädchen auf der Maschine klopfen; das mußte gar nicht so langweilig sein ... vielleicht sollte sie es versuchen.
Der Regen hörte auf, und sie war auf dem Ring angelangt, als sie plötzlich angesprochen wurde:
»Guten Morgen, Ladány ... Lange habe ich Sie nicht gesehen.«
Therese hob den Kopf und sah die Manci Darkács vor sich. Fünf Klassen hatten sie zusammen absolviert, doch in der sechsten war die Darkács plötzlich ausgeblieben. Sie war die Tochter einer Witwe, die Logenschließerin im Lustspieltheater war, und die Mädchen flüsterten bald einander zu, ein reicher Herr wolle die Manci zur Schauspielerin heranbilden lassen. Seither war sie nie mehr in der Schule zu sehen ...
»Schau, schau, Sie sind es, Darkács?«
Früher hatten sie einander geduzt, doch waren sie schon lange nicht beisammen und die Margarete Darkács sah so vornehm aus, daß Therese gar nicht den Mut gehabt hätte, sie zu duzen. Sie trug einen englischen Überzieher à la mode, einen kleinen schmalkrämpigen Biberhut mit einer Paradiesvogelfeder; ihre Füßchen waren mit amerikanischen Halbschuhen bekleidet. Ihre blonden Haare fielen in wohlgepflegten Locken auf ihre Stirne, ihre feine, schmal zugeschnittene Nase verlieh dem ganzen Gesicht einen sehr intelligenten Zug. Sie sah ernst aus, um so lebhafteren Eindruck machten daher ihre lachenden Augen ... Man sah ihr an, wie sehr es sie freute, einer ihrer gewesenen Mitschülerinnen begegnet zu sein.
»Haben Sie was Dringendes vor, Ladány?«
»Nein, nichts,« erwiderte Therese.
Und sie sprach die Wahrheit. Nach dem Vorgefallenen hatte sie zwar das Bestreben, in einem anderen Schreibmaschinenkurs Unterkunft zu finden, doch sie erblickte eine Schicksalsfügung darin, daß man sie aus dem Institut König hinauskomplimentiert hatte. Als hätte das Schicksal nicht gewollt, daß sie Schreibmaschinenfräulein werde und für 60 bis 80 Kronen monatlich tippe. Mit gierigen und neidischen Blicken betrachtete sie die Margarete Darkács, die Theaterschülerin war ... Warum sollte nicht auch sie es werden können? Wiederum klang ihr das Lob im Ohr: sie ist wirklich ein sehr talentiertes Kind.
»Wissen Sie was?« sprach Margarete in aufgeregter Hast, »kommen Sie mit mir in die Schule hinauf. Jetzt haben wir gerade die Kulturstunde, lauter Dummheiten, die mit der Schauspielkunst nichts zu schaffen haben, wir können da ungestört plaudern.«
»Darf ich denn dort hinaufgehen? Ich bin ja keine Schülerin ...«
»Na, hören Sie! Wenn ich hundertundzwanzig Kronen monatlich Schulgeld zahle, werde ich doch eine Freundin mitbringen dürfen. Sputen wir uns, der Regen geht wieder los.«
Therese war glücklich, ihr Gesicht war hochgerötet vor Freude und Neugierde. Sie pries den Zufall, daß sie gerade heute Vormittag frei war und mit ihrer alten Schulkollegin zusammentraf, die nicht aufhörte zu plaudern.
»Denken Sie sich, der Rudolf trägt Literatur auch in der Theaterschule vor.«
Schon in der Bürgerschule hatte Rudolf die Mädchen unterrichtet. Er war ein gestrenger Lehrer, doch auch ein Schwärmer, erfüllt von den Idealen seines Berufes. Über seine sommerlichen Ferienreisen pflegte er schwärmerische Berichte zu veröffentlichen, und er fand einen sicheren Zusammenhang zwischen dem Stil und dem Charakter. In der Bürgerschule waren alle Mädchen in ihn verliebt.
»Ist er auch da so streng?«
»Aber nein ... da kann er uns nichts vormachen ... er kann predigen, so viel er will, niemand schert sich darum. Auch die Jászai hat keine Literaturgeschichte gelernt und doch ist sie die Jászai, auch die Fedák tanzt mit ihren Beinen und nicht mit Franz Kazinczy ...«
Beide lachten laut über die schnurrige Idee, und gleich zwei ausgelassenen Kindern bogen sie in eine Seitengasse der Tabakgasse ein, wo sich die Theaterschule der Rosa Ligeti befand ...
Ein gelbes, einstöckiges Haus. Im ersten Stock war neben der Tür eine Tafel mit der Aufschrift:
Rosa Ligetis behördl. konzession. Theaterschule.
Die Tür war angelweit geöffnet, im Vorzimmer sah man auf dem Kleiderrechen Männerhüte und Frauenhüte in buntem Durcheinander. Indessen machte alles dieses trotz der Unordnung einen ganz andern Eindruck als das Vorzimmer der Paula König. Sonderbarerweise waren steife Männerhüte kaum zu sehen, zerdrückte und breitkrämpige Artistenhüte hingen neben den kleinen Damenhüten, die allesamt modern, ja hochmodern waren. Kokette, runde Dingerchen, Farben und Formen, die wöchentlich und monatlich wechseln. Nur die Modelaune, die sorglose Leichtfertigkeit konnte dafür Geld ausgeben.
Manci hängte ihren Mantel auf einen leeren Kleiderrechen und sagte zu Therese, die schüchtern, zögernd hinter ihr stand:
»Rici, leg ihn ab, die Mutter mag die Hüte nicht ...«
Sobald das Tor der Theaterschule hinter ihr war, duzte sie auch schon ihre gewesene Schulkollegin Therese, die sie vertraulich Rici nannte.
»Wenn ich aber nicht eintreten darf!« meinte Therese zaghaft.
»Dumme Gans! Hier ist alles erlaubt ...«
Und schon hatte sie ihr Hut und Mantel aus der Hand genommen ...
Aus dem Innern vernahm man den Gesang einer unangenehm kreischenden Stimme.
»O weh! Die Zsazsa Rombauer singt ... Sie zahlt hundert Kronen Extralehrgeld und die Mutter will für das Geld um jeden Preis eine Stimme aus ihr herauspressen ... aber da kann sie sich auf den Kopf stellen. Mir scheint, nicht der Rudolf ist da, sondern die Mutter ... man hält Probe fürs Theater ... Gehen wir ...