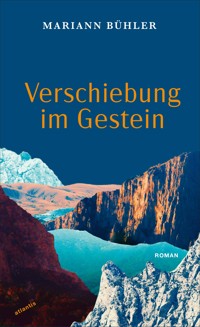
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lange hat draußen das Schild »Bis auf Weiteres geschlossen« gehangen, bis Elisabeth die Entscheidung trifft, die Bäckerei weiterzuführen. Sie allein. Jeden Morgen feuert sie an, rührt den Teig, schiebt die Brote in den Ofen – und überrascht das ganze Dorf und sich selbst dazu. In derselben Gegend Alois' Hof. Ein Hof, seit Generationen in Familienbesitz, Alois wurde nicht gefragt, ob er ihn übernehmen wollte. Er lebt mit dem Hund, überhört die Erwartung, eine Familie zu gründen – aber etwas schnürt sich zu. Vielleicht hat das mit Camenzind zu tun. Unterdessen kehrt eine junge Frau ins Dorf zurück; die drei Stufen zur Bäckerei laufen sich wie von selbst. Bei den Großeltern holt sie den Schlüssel zum Sommerhaus, es soll verkauft werden. Sie sieht alles wieder, den Bergkamm, das Tal, den Balkon mit der Zugbrücke. Bald, so scheint es ihr, beginnt das Haus mit ihr zu sprechen. Der Roman verfolgt drei Figuren, die nichts voneinander wissen und doch verbunden sind – durch die Gegend, das Dorf und die drängende Frage, wie es eigentlich weitergehen soll. Hartnäckig haben sich in ihnen weitläufige Spuren von Vergangenem festgesetzt, aber dann gerät doch etwas in Bewegung. In ihrem sprachlich dichten Debüt beobachtet Mariann Bühler, wie Veränderung sich ihren Weg sucht und Verschiebungen passieren, die so nie vorgesehen waren, die zuweilen sogar Berge versetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mariann Bühler
Verschiebung im Gestein
Roman
Atlantis
Das Tal hat keinen Boden. Die Hänge treffen an ihrem tiefsten Punkt im spitzen Winkel aufeinander. Über dem Wald gibt es Wiesen, die dem Tal etwas Weiches geben, zumindest von Weitem.
Hinten, wo zwei Bäche zusammenfließen, öffnet sich das Tal zu einer kleinen, bewaldeten Schwemmebene. Von Zeit zu Zeit lässt ein Gewitter die Bäche zu milchkaffeebraunen Fluten anwachsen, für kurze Zeit sind sie größer als ihr Bett. Hier, wo sie zusammenkommen, ringen sie miteinander und reißen alles aus, was gewachsen ist. Sie rollen Steine und lassen Sand liegen, verkeilen gehäutete Stämme, die die Sonne mit der Zeit versilbert.
Die Straßenlaternen leuchten auf die leere Hauptstraße. Die Kirche schweigt noch zur vollen Stunde. Die wenigen Autos hört Elisabeth lange, nachdem sie aus dem Dorf verschwunden sind.
Sie zieht sich im Dunkeln an, wäscht im Bad das Gesicht mit kaltem Wasser und geht hinunter in die Backstube. Die Neonröhren über ihrem Kopf springen gluckernd an. Sie blinzelt ins Licht.
Der Kühlschrank brummt leise. Auf den Regalen stehen Kisten und Säcke in Reih und Glied. Über der Arbeitsfläche hängen Messer, Teigschneider, darüber stapeln sich Backformen, Schüsseln, Messbecher in einer Ordnung, die den immer gleichen Arbeitsschritten entlang entstanden ist.
Elisabeth öffnet die Ofenklappe, zündet das aufgeschichtete Holz an, schaut zu, wie sich die Flammen ausbreiten. Das Feuer braucht Raum und Luft und etwas, das gleichzeitig Gefühl und Wissen ist. Sie weiß ohne Nachdenken, ob sie eingreifen oder dem Feuer Zeit lassen muss. Sie wählt die Scheite nach Form und Farbe, sieht ihnen die Hitze an, zu der sie fähig sind, sieht, wie lange sie an welchem Astknorz nagen, wie die Scheite zu stapeln sind, damit sie möglichst gleichmäßig brennen. Sie riecht, wenn der Ofen zu heiß wird, sieht, wie sich die Hitze im Stein verteilt hat. Sie ahnt das Nachtwetter, und ihre Hand übersetzt Temperatur und Luftfeuchtigkeit zuverlässig in die Position des Schiebers, der die Luftzufuhr regelt. Genauso, wie sie am zähen Klang hört, wenn zu wenig Wasser im Teig ist. Als wäre das Backen in sie hineingewachsen, Teil ihres Körpers geworden.
Sie schließt die Ofenklappe, geht durch den dunklen Durchgang. Der Laden ist nur von Straßenlampen beleuchtet. Sie schaltet die Kaffeemaschine ein, die ein leises Summen von sich gibt.
Zurück im Durchgang, nimmt sie eine frische Schürze vom Stapel, verknotet die Bändel hinter dem Rücken. Eine Arbeitsjacke, wie sie Jakob getragen hat, hat sie nicht. Das wäre nicht richtig. Das steht ihr nicht zu.
Sie hebt das Tuch vom Teig, den sie am Vorabend angesetzt hat. Er sieht aufgeplustert aus, wirft Blasen, riecht süßlich und säuerlich zugleich. Sie schöpft einen Teil ab, gießt den dickflüssigen Brei in den Plastikkübel, in dem schon Jakob den Teig aufbewahrt hat.
Elisabeth misst das Wasser ab, gießt es in die Knetschüssel. Sie wuchtet Mehlsäcke auf den Wagen, schiebt ihn zur Knetmaschine. Ihrem Rücken zuliebe hat sie sich vor ein paar Jahren eine Knetmaschine gekauft, die etwas tiefer ist als die alte. Alles andere in diesem Raum ist noch immer, wie es war.
Sie wuchtet den Mehlsack auf den Rand der Knetschüssel und leert ihn fast ganz hinein. Dann die Hefe und schließlich das Salz, das die Hefe im Zaum hält.
Sie schaltet in den ersten Gang, die Schüssel beginnt sich zu drehen. Der Knethaken geht hin und her, hoch und runter, greift zu Beginn noch kaum, Mehl und Wasser rinnen davon und erst nach und nach ineinander.
Elisabeth wirft einen Blick in den Ofen. Ihre Hand greift nach dem Schieber, bewegt ihn um Millimeter.
In der Knetschüssel dreht und zieht der Haken den Teig in taumelnden Kreisen. Sie schaltet in den zweiten Gang.
Im Laden füllt sie Bohnen auf, das Rieseln begleitet das Brummen der Knetmaschine. Dann lärmt die Kaffeemühle.
Mit ein paar Bewegungen presst Elisabeth den gemahlenen Kaffee fest, dreht den Kolben in die Maschine, die andere Hand hat schon eine Tasse daruntergeschoben, drückt den Knopf.
Während der Kaffee in die Tasse läuft, lehnt sich Elisabeth gegen die Ablage und schaut hinaus auf die Straße. Ein Auto taucht auf und verschwindet. Sie wartet eine Kaffeetasse lang, ob noch ein Auto kommt. Eine Katze überquert die Straße und verschwindet zwischen zwei Häusern.
Elisabeth stellt die leere Tasse in den Durchgang und blinzelt erneut ins Neonlicht der Backstube.
Der Teig windet sich um den Knethaken. Sie gießt einen Schuss kaltes Wasser dazu, den der Teig aufnimmt. Dann schaltet sie die Maschine aus, kippt den Kessel und packt den Teig in Kunststoffkisten, lässt ihm Platz zum Aufgehen, deckt ihn mit Leintüchern zu, als würde sie ihn schlafen legen.
Das sagte sie immer zu Ruth. Ihr Teigstück, das sie mit ihren Kinderhänden traktiert hatte, gehe nun im großen Mutterteig schlafen. Dabei beginnt die Hefe erst jetzt zu arbeiten.
Elisabeth wuchtet die zugedeckten Kisten ins Regal und zieht die nächsten Mehlsäcke auf den Wagen, schiebt sie zur Knetmaschine, in der bald Brötchenteig schmatzt.
Sie geht mit dem Besen durch den Laden, nimmt den Boden feucht auf. Trinkt einen weiteren Kaffee. Wuchtet die Kiste mit dem Brötchenteig auf den Arbeitstisch.
Für die Brötchen wiegt sie den Teig nur einmal im Monat, mehr aus Neugier als aus Notwendigkeit, um zu sehen, ob sich ihr Gefühl für die Teigklumpen verändert hat. Das Gefühl für den Teig ist beständig, mehr als ein paar Gramm liegt sie nie daneben.
Sie sticht die Portionen ab, wirkt sie mit den Handballen rund oder rollt sie lang, badet einen Teil der Teiglinge in der Lauge, reiht sie auf die Bretter und lässt sie gehen.
Draußen ist die Dämmerung inzwischen über den Horizont gekrochen. Wenn ein Lastwagen vorbeidonnert, bebt der Boden.
Elisabeth schaut in den Ofen. Die Glut leuchtet gleichmäßig und orange. Bald ist vom Holz nur noch Asche übrig.
Ein letztes Mal wuchtet Elisabeth Kisten auf den Wagen. Sie hebt das erste Tuch hoch. Als würde der Teig nach einer großen Anstrengung ausatmen, sinkt er seufzend in sich zusammen. Elisabeth seufzt mit ihm. Er ist elastisch wie junge Haut, ihre Hände greifen hinein in die weiche Wärme. Sie packt Teigstücke auf die Waage, fügt ein bisschen hinzu, nimmt ein bisschen weg. Ein Teil des Gewichts wird als Dampf im Ofen zurückbleiben.
Sie hat gehört, dass es Leute gibt, denen Teig zuwider ist, weil er zu sehr nach Körper aussieht.
Mit dem Handballen formt sie die Laibe – sie heißen ja auch so – zu gleichmäßigen Kugeln, legt sie auf die Bretter, stapelt die Bretter in die Regale. Sie bemehlt die Brote, als würde sie prächtige runde Hintern pudern. Oder Brüste.
Sie öffnet die Ofenklappe, den Aschekasten und versenkt darin das, was vom Feuer übrig ist. Das Metall des Ascheschiebers kreischt über den heißen Stein. Sie zieht einen Lappen aus einem Eimer voll Wasser, wirft ihn in den Ofen, schiebt den zischenden und dampfenden Fetzen rasch hin und her, zieht ihn heraus, bevor er Feuer fängt.
Brotschaufel um Brotschaufel verteilt sie die Brötchen im Ofen. Um die kleinen Teigbälle bildet sich eine Kruste, während sie sich aufplustern. Als sie die richtige Bräune haben, holt Elisabeth sie mit rudernden Bewegungen aus dem Ofen, legt sie zum Auskühlen auf die Regale.
Sie stellt die Sachen für die belegten Brötchen bereit. Eingeklemmte heißen die hier. Das gefällt ihr.
Jetzt hat der Ofen die richtige Temperatur für die Brote. Die Laibe bekommen eine Kruste, bevor sie austrocknen, und sind durchgebacken, bevor ihre Kruste zu dunkel wird. Elisabeth ritzt ein schnelles Muster in den Teig, gibt den Laiben Platz zum Aufgehen und schließt hinter dem letzten Brot die Klappe.
Sie schneidet Gurken und Eier, streicht Butter und Frischkäse, Senf und Mayonnaise und belegt die Brötchenhälften großzügig mit Käse, Schinken und Salami, deshalb kommt ihre Kundschaft, nimmt sogar Umwege auf sich. Sie schichtet die Eingeklemmten auf Platten und stellt eine nach der anderen in die Auslage im Laden, füllt die restlichen Brötchen in die Körbe.
Zurück in der Backstube, rudert Elisabeth mit der Brotschaufel Laib um Laib aus dem Ofen. Nicht zu hell, nicht zu dunkel sind sie, kräftig braun oben, heller auf der Seite, wo sie sich nahe gekommen sind. Wenn sie auf die Unterseite klopft, klingt es hohl.
Als sie den Ofen schließt und die Schaufel an die Wand lehnt, kehrt Stille ein. Nur die Brotlaibe knistern.
Sie lässt einen weiteren Kaffee in die Tasse laufen. Wischt sich mit dem Schürzenzipfel den Schweiß von der Stirn.
Elisabeth füllt Papiertüten und Brotpapier nach, Kaffeebecher sind noch genügend da. Ein Unding, diese Wegwerfbecher, aber bei ihrem kleinen Sortiment macht der Kaffee einen Unterschied im Umsatz.
Der Bus erscheint in der Kurve und hält vor der alten Post. Zwei, drei verschlafene Gestalten lösen sich von der Bank im Wartehäuschen, eine vierte hastet herbei.
Kaum ist der Bus verschwunden, gehen die Straßenlampen aus. Hinter einem Fenster auf der anderen Straßenseite geht das Licht an und wieder aus. Elisabeth schließt die Ladentür auf.
Alois spürt den Schuss noch in der Schulter.
Vor ein paar Monaten hat er einen Fuchs zur Sammelstelle gebracht, der unter ein Auto gekommen war. Im Vorjahr ein Kalb, das die Geburt nicht überlebt hat. Natürlich hat ihn das Kalb gereut. Aber das kommt vor, dass eine Geburt nicht gut ausgeht, gerade bei einem Rind.
Mit dem Hund ist es anders.
Alois steht am Straßenrand, schaut hinunter auf das Dorf. Der bewaldete Hügel auf der anderen Talseite ist dunkel gefleckt. Dahinter ragt der erste Berg auf. Eine Felswand leuchtet im letzten Licht.
Alois schließt die Hand zur Faust und öffnet sie wieder. Mit dem Daumen fährt er über die Narbe am Zeigefinger.
Das müsse gefeiert werden, fand seine Mutter damals.
Alois war anderer Meinung. Außer seinem Namen auf einem Papier – noch dazu der gleiche wie der des Vaters – würde sich nichts ändern. Er würde am nächsten Tag genau gleich im Stall stehen, wie er jeden Tag im Stall stand.
Er wollte der Mutter widersprechen, doch der Vater warf ihm über den Tisch einen Blick zu. Alois schnitt eine Grimasse und biss in sein Brot.
Am Sonntagmittag fuhr die Schwester auf den Hof. Aus einer Harasse im Kofferraum hob sie einen jungen Hund und drückte ihn Alois in die Arme.
Einen Bauernhof führe man nicht allein, sagte sie, und bis die rechte Frau komme, helfe der Vierbeiner aus.
Sie seien dann also auch noch da, begehrte die Mutter auf, und der Vater brummte Alois zu, dass er sich auf eine fleischlastige Kost einstellen müsse.
Der Hund leckte Alois’ Gesicht ab und zappelte mit Pfoten, in die er erst noch hineinwachsen musste. Alois strich über das feine Fell und brachte das Tier in den Stall. Ein Kälberstall war frei, er streute ein und fand einen Napf, den er mit Wasser füllte. Der Hund schnüffelte abwechselnd in den Ecken seines neuen Quartiers und an Alois’ Stiefeln.
Als Alois in die Küche kam, hatten sie die Suppe und den Salat schon gegessen.
Das Licht auf der Felswand ist verschwunden. Alois dreht seine Runde durch den Stall. Die schwarz-weiße Katze schleicht um seine Beine, springt erwartungsvoll auf die Stallbank.
Der Hund hatte abgegeben, war träge geworden. Sein Fell war matt, nur oben am Kopf war es fein und glänzend geblieben. Dass er nicht mehr jeden anbellte, störte Alois nicht, im Gegenteil.
Als die Anfälle kamen, ahnte er, dass es nicht mehr lange dauern würde. Er legte den Hund ins Stroh, damit er sich nicht wehtat.
Als der Tierarzt wegen einer Kuh da war, schilderte Alois die Anfälle und hoffte, dass ihm das nicht berechnet würde.
Der Tierarzt zuckte mit den Schultern. Er könne das schon abklären, aber fünfzehn Jahre, das sei ein stolzes Alter für so einen Hund. Der Tierarzt fragte, ob er jetzt gleich, und Alois schüttelte erst den Kopf und dann die Hand des Tierarztes.
Ein paar Wochen schien es, als ginge es dem Hund besser, dann wollte er nicht mehr fressen. Er lag im Stroh, schaute zu Alois hoch, ohne den Kopf zu heben. Das Stück Wurst, das Alois ihm brachte, beschnupperte der Hund lange und fraß es vorsichtig, als wollte er Alois damit einen Gefallen tun.
Alois strich ihm über das feine Fell am Kopf, über das raue am Rücken. Der Hund zitterte ein wenig unter seiner Hand, schloss die Augen halb. Alois holte die Bürste aus einer Nische in der Wand, bürstete dem Hund Rücken und Bauch, zupfte Strohhalme aus dem Fell.
Der nächste Anfall wollte gar nicht mehr aufhören. Alois konnte nicht länger zusehen.
Nach dem Melken legte er einen Futtersack in den Kofferraum und den toten Hund darauf. Er zupfte noch einmal Strohhalme aus dem Fell, strich ihm noch einmal über die Stirn. Bei der Sammelstelle ließ er das tote Tier vom Futtersack in die Klappe gleiten.
Alois dreht den Futternapf unschlüssig zwischen den Händen und stellt ihn dann auf den Sims vor dem Küchenfenster. Er streift die Stiefel von den Füßen und stellt sie neben die Tür. In der Küche trinkt er ein Glas Wasser. Aus einem Stapel auf der Bank zieht er ein Blatt Papier, das für Futtermittel zum Aktionspreis wirbt. Aus der Schublade holt er einen Stift und beginnt auf der Rückseite zu schreiben. Er streicht die ersten Zeilen durch, fängt noch einmal an, gesucht, ab sofort oder nach Vereinbarung. Er hält inne, schaut der schwarz-weißen Katze zu, wie sie vor dem Küchenfenster am Futternapf schnuppert und dann daneben Platz nimmt. Alois schreibt weiter.
Wochen später klingelt das Telefon.
Ob das Inserat noch aktuell sei, fragt eine Frauenstimme, und Alois stutzt.
Wegen dem Hof, fragt die Frauenstimme nach, die Stellvertretung?
Jetzt erst kommt es ihm wieder in den Sinn, ja, das Inserat sei durchaus noch aktuell, sagt er.
Sie seien auf der Suche, sagt die Frauenstimme, ob es auch paarweise, und Alois sagt, selbstverständlich.
Ob der Sonntag in vierzehn Tagen passe, dann will sie, Verena, mit ihrem Mann vorbeikommen, sich das anschauen.
Alois’ Herz schlägt schneller. Hunger hat er keinen mehr. Er wickelt den Käse wieder ein, legt ihn zurück in den Kühlschrank. An der Tür hängt das Inserat.
Er hat es auf der zweitletzten Seite gefunden, neben verkürzten Zeilen für Mähdrescher und Stroh und gegen die Einsamkeit. Er las das Inserat, einmal vorwärts, einmal rückwärts, Wort für Wort. So, hatte seine Schwester gesagt, finde man Fehler am besten. Er fand keinen Fehler.
Dann passierte nichts. Niemand rief an. Nach ein paar Tagen tippte Alois seine eigene Nummer ins Haustelefon. Sein Telefon vibrierte und klingelte in der Tasche. Er legte wieder auf.
Ein Anruf in Abwesenheit, sagte das Display, als er das Telefon das nächste Mal aus der Tasche zog und feststellte, dass es seine eigene Nummer war, die ihn nicht erreicht hatte.
Alois schaut auf die Uhr, gibt sich einen Ruck. Er zieht sich um, nimmt den Schlüssel vom Haken und steigt ins Auto.
Warum er läute, er komme doch sonst einfach rein, fragt die Schwester erstaunt, als sie die Tür öffnet, unter dem Arm einen Wäschekorb. Das Kind versteckt sich hinter ihrem Bein und wagt sich hervor, als es Alois erkennt.
Er müsse etwas besprechen mit ihr, sagt er, es sei wichtig.
Der Schwager sei in der Musikprobe.
Alois schaut sie einen Moment verwundert an und sagt dann, dass er ihn nicht brauche, nur sie.
Gut, sie müsse noch einmal in die Waschküche, ob er den kleinen Stümper schon mal ins Bett bringen könne.
Bin kein Stümper, sagt das Kind, aber es ist begeistert. Es nimmt Alois’ Hand und zieht ihn in sein Kinderzimmer. Dort zeigt es den Stall, den Alois ihm einmal zu Weihnachten gebaut hat. Die Kühe heißen gleich wie die von Alois. Auch der Hund heißt gleich.
Ist er wirklich tot?
Alois nickt.
Warum?
Alois zuckt mit den Schultern. Weil er alt war.
Hast du ihn beerdigt?
Alois wiegt den Kopf.
Auf eine Art habe er ihn schon beerdigt.
In einem Grab, wie Großvater und Großmutter?
Nicht ganz. Halt so, wie man das bei den Hunden macht. Das ist anders als bei den Menschen.
Das Kind nickt, dreht den Holzhund in den Händen hin und her.
Denkst du an den Hund manchmal?
Alois nickt, nimmt eine Holzkuh in die Hand.
Mama denkt manchmal an die Großmutter und den Großvater, weil die waren ihre Mama und ihr Papa. Dann gehen wir zum Grab, und dann ist sie traurig, aber nicht sehr lange. Sie sagt, es ist wichtig, dass man an die denkt, die nicht mehr da sind. Auch wenn es einen traurig macht.
Das Kind legt den Hund in die Hundehütte, die Alois an den Holzstall gebaut hat.
Mein Hund kann hier schlafen, sagt es und steht mit einem Seufzer auf. Morgen ist auch noch ein Tag, und Alois hört seinen Schwager aus der Kinderstimme.
Die Schwester steckt den Kopf ins Zimmer, jetzt ist aber allerhöchste Eisenbahn, sonst gibt es keine Geschichte.
Das macht heute der Alois, der kann auch Geschichten erzählen.
Na dann, sagt die Schwester, dann macht das der Alois. Jetzt aber ab ins Bett.
Und zu Alois, ob er etwas trinke, für Kaffee sei es ihr zu spät, aber sie mache ihm gern einen, oder vielleicht einen Tee, Bier sei keines im Haus.
Sie müsse nicht, kein Aufhebens, sagt Alois. Gern einen Tee, sagt er, als sie streng schaut.
Das Kind schlüpft unter die Decke, und Alois setzt sich auf die Bettkante, greift nach ein paar Bilderbüchern, die auf dem Boden liegen.
Was er vorlesen solle, fragt er.
Nicht vorlesen, erzählen, vom Hund.
Na gut, sagt Alois und beginnt zu erzählen, wie klein der Hund war, als er ihn zum ersten Mal aus der Harasse gehoben hat, wie groß seine Pfoten. Wie schnell er gewachsen ist, wie ungeschickt er am Anfang war, wie ihm eine Kuh auf die Pfote trat, wie er erst lernen musste, bis er ihn schicken konnte, um die Kühe von der Weide zu holen. Wie der Hund ihn überallhin begleitet hat – aber nur zu Fuß, im Auto wurde ihm schlecht. Wie er nach der Musikprobe auf der Fußmatte auf ihn gewartet hat, wie er sich erst ins Stroh verzog, wenn er wusste, dass Alois zu Hause war.
Die Atemzüge des Kindes werden tiefer.
Alois’ Eltern starben kurz nacheinander, ein paar Jahre bevor das Kind zur Welt kam. Die Mutter wurde krank und nicht wieder gesund. Die Schwester kam nach der Arbeit vorbei, pflegte die Mutter, kochte und nahm eine Portion nach Hause für ihren Mann.
Es war, als würde die Mutter in sich versickern. Als sie nach ein paar Monaten starb, überraschte das niemanden. Sie hatte die Tür leise hinter sich zugezogen.
Der Vater war zwar gesund, aber ihm war etwas abhandengekommen, das er brauchte wie die Luft zum Atmen.
Die Schwester kam noch immer fast täglich vorbei, kochte, putzte und wusch. Was würde aus mir werden ohne dich, sagte der Vater zu ihr. In seinen Augen glänzten Tränen, das taten sie in letzter Zeit öfter, das hatten sie in den vielen Jahren davor nie.
Die Schwester murmelte etwas von selbstverständlich. Sie sah müde aus.
Alois schluckte etwas hinunter, das nicht an diesen Ort gehörte.
Der Vater geisterte noch einige Monate über den Hof. Eines Morgens wachte er nicht mehr auf. Alois fand ihn und tat, was getan werden musste, gab der Schwester Bescheid, und die dem Arzt, dem Pfarrer.
Alois weinte nicht an der Beerdigung, er war noch nie einer, der weint. Am Grab schaute er auf die Leute, die gekommen waren. Sagte ihre Namen und suchte im Knoten in seinem Kopf nach denen, die ihm nicht mehr in den Sinn kamen.
Er schaute auf die Blumengestecke und Kränze, auf den alten Fahnenträger, der unter dem Schwung der Fahne beinahe das Gleichgewicht verlor und um ein Haar ins Grab fiel. Der Dirigent der Blasmusik erwischte ihn noch am Gurt. Das hätte Alois’ Vater gefallen. Das hätte er allen erzählt, immer und immer wieder, und dabei laut gelacht. Jetzt hör doch auf, hätte seine Mutter gesagt, das gehört sich nicht, und hätte dann auch gelacht.
Die Leute schüttelten Alois’ Hand und sagten mit ernstem Gesicht freundliche Worte. Seine Schwester stand neben ihm, neben ihr der Schwager, den Arm um ihre Schultern gelegt. Alois gab ihr ein Taschentuch und drückte ihre Hand.
Etwas schmal sehe er aus, etwas grau, sagten die Leute zueinander. Still sei er gewesen beim Leichenmahl. Aber wer ist das nicht, bei der Beerdigung des Vaters, so kurz nach der Mutter.
Zusammen mit seiner Schwester räumte Alois auf. Viel gab es nicht zu tun, die Mutter hatte vorgesorgt. Sie wolle keine Unordnung hinterlassen, das letzte Hemd habe keine Taschen.
Gemeinsam suchten sie Leidhelgen aus, Bilder von den Eltern, wie sie sich an sie erinnern wollten. Die Schwester schrieb die Rückseite vor, und Alois ließ im Fotogeschäft einige Dutzend der kleinen Fotos drucken.
An einem Sonntag saßen sie zusammen, die Schwester schrieb die Karten, Alois die Adressen und seinen Namen unter die Worte seiner Schwester, der Schwager klebte die Umschläge zu und Briefmarken darauf.
Alois ließ die Fotos vergrößern, von jedem zwei, und suchte Rahmen aus, helles Ahornholz. Als er die Fotos der Schwester brachte, weinte sie ein bisschen und machte dann Kaffee. Sie schlug vor, einmal die Woche vorbeizukommen, ihm im Haushalt zur Hand zu gehen. Er lehnte ab, sie habe in den letzten Monaten so viel, er könne doch für sich selbst, und seine Schwester war froh. Unter dem Tisch legte sie wieder einmal die Hand auf ihren Bauch.
Die Bilder der Eltern hängte Alois über den Küchentisch. Manchmal erzählte er den beiden von seinem Tag, vielleicht aus alter Gewohnheit. Manchmal half das. Manchmal ging er ihnen aus dem Weg.
Es wurde Herbst, der Nebel füllte das Tal nach und nach ganz aus, verschluckte die Berge und an manchen Tagen sogar den Waldrand. Die Ruhe, die sonst über ihn kam, wenn er abends die Stalltür schloss, war weg. Nachts lag er wach und lauschte, wie das Haus um ihn herum verstummte. Nur der Lärm in seinem Kopf, der blieb. An manchen Tagen hatte er ein Brennen in der Brust, das bis hinauf in den Kopf stieg. Dann wütete es hinter seinen Augen. Seine Gedanken zogen sich in die Länge, knäuelten sich ineinander, wie die Regenwürmer in einem Kessel, die er als Kind an Regentagen von der Straße gesammelt hatte, um sie im Gras wieder freizulassen. Er wusste nicht, wohin er die langen Gedanken tragen sollte, um sie freizulassen.
Ein Kinderschnarchen holt Alois aus seinen Gedanken. Er zieht die Tür leise hinter sich zu. Als er in die Küche kommt, stellt die Schwester volle Tassen auf den Tisch und schaut ihn erwartungsvoll an.
Alois beginnt zu erzählen, mit den Worten, die er vorbereitet hat, bricht ab, fängt noch einmal an, holt aus, beginnt beim Abend, als er den Hund zur Sammelstelle gebracht hat, erzählt von den Monaten davor, die sich zu Jahren zusammenzählen lassen, erzählt endlich die Sache mit Ruth, wie er erst dachte, das könnte etwas werden, wie sie das wohl auch dachte, bis es anders kam, wie sie schließlich ging, dass das schon richtig war, er streift Camenzind, mit dem er schon lange nicht mehr im Wald war, den er aus den Augen verloren hat, erzählt vom Entschluss, alldem nachzugehen, buchstäblich nachzugehen, dann vom Inserat und endet mit der Bitte, dass die Schwester an dem Sonntag dabei sei, wenn Verena und Werner kommen. Es kommt ihm vor, als habe er stundenlang geredet. Der Tee ist noch heiß.
Die Schwester schaut ihn nachdenklich an.
Ob sie sich Sorgen machen müsse.
Er glaube nicht. Sein Finger folgt der Maserung des Tisches.
Was er vorhabe, fragt sie. Ob er zurückkomme.
Weiter als bis zum Entschluss, zu gehen, sei er noch nicht gekommen. Er spürt ihren Blick auf sich.
Sie seufzt. Sie werde am Sonntag da sein.
Alois ist tonnenschwer und federleicht, als er vor dem Haus ins Auto steigt, als er durch die Nacht und den Wald hinauf zu seinem Hof fährt, als er durch den Stall geht, wo ihn die Kühe im plötzlichen Licht anblinzeln, und über den Platz und hinein in das Haus, in dem er schon sein ganzes Leben wohnt.
Der Zug ist abgefahren. Du rauchst eine Zigarette, steigst in den nächsten. Gleisfeld, Stahltulpen, Glashaus ziehen vorbei, Wiesenpausen zwischen den Häusern. Der Zug fährt durch Stadt, Vorstadt, Industriegebiet, Kleinstadt um Kleinstadt. Fährt an wegrationalisierten Bahnhöfen vorbei und hält auf Verlangen, wo sie noch im Konkursverfahren feststecken.
Die Reihenfolge der Ortsnamen kannst du beten wie das Vaterunser. Auf -wil folgt -au folgt -wangen folgt -husen folgt -see, auch wenn da nur ein Teich ist. Die Kirchen sind in den Dörfern geblieben, die Höfe zwischen den Hügeln, der leere Raum dazwischen ist aufgefüllt mit pastellfarbenen Einfamilienhäusern.
Ein Ortsschild nach dem anderen entzerrt die Kindergeografie in deinem Kopf, die Häuser, Straßen, Täler und Distanzen sind kleiner. Du zählst bis drei, dann kommt das nächste Dorf. Zwei Bahnhöfe weiter wellt sich die korrigierte Wahrnehmung, gleitet in die Kinderwelt zurück, jeder Kilometer wird zu Distanz, die Landschaft weitet sich in deinem Rücken, und dort vorne hinter den Bergen liegt die ganze Welt.
Du hast den Koffer gepackt und ihn wieder ausgepackt, um den Rucksack zu nehmen.
Du hast den Rucksack gepackt, bist auf das Fahrrad gestiegen und leicht schwankend zum Bahnhof gefahren.
Jetzt sitzt du in einem Zug, der Zug fährt durch Kleinstädte und Voralpen-Hügel-und-Tal-Gefilde, gemähte Wiesen und hüfthohe Maisfelder.
Du stellst dir vor: ein Leben, wie du es dieser Landschaft andichtest, getaktet durch Hochzeit, Geburt, Hausbau, Geburt, ein Radius von einer halben Stunde, gelegentliche Ausreißer ans Mittelmeer und in den Schnee.
Der Bildschirm in deiner Hand leuchtet auf, schlägt dir eine Meditation gegen galoppierende Gedanken vor. Du wischst die Nachricht weg. Das Gerät liegt in deiner Hand, als wäre es verwachsen mit dir.
Kleinstadt um Kleinstadt zieht vorbei, geadelte Dörfer, denkst du, und an das Leben in diesen Orten, wo nichts galoppiert außer zottlige Ponys über eine verkommene Weide, wo Tierschur-Ausstattungen hergestellt werden oder Heubelüfter. Wo in deiner Vorstellung jede Arbeit mit den Händen zu tun ist und abends sichtbar.
In der Nacht hast du, wie in vielen Nächten, wach gelegen oder zumindest geglaubt, wach zu liegen, hast in die Dunkelheit geschaut. Du hast dem Körper neben dir beim Schlafen zugehört. Manchmal hast du deine Hand ausgestreckt, die Haare, die dir auf dem Kissen entgegenkamen, berührt, den Rücken. Manchmal hat sich ein Arm um dich gelegt, wenn deine kratzende Hand durch die Matratze Erschütterungen in den anderen Körper schickte. Irgendwo in deinem Körper war ein Getöse.
Du bist aufgewacht, es war hell und er schon weg, den Kuss hast du verschlafen oder vergessen, und der kleine Zeiger zeigte schon nach oben.





























