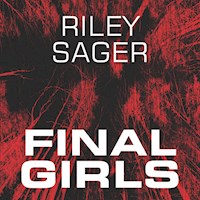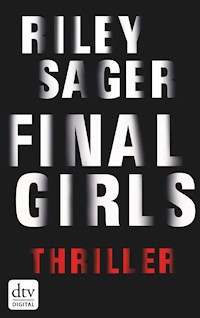Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Haus zum Träumen. Und zum Sterben. Willkommen im Bartholomew – wir hoffen, Sie werden sich hier wohlfühlen. Jules hat einen Wahnsinns-Job an Land gezogen: Sie soll im Bartholomew, einem prachtvollen alten Hochhaus am Central Park, auf eine Luxuswohnung aufpassen. Und dafür 1000 Dollar die Woche kassieren! Einige seltsame Bedingungen gibt es allerdings: Sie muss jede Nacht im Apartment schlafen und darf niemanden in die Wohnung lassen. Kaum ist Jules eingezogen, häufen sich unheimliche Vorkommnisse. Von Ingrid, ebenfalls »Apartmentsitterin«, erfährt sie, dass das Bartholomew ein dunkles Geheimnis hat. Als Ingrid verschwindet, versucht Jules, das Geheimnis zu lüften – und gerät dabei selbst in größte Gefahr. Ein Thriller der Extraklasse: spannend, atmosphärisch und bildstark. »Rosemarys Baby kann einpacken – urbane Paranoia hat jetzt eine herrlich schaurige neue Adresse.« Ruth Ware »Ein absolut überwältigender Thriller, meisterhaft geschrieben.« Booklist Von Riley Sager sind bei dtv außerdem folgende spannende Thriller erschienen: »Final Girls« »Schwarzer See« »HOME – Haus der bösen Schatten« »NIGHT – Nacht der Angst« »Hope's End«
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Jules, 25, hat einen neuen Job: Sie soll im Bartholomew, einem prachtvollen alten Hochhaus am Central Park, auf eine Luxuswohnung aufpassen. Dafür bekommt sie tausend Dollar in der Woche. Einige merkwürdige Bedingungen gibt es allerdings: Sie darf keinen Menschen in die Wohnung lassen, muss jede Nacht dort verbringen, und die anderen Bewohner des Hauses (alle entweder reich oder berühmt oder beides) darf sie nicht ansprechen.
Kaum ist Jules eingezogen, geschehen seltsame und unheimliche Dinge. Sie hat das deutliche Gefühl, dass sie verfolgt und beobachtet wird – aber von wem? Dann erzählt ihr Ingrid, eine andere Apartmentsitterin, dass es im Bartholomew ein grauenvolles Geheimnis gibt. Am nächsten Tag ist Ingrid verschwunden. Jules ist entschlossen, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Womit sie nicht gerechnet hat: dass sie selbst das Barthomolew vielleicht nicht mehr lebend verlassen wird …
Für Ira Levin
Die Füße fest auf dem Bürgersteig, im Innern jedoch so aufgewühlt wie das Meer, sah Ginny zu dem Haus auf. Nicht einmal in ihren kühnsten Träumen hätte sie geglaubt, dass sie es je betreten würde. Stets war es ihr so fern erschienen wie ein Märchenschloss. So sah es auch aus – hoch, imposant, von Wasserspeiern umkränzt. Die Manhattaner Version eines Palasts, bewohnt von den Reichen und Schönen der Stadt.
Für Außenstehende war es das Bartholomew.
Für Ginny war es der Ort, den sie nun als Zuhause bezeichnen durfte.
Greta Manville, ›Traumherz‹
JETZT
Helles Licht bohrt sich in die Finsternis, und auf einen Schlag bin ich wach.
Mein rechtes Auge wird aufgezwungen. Finger in Latexhandschuhen schieben die Lider auseinander, mit Gewalt, wie klemmende Jalousien. Das Licht wird noch greller. Gnadenlos, schmerzhaft grell. Eine Stiftleuchte, auf meine Pupille gerichtet.
Das Gleiche wiederholt sich bei meinem linken Auge. Aufzwingen. Gewaltsam. Licht.
Die Finger lassen meine Lider los. Wieder legt sich Finsternis über mich.
Jemand sagt etwas. Eine sanfte Männerstimme. »Können Sie mich hören?«
Ich öffne den Mund. Stechender Schmerz schießt mir durch den Unterkiefer, einzelne Blitze zucken bis in die Wangen und den Hals. »Ja.«
Es klingt unwahrscheinlich rau. Meine Kehle ist wie ausgetrocknet. Meine Lippen auch, abgesehen von einer klebrig feuchten, warmen Stelle, die metallisch schmeckt. »Blute ich?«
»Ja«, sagt dieselbe Stimme. »Aber nur ein bisschen. Hätte schlimmer sein können.«
»Viel schlimmer«, fügt eine zweite Stimme hinzu.
»Wo bin ich?«
»Im Krankenhaus«, sagt die erste Stimme. »Sie werden gerade zur Untersuchung gefahren. Wir müssen schauen, wie übel Sie zugerichtet sind.«
Mir wird bewusst, dass ich mich in Bewegung befinde. Unter mir surren Reifen über Fliesenboden, und ich spüre, wie das Transportbett, auf dem ich liege, immer wieder leicht erschüttert wird. Bis zu diesem Moment hatte ich eher das Gefühl gehabt zu schweben. Ich versuche mich zu bewegen, aber es geht nicht. Meine Arme und Beine sind festgeschnallt. Und um meinen Hals ist etwas geschlungen, was meinen Kopf an Ort und Stelle hält.
Um mich herum sind Menschen. Mindestens drei. Die beiden Sprecher und jemand, der das Bett schiebt. Über mein Ohrläppchen streichen regelmäßig warme Atemzüge.
»Schauen wir mal, woran Sie sich erinnern können.« Das ist wieder die erste Stimme. Das Sprachrohr der Crew. »Meinen Sie, Sie können mir ein paar Fragen beantworten?«
»Ja.«
»Wie ist Ihr Name?«
»Jules.« Ich unterbreche mich; die warme Feuchtigkeit auf meinen Lippen ist irritierend. Ich versuche sie abzulecken, taste mit der Zunge herum. »Jules Larsen.«
»Freut mich, Jules«, sagt die Männerstimme. »Ich bin Bernard.«
Ich will die Begrüßung erwidern, aber mein Kiefer tut zu weh.
Auch meine linke Seite tut weh, von der Schulter bis zum Knie.
Und mein Kopf auch.
Der Schmerz setzt rasend schnell ein, aus dem Nichts, und steigert sich binnen Sekunden ins Unermessliche. Oder vielleicht war er schon die ganze Zeit da, und erst jetzt kann mein Bewusstsein sich darauf einlassen.
»Wie alt sind Sie, Jules?«, fragt Bernard.
»Fünfundzwanzig.« Ich halte inne; eine neue Woge von Schmerz überkommt mich. »Was ist passiert?«
»Sie wurden von einem Auto erfasst, Liebes. Oder vielleicht das Auto von Ihnen. Darüber sind wir uns noch nicht so recht im Klaren.«
Da kann ich ihm auch nicht helfen. Mir ist das neu. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern.
»Wann?«
»Vor ein paar Minuten.«
»Und wo?«
»Direkt vor dem Bartholomew.«
Jetzt reiße ich die Augen auf – aus eigener Kraft. Ich blinzle ins Licht der grellen Neonröhren, die über mir vorbeiwischen. Bernard hält mit der Liege Schritt. Er trägt einen leuchtend hellen Kittel, hat dunkle Haut und braune Augen. Sie blicken sanft und freundlich. Deshalb saugt sich mein Blick flehend an ihnen fest. »Bitte«, stoße ich hervor, »bitte bringen Sie mich nicht dorthin zurück.«
SECHS TAGE ZUVOR
1.
Der Aufzug sieht aus wie ein Vogelkäfig, so ein hoher verzierter mit dünnen vergoldeten Gitterstäben. Beim Betreten muss ich an Vögel denken, exotisch, mit prächtigem, edlem Gefieder.
Nichts von dieser Beschreibung trifft auch nur annähernd auf mich zu.
Die Frau neben mir fällt schon eher in diese Kategorie mit ihrem blauen Chanel-Kostüm, der blonden Hochsteckfrisur und den perfekt manikürten, mit mehreren Ringen beschwerten Händen. Sie ist vielleicht Mitte fünfzig. Vielleicht auch älter. Ihr Gesicht ist botoxgestrafft und faltenlos. Ihre Stimme leicht und perlend wie Champagner. Selbst ihr Name ist elegant: Leslie Evelyn.
Da das hier im Prinzip ein Bewerbungsgespräch ist, trage auch ich ein Kostüm.
Schwarz.
Nicht von Chanel.
Meine Schuhe sind von Payless. Das braune Haar, das mir auf die Schultern fällt, könnte einen Schnitt gebrauchen. Ich wäre ja zu Supercut gegangen, aber momentan ist selbst das unerschwinglich für mich.
Ich nicke mit gespieltem Interesse, während ich Leslie Evelyns Ausführungen folge: »Der Lift ist natürlich noch original. Genau wie die Haupttreppe. Überhaupt hat sich am gesamten Eingangsbereich kaum etwas verändert, seit das Haus 1919 fertiggestellt wurde. Das ist das Wundervolle an so alten Gebäuden – sie wurden noch für die Ewigkeit gebaut.«
Anscheinend auch dafür, dass man sich auf die Pelle rücken muss. Leslie und ich stehen Schulter an Schulter in der erstaunlich engen Aufzugskabine. Was dieser an Größe fehlt, macht sie durch Stil wett. Roter Teppichboden, vergoldete Decke. Die drei Wände sind bis auf Hüfthöhe eichengetäfelt und gehen dann in mehrere schmale Fenster über.
Die Tür ist zweifach gesichert: durch ein drahtdünnes Gitter, das sich automatisch schließt, und ein Zickzack-Faltgitter, das Leslie von Hand zuzieht, ehe sie den Knopf für das oberste Stockwerk drückt. Dann geht es los – Etage um Etage steigen wir durch eines der sagenumwobensten Gebäude Manhattans nach oben.
Hätte ich gewusst, dass die Wohnung sich hier befindet, hätte ich mich nie auf die Annonce gemeldet. Reine Zeitverschwendung, hätte ich gedacht. Ich bin keine Leslie Evelyn, die eine cremefarbene Aktentasche trägt und sich hier ganz ungezwungen bewegt. Ich bin Jules Larsen, Produkt eines kleinen Ortes im Kohlerevier von Pennsylvania mit weniger als fünfhundert Dollar auf dem Konto.
Ich gehöre nicht hierher.
Aber bei der Annonce war keine Adresse angegeben. Es hieß nur: Wohnungssitter gesucht, dazu eine Telefonnummer für Interessenten. Ich war interessiert und rief an. Leslie Evelyn nahm ab und gab mir einen Bewerbungstermin und die Adresse. Eine niedrige Siebziger-Straße in der Upper West Side. Trotzdem wurde mir erst klar, wohin ich geraten war, als ich vor dem Haus stand und zum dritten Mal nachprüfte, ob ich die Adresse auch wirklich nicht verwechselt hatte.
Das Bartholomew.
Gleich hinter dem Dakota und dem San Remo mit seinen zwei Türmen gelegen und eines der unverwechselbarsten Wohngebäude Manhattans. Zum Teil deshalb, weil es so schmal ist. Verglichen mit all den anderen legendären Immobilien in New York ist das Bartholomew ein schmächtiges Ding, ein schmaler steinerner Dorn mit dreizehn Stockwerken, die den Central Park West überblicken. Neben den riesigen Klötzen in seiner Nachbarschaft fällt das Bartholomew allein dadurch auf, dass es das genaue Gegenteil ist. Klein, verschnörkelt, einprägsam.
Doch der Hauptgrund, warum das Bartholomew so bekannt ist, sind die Wasserspeier. Ganz klassische mit Fledermausflügeln und Teufelshörnern. Die steinernen Ungeheuer sind überall – angefangen mit den beiden über dem rundbogigen Eingangsportal bis hin zu denen, die an den vier Ecken des Giebeldachs kauern. Und alle zwei Stockwerke finden sich kleine Ansammlungen von ihnen an der Fassade. Sie sitzen auf Marmorvorsprüngen, die Arme zu den Simsen über ihnen emporgereckt, als hielten nur sie das Bartholomew aufrecht. Durch sie wirkt es pseudogotisch, ja beinahe sakral, was ihm einen nicht weniger sakralen Spitznamen eingebracht hat: St. Bart’s.
Über die Jahre zierte das Bartholomew mit seinen Wasserspeiern Tausende von Fotografien. Ich habe es schon auf Postkarten, in Werbeanzeigen und als Hintergrund auf Modefotos gesehen. Auch in Filmen tauchte es auf. Und im Fernsehen. Und auf dem Cover eines Romanbestsellers aus den achtziger Jahren namens ›Traumherz‹, durch den ich überhaupt erst von ihm erfuhr. Jane besaß das Buch, und oft lag ich quer über ihrem Jugendbett, und sie las mir daraus vor.
Der Roman erzählt die abstruse Geschichte einer zwanzigjährigen Waise namens Ginny, die dank einer Laune des Schicksals und des Wohlwollens der nie gekannten Großmutter plötzlich eine Wohnung im Bartholomew beziehen darf. In ihrer schicken neuen Umgebung bewegt sie sich mit Leichtigkeit in immer raffinierter werdenden Partykleidern und jongliert zwischen mehreren Verehrern. Schon etwas seicht, das Ganze, aber auf bezaubernde Art. Die dazu führt, dass pubertierende Mädchen davon träumen, im Gewimmel der Straßen von Manhattan die große Liebe zu finden.
Während Jane mir daraus vorlas, betrachtete ich immer das Coverbild des Buchs, das die Front des Bartholomew von der Straße aus zeigt. Dort, wo wir aufwuchsen, gab es keine solchen Gebäude. Nur niedrige Häuser- und Ladenzeilen mit schmierigen Schaufenstern, ihr trauriger Anblick gelegentlich unterbrochen von einer Schule oder einem Gotteshaus. Das unbekannte Manhattan faszinierte Jane und mich. Genau wie der Gedanke, in einem Haus wie dem Bartholomew zu leben, das Welten von der schlichten Doppelhaushälfte entfernt war, in der wir mit unseren Eltern wohnten.
»Irgendwann«, sagte Jane, oft zwischen zwei Kapiteln, »irgendwann wohne ich dort.«
»Und ich besuche dich dann«, fügte ich hinzu.
Da strich mir Jane immer übers Haar. »Besuchen? Wir wohnen dort beide zusammen, Julie-Maus.«
Natürlich wurde nichts aus diesen Kinderfantasien. Wer hat schon jemals so ein Glück? Vielleicht die Leslie Evelyns dieser Welt. Aber nicht Jane – und ich noch viel weniger. Näher als bis zu dieser Fahrt im Aufzug werde ich meinem Traum nie kommen.
Um den Aufzugschacht herum schraubt sich das Treppenhaus durch den Kern des Gebäudes nach oben. Durch die Fenster der Kabine ist es gut zu sehen. Auf jedes Stockwerk folgen zehn Stufen, dann ein Absatz, dann wieder zehn Stufen.
Auf einem der Treppenabsätze quält sich ein älterer Mann mit Hilfe einer erschöpft wirkenden Frau im lila Kittel nach unten. Geduldig, die Hand fest um seinen Arm, wartet sie, bis er Atem geschöpft hat. Beide tun, als interessiere es sie nicht, dass der Aufzug vorbeifährt, werfen aber doch einen raschen Blick in die Kabine, ehe wir ins nächste Stockwerk entschweben.
»Die Privatwohnungen befinden sich in den oberen zwölf Etagen«, erklärt Leslie. »Im Erdgeschoss liegen die Verwaltungs-, Service- und Personalräume. Im Untergeschoss ist für jede Wohnung ein Kellerraum vorhanden. Auf jeder Etage gibt es vier Wohnungen, zwei nach vorne und zwei nach hinten.«
Langsam, aber stetig passieren wir das nächste Stockwerk. Hier wartet eine Frau in Leslies Alter, die offensichtlich mit dem Aufzug nach unten will. Sie trägt Leggings, UGGs und einen unförmigen weißen Pullover und hält einen unfassbar winzigen Hund an einer nietenbesetzten Leine. Leslie schenkt sie ein höfliches Winken und mir einen intensiven Blick hinter ihrer riesigen Sonnenbrille hervor. In dem kurzen Augenblick, als ich mich auf ihrer Augenhöhe befinde, erkenne ich sie. Sie ist Schauspielerin. Oder war es zumindest einmal. Es ist zehn Jahre her, seit ich sie zuletzt in der Seifenoper sah, die ich in den Sommerferien mit meiner Mutter anschaute.
»Ist das – «
Mit erhobener Hand schneidet Leslie mir das Wort ab. »Hier spricht man nicht über andere Hausbewohner. Das ist eine unserer ungeschriebenen Regeln. Auf Diskretion wird im Bartholomew großen Wert gelegt. Die Bewohner möchten sich hier wohlfühlen können.«
»Aber hier wohnen doch auch Prominente?«
»Nicht unbedingt. Was uns sehr entgegenkommt. Paparazzi vor der Tür sind nun wirklich das Letzte, was man sich hier wünscht – oder etwas so Entsetzliches wie im Dakota, Gott bewahre. Generell ist die Klientel hier auf diskrete Weise wohlhabend. Und schätzt ihre Privatsphäre. Viele haben ihre Wohnungen von Scheinfirmen erwerben lassen, damit der Kauf nicht öffentlich bekannt wird.«
Klappernd kommt der Lift zum Halten. Das Treppenhaus endet hier.
»Zwölfter Stock. Wir sind da.« Leslie zieht mit einem Ruck das Faltgitter auf und tritt hinaus. Ihre Absätze klicken auf den schwarz-weißen Metrofliesen.
Der Flur ist bordeauxrot gestrichen; in regelmäßigen Abständen sind Wandleuchten angebracht. Wir passieren zwei anonyme Türen, dann endet der Flur an einer breiten Wand mit zwei weiteren Türen. Sie haben Türschilder.
12A und 12B.
»Ich dachte, auf jeder Etage wären vier Wohnungen«, bemerke ich.
»Das ist richtig«, sagt Leslie. »Die zwölfte Etage ist eine Ausnahme.«
Ich werfe einen Blick auf die unbeschrifteten Türen. »Und was ist da drin?«
»Lagerräume. Der Zugang zum Dach. Nichts Spannendes.« Sie greift in ihre Aktentasche, holt einen Schlüsselbund heraus und schließt Wohnung 12A auf. »Das hier ist viel spannender.«
Die Tür schwingt auf, und Leslie tritt beiseite. Vor mir liegt eine winzige geschmackvolle Diele. Die Einrichtung besteht aus einer Garderobe, einem vergoldeten Spiegel und einem Tisch, auf dem eine Lampe, eine Vase und eine kleine Schale für Schlüssel stehen. Dann wandert mein Blick weiter, in die eigentliche Wohnung hinein, direkt zu einem Fenster genau gegenüber dem Eingang. Mit einer der spektakulärsten Aussichten, die ich jemals gesehen habe.
Der Central Park.
Im Spätherbst.
Bernsteinfarbene Sonnenstrahlen, die auf orangegoldenen Blättern spielen.
Und alles aus der Vogelperspektive in über vierzig Metern Höhe.
Das Fenster, das diesen Blick bietet, reicht vom Boden bis zur Decke in einem repräsentativen Wohnzimmer, zu dem ein kurzer Flur führt. Ich durchquere ihn mit vor Schwindel weichen Knien und bleibe erst stehen, als meine Nase fast an die Fensterscheibe stößt. Geradeaus sieht man den Central Park Lake und die anmutig geschwungene Bow Bridge. Dahinter sind in der Ferne bruchstückhaft die Bethesda-Terrasse und das Loeb-Bootshaus zu erkennen. Rechts liegt Sheep Meadow, das Grün des Rasens gesprenkelt von menschlichen Gestalten, die die Herbstsonne genießen. Und links steht Belvedere Castle vor der würdevollen grauen Steinfassade des Metropolitan Museum of Art.
Etwas außer Atem sauge ich den Anblick in mich ein.
Ich habe ihn innerlich schon vor mir gesehen. Damals, beim Lesen von ›Traumherz‹. Genau diese Aussicht hatte Ginny im Buch von ihrer Wohnung aus. Die Wiese im Süden. Das Schloss im Norden. Und in der Mitte die Bow Bridge wie ein Fadenkreuz für ihre kühnsten Träume.
Einen flüchtigen Augenblick lang ist das hier meine Wirklichkeit. Trotz all dem Mist, den ich durchgemacht habe. Vielleicht sogar deshalb. Hier zu stehen fühlt sich an, als würde das Schicksal persönlich eingreifen – auch dann noch, als sich wieder dieser alles erdrückende Gedanke darüberlegt: Ich gehöre nicht hierher.
Ich reiße mich von dem Fenster los. »Verzeihen Sie«, sage ich. »Ich glaube, das hier ist ein Riesenmissverständnis.«
Wie es dazu gekommen ist, dafür gibt es viele Möglichkeiten. In der Anzeige bei Craigslist war vielleicht eine falsche Telefonnummer angegeben. Oder ich habe mich verwählt. Das Gespräch am Telefon war so kurz, dass auch da leicht etwas missverstanden werden konnte. Ich dachte, sie suchte nach einem Wohnungssitter – sie dachte, ich suchte nach einer Wohnung. Jetzt stehen wir da, Leslie mit leicht schiefgelegtem Kopf und verwundertem Blick, ich restlos überwältigt von einer Aussicht, die, seien wir ehrlich, nie für die Augen von jemandem wie mich bestimmt war.
»Gefällt Ihnen die Wohnung nicht?«, fragt Leslie.
»Nein, sie ist der absolute Wahnsinn.« Ich erlaube mir noch einen raschen Blick aus dem Fenster – ich kann nicht anders. »Aber ich suche keine Wohnung. Also, doch, schon, aber selbst wenn ich mein restliches Leben lang jeden Penny sparen würde, könnte ich mir die hier nicht leisten.«
»Die Wohnung steht noch nicht zum Verkauf«, sagt Leslie. »Wir suchen nur nach jemandem, der sie die nächsten drei Monate hütet.«
»Das würde doch kein Mensch machen – jemanden dafür bezahlen, dass er hier wohnt. Nicht mal für begrenzte Zeit.«
»Sie irren sich. Genau das haben wir vor.« Sie deutet auf ein Sofa mitten im Raum. Es ist mit blutrotem Samt bezogen und sieht teurer aus als mein erstes Auto. Behutsam setze ich mich hin, aus Angst, durch eine unvorsichtige Bewegung etwas kaputtzumachen. Leslie nimmt auf einem passenden Sessel gegenüber Platz. Zwischen uns steht ein Mahagoni-Couchtisch, darauf eine Orchidee im Topf mit strahlend weißen Blütenblättern.
Nun, da mich die Aussicht nicht mehr ablenkt, bemerke ich, dass das Zimmer ganz in Rot- und Holztönen gehalten ist. Gemütlich, wenn auch etwas altbacken. In der Ecke tickt eine Standuhr. An den Fenstern sind Samtvorhänge und hölzerne Fensterläden angebracht. Auf einem Stativ steht ein Messingteleskop, nicht auf den Himmel, sondern auf den Central Park gerichtet. Die Tapete hat ein rotes Blumenmuster – eine üppige Szenerie aus fächerförmigen Blütenblättern, die sich auf unwahrscheinlich vielfältige Weise überlappen. Den Übergang zur Decke bildet ein passender Stuckfries, der in den Ecken zu Blumenschnörkeln wird.
»Die Sache ist folgende«, sagt Leslie. »Ein weiteres ungeschriebenes Gesetz des Bartholomew besagt, dass keine Wohnung länger als einen Monat leer stehen darf. Es stammt noch aus uralter Zeit, und man könnte sich gewiss darüber streiten. Aber wir Hausbewohner sind uns einig, dass nur belebter Wohnraum für eine gute Atmosphäre sorgt. Manche der Wohnhäuser hier in der Gegend sind die Hälfte der Zeit verlassen. Natürlich gehören sie jemandem, aber die Bewohner sind kaum dort. Und das wirkt sich auf die Gebäude aus. Man fühlt sich darin wie in einem Museum – oder schlimmer noch, wie in einer Kirche. Dann ist da die Frage der Sicherheit. Wenn bekannt würde, dass eine Wohnung im Bartholomew einige Zeit leer stünde, würde wer weiß wer versuchen einzubrechen.«
Daher also die schlichte Anzeige zwischen all den anderen Hilfsgesuchen. Ich hatte mich ja schon gewundert, warum sie so vage war.
»Also suchen Sie nach jemandem, der sie bewacht?«
»Wir suchen nach jemandem, der dort wohnt. Der dazu beiträgt, dem Haus Leben einzuhauchen. Nehmen wir diese Wohnung hier. Die Eigentümerin ist kürzlich verstorben. Sie war Witwe und hatte keine Kinder. Nur ein paar gierige Neffen und Nichten in London, die sich jetzt darum streiten. Bis geklärt ist, wer sie bekommt, wird sie leer stehen. Was glauben Sie, wie verlassen das Stockwerk wirken würde, zumal es hier nur noch eine andere Wohnung gibt.«
»Warum vermieten die Nichten und Neffen nicht einfach befristet?«
»Das ist hier nicht erlaubt – aus den bereits erwähnten Gründen. Überlegen Sie, was ein Mieter, noch dazu mit einem befristeten Vertrag, alles darin anstellen könnte.«
Plötzlich beginne ich zu verstehen. Ich nicke. »Aber wenn sie jemanden dafür bezahlen, können sie sichergehen, dass er auf die Wohnung aufpasst.«
»Exakt. Man könnte es als eine Art Versicherung sehen. Die sich für den temporären Bewohner übrigens auszahlt, sollte ich hinzufügen. Im Falle dieser Wohnung hier werden die Erben monatlich viertausend Dollar zahlen.«
Meine Hände, die ich steif auf dem Schoß gefaltet hatte, rutschen mir herunter.
Vier Riesen im Monat.
Um hier zu wohnen.
Das ist so schwindelerregend, dass ich das Gefühl habe, als würde das tiefrote Sofa unter mir weggezogen und ich hinge einen halben Meter über dem Boden.
Ich habe Mühe, wieder klar zu denken – schon die einfache Rechnung fällt mir schwer: Das wären in drei Monaten zwölftausend Dollar. Mehr als genug, um über die Runden zu kommen, während ich versuche, wieder Ordnung in mein Leben zu kriegen.
»Ich nehme an, Sie sind interessiert«, sagt Leslie.
Ab und zu gibt einem das Leben die Chance, den Reset-Knopf zu drücken. Dann muss man das machen, und zwar so fest man kann. Das hatte Jane einmal zu mir gesagt. Damals, an einem der Vorlesetage auf ihrem Bett. Als ich zu jung war, um zu kapieren, was es bedeutete.
Heute weiß ich es genau.
»Durchaus«, sage ich.
Leslie lächelt, ihre weißen Zähne funkeln zwischen den samtig rosa Lippen. »Dann gehen wir mal in die Details, einverstanden?«
2.
Zur Fortsetzung des Vorstellungsgesprächs bleiben wir nicht auf dem Sofa sitzen. Stattdessen führt Leslie mich durch die Wohnung. In jedem Zimmer wird eine neue Frage fällig, wie beim Cluedo-Spiel. Was fehlt, sind nur das Billardzimmer und der Ballsaal.
Erste Station ist das rechts vom Wohnzimmer gelegene Arbeitszimmer. Es hat eine sehr maskuline Atmosphäre: ganz in Dunkelgrün und whiskeyfarbenem Holz. Die Tapete ist dieselbe wie im Wohnzimmer, nur in leuchtendem Smaragdgrün.
»Wie sind Sie derzeit beschäftigt?«, fragt Leslie.
Ich könnte – und sollte – wohl antworten, dass ich bis vor zwei Wochen Verwaltungsassistentin bei einem der größten Finanzdienstleister der USA war. Es war im Grunde ein Handlangerjob, nur eine Stufe über dem unbezahlten Praktikum. Mit viel Kopieren und Kaffeeholen und Sich-Verkrümeln, wenn die kleinen Manager, für die ich arbeitete, mal wieder ihre Launen hatten. Aber ich konnte meine Rechnungen bezahlen und hatte eine Krankenversicherung. Bis das Unternehmen ein Zehntel des Personals wegrationalisierte, darunter auch mich. Umstrukturierung hieß es – das klang in den Ohren meines Chefs wohl besser als Massenentlassungen. Das Ergebnis war allerdings dasselbe: Ich stand auf der Straße, und er kriegte vermutlich eine fette Gehaltserhöhung.
»Ich schaue mich gerade nach was Neuem um«, sage ich.
Leslies Reaktion ist ein kaum merkliches Nicken. Ich weiß nicht, ob das Gutes oder Schlechtes verheißt. Im Flur auf dem Weg zum anderen Ende der Wohnung fragt sie weiter.
»Rauchen Sie?«
»Nein.«
»Und trinken?«
»Beim Abendessen mal ein Glas Wein.«
Außer vor zwei Wochen, als ich mit Chloe abends wegging, um meine Sorgen in Margaritas zu ertränken. Fünf waren es insgesamt, und zwar in besorgniserregend kurzer Zeit. Danach kotzte ich mir in einer kleinen Seitengasse die Seele aus dem Leib. Noch etwas, was Leslie nicht wissen muss.
Der Flur knickt nach links ab. Statt ihm zu folgen, führt mich Leslie nach rechts – in ein Speisezimmer, bei dem ich nach Luft schnappe, so schön ist es. Glatt polierter Parkettboden, in dem man sich spiegeln kann. Über dem langen Tisch, an den gut zwölf Personen passen, hängt ein Kronleuchter. Die Blumentapete ist hier zartgelb. Und da es ein Eckzimmer ist, bieten die Fenster zwei konkurrierende Aussichten: auf den Central Park und auf das Nebengebäude.
Während ich um den Tisch herumgehe und dabei mit dem Finger über das Holz streiche, fragt Leslie: »Und Ihr Beziehungsstatus? Generell haben wir nichts gegen Pärchen oder gar Familien als Wohnungssitter, aber am liebsten sind uns ungebundene Personen. Das ist rechtlich gesehen einfacher.«
»Ich bin Single.« Ich gebe mir Mühe, meinem Ton keine Bitterkeit anmerken zu lassen.
Unerwähnt lasse ich, wie ich an ebenjenem Tag, als mir gekündigt wurde, früher als sonst in die Wohnung kam, die ich mir mit meinem Freund Andrew teilte. Nachts arbeitete er als Wachmann in dem Bürogebäude, wo ich arbeitete. Tagsüber studierte er Finanzwesen an der Pace University – und hatte, während ich bei der Arbeit war, offenbar wilden Sex mit einer Kommilitonin.
Genau damit war er beschäftigt, als ich mit dem jämmerlichen kleinen Karton hereinkam, in dem sich meine Sachen vom Arbeitsplatz befanden. Sie hatten es nicht mal ins Schlafzimmer geschafft. Ich ertappte sie auf dem Second-Hand-Sofa, Andrew mit bis zu den Knöcheln heruntergestreiften Jeans und seine Tussi mit gespreizten Schenkeln.
Ich wäre ja traurig über die ganze Geschichte, wenn ich nicht immer noch so stinksauer wäre. Und verletzt. Und wütend auf mich selbst, weil ich mich mit jemandem wie Andrew eingelassen hatte. Ich wusste, dass er mit seinem Job unzufrieden war und mehr vom Leben wollte. Was ich nicht ahnte, war, dass das auch mich betraf.
Leslie Evelyn führt mich in die Küche, die so riesig ist, dass sie gleich zwei Zugänge hat – einen vom Esszimmer und einen vom Flur aus. Langsam drehe ich mich im Kreis, geblendet vom strahlenden Weiß der Einbauschränke, den Granitarbeitsflächen, der kleinen Frühstücksecke am Fenster. Sie sieht aus wie aus einer Kochshow. Eine Küche, die fotogener kaum sein könnte.
»Die ist aber gewaltig«, sage ich, beeindruckt von der schieren Größe.
»Sie ist ein Relikt aus der Anfangszeit des Bartholomew«, sagt Leslie. »Am Gebäude selbst wurde ja kaum etwas verändert; die Wohnungen allerdings wurden über die Jahre teils stark umgestaltet. Manche wurden vergrößert. Andere verkleinert. Diese hier war ursprünglich Dienstbotenquartier und Küche für eine viel größere Wohnung gleich darunter. Sehen Sie?« Sie tritt zu einem Schrank zwischen Ofen und Spüle mit senkrechter Schiebetür. Als sie die Tür hebt, wird dahinter ein dunkler Schacht sichtbar, in dem zwei Seile hängen; ganz oben ist eine Winde.
»Ist das ein Speiseaufzug?«
»So ist es.«
»Wohin führt er?«
»Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Er ist seit Jahrzehnten nicht benutzt worden.« Sie lässt die Tür zugleiten und verfällt von einer Sekunde zur anderen wieder in Businesston. »Erzählen Sie mir doch von Ihrem familiären Hintergrund. Haben Sie Angehörige?«
Diese Frage ist schwerer zu beantworten, hauptsächlich deshalb, weil die Fakten so viel trister sind, als einen Job zu verlieren oder dass der Partner fremdgeht. Egal was ich sage, es lädt womöglich zu weiteren Fragen ein, auf die es nur noch tristere Antworten gibt. Vor allem, wenn ich Andeutungen darüber mache, was passiert ist.
Und wann.
Und warum.
»Ich bin Waise«, sage ich in der Hoffnung, dass ihr dieses Wort jede Lust am Weiterfragen nehmen wird.
Es wirkt – in gewissem Maße.
»Keine sonstigen Angehörigen?«
»Nein.«
Das ist beinahe die Wahrheit. Meine Eltern waren beide Einzelkinder, wie schon ihre eigenen Eltern. Also keine Tanten, Onkel, Cousinen oder Cousins. Nur Jane.
Die auch tot ist.
Vielleicht.
Wahrscheinlich.
»Gibt es denn jemanden, der im Falle eines Notfalls kontaktiert werden sollte?«
Noch vor zwei Wochen hätte ich Andrew angegeben. Jetzt wäre das wohl Chloe, allerdings ist sie in keinem meiner amtlichen Dokumente mit eingetragen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das juristisch überhaupt möglich wäre.
»Nein, niemanden«, sage ich. Im selben Moment wird mir bewusst, wie jämmerlich das klingt. Also füge ich einen kleinen Vorbehalt hinzu. »Momentan jedenfalls.«
Um endlich das Thema wechseln zu können, spähe ich durch die Tür neben der Küche. Leslie kapiert den Wink und geleitet mich weiter durch den Flur beziehungsweise eine Abzweigung desselben. Hier befinden sich ein Gästeklo, an das sie keine Zeit verschwendet, ein Wandschrank und – zu meiner Verblüffung – eine Wendeltreppe, die nach oben führt.
»Ach du meine Güte. Die Wohnung hat zwei Etagen?«
Leslie nickt erheitert – es scheint sie eher zu amüsieren als bedenklich zu stimmen, dass ich klinge wie eine Sechsjährige an Weihnachten. »Diese Eigenheit haben nur die beiden Wohnungen hier oben. Gehen Sie ruhig rauf und schauen Sie es sich an.«
Ich eile die gewundenen Stufen hinauf und finde mich in einem Schlafzimmer wieder, das einen sogar noch perfekteren Anblick bietet als die Küche. Hier passt die Blumentapete tatsächlich zur Stimmung des Raums. Sie ist zartblau. Wie der Frühlingshimmel.
Es ist ein Eckzimmer, genau wie das Speisezimmer darunter. Da es im Dachgeschoss liegt, sind die beiden Außenwände stark abgeschrägt und laufen zur Ecke hin im spitzen Winkel aus. Das massive Bett steht so, dass man im Liegen den Blick aus den Fenstern in beiden Dachschrägen genießen kann. Und direkt vor diesen Fenstern steht die Krönung.
Ein Wasserspeier.
Er sitzt auf dem Sims an der Hausecke, die Hinterbeine gebeugt, mit den Vorderpranken hält er den Rand gepackt. Seine Flügel sind ausgebreitet, sodass man den einen durch das Nordfenster und den anderen durch das Ostfenster sehen kann.
»Herrlich, nicht wahr?« Völlig unerwartet steht Leslie hinter mir. Ich hatte sie nicht einmal die Treppe heraufkommen hören, so hingerissen war ich von dem Wasserspeier, dem Zimmer und der ganzen surrealen Idee, dass man mich wahrhaftig – möglicherweise – dafür bezahlen könnte, hier zu wohnen.
»Ja, herrlich«, sage ich, zu überwältigt, um eigene Worte zu finden.
»Und recht geräumig«, fügt sie hinzu. »Selbst nach den Standards des Bartholomew. Auch das liegt am ursprünglichen Zweck der Räumlichkeiten. Einst wohnten hier mehrere Dienstboten. Sie schliefen hier oben, kochten in der großen Küche und arbeiteten in den Stockwerken darunter.«
Sie macht mich auf Verschiedenes aufmerksam, das mir noch gar nicht aufgefallen ist, zum Beispiel eine kleine Sitzecke links der Treppe mit cremefarbenen Sesseln und Glastisch. Der Teppichboden ist so weich, dass ich beim Darübergehen in Versuchung bin, die Schuhe abzustreifen und zu spüren, wie er sich unter den nackten Füßen anfühlt. In der Wand rechts sind zwei Türen eingelassen. Die eine führt zum Badezimmer – ein rascher Blick hinein enthüllt ein Doppelwaschbecken, eine verglaste Dusche und eine Badewanne mit Klauenfüßen. Hinter der anderen befindet sich ein riesiger begehbarer Schrank mit Schminktisch und Spiegel und so vielen leeren Kleiderstangen und Fächern, dass der komplette Bestand einer Modeboutique dort Platz finden würde. »Der ist ja größer als mein Kinderzimmer«, sage ich. »Nein, stimmt nicht. Größer als jedes Zimmer, das ich je hatte.«
Leslie, die vor dem Spiegel ihre Frisur geordnet hat, dreht sich um. »Da wir gerade davon sprechen, wo wohnen Sie denn zur Zeit?«
Noch so eine schwierige Frage.
Gleich an dem Tag, an dem ich Andrew mit seiner Kommilitonin erwischte, bin ich ausgezogen. Nicht aus freien Stücken, wohlgemerkt. Der Mietvertrag lief nur auf Andrews Namen. Als ich bei ihm einzog, hatte ich mich nicht mit eintragen lassen. Was im Prinzip bedeutete, dass es nie wirklich meine Wohnung war, auch wenn ich über ein Jahr lang dort gewohnt hatte. Die vergangenen zwei Wochen habe ich bei Chloe in Jersey City auf dem Sofa geschlafen.
»Ich schaue mich gerade nach etwas Neuem um«, sage ich und hoffe, die Lage klingt nicht ganz so Dickens-mäßig, wie sie ist.
Mit einem raschen Blinzeln versucht Leslie ihre Verblüffung zu verbergen. »Sie schauen sich nach etwas Neuem um?«
»Meine alte Wohnung wurde von einer Baugenossenschaft übernommen«, schwindle ich. »Ich wohne bei einer Freundin, bis ich was anderes gefunden habe.«
»Dann käme es Ihnen ja sehr gelegen, wenn Sie hier wohnen könnten«, sagt Leslie taktvoll.
Das ist untertrieben. Es wäre meine Rettung. Dann hätte ich bei der Suche nach Job und Unterkunft eine anständige Ausgangsbasis. Und, nicht zu vergessen, danach zwölf Riesen auf dem Konto.
»Nun, dann gehen wir doch die restlichen Fragen durch und schauen, ob Sie die passende Kandidatin sind.«
Sie führt mich die Treppe hinunter und zurück zu dem blutroten Sofa im Wohnzimmer. Ich setze mich wieder mit im Schoß gefalteten Händen hin und tue mein Bestes, meinen Blick nicht zum Fenster wandern zu lassen. Er wandert trotzdem dorthin, nun, da das Sonnenlicht auf dem Park einen spätnachmittäglich tiefgoldenen Schimmer angenommen hat.
»Nur noch ein paar Fragen, dann sind wir durch«, sagt Leslie, öffnet ihre Aktentasche und zieht einen Stift und eine Art Formular heraus. »Alter?«
»Fünfundzwanzig.«
Sie schreibt es nieder. »Geburtsdatum?«
»Erster Mai.«
»Irgendwelche gesundheitlichen Probleme oder Einschränkungen, von denen wir erfahren sollten?«
Ich reiße den Blick vom Fenster los. »Wozu brauchen Sie denn das?«
»Aus Sicherheitsgründen. Da es momentan niemanden gibt, den wir benachrichtigen könnten, falls – Gott bewahre – Ihnen während Ihres Aufenthalts hier etwas passiert, brauchen wir etwas genauere medizinische Angaben. Ich versichere Ihnen, das ist ein Standardverfahren.«
»Keine bekannten Krankheiten«, sage ich.
Der Stift bleibt über dem Papier schweben. »Keine Herzprobleme oder Ähnliches?«
»Nein.«
»Augen und Gehör sind in Ordnung?«
»Beides bestens.«
»Bekannte Allergien?«
»Bienenstiche. Aber ich hab immer einen EpiPen dabei.«
»Sehr umsichtig von Ihnen«, sagt Leslie. »Schön, wenn eine junge Frau ihren Verstand einschaltet. Was mich auf meine letzte Frage bringt: Würden Sie sich als wissbegierige Person bezeichnen?«
Wissbegierig. Also, das ist mal ein Wort, das ich bei diesem Gespräch bestimmt nicht erwartet hätte – außerdem ist Leslie diejenige, die eine Menge von mir wissen will.
»Ich weiß nicht genau, was ich darunter verstehen soll«, gebe ich zu.
»Dann sage ich es ganz platt«, gibt sie zurück. »Sind Sie neugierig? Stellen Sie Fragen? Und noch schlimmer – erzählen Sie Dinge weiter, die Sie erfahren? Sie wissen wahrscheinlich, dass das Bartholomew im Ruf steht, diskret zu sein. Die Außenwelt ist natürlich neugierig, was hinter seiner Fassade geschieht, obwohl Sie ja schon gesehen haben, dass es sich um ein ganz normales Wohnhaus handelt. In der Vergangenheit hatten wir gelegentlich Wohnungssitter mit falschen Absichten. Sie waren auf der Suche nach Skandalen. Um das Haus, seine Geschichte und seine Bewohner. Die typischen Boulevardschlagzeilen eben. Ich kam ihnen sehr schnell auf die Spur – jedes Mal. Wenn es Ihnen also um Klatsch und Tratsch geht, wäre es besser, Sie verabschiedeten sich sofort wieder.«
Ich schüttle den Kopf. »Mir ist egal, was hier läuft. Ganz ehrlich, ich brauche einfach für kurze Zeit einen Platz zum Wohnen und ein bisschen Geld.«
Damit endet das Bewerbungsgespräch. Leslie steht auf, streicht ihren Rock zurecht und dreht einen der dicken Ringe an ihren Fingern in die richtige Richtung. »Normalerweise würde ich Ihnen jetzt sagen, dass ich Sie anrufe, falls wir uns für Sie entscheiden. Aber ich sehe keinen Sinn darin, Sie warten zu lassen.«
Ich weiß, was jetzt kommt. Ich wusste es schon in dem Augenblick, als ich in diesen Vogelkäfig von Aufzug stieg. Ich bin des Bartholomew nicht wert. Leute wie ich – elternlos, arbeitslos, so gut wie obdachlos – haben hier nichts zu suchen. Ein letztes Mal schaue ich aus dem Fenster, im Wissen, dass sich mir ein solcher Ausblick niemals wieder bieten wird.
Leslie fährt fort: »Wir würden Sie sehr gerne bei uns einstellen.«
Zuerst denke ich, ich hätte mich verhört. Ich starre sie verwirrt an, was vermutlich zeigt, wie wenig ich es gewohnt bin, gute Neuigkeiten zu hören. »Sie machen Witze.«
»Ich könnte es nicht ernster meinen. Wir werden natürlich noch Ihren Leumund überprüfen müssen, aber aus meiner Sicht passen Sie genau hierher. Jung und intelligent. Außerdem glaube ich, es wird Ihnen sehr guttun, hier zu wohnen.«
Da sickert es bei mir durch: Ich werde hier wohnen. Ausgerechnet im Bartholomew, verdammt noch mal. In einer Wohnung, wie ich sie mir in meinen wildesten Träumen nicht hätte vorstellen können.
Und noch besser: Ich werde dafür bezahlt.
In meinen Augen sammeln sich Freudentränen. Hastig wische ich sie weg – sonst glaubt Leslie vielleicht noch, ich wäre zu emotional, und ändert ihre Meinung.
»Danke«, sage ich. »Wirklich. Das ist die Chance meines Lebens.«
Leslie strahlt. »Es ist mir ein Vergnügen, Jules. Willkommen im Bartholomew. Ich denke, Sie werden sich hier sehr wohlfühlen.«
3.
»Das hat doch sicher einen Haken, oder?«, sagt Chloe und nimmt einen Schluck vom Zwei-Dollar-Wein von Trader Joe’s. »Ich meine, da muss es doch einen geben.«
»Dachte ich mir auch«, sage ich. »Aber wenn ja, hab ich ihn noch nicht entdeckt.«
»Kein vernünftiger Mensch würde einen Fremden dafür bezahlen, dass er in seiner Luxuswohnung wohnt.«
Wir sitzen im Wohnzimmer von Chloes Alles-andere-als-Luxuswohnung in Jersey City an dem Couchtisch, an dem wir zu Abend essen, seit ich hier eingezogen bin. Heute Abend stehen darauf ein paar Take-away-Schachteln von einem preiswerten Chinesen. Lo Mein mit Gemüse und gebratener Reis mit Schweinefleisch.
»Es ist ja nicht einfach bezahlter Urlaub«, sage ich. »Es ist ein Job wie jeder andere. Ich muss mich um die Wohnung kümmern. Sie putzen, darauf achten, dass alles in Schuss ist.«
Chloe hält im Abbeißen inne, die Nudeln gleiten an ihren Essstäbchen herunter. »Halt mal, hast du etwa vor, das wirklich zu machen?«
»Natürlich. Ich kann morgen einziehen.«
»Morgen? Also, das kommt mir aber verdächtig schnell vor.«
»Die wollen so schnell wie möglich jemanden da drinhaben.«
»Hey, du weißt, dass ich alles andere als paranoid bin, aber da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Wenn das nun eine Sekte ist oder so?«
Ich verdrehe die Augen. »Jetzt ernsthaft?«
»Und wie. Du kennst die Eigentümer doch gar nicht. Hat diese Frau dir überhaupt gesagt, was mit der Vorbesitzerin passiert ist?«
»Sie ist gestorben.«
»Ja, aber wie?«, fragt Chloe. »Und wo? Wenn sie nun in der Wohnung gestorben ist? Wenn sie ermordet wurde?«
»Du machst dir echt schräge Gedanken.«
»Ich mache mir Gedanken um deine Sicherheit. Das ist ein Unterschied.« Sie nimmt noch einen Schluck Wein. Leicht genervt. »Lass wenigstens Paul den Vertrag überfliegen, bevor du irgendwas unterschreibst.«
Chloes Freund arbeitet momentan als Angestellter bei einer schicken Großkanzlei und bereitet sich auf das Jura-Examen vor. Nach dem Examen wollen sie heiraten, in einen Vorort ziehen und zwei Kinder und einen Hund haben. Chloe witzelt gern, dass sie sozial aufstiegsfähig seien.
Ich bin das Gegenteil. So tief gesunken, dass ich dort, wo ich esse, hinterher auch schlafen werde. Es ist, als wäre meine ganze Welt innerhalb von zwei Wochen auf die Größe dieser Couch geschrumpft.
»Ich hab schon unterschrieben«, gestehe ich. »Einen Dreimonatsvertrag mit der Option auf Verlängerung.«
Das ist ein bisschen übertrieben. Es ist kein Vertrag, sondern eine gegenseitige Einverständniserklärung, und Leslie Evelyn hat lediglich angedeutet, dass die Erben der verstorbenen Eigentümerin möglicherweise noch länger brauchen würden, um zu einer Einigung zu kommen. Ich sage das so, um der Sache einen professionelleren Anstrich zu verleihen. Chloe arbeitet als Personalerin; mit Verlängerungsoptionen kann man sie beeindrucken.
»Und ein Steuerformblatt?«
»Ein Steuerformblatt?«
»Hast du eines ausgefüllt?«
Statt zu antworten, fange ich an, mit den Essstäbchen im gebratenen Reis nach Fleischstücken zu stochern. Chloe reißt mir die Schachtel aus der Hand und knallt sie auf den Tisch. Auf der Tischplatte hüpfen ein paar Reiskörner. »Jules, lass die Finger von schwarz bezahlten Jobs. Das hört sich total zwielichtig an.«
»Das heißt doch bloß, dass für mich mehr Geld übrigbleibt.«
»Das heißt, dass es illegal ist.«
Ich schnappe mir die Schachtel wieder und bohre die Stäbchen hinein. Abwehrend sage ich: »Mir geht’s um die zwölftausend Dollar. Ich brauche die Kohle, Chloe.«
»Ich hab dir doch gesagt, ich kann dir was leihen.«
»Das würde ich nie zurückzahlen können.«
»Doch«, beharrt Chloe. »Irgendwann. Tu das bitte nicht nur deshalb, weil du glaubst, du wärst …«
»Eine Belastung?«
»Das hast du gesagt. Nicht ich.«
»Aber ich bin eine für dich.«
»Nein, du bist meine beste Freundin und hast gerade ein Tief im Leben, und du darfst von mir aus wirklich gerne bleiben, solange es nötig ist. Du kriegst die Kurve sicher bald wieder.«
Chloe hat mehr Vertrauen in mich als ich selbst. Die letzten zwei Wochen habe ich ständig darüber nachgegrübelt, wie mein Leben so aus der Spur geraten konnte. Ich bin nicht blöd. Ich kann hart arbeiten. Ich bin ein guter Mensch, jedenfalls bemühe ich mich darum. Und doch genügte der Doppelschlag aus Jobverlust und miesem Arsch als Freund – und schwups gehöre ich zum Abschaum der Menschheit.
Man könnte anmerken, dass ich selbst schuld bin. Dass ich mir etwas für Notfälle hätte zurücklegen sollen. Mindestens drei Monatslöhne, sagen die Experten. Sollte mir je jemand damit kommen, werde ich ihm aus tiefstem Herzen eine verpassen. So was kann nur jemand sagen, der nie einen Nettolohn hatte, der gerade einmal Miete, Essen und laufende Kosten abdeckte.
Die Sache ist: Die meisten Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, was es heißt, arm zu sein, außer sie waren selbst schon mal in dieser Situation.
Sie haben keine Ahnung, wie sehr man kämpfen muss, um sich über Wasser zu halten, und, sollte man auch nur eine Sekunde untergehen, wie höllisch schwer es ist, wieder an die Oberfläche zu kommen. Sie haben noch nie mit zitternden Händen einen Scheck ausgefüllt und insgeheim gebetet, dass er gedeckt ist. Sie haben noch nie sehnlich darauf gewartet, dass sie Punkt null Uhr ihr Gehalt überwiesen bekommen, weil sie keinen Cent mehr in ihrem Portemonnaie haben, ihr Kreditkartensoll ausgereizt ist und sie dringend das Auto auftanken müssen.
Und sich was zu essen kaufen.
Und ein Rezept einlösen, das schon seit einer Woche herumliegt.
Solche Leute mussten noch nie die schiefen Blicke von Kellnern oder Kassierern ertragen, wenn ihre Kreditkarte im Supermarkt, im Restaurant oder bei Walmart abgelehnt wurde.
Und noch so etwas, was die meisten Leute nicht verstehen: wie schnell andere über dich urteilen. Und dich in eine Schublade stecken. Und davon ausgehen, dass pleite zu sein nur daher kommt, dass du dumm und faul bist und jahrelang schlecht gewirtschaftet hast.
Sie wissen nicht, wie es ist, wenn man im Alter von nicht einmal zwanzig für das Begräbnis beider Eltern aufkommen muss.
Wenn man heulend über einem Stapel Schuldscheine sitzt, der von den vielen Ausständen zeugt, die sie über die Jahre angehäuft haben.
Wenn einem gesagt wird, dass sämtliche vorhandenen Versicherungen bereits gepfändet wurden.
Wenn man, um wieder ans College zurückkehren zu können, auf Finanzierungshilfen, zwei Nebenjobs und Studienkredite angewiesen ist, die man frühestens mit vierzig abbezahlt haben wird.
Wenn man dann mit einem abgeschlossenen Literaturstudium in den Arbeitsmarkt eintritt und bei jeder Bewerbung zu hören bekommt, man sei entweder über- und unterqualifiziert.
Über ein solches Leben will keiner nachdenken, also tut es keiner. Man kommt ja wunderbar klar und kann daher nicht verstehen, warum es anderen nicht so geht. Und du selbst stehst allein da mit der Demütigung. Und der Angst. Und der Sorge.
Dieser schrecklichen Sorge.
Die immer, immer da ist. Ein lautes Hintergrundrauschen, das jeden wachen Gedanken begleitet. Meine Aussichten sind so trüb, dass ich mich mittlerweile frage, wie lange es noch dauern wird, bis ich ganz unten angekommen bin, und was ich tun werde, falls es dazu kommt. Werde ich mich an den eigenen Haaren herausziehen können, wie Chloe glaubt? Oder werde ich mit voller Absicht in den gähnenden Abgrund springen wie mein Vater?
Bisher sah ich keine Chance, schnell wieder aus meiner Krise herauszukommen. Aber jetzt hat sich ein Lichtblick aufgetan.
»Ich muss das einfach machen«, erkläre ich Chloe. »Ja, es ist ungewöhnlich, das gebe ich offen zu.«
»Und zu schön, um wahr zu sein.«
»Manchmal haben Leute, die’s vielleicht verdient haben, eben richtig Glück, gerade wenn sie’s am nötigsten brauchen.«
Chloe rutscht neben mich und zieht mich heftig in die Arme. Das hat sie schon immer gemacht, seit wir uns als Zimmergenossinnen im Wohnheim an der Pennsylvania State University kennenlernten. »Ich wollte, es wäre nicht ausgerechnet das Bartholomew.«
»Wieso, was gibt es für ein Problem mit dem Bartholomew?«
»Ach, schon allein diese Wasserspeier. Findest du die nicht gruselig?«
Fand ich überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, den zwischen den Fenstern vor dem Schlafzimmer finde ich richtig süß. Wie ein Wächter, zu meinem Schutz.
»Und ich hab schon …« – Chloe sucht nach einem angemessen ominösen Wort – »… Sachen gehört.«
»Was für Sachen?«
»Meine Großeltern wohnten auch in der Upper West Side. Großvater ist nie direkt am Bartholomew vorbeigegangen. Er sagte, es wäre verflucht.«
Ich greife nach dem Lo Mein. »Ich finde, das sagt mehr über deinen Großvater aus als über das Bartholomew.«
»Er hat fest daran geglaubt. Er sagte, der Mann, der’s gebaut hat, hätte sich umgebracht. Indem er vom Dach sprang.«
»Ich lehne den Job ganz bestimmt nicht ab, nur weil dein Großvater irgendwas erzählt hat.«
»Ich will doch nur sagen, dass du vielleicht vorsichtig sein solltest, wenn du dort wohnst. Und wenn dir was komisch vorkommt, dann komm zurück zu mir. Die Couch steht dir jederzeit zur Verfügung.«
»Danke«, sage ich. »Ich bin dir echt dankbar für das Angebot. Wer weiß, vielleicht muss ich es ja in drei Monaten wieder annehmen. Aber verflucht oder nicht, in meiner Lage ist das Bartholomew der bestmögliche Ausweg.«
Nicht jedem streckt das Leben so die Hand hin. Definitiv nicht meinem Vater. Oder meiner Mutter.
Aber mir. Jetzt.
Vor mir ist ein Reset-Knopf, so groß wie ein ganzes Haus.
Ich werde ihn drücken, so fest ich kann.
JETZT
Mit einem Ruck erwache ich. Verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, und das macht mir Angst.
Ich hebe den Kopf. Ich liege in einem dunklen Zimmer, leicht erhellt durch den Spalt der offenstehenden Tür. Dahinter kann ich einen kahlen Flur erkennen und gedämpfte Stimmen und das leise Quietschen von Gummisohlen auf Fliesenboden hören.
Der Schmerz, der meine ganze linke Seite und den Kopf durchjagt hatte, ist nur noch ein schwaches Summen. Ich vermute, das habe ich Schmerzmitteln zu verdanken. Mein Hirn und Körper fühlen sich luftig an. Als wäre ich mit Watte ausgestopft.
Mit zunehmender Panik registriere ich, was sie mit mir gemacht haben, während ich bewusstlos war.
In meinem Handrücken steckt die Nadel einer Infusion.
Mein linkes Handgelenk ist verbunden.
Mein Hals geschient.
An der Schläfe habe ich ein dickes Pflaster. Neugierig, aber vorsichtig drücke ich darauf. Der Druck löst einen stechenden Schmerz aus, so stark, dass ich zusammenzucke.
Zu meinem Erstaunen kann ich mich mit Hilfe der Ellbogen aufsetzen. Bei der Bewegung tut meine linke Seite zwar ein bisschen weh, aber das ist es wert. Draußen vor der Tür geht gerade jemand vorbei und bemerkt mich.
»Sie ist wach.«
Das Licht wird eingeschaltet. Nun sehe ich weiße Wände, einen Stuhl in der Ecke, an einer Wand einen Monet-Druck in einem billigen schwarzen Rahmen.
Ein Pfleger kommt herein. Der, den ich schon kennengelernt habe, mit den freundlichen Augen. Bernard.
»Na, Schneewittchen?«, sagt er.
»Wie lange war ich weg?«
»Nur ein paar Stunden.«
Ich schaue mich im Zimmer um. Es gibt kein Fenster. Alles wirkt steril, so weiß, dass es in den Augen schmerzt. »Wo bin ich?«
»Im Krankenhaus. Immer noch.«
Erleichterung durchströmt mich. Eine abgrundtiefe Erleichterung, die mir die Tränen in die Augen treibt. Bernard zieht ein Taschentuch hervor und tupft mir die Wangen ab. »Nicht weinen«, sagt er. »So schlimm ist es doch nicht.«
Er hat recht. Es ist nicht schlimm. Im Gegenteil, es ist wundervoll.
Ich bin in Sicherheit.
Ich bin weit weg vom Bartholomew.
FÜNF TAGE ZUVOR
4.
Am Morgen drücke ich Chloe zum Abschied noch einmal ganz fest und nehme mir ein Uber nach Manhattan. Ein Luxus, weil ich all meine Besitztümer dabeihabe. Viel ist es nicht. Nachdem ich Andrew mit seiner »Bekannten« erwischt hatte, nahm ich mir genau eine Nacht lang Zeit, um auszuziehen. Ich bekam keinen Weinkrampf oder schrie die Nachbarschaft zusammen. Ich sagte nur: »Raus hier. Und komm erst morgen früh zurück. Dann bin ich weg.«
Andrew widersprach mit keiner Silbe. Schon das sagte mir alles. Nicht dass ich es noch gewollt hätte, trotzdem war ich überrascht, dass er nicht wenigstens versuchte, die Beziehung zu retten. Er ging einfach. Wohin, werde ich nie erfahren. Wahrscheinlich zu ihr. Um in Ruhe weitermachen zu können.
Als er weg war, packte ich methodisch meine Sachen, wählte genau aus, was ich unbedingt brauchte und was zurückbleiben konnte. Letzteres war eine ganze Menge, hauptsächlich Sachen, die wir uns gemeinsam gekauft hatten und um die zu streiten ich nicht die Energie hatte. So überließ ich ihm den Toaster, den IKEA-Couchtisch und den Fernseher.
Irgendwann im Laufe deser schrecklichen Nacht war ich nahe daran, den ganzen Krempel komplett wegzuwerfen. Nur um Andrew zu zeigen, dass ich auch fähig war, Dinge zu zerstören. Aber ich war so traurig und erschöpft, dass ich nicht die nötige Wut aufbrachte. Stattdessen begnügte ich mich damit, alle Spuren unseres gemeinsamen Lebens in einem großen Topf auf dem Herd zu sammeln. Die Fotos, die Geburtstagskarten, die kleinen Zettel mit Liebesbezeugungen, verfasst im Taumel der ersten Monate. Dann zündete ich ein Streichholz an, ließ es auf die Sachen fallen und sah zu, wie die Flammen aus dem Topf schlugen.
Bevor ich ging, kippte ich die Asche auf dem Küchenboden aus.
Auch die konnte Andrew gern behalten.
Doch als ich nun zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen meine Sachen packte, begann ich mir zu wünschen, ich hätte mehr als nur meine Kleider und Accessoires, Bücher und persönlichen Erinnerungsstücke mitgenommen. Ich war gelinde gesagt entsetzt, wie wenig ich besaß. Mein ganzes Leben passt nun in einen Koffer und vier kleine Kartons.
Als das Uber vor dem Bartholomew hält, stößt der Fahrer einen leisen Pfiff aus. »Arbeiten Sie da drin oder so?«
Im Prinzip lautet die Antwort Ja. Aber die inoffizielle Beschreibung meines Jobs klingt besser. »Ich wohne hier.«
Dann steige ich aus und schaue an der Fassade meines vorübergehenden Heims empor. Die Wasserspeier über dem Eingang starren zurück. Mit den ausgebreiteten Flügeln und in der sprungbereiten Haltung sehen sie aus, als wollten sie herunterhüpfen und mich begrüßen. Doch das übernimmt der Türsteher, der vor dem Eingang steht. Er ist groß, massig, hat rote Wangen und einen buschigen Schnurrbart und ist bei mir, kaum dass der Fahrer den Kofferraum geöffnet hat.
»Lassen Sie mich die hier nehmen«, sagt er und greift nach den Kartons. »Sie sind Miss Larsen, nehme ich an? Ich bin Charlie.«
Um mich wenigstens ein bisschen nützlich zu machen, schnappe ich mir meinen Koffer. Ich habe noch nie in einem Haus mit Türsteher gewohnt. »Freut mich, Charlie.«
»Ganz meinerseits. Willkommen im Bartholomew. Gehen Sie nur rein, Miss Evelyn erwartet Sie schon. Ich kümmere mich um Ihre Sachen.«
Ich kann mich nicht erinnern, wann mich das letzte Mal jemand erwartet hat. So fühle ich mich mehr als willkommen – ich fühle mich gebraucht.
Tatsächlich wartet Leslie in der Lobby. Wieder in einem Chanel-Kostüm. Diesmal gelb statt blau.
»Herzlich willkommen«, sagt sie fröhlich und bekräftigt ihre Begrüßung durch zwei Luftküsschen neben meine Wangen. Mit einem Blick auf den Koffer sagt sie: »Nimmt Charlie Ihre übrigen Sachen?«
»Ja.«
»Er ist ein echter Schatz, unser Charlie. Bei Weitem der effizienteste Türsteher, den wir haben. Aber alle sind auf ihre Art wunderbar. Wenn Sie Hilfe brauchen sollten, finden Sie einen von ihnen immer da draußen oder hier drin.« Sie deutet auf die Tür zu einem kleinen Raum neben der Lobby. Man sieht einen Schreibtisch mit Stuhl und eine Reihe bläulich leuchtender Schwarzweißbildschirme. Einer davon zeigt von schräg oben zwei Frauen, die auf dem Schachbrettboden der Lobby stehen. Erst auf den zweiten Blick erkenne ich, dass eine davon ich bin. Die andere ist Leslie. Ich blicke nach oben; da hängt die Kamera, gleich über der Eingangstür. Ich schaue wieder auf den Bildschirm – jetzt bin ich allein zu sehen. Leslie hat das Sichtfeld verlassen.
Ich schließe mich ihr an. Sie tritt zu einer Wand voller Briefkästen auf der gegenüberliegenden Seite der Lobby. Es sind zweiundvierzig, einer für jede Wohnung, angefangen mit 2A. Leslie hält einen winzigen Schlüssel an einem schlichten Ring mit dem Schildchen »12A« in die Höhe. »Hier, Ihr Briefkastenschlüssel.« Und lässt ihn in meine offene Handfläche fallen wie eine Großmutter ein Bonbon. »Sie müssen jeden Tag hineinschauen. Natürlich wird nicht viel Post kommen. Aber die Erben der Eigentümerin haben darum gebeten, dass man ihnen alles zusendet, egal was es ist. Es versteht sich von selbst, dass Sie nichts öffnen dürfen, und sollte es noch so eilig erscheinen. Für Ihre eigene Post würden wir Ihnen empfehlen, sich ein Postfach zu mieten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, sich etwas an diese Adresse schicken zu lassen.«
Ich nicke hastig. »Verstanden.«
»Nun, dann gehen wir jetzt in die Wohnung hinauf. Auf dem Weg erkläre ich Ihnen die restlichen Regeln.«
Sie macht sich auf den Weg zum Aufzug. Ich trotte mit meinem Koffer hinterher. »Regeln?«
»Nichts Schlimmes. Nur ein paar Richtlinien, an die Sie sich halten müssen.«
»Und die wären?«
Wir stehen vor dem Aufzug, der gerade in Gebrauch ist. Durch die vergoldeten Gitterstäbe sehe ich, wie die Kabel sich nach oben bewegen. Weit unter mir ertönt das Sirren von Maschinen, und von weit oben kommt summend die Kabine näher.
»Kein Besuch«, sagt Leslie. »Das ist die wichtigste Regel. Und damit meine ich: absolut keinen. Keine Freunde, denen Sie das Haus zeigen. Kein Übernachtungsbesuch von Bekannten oder Verwandten, denen Sie die Kosten für ein Hotelzimmer ersparen wollen. Und schon gar nicht von einem Unbekannten, den Sie möglicherweise in einer Bar oder auf Tinder kennengelernt haben. Das kann ich nicht genug betonen.«
Mein erster Gedanke gilt Chloe, der ich für den Abend eine Besichtigungstour versprochen habe. Das wird ihr nicht gefallen. Sie wird es als ein weiteres Zeichen deuten, als ein erneutes Schrillen der Alarmglocke. Wobei ich dieses hier auch ohne Chloe laut und deutlich vernehme. »Ist das nicht …« Ich halte inne, suche nach einem Wort, das nicht zu aufbegehrend klingt. »Ein bisschen streng?«
»Vielleicht. Aber unumgänglich. Hier wohnen einige recht bekannte Persönlichkeiten, die etwas dagegen haben, wenn sich Fremde in ihrem Haus herumtreiben.«
»Bin ich nicht im Grunde auch eine Fremde?«
»Sie sind eine Angestellte«, berichtigt Leslie. »Und die nächsten drei Monate lang eine Hausbewohnerin.«
Endlich kommt der Aufzug. Ihm entsteigt ein Mann Anfang zwanzig. Er ist klein, muskulös, mit breiter Brust und starken Armen. Sein Haar ist pechschwarz – sichtlich gefärbt – und fällt ihm übers rechte Auge. In den Ohrläppchen trägt er kleine schwarze Scheiben.
»Ah, was für ein Zufall«, sagt Leslie. »Jules, darf ich Ihnen Dylan vorstellen? Er ist auch ein Wohnungssitter.«
Das hatte ich schon geahnt. Das Danzig-T-Shirt und die ausgeleierte schwarze Jeans mit ausgefranstem Saum verraten deutlich, dass er genau wie ich eigentlich nicht hierher passt.
»Dylan, das ist Jules.«
Statt mir die Hand zu geben, steckt Dylan seine in die Taschen und brummt halblaut einen Gruß.
»Jules zieht heute ein«, sagt Leslie. »Sie hat gerade Bedenken geäußert, was einige unserer Regeln für vorübergehende Bewohner betrifft. Vielleicht könnten Sie ihr diese ein wenig nehmen?«
»Ist alles nicht so wild.« Seine Aussprache ist gefärbt. Die behäbigen Vokale und abgeschliffenen Konsonanten lassen die Brooklyner Herkunft erkennen. Vom ganz alten Schlag. »Mach dir keine Gedanken. Kommt man echt mit klar.«
»Sehen Sie? Sie können unbesorgt sein.«
»Ich muss los«, sagt Dylan, den Blick auf den Marmorboden zwischen seinen Turnschuhen gerichtet. »Freut mich, Jules. Wir sehen uns.«
Die Hände tief in den Taschen, eilt er mit gesenktem Kopf an uns vorbei. Ich sehe ihm nach. Als Charlie ihm die Tür aufhält, bleibt er kurz stehen, als bereite ihm der Gedanke, da hinauszugehen, Unbehagen. Schließlich tritt er auf den Bürgersteig, schreckhaft wie ein Hirsch, der im Begriff ist, eine belebte Straße zu überqueren.
»Ein netter junger Mann«, sagt Leslie, als wir im Aufzug stehen. »Sehr ruhig, genau wie man es hier schätzt.«
»Wie viele Wohnungssitter gibt es denn im Augenblick?«
Leslie zieht das Faltgitter vor. »Sie sind der dritte. Dylan und Ingrid wohnen beide einen Stock unter Ihnen.«
Sie drückt auf den obersten Knopf, und der Aufzug setzt sich knirschend in Bewegung. Während der Fahrt geht sie die übrigen Regeln mit mir durch. Ich darf kommen und gehen, wann ich will, muss aber jede Nacht in der Wohnung verbringen. Verständlich – dafür werde ich schließlich bezahlt. Um hier zu wohnen. Mich in der Wohnung aufzuhalten. Ihr Leben einzuhauchen, wie Leslie es in jenem surrealen Bewerbungsgespräch formulierte.
Rauchen ist verboten.
Nicht verwunderlich.
Drogenkonsum auch.
Auch klar.
Alkohol ist in Maßen erlaubt, was mich erleichtert, immerhin befinden sich in einem der Kartons zwei Flaschen Wein, das Abschiedsgeschenk von Chloe.
»Und Sie müssen stets alles in bester Ordnung halten«, fährt Leslie fort. »Wenn etwas kaputtgeht, rufen Sie sofort das Servicepersonal an. Im Grunde müssen Sie die Wohnung so hinterlassen, wie Sie sie vorgefunden haben.«
Außer dem Besuchsverbot klingt alles sehr vernünftig. Und selbst jenes ergibt Sinn, wenn man den Grund kennt. Ich neige dazu, Dylan recht zu geben: alles halb so wild.
Doch dann schiebt Leslie noch eine Regel nach, ganz beiläufig, als wäre sie ihr eben erst in den Sinn gekommen. »Oh, noch etwas. Wie ich schon sagte, sind die Bewohner hier sehr auf Privatsphäre bedacht. Und da manche von ihnen Personen von öffentlichem Interesse sind, müssen wir darauf bestehen, dass Sie sie nicht belästigen. Sprechen Sie niemanden an, außer Sie werden selbst angesprochen. Und besprechen Sie nichts, was Sie hier sehen und hören, mit Außenstehenden. Nutzen Sie soziale Medien?«