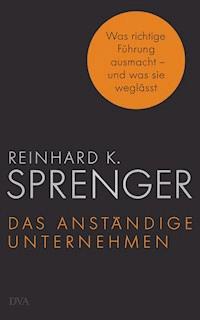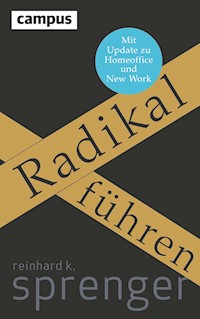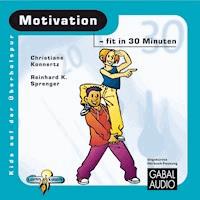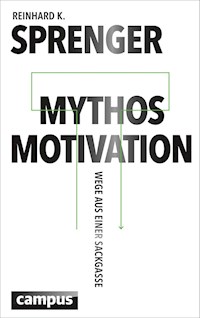Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Führungsexperte Reinhard K. Sprenger hat mit seinen Bestsellern Mythos Motivation, Das Prinzip Selbstverantwortung und Aufstand des Individuums die Führungsetagen der Unternehmen aufgerüttelt. In seinem neuen Buch dringt er nun bis auf den Grund vor: Worauf muss Führung basieren? Was macht Führung und damit ein Unternehmen wirklich erfolgreich?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.campus.de
Sprenger, Reinhard K.
Vertrauen führt
Worauf es im Unternehmen wirklich ankommt
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 2007. Campus Verlag GmbH
Besuchen Sie uns im Internet: www.campus.de
E-Book ISBN: 978-3-593-40402-8
|7|EINLEITUNG
»Ich lege jetzt meine Waffe weg. Dann können wir miteinander reden.«
Derrick
Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern? Vertrauen Ihre Mitarbeiter Ihnen? Woher wissen Sie das? (Sie sehen, mein Vertrauen ist begrenzt...) Und vertrauen Sie Ihrem Chef? In welcher Hinsicht? Was haben Sie gemeint, als Sie bei der letzten Vorgesetztenbeurteilung die Frage: »Erleben Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Chef als vertrauensvoll?« mit »Ja« beantworteten? Dass er sie informiert? Dass er Ihnen nicht ständig über die Schulter schaut? Dass er Sie nicht feuert? Alles zugleich?
In diesem Buch setze ich mich ein für Vertrauen. Für mehr Vertrauen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, zwischen Kollegen und Partnern. Ich werbe dafür, dem Vertrauen zu vertrauen und dem Misstrauen zu misstrauen. Dabei sehe ich die Schwierigkeiten, die dem Thema innewohnen, aber ich sehe auch, dass die Vorteile einer Kultur des Vertrauens die Nachteile überwiegen. Vertrauen ist sicherer als jede Sicherungsmaßnahme. Vertrauen kontrolliert effektiver als jedes Kontrollsystem. Vertrauen schafft mehr Werte als jedes wertsteigernde Managementkonzept.
Bevor ich aber mit der Werbung beginne, will ich kurz die Vorgeschichte dieses Buches erzählen: Es bildet in gewisser Weise den Schlusspunkt eines Denk- und Schreibweges.
Einige von Ihnen werden sich erinnern: In Mythos Motivation (1991) beschrieb ich die Mechanik der Bonussysteme, Incentives und Prämien als institutionalisiertes Misstrauen. »Ich glaube nicht an deine Leistungsbereitschaft!«, »Du bist kein vereinbarungsfähiger Partner!« – das sind die Botschaften, die die Motivierung den Menschen |8|entgegenschleudert, wie sehr sich diese Irrlehre auch kostümieren mag. Deshalb scheitern so viele Managementsysteme: Weil sie das »Ich vertraue dir nicht!« immer mitkommunizieren. Ich empfahl, sich mehr um die demotivierenden Einflüsse zu kümmern – und sich als Führungskraft davon nicht auszunehmen.
Das Prinzip Selbstverantwortung (1995) legte eine weitere »konstruktive« Alternative vor. Der Mitarbeiter selbst, die Qualität seines Bewusstseins, mit dem er morgens zur Arbeit geht, Selbstmotivation und Commitment – das stand hier im Fokus. Was braucht es tatsächlich, um engagiert und eigeninitiativ zu arbeiten? Ich entwickelte die Selbststeuerung als innere Einstellung, die dauerhaft hohe Leistung ermöglicht. Das Schlusskapitel dieses Buches beschrieb mit einem Entwurf der »Glaubwürdigkeit« schon einen Aspekt von Vertrauen, ohne das Thema zentral anzusprechen.
Dann kam Aufstand des Individuums (2000). Hier habe ich die groben strukturellen Missstände in den Unternehmen aufgedeckt, die die Erfolgsfaktoren der Zukunft – Commitment, Innovation und Unternehmergeist – verhindern. Der zweite Teil des Buches legte unter der Überschrift »Das individualisierende Unternehmen« eine Führungslehre vor, in der ich Vertrauen als Basis funktionierender Zusammenarbeit immer wieder habe anklingen lassen, es aber als Gegenstand selbst nie ausdrücklich untersuchte.
Nach Erscheinen dieses Buches ließ mich das Thema Vertrauen nicht mehr los. Ich hatte das Gefühl – etwas Entscheidendes war noch nicht gesagt, Neuland wartet auf mich. Das mag Sie irritieren, schließlich geistert das Wort »Vertrauen« schon lange durch die Managerwelt. In der Tat: Ich kenne keinen Unternehmensführer, der Vertrauen nicht für das Wichtigste bei der Mitarbeiterführung hält. Ich kenne keinen Vortragsredner, der Vertrauen nicht als den Schlüssel zu einer wertorientierten Unternehmenskultur predigt. Ich kenne kein ernst zu nehmendes Managementbuch, das durch Vertrauen nicht alle möglichen positiven ökonomischen Effekte erklärt. Aber ich habe bisher noch niemanden getroffen, der mir erklärte, was Vertrauen ist.
|9|Alan Fox war es, der 1974 die »High-Trust-Culture« als Wettbewerbsvorteil ausgerufen hat. Wenig ist seither geschehen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Fox Vertrauen zwar als Erklärung für kooperatives Verhalten beschreibt, jedoch nicht als selbst zu erklärendes Phänomen. Es wird als Explanans benutzt (als Gegenstand, der als Erklärung dient), nicht aber als Explanandum (als Gegenstand, der erklärt werden soll). Und die Beiden haben etwa so viel gemeinsam wie Pik-Ass und Aspik.
In der gelebten Unternehmenspraxis bleibt der Begriff des Vertrauens ein Schwallwort, das den Gegenüber, der offenbar nicht vertraut, in die Büßerecke drängt, – eitel, selbstgefällig und nach Applaus heischend. Es wird vor allem immer dann in die Runde geworfen, wenn irgend etwas Wichtiges im Unternehmen nicht funktioniert. Vor allem von Topmanagern, von »oben« also – forderndappellativ zumeist, man möge doch und solle doch, und wenn wir nicht, dann ...
Darüber hinaus hat sich nur die aufschiessende Idyllenliteratur mit Vertrauen befasst. Überall begegnen wir einer Vertrauens-Prosa, die im traditionellen Sinn gar nicht mehr gehört, gelesen und ernst genommen werden kann, sondern die uns wie eine Abgaswolke umgibt. Diese Prosa will keine Zustimmung erreichen durch ein Argument. Sie setzt sie vielmehr voraus durch die Konsensformel Vertrauen. Alle Sehnsüchte und Hoffnungen schütte man hinein in diesen sprachlichen Passepartout! Mund auf und schlucken! Wir haben verstanden und nur Spielverderber werden es da genauer nehmen wollen. Die optimistischen Appelle und Beschreibungen sind nicht falsch, aber bedeutungslos. Vor allem die amerikanischen Beiträge, die »Trust« im Titel führen, kommen über moralisierendes Geraune, Forderung nach Transparenz und hilfloses »Schön wärs ja« selten hinaus. Das ist viel anglisierte heiße Luft, die einem zwischen den Buchdeckeln entgegenweht.
Was also ist Vertrauen? Ist es ein Gefühl? Eine moralische Haltung? Eine Schrulle aus der guten alten Zeit? Ein Modewort der Unternehmensphraseologie? Rundum-Problemlösungsklischee? Ein rhetorischer |10|Trick, mit dem die Bemäntelungsgenies ihre Machttaktik umwölken? Ein Heilswort, um nicht unter die Räder zu kommen? Ein Textbaustein motivierenden Gequatsches, das unser Arbeitsleben begleitet wie die Fliege die trottende Kuh?
Auch die akademischen Disziplinen bieten uns keine breite Schulter, an die wir uns lehnen könnten. Nicht einmal auf eine gemeinsame Definition von Vertrauen hat man sich bisher geeinigt. Dennoch haben mich fremde Sätze und Texte bis zuletzt begleitet, über die das Literaturverzeichnis Rechenschaft ablegt. Ohne Tanja Rippergers vorzügliche Dissertation hätte ich dieses Buch so nicht schreiben können. Auch der von Martin Hartmann und Claus Offe herausgegebene Sammelband sowie Niklas Luhmanns lange Zeit einsam dastehende Monographie haben unverkennbar Spuren hinterlassen.
Zu beobachten ist eine riesige Differenz zwischen Vertrauensbedarf und -rhetorik einerseits und dem tatsächlichen Handeln andererseits. Es gibt aber nur einen einzigen Weg, etwas zu wissen, dessen man gewiss ist: seine Überzeugung in eine Tat umzusetzen. Genau das passiert nicht. Weil Vertrauen – wie so vieles im Management – nur Lippenbekenntnis ist? Oder liegt es an den innewohnenden Schwierigkeiten? Kann man da vielleicht gar nichts tun? Ist Vertrauen ein unzugängliches Juwel aus den Schatzkammern von Gottes uneingelösten Utopien?
Sollten Sie zu den Managern alter Schule gehören, dann werden Sie vielleicht antworten: »Vertrauen? Das ist doch weicher Quark mit Konsenssoße. Fakten und Daten, die brauche ich. Kommen Sie mir nicht mit diesem Bauchgefühl. Das bringt doch nichts.« Vertrauen steht in der Tat da wie eine Kapelle zwischen Wolkenkratzern. Was ihm auf fatale Weise fehlt, ist Rationalität. Es trägt zwar Obertöne von Heimat, Nähe und guter Zusammenarbeit, es verspricht auch Aufgehobensein, etwas jenseits des Gegenwärtigen, – aber keinen wirtschaftlichen Nutzen. Es scheint sogar eine Absage an die Vernunft zu sein. Zu treuherzig, zu mysteriös, zu nostalgisch.
Was aber, wenn sich herausstellte, dass einige betriebswirtschaftlich höchst relevante Güter sich nur über Vertrauen erschließen lassen|11|? Und dass von einigen dieser Güter das wirtschaftliche Überleben in der Zukunft abhängt? Was, wenn Vertrauen als »harter« Faktor nachgewiesen werden könnte, als einer, der »sich rechnet«? Sicherlich kein Buchungsinhalt, keine Finanzkennzahl –, aber eine Querschnittsfunktion im Unternehmen und damit ein operativer Ergebnistreiber? Wäre es nicht unintelligent, es einfach zu ignorieren?
Vertrauen ist deshalb so spannend, weil es mit vielen Themen des Wirtschaftslebens verknüpft ist: Vereinbarung, Wechselseitigkeit, Zusammenarbeit, Verträge, Führung, Economy of Speed, Innovation, Zuverlässigkeit, Commitment. Und es ist neben »Macht« und »Geld« eines der drei großen Steuerungsformen im Unternehmen. Genau hier setzen aber meine Überlegungen an. Lebensweltlich fängt Vertrauen da an, wo seine Ersetzbarkeit aufhört. Schauen wir also genau hin: Macht und Geld funktionieren – für jedermann wahrnehmbar – nicht mehr so, wie sie es über Jahrzehnte taten. Der wirtschaftliche Rahmen hat sich geändert. Die wirtschaftlichen Strukturveränderungen haben Macht und Geld als Steuerungsmechanismen flexibler, dezentral strukturierter Organisationen entwertet. Sie waren ohnehin nur Ergebnis enttäuschten Vertrauens. Erst, als wir betrogen wurden, haben wir nach ihnen gegriffen.
Zunächst will ich deshalb erläutern, warum Vertrauen das Thema der Zukunft ist. Globalisierte, schnelle Märkte, flexible Arbeitsstrukturen und virtuelle Organisationsformen – so sieht in etwa das wirtschaftliche Szenario der Zukunft aus. Für viele Unternehmen ist es schon Realität. Der Bedarf an Vertrauen ist dadurch dramatisch gestiegen. Andererseits wird durch genau diese Bedingungen das Vertrauen im Wirtschaftsleben massiv bedroht. Eine »alte« und weit verbreitete Konzeption von Vertrauen, die auf die Dauerhaftigkeit der Lebensumstände baut, muss jedenfalls durch die Verhältnisse modernen Wirtschaftens zwangsläufig frustriert werden. Wir erleben somit gegenwärtig eine Scherenentwicklung, deren Konsequenzen wir nicht einmal begonnen haben zu verstehen. »Die Gesellschaft der Zukunft ist zum Vertrauen verurteilt«, schreibt der Philosoph Peter Sloterdijk.
Etwas kommt hinzu: Die wichtigste Unterscheidung modernen |12|Wirtschaftens ist nicht mehr die zwischen Arbeit und Kapital, auch nicht die zwischen Unternehmer und Konsument, schon gar nicht die zwischen Staat und Markt – das alles ist 19. Jahrhundert. Nein, die wichtigste Unterscheidung ist jene zwischen Gläubigern und Schuldnern: was ein Gläubiger einem Schuldner glaubt, und was dieser Glauben kostet. »Bin ich bereit, mich zu verschulden, weil ich meiner Leistungskraft vertraue?« – so fragt der Nehmer. »Habe ich Vertrauen, dass das Geld zurückfließt?« – das fragt der Geber. Damit tritt Vertrauen in das Kerngeschehen der modernen Ökonomie. Es bedarf jedenfalls keiner großen prognostischen Fähigkeit, dieses festzustellen: Vertrauen wird das beherrschende Managementthema der nächsten Jahrzehnte. Ich werde daher mit Verve die These vertreten, dass es für wirtschaftlichen Erfolg nur einen einzigen Erklärungsansatz gibt: das Maß gelebten Vertrauens.
Erst nach dieser Bestandsaufnahme werde ich mich dem Begriff des Vertrauens selbst zuwenden: Was ist Vertrauen? Was verbirgt sich hinter dem Phänomen? Ist Vertrauen etwas Irrationales, etwas grundsätzlich Gutes? Ist es ein moralischer Begriff oder, vielleicht besser, ein Begriff, der bei vielen von Ihnen eine moralische Resonanz auslöst? Hier betreten wir ein Minenfeld von Halbwahrheiten, Missverständnissen und Denksackgassen. Es zu räumen, werde ich mich bemühen.
Dieses zweite Kapitel wendet sich vor allem an jene unter Ihnen, die sich nicht nur aus alltagspraktischem Interesse heraus mit Vertrauen befassen, sondern auch Kraft und Grenzen des Begriffs verstehen möchten. Die »Praktiker« unter Ihnen können ihn getrost überspringen; die »Theoretiker« mögen mir die Knappheit nachsehen.
Der dritte Abschnitt ist der Praxis des Vertrauens gewidmet. Wie funktioniert der Vertrauensmechanismus? Was können Sie als Führungskraft tun, um Vertrauen zu schaffen? Welche institutionellen Rahmenbedingungen fördern die Entwicklung von Vertrauen? Welche verhindern sie? Im Gegensatz zur verbreiteten Meinung werde ich nachweisen, dass Vertrauen nicht nur indirekt und langsam aufzubauen ist – gleichsam als unbeabsichtigtes Nebenprodukt –, sondern |13|dass es einen direkten Weg gibt, einen – wenn Sie so wollen – »schnellen« Weg zum Sofortvertrauen.
Der Titel Vertrauen führt spielt daher mit der Dreifaltigkeit des Verbs: Erstens ist Vertrauen das Erste (und in gewisser Weise auch das Einzige), worauf es im Unternehmen ankommt; zweitens ist es die Basis der Mitarbeiterführung und führt – drittens – zu Werten, die ohne Vertrauen ungehoben bleiben.
Sie mögen erkennen: Meine Fragen kreisen um Vertrauen als instrumentellen Wert. Ich zweifele nicht, dass Vertrauen um seiner selbst willen wertvoll ist. Mir geht es aber hier vor allem darum, Vertrauen aus der romantischen Ecke zu holen und in den Mittelpunkt einer rationalen Unternehmenspolitik zu stellen, die möglichst viele Menschen überzeugt. Ich plädiere für ein Vertrauen, das berechenbar ist, das berechnet und sich rechnet. Ein Vertrauen, das »sich lohnt«, das kalkuliert ..., und spätestens jetzt hat sich das Thema für einige von Ihnen schon erledigt. Ein Gutmeinender springt auf und ruft: »Kalkuliertes Vertrauen? Vertrauens-Engineering wohlmöglich? Wie soll das gehen? Vertrauen gedeiht doch nicht im Kühlhaus ökonomischer Nutzenoptimierung! Wie kann man Vertrauen dingfest machen, ohne es sogleich zum Verschwinden zu bringen? Und überhaupt: Vertrauen klingt vielleicht warm und nett, aber auch harmlos und naiv. Es ist schön, ein vertrauenswürdiger Mensch zu sein, aber risikoreich. Als Lebenskonzept führt es ins Leichenschauhaus. Einigen Menschen vertraut man mehr, einigen weniger. Warum, ist nicht so wichtig. Vertrauen ist halt da oder nicht. Mehr ist eigentlich nicht zu sagen, oder?«
Das mag sein, aber ich will Vertrauen hier »vernünftig« begründen. Vor allem will ich den ökonomischen Mechanismus hinter der Begriffsfassade klären. Das ist kein leichtes Vorhaben. Das Thema steckt voller Paradoxien und Mehrdeutigkeiten. Es gibt hier keine leichten Antworten, keine How-To-Checklisten – wenn man es wirklich ernst meint. Aber hätte der Begriff sich nicht verborgen, ich hätte nicht so ausgespäht, ihn zu ergründen. Überdies – das zur Warnung! – ist Vertrauen ein »ernstes« Thema. Das amüsierte Schmunzeln über |14|die Narreteien der betriebsinternen Realsatire scheint mir hier unangebracht. Widerstanden habe ich daher der Versuchung provokativer Rücksichtslosigkeit.
Im ersten Teil lässt meine Darstellung manches klarer und einfacher erscheinen, als es bei näherer Betrachtung ist. Das verdankt sich methodischen Gründen: Wenn ich Vertrauen dem Misstrauen gegenüber stelle, so zeichne ich die Umrisse des Begriffs in einem Gegenlicht, das die Konturen kenntlich macht. Ins Extreme verschoben wird jedes Argument und jede Haltung gefährlich. Das gilt vielleicht besonders für das Thema »Vertrauen«. Das richtige Maß ist gefragt. Allein darum geht es mir.
Viele von Ihnen werden die Lektüre des Buches mit der immer wieder aufflackernden Frage »Ja, aber wenn ...« begleiten (ich habe das innerlich auch getan). Sie werden oft »Heimkino gucken« und Ihre privaten Fragen und Erfahrungen gegenlagern. Ich kann Sie nur bitten, an meiner Seite zu bleiben. Vor allem, wenn Sie Führungskraft sind. Denn für Sie habe ich dieses Buch vorrangig geschrieben. Am Ende liegt es an Ihnen, ob Sie die alles entscheidende Fähigkeit besitzen – sich dem Unvertrauten zu stellen.
|15|WARUM VERTRAUEN?
Eine Lounge des Wiener Flughafens. Ich warte auf den Rückflug nach Düsseldorf. Draußen dunkelt es schon. Durch die großflächigen Fensterscheiben senkt sich diese eigenartige solidarische Tagesendstimmung in den neonerleuchteten Raum. Ein Mann sitzt mir gegenüber. Etwa gegen 19.00 Uhr beginnt er zu telefonieren. Die Gespräche nehmen alle einen ähnlichen Verlauf. Es sind diese üblichen »Status-Telefonate«. Wie sieht es bei diesem Kunden aus? Wie bei jenem? Was ist mit diesem Projekt? Warum hat XY noch nicht geantwortet? Was steht morgen an? Nachdem er die Telefonliste abgearbeitet hat, kommen wir ins Gespräch. Ich äußere meine Verwunderung, dass er noch so spät beruflich telefoniere. Das sei eher früh, antwortet er, manchmal würde es noch später. Er habe es sich zur Gewohnheit gemacht, jeden Abend – »nur ganz kurz« – mit seinen Mitarbeitern zu sprechen, um zu sehen, wie die verschiedenen Projekte liefen. Er wolle einfach sicher gehen, dass alles in Ordnung sei, insbesondere bei jenen, die an schwierigen Aufgaben »dran« seien.
Ich war zunächst beeindruckt von seiner Hingabe an den Job und der Loyalität gegenüber seiner Firma. Auch nach einem langen und harten Arbeitstag suchte er noch den Kontakt mit seinen Mitarbeitern. Und die waren offensichtlich auch noch bereit, abends um 19.00 Uhr mit ihrem Chef zu sprechen. Donnerwetter! Aber dann kamen mir Zweifel. Konnte es sein, dass er nur deshalb telefonierte, weil er kein Vertrauen in seine Mitarbeiter hatte? Konnte es sein, dass er sein Misstrauen bis in die Wohnstuben seiner Mitarbeiter trug, |16|weil er ihnen nicht zutraute, ihn anzurufen, wenn sie einen Gesprächspartner suchten?
... weil es fehlt: eine Bestandsaufnahme
Der Vorstandsvorsitzende, dessen Unternehmen als eines von fünf Leitwerten »Vertrauen« öffentlich ausgewiesen hat, nimmt den Moderator entschlossen in den Blick: »Wir müssen dringend mehr zum Thema ›Vertrauen‹ tun. Da hapert es an allen Ecken und Enden.« Zustimmendes Nicken im Kreis der anderen Vorstandskollegen. Der Moderator wartet einen Moment. Dann fragt er: »Und Sie? Vertrauen Sie einander?«
Auf dem 55. Deutschen Betriebswirtschaftertag im September 2001 in Berlin war man sich einig: Langfristig seien in erster Linie immaterielle Vermögensgegenstände geeignet, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Zu diesen »intangibles« zählen Wissen, vernetzte Talente, die Marke und – quer zu den Dreien – Vertrauen. Nie sei Vertrauen so wertvoll gewesen wie heute.
Vertrauen steht generell hoch im Kurs. Die Finanzmärkte fordern es, denn Vertrauen in die Unternehmensführung spiegelt sich wider im Aktienkurs. Die Zeitungen titeln »Jetzt hilft nur noch Vertrauen« und meinen die Zuversicht in die wirtschaftliche Entwicklung. »Können wir Politikern trauen?« fragt eine Fachzeitschrift. »Welcher Politiker ›flösst‹ mehr Vertrauen ein?«, wollen Meinungsforscher wissen.
Überall wird Vertrauen beschworen, gewünscht, gefordert. Warum?
Weil es fehlt. Von Vertrauen wird geredet, wenn es vermisst wird. Seine Erscheinungsweise ist die Nichtexistenz. Man übertreibt nicht, wenn man feststellt: Je mehr über Vertrauen gesprochen wird, desto schlechter ist die Lage. Das Auftauchen von Vertrauen ist ein untrügliches Zeichen der Krise.
|17|So hat es auch etwas Schiefes, wenn ein Vorstand bei seinen Mitarbeitern um Vertrauen wirbt: »... und deshalb bitte ich Sie gerade in diesen schwierigen Zeiten um Ihr Vertrauen.« Oder eine deutsche Großbank ihre Anzeigen mit dem bewegenden Slogan schmückt: »Vertrauen ist der Anfang von allem.« Es hat überhaupt etwas Fragwürdiges, über Vertrauen zu reden. Offenbar kann es nur als Verlorenes erlebt werden. Irgendetwas scheint schon zerrissen zu sein. Deshalb können wir auch leichter ausdrücken, warum wir jemandem misstrauen, als sagen, warum wir jemandem vertrauen.
Im Unternehmen ist Vertrauen angeblich das Wichtigste für die Zusammenarbeit. Gleichzeitig ist es oft das Seltenste. Führungskräfte antworten gern, befragt nach ihren besten Führungseigenschaften: »Ich vertraue meinen Mitarbeitern.« Gleichzeitig wünschen sie sich ihrerseits mehr Vertrauen »von oben«. Eine Hierarchiestufe höher das gleiche Spiel: Wieder glaubt man an die eigene Vertrauensfähigkeit und beklagt seinerseits einen Mangel an Vertrauen »von oben«. Was ist da los? Gibt es lediglich eine Differenz in der Wahrnehmung? Die Antwort dämmert, wenn man Führungskräfte nach ihren Führungsdefiziten befragt. Häufig wird der eigene »Hang zur Perfektion« genannt. Mit leichtem Lächeln wird die Neigung zugegeben, sich gerne einzumischen und auch schon mal zum Instrument der »Chefsache« zu greifen. Der Auftrag ist tief verinnerlicht: »Du musst sie immer im Auge behalten!« Und der Blick des Chefs liegt auf dem Mitarbeiter und fragt unablässig: »Wird dieser seine Rolle erfüllen? Ist er der Aufgabe gewachsen? Ist er erfahren genug, das Notwendige zu tun?« Eine Stufe weiter unten wird dieses kontrollierende Verhalten als Misstrauen erlebt. Der Wunsch nach mehr Vertrauen ist geboren.
Zwar war arbeitsteiliges Handeln schon immer ohne ein gewisses Maß an Vertrauen in die Kontinuität des Handelns anderer, ihre Berechenbarkeit, Ehrlichkeit und Kooperationsbereitschaft nicht vorstellbar. Auch die alte Idee des Delegierens lebt letztlich davon, dass der Chef dem Mitarbeiter zutraut, die Aufgabe auszuführen. Aber dieses Vertrauen in die Kompetenz des Mitarbeiters reicht scheinbar |18|nicht weiter als der Radius des jederzeit kontrollierenden Blicks. Das zeigt sich, wenn man die Kontrollwut gegenüber dem Außendienst betrachtet. Durch neue Informationstechnologien wurden hier immer neue Kontrollmechanismen über große Entfernungen hinweg eingeführt – auch wenn sich alsbald herausstellte, dass dadurch auch nicht wirklich effizient kontrolliert werden konnte. Heute hätten wir eigentlich alle technischen Möglichkeiten, um entspannt dort zu arbeiten, wo wir gerade sind. Flexibel, vernetzt, unterstützend, alle Kompetenzen integrierend – auch bei leichtem Schnupfen oder schwerer Schwangerschaft. Aber das, was heute auf neudeutsch »Remote Management« genannt wird, also ein System für informationstechnologische Fernsteuerung, das stößt auf den Widerstand der meisten Unternehmen mit ihrer modern verkleideten, frühindustriellen Arbeitsorganisation: Präsenzpflicht, Kontrollsysteme, Meetingrituale. Da wird das »Remote Management« zynisch zur »Kontrolle aus dem Hinterhalt« (H. Rust). Das Kernproblem auch hier: Misstrauen.
So proaktiv und entscheidungsfreudig die Unterhaltungen in den Fluren der Unternehmen sind – ein bisschen klingen sie zugleich behindert, ein Unterton des Zögerlichen fehlt nicht, die Ansichten, die geäußert werden, klingen ein wenig wie auswendig gelernte Examensantworten – »Synergien«, jaja, und »Lernende Organisation« sowieso. Ohne große Mühe kann man in den Unternehmen ganze Misstrauensabteilungen identifizieren, die ihre Zeit damit verbringen, Leute zu überwachen und zu überprüfen, ob sie auch tun, was sie tun sollen. Facharbeiter für falschen Alarm, die ihre Opfer mit Formularen und Regularien unter neurotischen Dauerstress setzen. Mitarbeiter sind offenbar eine feindliche Spezies, die es zu beargwöhnen, zu kontrollieren und in ihrer Vielfalt einzuebnen gilt.
Wichtig ist: Misstrauen beherrscht das Verhältnis sowohl der Führenden zu den Geführten wie umgekehrt. Das Management traut den Mitarbeitern nicht zu, Entscheidungen zu treffen, die sich am Wohl des Unternehmens orientieren. Umgekehrt trifft das, was das Management tut, auf zynisch getöntes Misstrauen, weil ihm die Kompetenz und die Verantwortung für langfristig tragfähige Problemlösungen |19|nicht zugetraut wird. Beargwöhnt wird: dass Führungskräfte sich nicht an Vereinbarungen halten, als Selbstoptimierer weniger die Interessen des Unternehmens als ihre eigenen im Auge haben, generell unglaubwürdig sind. Oder, anders herum: dass Mitarbeiter ihren Job grundsätzlich nicht gerne tun, nicht motiviert sind, sondern angestachelt werden müssen, damit sie ihn überhaupt tun. Oder, noch grundsätzlicher: dass man der freigelassenen Menschennatur schlicht nicht trauen dürfe. Hinzu kommt das horizontale Misstrauen, das ja unter Wettbewerbsbedingungen nicht unverständlich ist. Kollegen werden dann zu Gegnern. Und all das, was von der Kooperationsbereitschaft der Mitarbeiter untereinander abhängt, findet nicht statt.
Ornamente des Misstrauens: die Anonymität der Befragungen. Die Geheimnistuerei um die Gehälter. Die Springfluten der »Vermerke«, der »Aktennotizen«, des »Können Sie mir das schriftlich geben?«. Die institutionalisierte Rückdelegation im Kreditwesen. Die bornierte Hypertrophie des Messens: »Was man nicht messen kann, kann man nicht managen.« Der Johnny-Kontrolletti-Chef mit seinem »Setzen Sie mich bei E-Mails bitte immer ins ›cc:‹!«. Der Absicherungsaufwand vor Entscheidungen. Wenn alle auf »Nummer Sicher« gehen (eine Redensart, die aus dem Strafvollzug stammt). Die immer größer werdenden Meetings. Die sich verstärkenden Leistungskontrollen. Die zum »Zeiterfassungscomputer« avancierte Stempeluhr, die dem Mitarbeiter schon am Eingang »Ich trau’ Dir nicht!« entgegenbellt – aber von den besseren Menschen (ATs) mit stolzen Blicken links liegen gelassen wird. Der Drang zur totalen Kommunikationskontrolle. Chefs verordnen ihren Mitarbeitern, » sich in der Öffentlichkeit nur positiv über das Unternehmen zu äußern.« Sie entwerfen Funktionsdiagramme, die detailgenau bestimmen, wer nach außen über was sprechen darf. Sie zwingen ihre Mitarbeiter, sich am Telefon mit den immer gleichen Worten zu melden, die immer gleichen Inhalte auf die immer gleiche Weise zu präsentieren. Oder die Sekretärin, der auch nach wiederholtem Bemühen von der Zentralstelle verweigert wird, einen Generalschlüssel für die Kaffeemaschine zu benutzen. So muss sie, anstatt mittels des Schlüssels ganze Kannen |20|füllen zu können, für 120 Tassen 120-mal auf den Knopf drücken. Von da ist es im Zeitalter der Gentechnologie nicht weit zur Implantation eines Kontrollchips.
Groteske Dimensionen: Der Journalist Eike Gebhardt erzählte mir, dass die von ihm verauslagten 2000 Euro für einen Gabelflug Stuttgart-Düsseldorf-Kairo vier Monate von seiner Rundfunkanstalt nicht überwiesen wurden, weil man nachprüfen wollte, ob die bei Auslandseinsätzen üblichen 7 Euro »Tagesgeld« bei einem solchen Flug (über Düsseldorf) von ihm berechtigterweise in Anspruch genommen worden waren.
Misstrauen fatalerweise auch schon am Beginn der Zusammenarbeit, beim Einstellungsinterview: »In möglichst kurzer Zeit viel aus dem Bewerber herauskriegen« – das ist die Haltung, mit der viele Interviewer die Gespräche führen. »In möglichst kurzer Zeit« – das signalisiert: »Du bist nicht wichtig.« »Viel aus dem Bewerber herauskriegen« – das geht davon aus, das der Bewerber etwas verbirgt, sich besser darstellt, als er ist. Wechselseitig belauert man sich, vermutet hinter jeder Frage die Tücke, hinter jeder Antwort das nur Vorgegaukelte, schürft nach etwas Widerständigem »dahinter«, unterstellt Schönfärberei – hier der eigenen Fähigkeiten, dort des Unternehmens. Einstellungsinterviews sind nicht selten Misstrauensexzesse.
Für viele kristallisiert sich das Thema aber im Umgang mit der Arbeitszeit heraus – die öffentliche Diskussion spricht von »Vertrauensarbeitszeit«. Schon diese Wortkombination spricht Bände: Sie plakatiert den generösen Ausnahmecharakter der Regelung. Gibt es denn auch »Misstrauensarbeitszeit«? Schon 1972 wurde bei Hewlett-Packard die Zeiterfassung abgeschafft, was, wie der damalige CEO Lewis Platt bemerkte, »einen starken Glauben an die Mitarbeiter« voraussetzte. Herrn Platts Motiv in Ehren: War es doch nicht eher ein Kostenkalkül? Jeder kennt die Manipulierbarkeit der Zeiterfassungssysteme. Und ist ein rein quantitativer, zeitorientierter Arbeitsbegriff überhaupt noch »zeit«-gemäß? Sollten wir uns nicht eher am Output orientieren, weniger am Input? Mittlerweile haben etliche Unternehmen versucht, Vertrauensarbeitzeit einzuführen. Es scheitert jedoch |21|oft am wechselseitigen Misstrauen: »Oben« fürchtet bei Aufgabe der Zeiterfassung steigende Kosten: »Die, die arbeiten, sind immer die Gleichen; die, die in der Sonne liegen, auch.« »Unten« fürchtet, bei Überlastungssituationen unfair behandelt, ja ausgebeutet zu werden, wenn sie ihren Chefs nicht schwarz auf weiß den Anwesenheitszettel unter die Nase halten können. Nichts bewegt sich. Misstrauen ist das Gift, das alle lähmt.
Da ist der Vorstand, der die Aushilfe seines Bereichsleiters genehmigen muss. Da sind die Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes, die per Videokamera kontrolliert werden, um die Schwundrate bei Metallteilen zu minimieren. Da ist die überbordende Audit-Mania – ein überhöhtes Bedürfnis nach unabhängiger Kontrolle. Da ist der neue Arbeitsdirektor, ein frischer, dialogfreudiger Mensch – zu dialogfreudig für manche Personaler. Sie versenden eine streng vertrauliche E-Mail: »Wir, die Leiter HR Europa, haben beschlossen, dass die Kommunikation mit dem neuen Arbeitsdirektor nur über uns läuft. Direkte Kontakte sind zu unterlassen.«
Nicht wenige Führungskräfte sind geradezu von der Vorstellung besessen, ihre Mitarbeiter wollten sie nur betrügen. Sie installieren ein Fluchtverhinderungssystem nach dem anderen. Und täglich kann man eine Verschärfung des kontrollierenden Umgangs erleben. Reportingwellen ohne Maß und Begrenzung: »Monday update« zum Beispiel. Montag soll man seine Projekte in das Intranet stellen, damit die Zentralinstanz »einen Überblick hat«. Dadurch werden natürlich auch kleinere Arbeiten, die man früher nebenbei erledigte, zu veritablen Projekten aufgeschäumt. Der heutige Softwarunternehmer und ehemalige IBM-Manager Dan Cerutti stellt rückblickend fest: »Ich hatte es mit Managern zu tun, die jedem Mitarbeiter grundsätzlich unterstellten, er wolle nicht arbeiten. Dieses Misstrauen äußerte sich in allem, was sie taten.«
So ist es wohl: Viele Unternehmen sind reine Verdachtsorganisationen. Aus Misstrauen erlassen Führungskräfte bibeldicke Manuale, um auch noch die kleinste Rolle im Unternehmen festzuzurren. Sie glauben nicht daran, dass Menschen gute Arbeit machen wollen. Eine |22|tiefsitzende Unsicherheit, die sich rational maskiert, macht Führungskräfte zu Ordnungskräften, Manager zu Polizisten, die »Kontrollspannen« überblicken. Sie vertrauen nicht dem selbstgesetzten Qualitätsanspruch ihrer Mitarbeiter. Sie sind extrem zurückhaltend, wenn es darum geht, die Mitarbeiter ihre eigenen Wege zum Ziel finden zu lassen.
Die Misstrauensvereisung äußert sich in Formulierungen wie: »Jeder misstraut jedem im Werk.« »Man kann hier keinem über den Weg trauen.« »Jede Bewegung wird kontrolliert.« »Ehrlichkeit ist hier Naivität.« »Es kann gefährlich sein, eine Meinung zu vertreten.« Da ist der CSM-Point schnell erreicht, der Career Shortening Move. Auch dem ausländischen Geschäftsführer wird misstraut, »der unsere Sprache nicht lernen will und wahrscheinlich bald wieder weg ist.«
Überall mangelt es an Glaubwürdigkeit: Der Informationspolitik »des Hauses« wird mit großer Skepsis begegnet. Das gilt für die Zukunft der Firma, die finanzielle Situation, die Personalpolitik und auch geplanter Umstrukturierungen: »Es wird nicht mit offenen Karten gespielt« »Die Firmenzeitung ist ein Propaganda-Blatt.« Andere Aussagen beklagen Inkonsistenz zwischen Sprechen und Handeln: »Ich bin enttäuscht von den Entscheidungen des Managements, die bereits nach einem halben Jahr in ihr Gegenteil gekehrt werden.« »Hier gilt das Motto: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.« »Heute so, morgen so.« Und das Vertrauen wächst auch nicht gerade, wenn die Menschen eine Diskrepanz feststellen zwischen der kleinlichen Spar- und Bewilligungspraxis einerseits und den gewaltigen Summen, die dem Topmanagement gezahlt werden.
Viele haben »genug« von der Zunahme an Regelungen sowie an Kontroll- und Rechtfertigungsmechanismen, die sie als Behinderung ihrer eigentlichen Arbeit erleben: »Zuviel Bürokratie«, die »steigende Papierflut«, »für alles Formulare ausfüllen«, »zunehmende administrative Arbeit, die zum Added Value absolut nicht beiträgt.« »Arbeit nach vorbestimmten Abläufen, egal, ob das sinnvoll ist oder nicht.« Viele Menschen sind auch der alltäglichen Durchtriebenheit müde, die unaufhörlich die Fäden des Scheins und der Lüge miteinander |23|verknüpft. »Da hört man doch gleich, dass da etwas nicht stimmt.« Zum Misstrauen besteht offenbar unausgesetzt Anlass. Man hält sich fast nur noch »hinterm Licht« auf, wohin einen nahezu jede offizielle Mitteilung zu führen scheint.
Eine wissenschaftliche Untersuchung über die »Befindlichkeit in der Chemischen Industrie« (Kiefer und andere 2001) macht nachgerade dramatische Vertrauensdefizite dingfest: »Es findet sich im gesamten Antwortset keine einzige Aussage, die auf eine vertrauensvolle Beziehung zum Topmanagement hinweisen würde.« Die Studie spricht von einer »aufsehenerregenden« Entfremdung vom oberen Management. Zitate: »Was führen die da oben im Schilde?« »Ich glaube denen nicht, dass sie das Wohl der Firma im Sinn haben. Sie machen Karriere auf Kosten der Firma.« Die Studie kommt zu dem Schluss, dass keineswegs alle negativen Gefühle mit einer allgemeinen Rückzugstendenz beantwortet werden. Misstrauen ist in seinen Konsequenzen für das Unternehmen deutlich von anderen negativen Emotionen wie Ärger, Sorge und Enttäuschung zu unterscheiden. Alltägliche Ärgernisse beispielsweise werden zwar der Firma angelastet, aber sie berühren nicht das Leistungsverhalten innerhalb der eigenen Aufgaben. Misstrauen hingegen führt sowohl zum innerlichen Rückzug aus der Firma wie auch von der eigenen Arbeit. Wer misstraut, »ist weniger bereit, sich für die Firma und den Job einzusetzen, und auch weniger bereit, in der Firma wie auch im Job zu bleiben.«
Um die Überwachungswut zu rationalisieren, ist viel Abgegriffenes im Umlauf: dass Vertrauen gut, Kontrolle besser sei, dass man sich Vertrauen erst verdienen müsse, dass Gelegenheit bekanntlich Diebe mache. Ernst zu nehmende, reflektierende Manager entfalten oft brillante Rhetoriken zur Rechtfertigung von Misstrauen. Nicht selten werden bestürzende Geschichten über Vertrauensbrüche, Betrug und Niedertracht erzählt. Dass ein Vertrauensmissbrauch mit erheblichen Konsequenzen verbunden sein kann, kann man in der Tat an vielen Beispielen belegen: Man sah es 1995 an den durch den Broker Nicholas Leeson verursachten Milliardenverlusten der Londoner Barings Bank und 1996 an dem Schaden, den der Kupferhändler |24|Yasuo Hamanaka der Sumitomo-Bank zufügte. Auch die Electrolux Deutschland GmbH ist 1999 durch nicht genehmigte Devisentermingeschäfte eines Mitarbeiters um 55 Millionen DM geschädigt worden. Die Namen Schneider, Flowtex, Swissair, ABB und Enron stehen für Inkompetenz, Geldgier und zum Teil kriminelle Machenschaften. Der »Neue Markt« scheint sich mehr und mehr als ein Lehrstück abenteuerlicher Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden zu entpuppen, die vor allem dazu dienen, die Anleger hinters Licht zu führen.
Aber das Pendel ist zu weit ausgeschlagen. Die Unternehmen haben das Augenmerk zu sehr auf die Risikobegrenzung gelegt. Dabei haben sie die Chancen eines Chancenmanagements außer Acht gelassen. Die Verhältnisse stehen auf dem Kopf. Normalerweise werden für Misstrauen Gründe eingefordert, für Vertrauen nicht. »Warum vertraust Du mir?« – das fragt niemand. Umgekehrt ist es im Unternehmen: Das Misstrauen ist nicht begründungspflichtig, das Vertrauen ist es. Insbesondere dann, wenn etwas schief gelaufen ist. Und natürlich läuft immer mal wieder etwas schief. Viele Unternehmen sind daher zur Verregelungsseite des Spektrums hin eskaliert. Dann kommen die Sicherheitsfanatiker an die Macht. Dann wird Misstrauen zur Norm. Wenn aber Misstrauen zur Norm wird, wird Vertrauen zur Sünde.
Betrachten wir die strukturellen Hintergründe. Die Ökonomie interessiert sich scheinbar nicht für Vertrauen. Ökonomisches Verhalten – Nutzen maximieren, Wettbewerbsstrategien entwickeln, Informationsvorteile ausbeuten – all das scheint Vertrauen geradezu auszuschließen. Überschaut man die betriebswirtschaftliche Literatur, so scheint sich die gesamte ökonomische Intelligenz am Modell des Gebrauchtwagenkaufs zu orientierten – am Modell maximalen Misstrauens.
Wir haben die Leistungsgrenzen dieses Paradigmas erreicht. Die Prolongationskapazität (ein Ausdruck, den ich mir von der Evolutionsbiologie geborgt habe) ist ausgeschöpft. Ein weiteres Wachstum ist mit dem zur Verfügung stehenden Denkrahmen nicht möglich. Der Reifegrad ist hoch, die Systemintelligenz auch, der wirtschaftliche |25|Erfolg aber bereits fragil. Ein kleine Veränderung der Umweltbedingungen verringert oft drastisch die Prolongationskapazität. Viele Unternehmen befinden sich in einem unsichtbaren Gefängnis. Eine überbordende Bürokratie, starres Verwaltungshandeln und eine Vielzahl von Richtlinien lähmen jeden unternehmerischen Tatdrang. Die Wände und Gitter dieses Gefängnisses sind die Grundannahmen über die Ökonomie und das menschliche Verhalten.