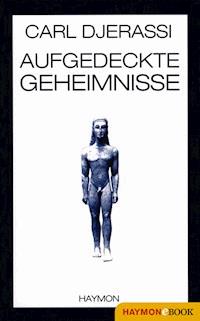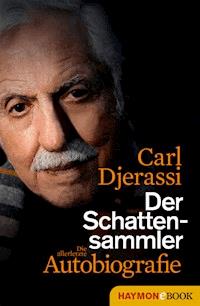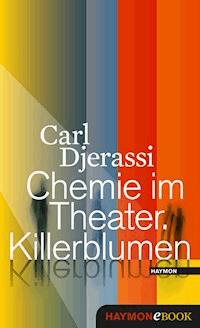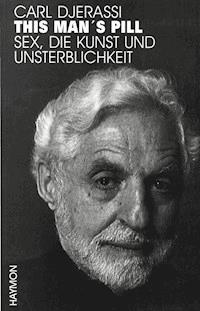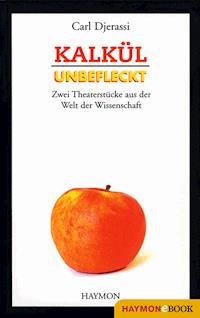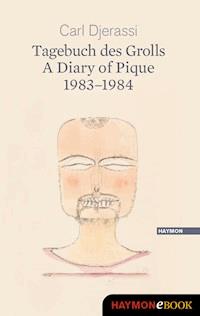Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
NACH EINEM AUTOUNFALL IST DER ZWEIJÄHRIGE LUCAS HIRNTOT. Der ehrgeizige Neurologe Quintus Swann entschließt sich zu einem gewagten EXPERIMENT: Er wird den Jungen künstlich am Leben erhalten und seine körperliche, vor allem auch seine sexuelle Entwicklung beobachten. Jahre später wird Lucas, gesundheitlich stark beeinträchtigt und zum Jugendlichen herangewachsen, wieder in die Pflege seines Vaters und seiner Stiefmutter Opuntia übergeben. Der Vater bleibt auf Distanz, doch zwischen Lucas und Opuntia entwickelt sich eine INNIGE BEZIEHUNG, die ungeahnte KONSEQUENZEN hat. IM KREUZFEUER WIDERSTREITENDER INTERESSEN In seinem LETZTEN ROMAN erzählt CARL DJERASSI die bewegende und spannungsgeladene Geschichte eines versehrten Kindes, das aufgrund seiner Krankengeschichte zum Spielball widerstreitender Interessen und Ideologien wird. Der mit über 30 Ehrendoktoraten ausgezeichnete Wissenschaftler und Schriftsteller geht darin einigen der GROSSEN ETHISCHEN FRAGEN UNSERER ZEIT nach: Wie weit darf moderne Wissenschaft gehen? Wie können FORSCHERDRANG UND ETHIK im Gleichgewicht bleiben? Wann ist ein Leben noch ein Leben? Und was bedeutet die TRENNUNG VON SEXUALITÄT UND FORTPFLANZUNG für eine Gesellschaft? Präzise lotet er menschliche Stärken und Schwächen aus und zeichnet mit feiner Ironie ein erhellendes Porträt der texanischen Gesellschaft zwischen Religion und großem Geld, zwischen Keuschheitsbewegung und Hightech. DAS WERK EINES GENIALEN WISSENSCHAFTLERS UND AUTORS Carl Djerassi beeinflusste als Naturwissenschaftler das Leben von Generationen von Menschen. Als Schriftsteller, dessen Werke in zahlreiche Sprachen übersetzt worden sind, widmete er sich ausführlich dem von ihm erfundenen Genre SCIENCE-IN-FICTION. In seinen Romanen und Theaterstücken stellt er sich den wissenschaftlich aktuellen Themen und erlaubt dadurch auf unterhaltsame und auch kritische Weise faszinierende Einblicke in die Welt von Wissenschaft und Forschung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carl Djerassi
Verurteilt zu leben
Roman
Unter Mitarbeit von Laura Roberts
Aus dem Amerikanischen von Steffen Beilich
Einmal ausgesprochen, fliegt ein Wort unwiderruflich davon.
Horaz
Die Macht wird nur dem zuteil, der es wagt, sich zu bücken und sie aufzuheben … wagen muß man!
Fjodor Dostojewski, Schuld und Sühne
Kapitel 0
(1996)
Ein verstohlener Blick durch den gut ausgeleuchteten Spalt einer sich pneumatisch öffnenden und schließenden Tür genügte, und Rod Hunt wusste Bescheid, dass das Baby, nach dem er suchte, von der Intensivstation woandershin verlegt worden war. In die Leichenhalle? Womöglich inzwischen begraben? Auf jeden Fall war das Kind weg.
Er machte auf dem Absatz kehrt, was ein quietschendes Geräusch auf dem Hochglanzlinoleum verursachte, und steuerte geradewegs auf das Schwesternzimmer zu. Nein. Sie wüssten nichts, behaupteten sie. Hätten keine Ahnung. Nichts gesehen. Nichts gehört. Und sagen würden sie auch nichts. Sie hätten ebenso gut die drei Affen sein können, die opponierbaren Daumen in die Ohren gesteckt und mit wedelnden Greifschwänzen, an denen sich ihr Missfallen ablesen ließ. »Sie sollten Dr. Swann sprechen. Nehmen Sie doch Platz, wir fragen, wann er Sie empfangen kann.« Diese Affenvariante einer klassischen Abfuhr brachte Rod dazu, bumerangartig zum Hauptempfang zurückzustürzen, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren.
Er sprach klar, höflich und unumwunden mit mehreren typisch bürokratischen Verwaltungsangestellten. Nachdem er allen, die ihn sehen wollten, seinen Presseausweis vorgelegt hatte, fragte er, ob er heute noch einen kurzen Termin bei Dr. Swann bekommen könne. Immer wieder wurde telefonisch nachgefragt, bis man Rod schließlich für 14 Uhr ein »sehr kurzes Gespräch« im Arbeitszimmer von Dr. Quintus Swann anbot.
Rod trottete durch die trübe Welt langer, schmaler Korridore und las im Vorbeigehen die Türschilder, bis er auf »Quintus Swann, Dr. med., Pädiatrische Neurologie« stieß. Er klopfte an die Tür, die einen Spaltbreit offen stand und den Blick ins Innere des Arbeitszimmers freigab. Dann klopfte er erneut, dieses Mal lauter. Er strich seinen Hemdkragen glatt und rückte den Trageriemen seiner Kameratasche, der in seine Schulter schnitt, wieder zurecht. Er klopfte noch einmal, laut und kräftig: »Doktor Swann?«, rief er. »Hier ist Rodion Hunt. Mir wurde gesagt, Sie würden mich empfangen.«
Der Arzt starrte auf eine Bilderserie an einem Leuchtkasten an der Wand, starrte mit einer Intensität, wie sie normalerweise dem Schleifen von Diamanten vorbehalten ist. Wie er so bewegungslos dastand, feine Gesichtszüge und mit weißem Kittel, hätte man ihn ohne Weiteres mit einem Juwelier verwechseln können. Oder einem Uhrmacher. Vielleicht auch mit einem Spitzenklöppler aus der Renaissance. Aber ein Juwelier wäre der Sache wohl am Nächsten gekommen, weil einige der beleuchteten Bilder tatsächlich die satten Farben von Edelsteinen hatten. Andere waren diffus und erinnerten an Spitzenborte. Manche hatten große Ähnlichkeit mit einem komplizierten Uhrwerk. Doch allesamt waren es Bilder eines menschlichen Gehirns: des Gehirns eines kleinen Kindes.
Rod, der höflich, aber durchaus selbstbewusst im Eingang zum Büro wartete, räusperte sich mehrmals, ehe er den Arzt erneut ansprach: »Dr. Swann? Dr. Swann? Verzeihen Sie, Doktor. Ich bin Rod Hunt. Ich bin Journalist. Von The Sentinel. Wir haben einen Termin.«
Der Reporter, der in der Tür verharrte, war nur wenige Meter von der Ellbogenbeuge des Arztes entfernt und wartete vornehm zurückhaltend. Noch einmal pochte er laut gegen die halb geöffnete Bürotür. Sein viertes Klopfen wurde schließlich gehört.
»Ja? Wie Sie sehen, bin ich ziemlich beschäftigt. Falls Sie sich verlaufen haben – zum Fahrstuhl geht es dort entlang. Da drüben. Rechts von mir aus, links von Ihnen. Verstehen Sie?«
Gerade als der Arzt die Tür zuschlagen wollte, schob Rod seinen Fuß mit berufsmäßiger Geschicklichkeit dazwischen.
»Entschuldigen Sie, Doktor. Ich bin Rod Hunt. Verzeihen Sie, wenn ich hier hereinplatze, aber die Dame vom Empfang hat Sie vorhin angerufen und für mich einen Termin für 14 Uhr ausgemacht. Es ist jetzt 14 Uhr. Eigentlich sogar 14.09 Uhr.«
Quintus Swann warf einen Blick auf seine Uhr und zuckte die Schultern.
»Tut mir leid. Es stimmt. Die haben wirklich angerufen und 14 Uhr vereinbart. Ich habe einen sehr vollen Tag und die Zeit aus den Augen verloren. Kommen Sie herein. Ich habe nur ein paar Minuten. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich habe einfach nicht genug Zeit und auch nicht genug Platz für ordentliche Besprechungen. Was kann ich also für Sie tun, Mr. Hunt? Entschuldigen Sie, aber von welcher Zeitschrift, sagten Sie, sind Sie?«
Rod sah sich nach einer sicheren neutralen Zone um, die er für sich beanspruchen konnte, und entschied sich schließlich für eine Ecke, wo er sich anlehnte. »Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit. Mein Name ist Rod Hunt, Doktor Swann. Ich bin Reporter bei The Sentinel. Keine Zeitschrift. Eine Zeitung.«
»Nicht gerade The New York Times oder The Wall Street Journal, Mr. Hunt.«
»Und Sie sind auch nicht gerade Michael DeBakey oder Louis Pasteur. Wir sind in Texas, mitten in der Prärie, Doktor. Nicht eben New York, nicht wahr?«
Der Arzt betrachtete ihn nun eingehender, während der Reporter zu einer Erklärung für seinen Besuch ansetzte:
»Ich habe allmählich das Gefühl, dass Sie mich hinhalten, Doktor. Warum sagen Sie mir nicht einfach die Wahrheit? Was geht hier wirklich vor?«
»Die Wahrheit worüber? Wovon reden Sie? Weshalb sind Sie hier?«, wollte Quintus wissen.
»Ich suche nach einem Kind. Was ist aus dem hirntoten Kind geworden?«, fragte Rod mit Nachdruck. Er bedauerte, dass er sich derart gereizt aufgeführt hatte, ehe der Arzt überhaupt wissen wollte, wer er war und was er wollte. Für Quintus stand sofort fest, dass dieser Reporter entschieden zu neugierig war; nicht eben die Art Besucher, die Quint gern sah. Um die Sache mit einer schnellen, originellen Standpauke zu beenden, holte der Arzt nun in makellosem Latein gegen Rod zum Schlag aus: »Amicule, deliciae, num is sum qui mentiar tibi?« 1
Rod zögerte keine Sekunde und spielte den Ball sofort in ebenso fehlerfreiem Latein zurück: »Ascendo tuum!« 2
Quintus, der sein Lachen kaum mehr zurückhalten konnte, fuhr fort: »Quod licet jovi non licet bovi.« 3
Und wieder kam prompt eine Salve zurück: »Asinus asinum fricat.« 4
Im Grunde ein Unentschieden. Beide Männer waren sich auf einmal bewusst, dass sie diesen kleinen Raum und diesen Augenblick mit einem geistig Ebenbürtigen teilten.
»Ich nehme an, wir haben es hier mit etwas zu tun, was Henry James womöglich ein verlegenes englisches Schweigen nennen würde. Bitte setzen Sie sich, Rod. Oder Rodney? Und bitte nennen Sie mich Quintus … oder auch Quint, wenn Sie wollen.«
»Eigentlich Rod wie in Rodion, Doktor Swann. Pardon, ich wollte sagen Quint. Das kommt aus dem Russischen. Nennen Sie mich bitte einfach Rod.«
Sie gaben einander die Hand. Ein Lächeln gegenseitigen Bedauerns huschte über ihre Gesichter.
»Wie bei Rodion Raskolnikow? Dostojewski? Wurden Sie zwischen den Seiten von Schuld und Sühne ausgebrütet? Wo Porfirij Petrowitsch hinter jeder dunklen Ecke lauert und nur darauf wartet, einem die Handschellen anzulegen?«
Die Funken des Wettstreits, die durch das Büro flogen, verwandelten sich zusehends in interessante persönliche Details.
»Das könnte man wohl so sagen. Mein Vater ist Jurist – der geborene Gutachter. Er liebt die russische Literatur und brachte mir, als ich ein Kind war, mit viel Freude Latein bei. Dostojewski und Cicero waren meine Mark Twains. Ich hatte das Glück, einen begabten Vater zu haben. Und Sie? Woher der Name Quint? Von Quincy? Oder waren Sie einer von Fünflingen, die durch übereifrigen Kinderwunsch zustande gekommen sind?«
Die frostige Stimmung, die zuvor im Büro geherrscht hatte, taute zusehends auf, nun, da beide Männer grinsen mussten und damit ihren Gebietsansprüchen die Schärfe nahmen. Als Reporter spürte Rod, dass es brisant sein dürfte, diesen Arzt zu befragen. Dreißig Sekunden, nachdem er das Büro betreten hatte, war er außerdem überzeugt, dass es hier eine brandheiße Geschichte zu holen gab. Vielleicht sogar eine große Story.
»Was führt Sie also wirklich zu mir, Rod? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendwer gerade jetzt für mich interessieren sollte.«
»Klingt, als kämen Sie auch nicht gerade aus einer bildungsfernen Familie.«
»Meine Mutter stand im Bann von Horaz: Quintus Horatius Flaccus für Eingeweihte.«
»Und Wichtigtuer«, unterbrach Rod.
»Stimmt, ertappt.« Quintus nickte. »Meine Mutter ist aber bescheiden und hegt nach wie vor eine stille, ansteckende Liebe zum Lateinischen. Sie ist eine hervorragende Lehrerin, und viel von meinem Erfolg beim Medizinstudium habe ich ihr zu verdanken.« Einen Augenblick zögerte er und musterte Rod. »Mir ist immer noch rätselhaft, weshalb Sie mich treffen wollten, Rod. Wie kann ich Ihnen helfen? Und an welchem Kind haben Sie so ein offensichtliches Interesse?«, fragte er. Es klang unaufrichtig.
Rod ließ sich tiefer und bequemer in seinen Stuhl hineinsinken, während er sich eine Bühne für seine Informationsgewinnung schuf. Erst holte er ein Notebook und anschließend eine Kamera hervor. Er versuchte, den Arzt mit diesen Vorbereitungen nicht zu erschrecken, und Quint blieb tatsächlich cool, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Das einzige Anzeichen von Nervosität war, dass er mit seinem Stethoskop kaum hörbar gegen die metallene Ecke des Schreibtisches klopfte. Unterdessen legte Rod sich Stift und Notizblock zurecht und setzte zu einer Erklärung für den Grund seiner Neugier an.
»Vor ein paar Monaten landete ich in der Notaufnahme. Hier. In diesem Krankenhaus. Nichts Ernstes. Ein Skorpion hatte mich gestochen. Eine lange Geschichte. Hat mit der anderen rein gar nichts zu tun. Aber es hatte an dem Tag, ein paar Stunden zuvor, einen furchtbaren Verkehrsunfall gegeben. Eine junge Mutter war am Unfallort verstorben. Ein kleines Kind hatte schlimmste Verletzungen erlitten. Es hieß, das Kind … ein Junge … sei im Grunde hirntot. Der Vater, der den Unfall mit ein paar Schrammen und Beulen überlebt hatte, hatte anscheinend einfach das Weite gesucht. Nachdem er zuvor mit einer geladenen Waffe herumgefuchtelt und ein paar Gebete gemurmelt hatte. Kommt Ihnen das nicht bekannt vor, Quintus?«
»Ich verstehe nicht ganz, was Sie an diesem Fall so interessant finden. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber hirntote Kinder sind hier wahrlich keine Seltenheit. Zitieren Sie mich bitte nicht, Rod. Das Gespräch muss komplett vertraulich bleiben, einverstanden?«
»Einverstanden«, antwortete Rod. Um deutlich zu machen, dass er sich daran halten würde, schob er sein Notebook beiseite und legte seinen Stift wieder hin.
»Ich will wirklich nicht hartherzig klingen«, fuhr Quint in ruhigem Ton fort, »aber über fünfzigtausend Menschen sind allein letztes Jahr an SHT – so heißt ein Schädel-Hirn-Trauma in unserem Fachjargon – gestorben. Es ist eine der häufigsten Todesursachen bei Kindern und Jugendlichen. Tragisch. Ein fürchterlicher Verlust. Aber keineswegs ungewöhnlich. Oder für große Schlagzeilen oder selbst kleine Meldungen geeignet. Warum interessieren Sie sich also ausgerechnet für dieses sogenannte hirntote Kind?«
Da saßen einander zwei hochintelligente, gebildete Männer auf engstem Raum gegenüber. Hätte ein Karikaturist die Szene abgebildet – die Wände von Quints Büro hätten sich nun mit einem tiefen Brummen nach innen verschoben, um die beiden schließlich so plattzudrücken wie ein Blatt Papier. Beide hatten eigentlich wissen wollen, was der jeweils andere wusste – oder auch nicht. Nun musste jeder von ihnen unbedingt wissen, was der andere wusste.
»Im Krankenhaus erzählt man sich, dass der Vater ein ziemlich, nennen wir es mal so: rüpelhafter religiöser Fundamentalist ist, der sich geweigert haben soll, dem Krankenhaus den Abbruch der lebenserhaltenden Maßnahmen für das Baby zu erlauben«, erklärte Rod. »Es heißt, dass nach dem Unfall bei dem Kind nur sehr wenig oder gar keine Gehirnaktivität mehr festgestellt werden konnte. Im Krankenhaus kursieren Gerüchte, wonach der Vater einige Wochen später einfach irgendwohin verschwunden sein soll. Hat sich einfach in Luft aufgelöst! Puff! Und niemand hat eine Ahnung, wie man ihn erreichen kann. Stimmt das, Quint? Hat der Vater sein Kind verlassen? Hat dieser verrückte Prediger seinen Sohn im Stich gelassen? Oder ist das nur leichtfertiges Krankenhausgerede? Ist das Kind noch am Leben? Es hat nämlich den Anschein, dass auch der Junge verschwunden ist. Ein doppeltes Verschwinden? Vater und Sohn? Diese Familie scheint ja eine erstaunliche genetische Veranlagung zum Verschwinden zu haben, finden Sie nicht auch, Doc?«
Nun lagen die Karten auf dem Tisch. Wenn es Quintus nicht gelang, das Gespräch auf neutrales Terrain zu verlegen, würde er bald lügen müssen.
»Als Fan der russischen Literatur werden Sie mir doch sicher zustimmen, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen, Rod. Dostojewski war ein Meister darin, Gut als Böse und Schuld als Aufgeklärtheit zu tarnen, nicht wahr?«
»Lassen wir doch dieses Rätselraten für Eingeweihte, Doktor. Wir haben beide viel zu tun. Ich bin extra hierher ins Krankenhaus gekommen, weil ich sehen wollte, wie es dem Baby geht. Dass es nicht mehr da ist, hat mich natürlich sehr überrascht. Und der Vater? Ebenfalls weg. Zwei verlorene Seelen. Und jeder wechselt ein wenig zu eifrig das Thema, sobald berechtigte Fragen gestellt werden. Könnte es sein, dass der Stecker gezogen wurde? Ohne dass die Eltern das genehmigt hätten? Oder ist der Junge an seinen ursprünglichen Verletzungen verstorben? Oder wenn es stimmt, dass er immer noch künstlich am Leben erhalten wird, sein Vater verschwunden und seine Mutter tot ist – wer gewährleistet dann, dass seine Behandlung rechtlich geregelt ist? Ich meine, wenn er überhaupt behandelt wird. Wo steckt das Kind, Doc? Warum ist der Junge weg? Und wieso auf einmal diese ganze Heimlichtuerei?«
»Ziemlich lang, Ihre Fragenliste. Was genau meinen Sie mit ‚weg‘, Rod?«
»Weg. Ein einfacher Begriff. Weder links noch rechts von mir, wie bei Ihrem Fahrstuhl. Liegt nicht mehr als Patient auf der Kinderintensivstation. Dort ist kein hirntotes Kind mehr. Und auch kein liebender Vater am Krankenbett. Geben Sie’s doch zu, Quintus: Sie wissen, was ‚weg‘ bedeutet. Und für mich steckt eine Geschichte in diesem ‚weg‘. So oder so. ‚Weg‘ wie in beerdigt. Oder ‚weg‘ wie in ‚dauerhaftes Dahinvegetieren‘. Ein Waisenkind. Abhängig von der Barmherzigkeit des Krankenhauses. Allein auf der Welt. Im Stich gelassen von einem Mann Gottes. Ein Heiliger Geist offenbar. Anders gesagt, potenziell eine ziemlich spannende Geschichte.«
Quint rang um professionelle Gelassenheit. Dies hätte der Moment in dem Gespräch sein können, in dem sich ihm die Gelegenheit bot, Rod zu beschwichtigen. Ohne Vorbehalt zu lügen, jeden Verdacht zu begraben. Doch Quint blieb stumm, eine Erklärung war nicht in Sicht. Das war nicht die Reaktion, mit der Rod gerechnet hatte, und so holte er, neuerlich frustriert, zum nächsten Schlag aus.
»Jetzt stellen Sie sich doch nicht so begriffsstutzig. Sie sind es, der unser beider Zeit verschwendet, Doktor. Sie wissen, dass ich keinen Zugang zu den persönlichen Akten habe. Noch nicht. Ich sage es noch einmal: noch nicht. Aber wir wissen beide, dass es eine Menge Informationen gibt, die inoffiziell innerhalb dieser Krankenhausmauern ausgetauscht werden. Manches davon dürfte konkret genug sein, um in einer Zeitung zu erscheinen. Gibt es etwas, das Sie mir sagen wollen, Quintus? Bevor ich dieses Büro verlasse und anfange, einige unbequeme Fragen zu stellen?«
»Kommen Sie, lassen Sie uns einen Spaziergang machen«, sagte Quint. »Ich möchte Ihnen auf unserem Weg nach draußen einiges zeigen. Falls Sie daran interessiert sind.«
***
Als Quintus in dem ihm eigenen abgehackten und energischen Tonfall zu seinem unerwarteten Bekenntnis ansetzte, war Rod immer noch schwer erschüttert von Lucas’ Anblick. Auf Quints spontanen Besuch am Bett des Kindes war er schlichtweg nicht vorbereitet gewesen. Die Einsamkeit, die Sinnlosigkeit, die das Zimmer trotz der aufleuchtenden Monitore und der Verrichtungen des Personals ausstrahlte, waren für Rod unerträglich. Der Journalist war auf den Flur hinausgetaumelt, noch ehe Quintus der diensthabenden Nachtschwester seine Anweisungen gegeben hatte. Als Reporter hatte Rod im Krieg Männer leiden und sterben sehen, doch er hatte kaum Erfahrungen mit dem ganz besonderen Leid, das von einem kleinen Kind ausgeht. Quintus schien von diesem kurzentschlossenen Besuch bei Lucas dagegen geradezu beflügelt. Er war dabei, die bisherige knallharte Geheimhaltung aufzuweichen, ließ bestimmte Details jedoch weiterhin strikt aus. Und trotzdem flüsterte er Rod ins Ohr, was seine abstrakten Ziele für Lucas’ Zukunft waren.
»Ich denke, ich kann einen bedeutenden Teil von Lucas’ kognitiven Fähigkeiten wiederherstellen«, sagte er aufrichtig. »Nicht alles, natürlich. Aber genug, um ihm ein einigermaßen lebenswertes Leben zu ermöglichen. Und wenn es mir gelingt, Lucas am Leben und gesund zu erhalten, bis er erwachsen wird, erhalten wir eine Fülle existenzieller Informationen.«
»Sie sind voller Überraschungen, Doktor. Ein solches Gespräch hatte ich wirklich nicht erwartet. Genauso wenig, wie Lucas heute offiziell vorgestellt zu werden. Seine Beatmungsgeräte zu hören. Ein so kleines Kind in dieser Lage vorzufinden. Ihre Gelassenheit erstaunt mich ganz ehrlich. Man könnte das mit Distanz verwechseln, Doktor.«
»Gelassenheit? Mag sein. Aber auch eine Ausbildung zum Doktor der Medizin – in meinem Fall zusätzlich zum Doktor der Philosophie – schützt uns nicht vor Schmerz oder Versagen oder den Fallstricken des menschlichen Daseins. Schmerz lässt sich aus der Medizin nicht verbannen. Oder aus menschlichen Beziehungen. Ich behalte meinen Schmerz im Blick; ich muss der sein, der ich bin, um das tun zu können, was ich tun muss. Nennen Sie das von mir aus Gelassenheit.«
»Ja, ziemlich gelassen. Während andere vielleicht verzweifelt sind.«
»Wissen Sie, was die Russen sagen? ‚Wer bei Begräbnissen weinen muss, sollte nicht Bestatter werden.‘«
»Sie scheinen sich ja ziemlich sicher zu sein, dass Sie Lucas’ Situation verbessern können. Bei Ihnen klingt es fast so, als wäre das ein medizinisches Kinderspiel.«
»Das wohl kaum. Der Natur wäre es lieber, wir würden unsere Kleinkinder begraben, anstatt an ihren Gehirnen herumzudoktern. Oder zu versuchen, ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken.«
»Sie hören sich an, als hätte Lucas die Grippe und nicht ein zerstörtes Gehirn. Bei Ihnen klingt das so leicht, Quintus.«
»Nein. Nicht leicht. Ganz und gar nicht leicht. Mutter Natur will keine kranken Kinder. Ihr wäre es lieber, ihr hirntotes Kind wäre tot. Aber in diesem Krankenhaus ist es uns lieber, wenn unsere Kinder leben. Wenn sie ihr ganzes Leben leben. Alle unsere Kinder. Alle.«
»Und Sie glauben, das geht?«
»Ja, natürlich geht das. Ein hirntotes Kind am Leben zu erhalten, ist heute kein medizinisches Wunderwerk mehr. Es gibt eine junge Frau, die 25 Jahre im Koma lag und es bei recht guter Gesundheit überlebt hat. Aber darum geht es mir nicht. Was ich eigentlich will, sind seine Geheimnisse. So viele, wie ich bekommen kann.«
»Sie erwarten also, dass Sie ganz über ihn verfügen können, ihn mit der Zeit öffnen werden wie die Büchse der Pandora? Und wenn er am Leben bleibt, wird er Ihnen einfach die Schlüssel zu seinem Innersten überlassen? Wie bei einem Neurologie-Quiz? Oder einem sezierten Insekt?«
»Die Möglichkeiten sind überwältigend.« Quint konnte nicht zulassen, dass Rods sarkastische Bemerkungen seinen Optimismus zunichtemachten. »Weil wir eben nicht sind, was Sie unterstellen: Insekten«, fuhr Quintus fort. Er sah, dass Rod immer noch recht blass war. »Insekten geht es vor allem darum, sich fortzupflanzen«, fuhr Quint fort. »Insekten produzieren noch mehr Insekten, ohne die Vorzüge und Annehmlichkeiten, die die sexuelle Fantasie mit sich bringt. Bei Fruchtfliegen oder Honigbienen ist das reine Biochemie. Aber bei Menschen? Wir haben Komplexe. Vorlieben. Das Sexualleben eines Insekts kann durchaus bizarr sein – und oft ist es das auch –, aber es ist ganz auf Reproduktion ausgerichtet, auf den Fortbestand der Spezies. Wir dagegen können die ganze Zeit Sex haben …«
»Wollen Sie prahlen?«
»Wohl kaum. Ich versuche lediglich, Ihre Frage zu beantworten. Beim Menschen kann das Männchen ein Weibchen jederzeit – 365 Tage im Jahr – sexuell attraktiv finden, nicht nur während des Eisprungs oder wenn es vom Licht angeregt wird. Unsere sexuelle Aktivität basiert nicht allein auf Reproduktion; wir sind weitaus interessanter und komplexer, weil wir meistens Sex um des Sexes willens haben und nicht etwa, um den Fortbestand der Spezies zu sichern. Mit vielen offenen Fragen. Und wenn Lucas über die normale Pubertät hinaus am Leben bleibt, werden wir viel von ihm lernen. Wir werden den Antworten auf einige wirklich spektakuläre Fragen näherkommen.«
»Als da wären?«
»Zum Beispiel, ob sich die normalen Sexualfunktionen auch ohne externe Trigger vollziehen. Kann sich ein hirntoter Junge ohne kognitive Fähigkeiten physisch zu einem sexuellen Wesen entwickeln? Ohne ein Gehirn, das ihn leitet? Oder kann er später noch irgendwie aufholen? Könnte es sein, dass dieses Gehirn nur einen Dornröschenschlaf schläft? Oder dass unser Geist und unser Körper in ihrer Sexualität keine parallelen Wege gehen?«
»Was meinen Sie? Ich kann Ihnen nicht folgen.«
»Ich kann zwar noch nicht auf Einzelheiten eingehen. Aber die Frage ist: Wird Lucas mental ein zwei Jahre altes Kind sein, das im Körper eines zwanzigjähren Mannes gefangen ist? Und wenn ja, was für ein Mann wird das sein? Ein Mann, der gleichzeitig Kind ist, der sich nur für Teddybären und Märchen interessiert? Oder wäre Lucas mit zwanzig – oder eigentlich sogar schon in der Pubertät – fähig, Geschlechtsverkehr zu haben? Die Wissenschaft hat ja keine Möglichkeit, die sexuelle Entwicklung bei fehlendem Bewusstsein zu untersuchen. Gänzlich ohne kognitive Faktoren. Oder mit sehr begrenzten Faktoren, sofern sich in Lucas’ Fall einige wiederherstellen lassen. Wenn wir zeigen könnten, dass sich Lucas’ sexuelle Entwicklung unabhängig von seiner kognitiven Entwicklung vollzieht, wäre sein abwesendes Gehirn dann jemals in der Lage, seine biologisch-sexuelle Entwicklung einzuholen? Eine einfache Frage. Oder?«
Tagebuch des Rodion Hunt
Erschöpft und doch energiegeladen von mehreren langen Debatten bei Swann. Fühle mich nachträglich angeregt, meine Gedanken zu Papier zu bringen. Dr. Quintus Swann? Okay, warm und flauschig ist er also nicht. Eher eine Art Dauerfrostboden. Unsere Unterschiede sind tiefgreifend. Könnte schwierig werden, mit ihm zu arbeiten. Wirkt kaum vertrauenswürdig. Und strahlt gerade mal so viel persönliche Wärme aus wie ein Tropenfisch. Habe heute gehört, dass die Krankenschwestern ihre eigene Insider-Beschreibung für ihn haben: »Einziger lebender Herzspender in Texas.« Muss zugeben, er schert sich einen Dreck um die öffentliche Meinung. Selbstgenügsam. Eine beinahe unanfechtbare Sicherheit. Meine Vermutung? Swann ist der Typ Mann, dessen Widersprüche widersprüchlich bleiben. Soll ich mich in diese Geschichte stürzen? Nachdem ich bisher kaum ein gutes Verhältnis zu Wissenschaftlern hatte? Für den täglichen Gebrauch sind sie alle ein wenig zu unnachgiebig. Wollen nicht zugeben, dass es für manche Probleme vielleicht keine Lösung gibt. Wie den Hirntod. Kein Ausweg, den ich sähe. Aber Quintus deutet etwas an, was mehr als nur eine Lösung wäre für das HTB, eine Abkürzung für hirntotes Baby, die ich vorher noch nicht gehört habe. Falls Quint richtig liegt, also falls er die Wahrheit über die vor uns liegenden Möglichkeiten sagt, könnte das eine ganz große Fahrt werden. Eine einfache Frage. Oder? Wird Quintus bereit sein, mich an der Wahrheit teilhaben zu lassen?
Kapitel 1
(1996)
Wenn er seinen Kopf ganz vorsichtig drehte, konnte Ezekiel Reed, eingeklemmt hinter dem verzogenen Lenkrad, erkennen, dass das Baby noch atmete. Die Schnallen der Sitzgurte hoben und senkten sich auf der winzigen Brust. Ezekiel dachte, er hätte ein Miauen wie von einem Kätzchen vernommen, aber das Zischen der Dämpfe, die aus dem Autowrack entwichen, schwächte alle anderen Geräusche ab. Erste Anzeichen eines Blutergusses breiteten sich auf dem Gesicht des Kleinen aus, weitere Verletzungen konnte Ezekiel aus seinem Blickwinkel nicht sehen; was den schlimmsten Schaden angerichtet hatte, war nicht so leicht zu entdecken. Er blieb vorerst verborgen, tief im Inneren des kindlichen Körpers.
»Gelobt sei der Herr, der barmherzig ist gegen sein kleines Lamm«, murmelte Ezekiel und richtete seine Aufmerksamkeit auf den reglosen Haufen neben ihm. Lydia. Er hielt ihr Handgelenk fest umklammert, und seine Finger wurden allmählich taub. Es schien undenkbar, dass sie nur einige Augenblicke zuvor noch zusammen gelacht hatten, weil das Baby seine ersten Gesangsversuche unternommen hatte.
»Ruff rifted me«, hatte ihr Sohn verkündet.
Dass der Kleine auf dem Rücksitz so plötzlich und spontan versucht hatte, ein Lied nachzusingen, hatte Lydia veranlasst, ihre entspannte Haltung neben Ezekiel aufzugeben und sich dem Jungen zuzuwenden. Als das Auto von der Straße abkam, hatte sie vor ihrem Kind gekniet und war zu seinen ersten Versuchen, ein Kirchenlied aus dem Radio mitzusingen, auf und ab gehopst.
Es war ein wunderschöner Tag, der Himmel blau. Lydia war jung und gesund. Eine glückliche Ehefrau und liebevolle Mutter. Sie war völlig bezaubert von ihrem Sohn, der ständig neue Wörter dazulernte und nun die Musik für sich entdeckte. Er machte gerade seinen ersten Versuch, laut zu singen, als der Tod sie holte.
»Ruff rifted me. Ruff. Ruff. Rifted me!«, trällerte der Junge.
Das Kind erlebte gerade das Wunder, selbst musikalische Töne zu produzieren. Inspiriert vom Himmel und gesendet von evangelikalen Radiowellen.
»Hör doch! Hör doch mal, Zeke. Luke singt! Mach lauter. Mach das Radio lauter! Hör doch nur. Es ist Love Lifted Me. Luke singt das!«
Der Kleine strahlte seine Mutter an, während seine kindliche Stimme und die Musik das Auto erfüllten. »Ruff rifted me«, verkündete er abermals voller Stolz. Die Stimme im Radio hatte zwar mehr Schliff, aber dass ihr Kind mitsang, war für Lydia als Mutter weit mehr als bemerkenswert: Es war nichts weniger als ein Wunder Gottes, der Erfindung des Rades ebenbürtig.
Lydia brach in ein ansteckendes Lachen aus und klatschte in die Hände.
»Hör dir doch nur unser Baby an, Zeke. Er singt! Er singt Love Lifted Me! Ist er nicht unglaublich? Er singt mit. Ohne Fehler! Ja, mein Schatz, die Liebe hat dich erhöht.«
Lydia kramte eilig ein kleines Notizbuch aus ihrer Handtasche hervor, in dem sie regelmäßig Lucas’ neueste geniale Taten und Sprechversuche festhielt. Sie nahm einen kurzen, mit einem Stiftmesser angespitzten Bleistift zur Hand und leckte die Spitze an, bevor sie zu schreiben begann.
»Wenn ich ‚Liebe‘ und ‚erhöht‘ dazuschreibe, ist er schon bei 57 Wörtern, Zeke. Weit über dem Durchschnitt für zwei Jahre, weißt du? Weit darüber«, versicherte sie Ezekiel ehrfürchtig flüsternd. »Und er singt! Ich hatte ja keine Ahnung, dass er singen kann. Ich sollte vielleicht ein zweites Notizbuch anfangen, nur für seine musikalischen Talente. Hast du das gehört, Zeke? Love lifted me!«, wiederholte sie. Anscheinend hatte Gott Lydia gehört. Und so hob Er sie ohne Umschweife genau in diesem Augenblick direkt aus ihrem Leben heraus in die Höhe.
Obwohl Ezekiel als Kind eines Pfarrers mit seinem Vater oft an Totenbetten gestanden hatte, war dies seine erste Erfahrung mit einem leblosen Körper. Hatte Lydia gehört, dass er ihr in dieser kurzen Sekunde, als ihm klar wurde, wie schwer das Auto ins Schlingern geraten war und wie schlimm es sich überschlagen würde, noch etwas zurief? Sicher hatten weder Mann noch Frau begriffen, dass selbst für das kürzeste Lebewohl keine Zeit mehr blieb.
Noch immer quetschte Ezekiel Lydias Handgelenk, fest entschlossen, das Blut durch pure Willenskraft wieder in ihren Körper fließen zu lassen und einen Puls zu erzeugen – doch sie war bereits leblos. Ezekiel sehnte sich danach, Lydia an seine Brust zu drücken. Sie zum Atmen zu zwingen. Sie zu trösten. Sich selbst zu trösten. Doch sie blieb unerreichbar – begraben unter den rauchenden Trümmerteilen des Motors. Ein Teil ihrer linken Schulter drückte gegen sein Knie und durchtränkte seine Sommer-Khakihose bis zum Knöchel mit ekelerregend klebrigem Blut, das bereits zu stocken begann. Lydias Blut bedeckte beide Seiten der Bodenplatten und sickerte auf den weichen heißen Teer des Highways; es war eine Offenbarung für Ezekiel, dass aus einem menschlichen Körper so viel Blut fließen konnte.
Entschlossen, an das Baby heranzukommen, kämpfte Ezekiel gegen die drohende Ohnmacht an und unterdrückte seine Übelkeit. Die Luft im Auto roch nach metallischem Rauch und brennendem Gummi. Er stemmte seinen knochigen Körper mit ganzer Kraft gegen die Türschwelle, und es gelang ihm, die zerquetschte Tür aufzustoßen und sich vom Vordersitz zu hieven. Dann griff er durch ein zerborstenes Fenster und zog den Kleinen an seine Brust. Er blickte auf Lydia herab und überlegte, wie er auch sie aus dem Wrack herausbekäme. Ihre schlanken Beine wirkten blass und unversehrt – im Gegensatz zu ihrem restlichen bis zur Unkenntlichkeit entstellten Körper. Ihr geblümter Rock bauschte sich unzüchtig oberhalb der Taille, die Sommersandalen waren verschwunden. Ihre Füße sahen noch immer gepflegt aus. Verzweifelt wollte Ezekiel ihren Rock wieder herunterziehen. Er sah sich um, in der Hoffnung, ihre Schuhe wiederzufinden. Benommen wie er war, überkam ihn das rasende Verlangen, die Ordnung wiederherzustellen und systematisch alles aufzuräumen, was der Tod verwüstet hatte. Weinend und wutschnaubend verfluchte er Gott und entfernte sich eilig vom Auto, um zu retten, was noch zu retten war.
Er taumelte zum staubigen Straßenrand und legte seinen Sohn im Schatten einer kleinen Sichelblättrigen Eiche ab; ganz in der Nähe kauten Kühe unbekümmert auf trockenen Gräsern herum. An diesem geschützten Ort untersuchte er das reglose Kind, drehte es sanft von einer Seite auf die andere. Ezekiel spuckte in seine Handflächen und strich das Haar des Jungen glatt; er spuckte noch einmal und versuchte, den rostigen Staub um Lucas’ Mund herum zu entfernen. Er legte die Gliedmaßen des Kindes, das ruhig dalag, ordentlich zurecht und rieb die warme Grübchenhand des Babys an seiner Wange; Lucas, klein und erschlafft, reagierte nicht auf seine Berührung. Obwohl er sich nicht rührte und nach wie vor ohne Bewusstsein war, tröstete sich Ezekiel damit, dass der Kleine warm war und bis auf den Bluterguss keine sichtbaren Verletzungen zeigte.
Es fiel Ezekiel schwer, das ganze Ausmaß des Unfalls zu begreifen. Er dachte über sein Kind nach und betete für den Jungen. Lucas atmete noch. ‚Mein Sohn ist noch am Leben, er sieht kaum verändert aus‘, tröstete sich Ezekiel. ‚Er ist einfach nur bewusstlos oder schläft vielleicht. Gott in seiner unendlichen Weisheit will mein Kind wohl vor dem Grauen des Unfalls beschützen und hat es deshalb für eine Weile bewusstlos gemacht.‘ Als er seine Panik überwunden hatte, zog Ezekiel ein großes Stofftaschentuch aus seiner hinteren Hosentasche, um sich das klebrige Blut von Händen und Gesicht abzuwischen, doch Übelkeit übermannte ihn. Instinktiv hielt er nach einem mit grünen Sommergräsern bewachsenen Streifen Ausschau und entfernte sich ein paar Meter von dem Kind, um sich zwischen den Metallkappenspitzen seiner Cowboystiefel zu übergeben. ‚Verrückt. Verrückt ist das‘, dachte er zwischen zwei Würgeattacken. ‚Ich bin doch nicht ganz bei Trost! Mein Vater, der Scheißkerl, ist seit 20 Jahren tot und sagt mir immer noch, wie ich kotzen soll!‘
»Wenn dir übel ist, Sohn, dann mach’s wie ein richtiger Mann! Geh raus und such dir eine Stelle mit Gras, damit du dir die Stiefel nicht bespritzt.«
Im Schatten der Eiche legte Ezekiel dem Baby seine Hand auf die Brust und ging den Unfall noch einmal in Zeitlupe durch. Das Letzte, woran er sich erinnerte, war Lydias Lachen und dann der Schlenker, um etwas auf der Straße auszuweichen – etwas, das groß war und sich nur langsam bewegte. Er stand auf, um den Unfall noch einmal durchzuspielen. Ihn schwindelte noch, als er zu dem dampfenden, hochkant stehenden Auto kam; von dort ging er den Weg zurück. Er folgte den Reifenspuren auf der Fahrbahn, bis er auf eine sich windende Klapperschlange stieß.
Einige der verloren gegangenen Augenblicke kehrten wieder zurück: Eine Schlange war der Grund für seinen tödlichen Schlenker gewesen. Ezekiel rannte zum Auto zurück und verbrannte sich die Hand, als er das schwelende Handschuhfach aufbrach. Seine Brille, eine geladene Pistole und die Bibel seines Vaters flogen ihm entgegen. Als er sich die Pistole und die Bibel in den Hosenbund gestopft hatte und sich bemühte, sich die Brille wieder ordentlich aufzusetzen, blieb sein Ärmel an einem abstehenden Stück heißen Metalls hängen. Mehrere Sekunden lang hing er so unfreiwillig fest und musste abermals die zerschmetterte Lydia betrachten. Dann aber rannte er voller Zorn zurück zu der Schlange und fixierte sie mit dem Schuh. Er wusste, dass er in diesem Augenblick imstande war zu töten, imstande, einem lebendigen Wesen Schmerz zuzufügen, und das verlieh ihm vorübergehend ein tröstliches Gefühl von Macht. Er versuchte, Blickkontakt herzustellen; verzweifelt bemühte er sich zu erkennen, ob die sterbende Schlange begriff, dass er an ihr Rache nahm, doch er sah bloß die ausdruckslose Leere eines Reptils.
Wie eine herabhängende elektrische Leitung schnellte die Schlange im Todeskampf in ihrer ganzen Länge durch die Luft und peitschte gegen Ezekiels Oberschenkel. Er hielt die Mündung zwischen die Augen des Tiers und drückte ab. Der Schlangenkopf explodierte in feinste, rötliche Teilchen. Während er mit seinem Taschenmesser die Klappern der Schlange abtrennte, sie in die Luft hob und einem launischen Himmel entgegenreckte, verfluchte Ezekiel einen schrecklich irrationalen Gott. Geifernd trampelte er mit den Absätzen seiner Stiefel auf der toten Schlange herum. Er erkannte seine eigene Stimme nicht mehr. Die Wunde an seinem Kopf blutete, seine verbrannte Hand nässte, und er hatte die Pistole so nah an seinem Ohr ausgelöst, dass er inzwischen überhaupt nichts mehr hörte.
Benommen entfernte er sich von der toten Schlange und kehrte zu seinem Sohn zurück, der immer noch stumm und reglos war. Er hob Lucas hoch und drückte ihn, der schlaff wie eine Stoffpuppe war, an seine Brust. Außerstande, das gesamte Ausmaß des Entsetzens zu erfassen, das er angesichts des Verlustes spürte, war er froh, dass sein Sohn warm war und atmete. Während er Lucas immer wieder verzweifelt und innig an sich drückte, drang eine entsetzliche Botschaft in Ezekiels Bewusstsein.
Plötzlich erschütterte ihn ein übernatürlicher, unbestimmter Verdacht, dass dem Kind, das er hier so liebevoll hielt, jetzt etwas Großes fehlte. Etwas Wesentliches, das vorher noch dagewesen war und jetzt fehlte. Etwas Elementares war seinem Sohn genommen worden, und das war so einfach gewesen wie es für Ezekiel war, seine schwere Taschenuhr aus der Hosentasche zu ziehen, um nach der Zeit zu sehen.
Als der Notarztwagen kam, fand man Ezekiel taub und taumelnd vor: Seinen Sohn fest umklammernd, fuchtelte er wild mit seiner geladenen Pistole herum und feuerte Schüsse gegen Gottes Ungerechtigkeit in den Himmel. Einer der Sanitäter, der wenig Lust verspürte, gemeinsam mit einem trauernden, eine Knarre schwenkenden Eiferer im Notarztwagen ins Krankenhaus zu rasen, überredete Ezekiel, ihm die Waffe zu überlassen. Nach der Untersuchung des Unfallorts und der sachlichen Feststellung, dass Lydia medizinisch nicht mehr zu helfen war, wandten sich die Helfer Ezekiel und dem kleinen Lucas zu.
Die Rettungssanitäter warfen einander düstere Blicke zu – der Verdacht, dass der Zustand des bewusstlosen Kindes sehr ernst war, schien sich zu erhärten. Sie prüften rasch, ob es noch Lebenszeichen gab, und bald wurde der Kleine im dahinrasenden Krankenwagen an einen wild schaukelnden Tropf gehängt. Ezekiel hatte sich eine Schulter ausgerenkt, mehrere Rippen angebrochen, sich an der Hand verbrannt und am Kopf verletzt und hörte auf dem linken Ohr nichts mehr. Mit systematischer, distanzierter Präzision mühten sich die Sanitäter ab, das Kind wiederzubeleben, führten ihm einen Atemschlauch ein und ließen das winzige Gesicht unter einer Sauerstoffmaske verschwinden. Doch für den kleinen Lucas, inzwischen ebenso schlaff und schwer wie die kopflose Schlange, kam wohl jede Wiederbelebung zu spät.
***
Als die Krankenschwester in der Notaufnahme in ihrem gebügelten und gestärkten Kittel um die Ecke gebogen und mit Ezekiels Blutproben verschwunden war, begutachtete Ezekiel seine Verletzungen. Sein linkes Ohr schmerzte, und bis auf einen Dauerton, der an die Brandung des Meeres erinnerte, konnte er damit nichts hören. Sein Sehvermögen war gestört, und einen Moment lang dachte er, er würde den flackernden Abdruck eines Pistolengriffs in seiner Handfläche sehen. Unter der schweren Eispackung war die verbrannte Innenseite seiner Hand, inzwischen so groß wie ein Baseballhandschuh für Kinder, über und über mit Blasen bedeckt. In seiner ausgerenkten Schulter pochte ein heftiger Schmerz. Mehrere Knochen hatten sich verschoben und waren in Bereiche eingedrungen, wo sie nicht hingehörten. Er spielte an seinem Patientenarmband herum, das Datum und eine Zeitangabe gleich neben dem verschwommen Namenszug auf dem Plastikstreifen zermürbten ihn völlig. Er taste den Hosenbund nach der Bibel ab. Fragmente von Psalmen schossen ihm durch den Kopf, als seine Fingerspitzen die Form des Buches erkannten: »Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt; mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzen Wachs.«
Ezekiel hatte in seiner Kindheit gemeinsam mit seinem Vater, der als Wanderprediger unterwegs war, eine kurze Zeit lang einen einträglichen Ruhm genossen. Man hatte festgestellt, dass Ezekiel als junger Mann mühelos mehrere Teile seines Körpers ausrenken konnte, besonders Schultern und Daumen. Mit andächtigen Worten rief ihn sein Vater dann immer in den vorderen Bereich des Erweckungszeltes und »heilte« vor aller Augen seine »gebrochenen« Knochen. Eilig und hingebungsvoll wurden Gesangs- und Scheckbücher geöffnet. Und so biss Ezekiel nun mit geübter Leichtigkeit die Zähne zusammen, schaute sich um, damit es keine ungebeten Zeugen gäbe, nahm all seine Konzentration zusammen und ließ die fehlplatzierten Gelenke wieder in Stellung krachen. Das deutlich vernehmbare Knallen rief die Stationsschwester auf den Plan, die wie aus dem Nichts heraus auftauchte.
»Schwester, wer hat mein Baby?«, verlangte Ezekiel zu wissen. »Wo haben sie ihn hingebracht? Was tun sie ihm an? Ich muss ihn jetzt sehen. Ich glaube, ich kann ihn weinen hören; mein Junge braucht mich. Er braucht meine Gebete. Ich muss Gott zu ihm rufen.«
Die forsche Schwester war entschlossen, Ezekiel zu besänftigen. Bald nach den Berichten des Rettungsfahrers und seiner Beschreibung des »verrückten Höllenpredigers, der mit einer Klapperschlange, einem Baby, einer Pistole und einer Bibel herumgefuchtelt« habe, hatten Gerüchte im Krankenhaus die Runde gemacht. Ihr professionelles Mitgefühl war durch ihre Neugier, aber auch durch ihre Angst vor dem Mann gedämpft. Doch die Geschichte von der wohl aussichtslosen Lage des Kindes und dem Tod der Frau hatte ihre Station längst erreicht. So sehr sie es auch versuchten, konnten die Mitarbeiter des Krankenhauses angesichts des hirntoten Kindes und Ezekiels immenser und fassungsloser Trauer doch nicht teilnahmslos bleiben.
»Mr. Reed, versuchen Sie, Ihre Eispackung nicht zu verschieben; lassen Sie mich bitte mal Ihre Hand sehen. Mr. Reed! Hören Sie mich? Verstehen Sie, was ich sage?«
»Ich bin ein Diener Gottes. Sie werden mich mit ‚Reverend‘ ansprechen oder schweigen«, fuhr Ezekiel sie an.
»Ja, gut, Sir. Das machen wir schon, Reverend. Wir wollten Ihre Hand lieber nicht röntgen, bis die Schwellung etwas zurückgegangen ist – das verstehen Sie doch, nicht wahr? Natürlich verstehen Sie das … und der Seelsorger möchte Sie gern einen Moment sprechen. Fühlen Sie sich stark genug, um ihn zu treffen? Sehen Sie mich bitte an. Nicht nach unten, nach oben schauen. Versuchen Sie, mich direkt anzusehen. Ihr Gesicht sieht schon viel besser aus … wollen Sie jetzt versuchen, Ihre Brille wieder aufzusetzen? Sie liegt bei mir am Schalter. Ich habe sie Ihnen geputzt, ist wieder wie neu. Und Ihre Medikamente habe ich auch gleich hier. Sie müssen sie jetzt einnehmen, mit Wasser, viel Wasser; und versuchen Sie, Ihre Hand hochzuhalten, oberhalb Ihres Herzens, wenn Sie können. Ja, schön anheben, so ist es richtig. Das ist gut. Sobald Sie vom Röntgen zurück sind, legen wir Ihnen einen schönen sauberen Verband an. Wie ich sehe, ist die Schwellung schon etwas besser … Ihre Medizin wird Sie entspannen und gegen die Schmerzen helfen. Verstehen Sie mich, Mr. Reed? Entschuldigung, Reverend Reed. Der Krankenhausseelsorger wartet draußen im Korridor, um Sie mit in die Kapelle zu nehmen. Denken Sie, dass Sie schon mitgehen können? Können Sie allein aufstehen?«
Ezekiel hatte rasende Kopfschmerzen von dem Staccato-Feuerwerk, das die Schwester mit ihren Fragen und Anweisungen produzierte, freute sich aber wie ein Kind, seine Brille wiederzuhaben. Nachdem er das Gestell zurechtgebogen hatte, konnte er wieder klar sehen. Seine Schulter und seine Knie schmerzten, und er zitterte im Licht der Leuchtstofflampen. Eine der langen staubigen Röhren war defekt, sie stotterte und zischte und warf ihn zurück an den Unfallort; er erinnerte sich, wie er beim Öffnen des versengten Handschuhfachs einen kurzen Blick auf den zertrümmerten Seitenspiegel geworfen hatte, der ihn warnte: »Dinge im Spiegel sind näher, als sie erscheinen.« Machte Gott sich über ihn lustig? Er schloss fest die Augen, legte die Stirn in die Hände und betete. Er schlotterte, schaukelte hin und her und weinte leise.
Obwohl er deutlich sah, wie sich der Mund des Seelsorgers über seinem Kollar bewegte, während er Ezekiel vom Gang aus zuwinkte, konnte Ezekiel nicht verstehen, was er sagte. Sein linkes Ohr war noch immer taub.
»Mr. Reed? Mr. Reed? Darf ich Sie mal kurz sprechen?«
Mehrere wartende Patienten standen ganz in der Nähe gelangweilt beisammen und plauderten mit den Schwestern. Ezekiel sträubte sich dagegen, Objekt ihres Mitleids zu werden, und plötzlich glaubte er, dringend fliehen zu müssen. Er ging auf die von hinten beleuchtete Figur des Seelsorgers in der Tür zu. Ezekiel berührte sein Ohr, zog am Ohrläppchen und schüttelte den Kopf, um dem Seelsorger zu bedeuten, dass er nichts hörte. Dieser nickte bestätigend und sprach sofort langsamer und übertrieben deutlich. Ezekiel konnte ihm nun mühelos von den Lippen ablesen.
»Sollen wir das ganz locker angehen, Mr. Reed? Ich bin Reverend Lamm. Ich bin der Krankenhausseelsorger.« Der Seelsorger gestikulierte, als spräche er zu einem Schwachsinnigen und presste den Zeigefinger auf seine Nase. »Es tut mir so leid. Ihr Verlust tut mir sehr leid, Mr. Reed, sehr, sehr leid.« Der Seelsorger blickte finster, schüttelte den Kopf und legte die Stirn auf eine Weise in Falten, die, wie er glaubte, tiefe Trauer ausdrückte. Mehrmals berührte er einen Bereich oberhalb seines Herzens – eine Geste, mit der er den Punkt auf seiner Brust markierte, an dem wohl die meiste Anteilnahme in seinem Körper zu finden sein musste. »Würden Sie gern mit mir in der Krankenhauskapelle vorbeischauen? Es kann Trost spenden, in solchen Zeiten zu Gott zu sprechen.« Er nahm das Kreuz, das um seinen Hals hing, schüttelte es und hob es dann ein wenig hoch, wie Lernkarten im Kindergarten. Ezekiel nickte. »Ich habe den Schwestern Bescheid gesagt, sie wissen, wo Sie zu finden sind, falls Sie gebraucht werden«, versicherte Reverend Lamm.
Die kleine Kapelle war nur spärlich beleuchtet und roch nach Fußbodenreiniger mit Kieferduft. Die Schwester in der Aufnahme hatte Ezekiel zuvor seine Stiefel ausgezogen, stattdessen trug er nun schlecht sitzende blaue Papierlatschen. Da die Sohlen inzwischen klebrig waren, fiel Ezekiel das Laufen schwer. Die Orgel spielte einen Choral, und die Musik schwebte in der harzigen Luft, doch Ezekiel hörte schlecht. Die Musik klang nach unbestimmter Meeresbrandung, ohne spezifische Form. Alles um Ezekiel herum verschwand – bis auf die verschwommenen Töne des Chorals. Langsam, als wäre er eine schwere Kette, an der jemand zog, bewegte er sich auf den Nebel der Musik zu.
Plötzlich vernahm er den Choral deutlich; er lag im Bett seiner Kindheit. Er erkannte die Stimme seiner Mutter. Sie spielte ihm etwas auf der Mundharmonika vor. Sang ein Kirchenlied. Schüttelte sein Kopfkissen auf, streichelte sein Gesicht und besänftigte sein Schluchzen. Er bebte und rang nach Luft, wie es nur Kinder tun, die sehr lange geweint haben.
Ezekiel hatte seinen ersten Zahn verloren; in schüchternem kindlichem Vertrauen hatte er ihn unter sein Kopfkissen gelegt und auf eine Belohnung von der Zahnfee gewartet. Als Ezekiels Vater mitbekam, was sein Sohn da getan hatte, zog er seinen speckigen Ledergürtel aus der Hose und verpasste dem Kind eine Tracht Prügel, wie sie nicht einmal ein Verbrecher verdient hätte, ganz zu schweigen von seinem eigenen arglosen Kind. Ezekiels Vater war ein Angst- und Höllenprediger aus Westtexas, in dessen Welt kein Platz für die Zahnfee und ihresgleichen war, die wie der Osterhase und tanzende Hexen ins Reich der Jünger des Teufels gehörten. Als charismatischer Geistheiler mit direktem Draht zu Gott war er im gesamten Bundesstaat dafür bekannt, verlorene Seelen wieder aufzurichten.
»Ich hebe sie so hoch, dass sie von oben herabblicken müssen, um den Himmel zu sehen …«
Leider hatte Reverend Reed der Ältere, in dem nicht nur das dunkle Herz eines Hochstaplers steckte, sich ein reichhaltiges Sortiment an ausgesprochen unschönen Angewohnheiten zugelegt: Jenseits seiner finsteren Praktiken väterlicher Unterdrückung wurde ihm oft Betrug oder unverhohlener Diebstahl vorgeworfen. Über sexuellen Missbrauch und häusliche Gewalt wurde geredet, Pädophiliegerüchte hielten sich hartnäckig. Obwohl niemals offiziell Anklage erhoben wurde, herrschte die gängige Meinung, der Pfarrer finde Vergnügen am Schmerz anderer. Immer wieder verprügelte der Reverend Ezekiel wie einen Ackergaul. Wenn er müde davon war, seinen Sohn auf dem unbefestigten Scheunenboden zu schlagen, zwang er ihn in einen Kartoffelsack hinein; dann hängte er den Sack an einem Ast auf und prügelte nun geruhsamer weiter, von einem Stuhl aus mit einem langem Stock.
Er schleppte Ezekiel von einer geschmacklosen Erweckungsshow, die in riesigen Zelten stattfanden, zur nächsten, wobei er sich die Anwesenheit des Kindes und dessen Begabung, sich die Gelenke auszurenken, zunutze machte, um Spenden einzutreiben und die Bankkonten all der naiven Seelen zu räumen, die daran glaubten, dass Jesus direkt zu ihm sprach. In der leidenschaftlichen Verzückung seiner Zeltpredigten rollte Reed mit Schaum vor dem Mund seine Augen zurück, bis nur noch das Weiße zu sehen war. Er bebte majestätisch und schüttelte sich wie ein nasser Hund. Schweißtropfen flogen durch das Zelt, während er seine Hände hoch über den Kopf erhob und auf den Absätzen vor- und zurückschwankte. Er schrie den Teufel an und ließ sich in tiefer, scheinheiliger Ohnmacht zu Boden fallen, als hätte die Gnade Gottes plötzlich seinen Herzschlag unterbrochen.
Anstelle einer glücklichen Kindheit hatte Ezekiel Gott.
Ezekiels Mutter beschützte ihren Sohn so gut sie konnte, indem sie ihm mit Liebe und Zärtlichkeit nicht nur einen Ort der Zuflucht schuf, sondern auch ehrgeizige Versuche unternahm, seine mangelhafte Bildung zu verbessern. Ihre anhaltende Zuneigung begleitete ihn noch, als er bereits erwachsen war – was vielleicht auch der eigentliche Grund dafür war, warum Ezekiel sich niemals von Gott abwandte. Im Gegenteil: Als sein Vater starb, schlug Ezekiel überraschend dessen Pfad der Rechtschaffenheit ein. Und anschließend den eines entspannteren, unbeabsichtigten Fundamentalismus – doch Fundamentalismus war es allemal. Ezekiel Reed wurde zum unverhofften Schutzpatron der Tradition, ganz und gar Spross aus verdorbenem Stamm. Zur Überraschung aller Beteiligten wurde er, was den Heiligen Geist betraf, zum Papagei seines Vaters. Kein Wunder also, dass einer der Sanitäter Ezekiel gegenüber dem Rettungsfahrer so beschrieben hatte: »So’n verrückter Prediger, ballert mit seiner Pistole herum, brüllt irgendwas von Sündern und wackelt allen mit seinem Schwanz vor der Nase rum. Hätt er lieber sein Baby erschießen sollen als die Klapperschlange. Aber wir bringen sie beide rein. Na, dann ma’ die Köpfe hoch, in die Hände gespuckt und alle fertig machen.«
Die Orgelmusik setzte aus, und der Seelsorger klopfte Ezekiel sanft ans Knie.
»Mr. Reed? Geht es Ihnen gut? Wollen Sie gern noch mal zur Krankenschwester rein? Ich komme mit.«
Ezekiels Mutter verschwand zusammen mit der Musik. Er erinnerte sich wieder daran, wo er war. Erinnerte sich an Lydias zerstörten Leib. Wo war sie jetzt? Er wollte zu ihr gehen, wollte sie sehen und neben ihr beten. Und wo war Lucas?
Ezekiel fuhr herum und starrte den Seelsorger wütend an.
»Nennen Sie mich nicht ‚Mister‘. Ich bin ein geweihter Diener Gottes. Gott hat mich berufen. Also nennen Sie mich ‚Reverend Reed‘, Sir. Und jetzt will ich meinen Sohn. Jetzt. Augenblicklich. Bringen Sie mich sofort zu ihm. Er braucht mich. Wo ist er? Es sind Fremde, die bei ihm sind.«
Reverend Lamm verließ die Kapelle und kehrte mit einer Schwester aus der Notaufnahme zurück. Sie brachte Ezekiel und den Seelsorger nach oben auf die Kinderintensivstation. Mit betrübtem Blick platzierte sie die beiden auf Stühlen neben dem Bett des Kindes. Lucas war inzwischen von einem Meer aus Schläuchen und Monitorkabeln bedeckt. Ein Beatmungsgerät keuchte rhythmische Beteuerungen in den Raum, während die blau leuchtenden Bildschirme diverser Gerätschaften mit ihrem Piepen von kostspieliger Wachsamkeit kündeten.
Reverend Ezekiel Reed wurde in seine tiefe Trauer zurückgestoßen, fassungslos angesichts der unheilvollen Menge komplizierter Systeme, die es offenbar brauchte, um sein Kind am Leben zu erhalten. Glücklos und elend stand er von seinem Stuhl auf, außerstande, dem quälenden Verlangen zu widerstehen, seinen Sohn in die Arme zu nehmen. Die Schwester stellte sich dazwischen und nahm sanft Ezekiels geschwollene Hand. Sie tätschelte seinen Handrücken.
»Mr. Reed, es ist besser, wenn Sie Ihren Sohn jetzt nicht berühren. Er ist noch bewusstlos. Aber er hat keine Schmerzen. Keinerlei Schmerzen, das verspreche ich Ihnen. Wir sind ziemlich sicher, dass er keine Schmerzen empfindet.«
Ezekiel hatte sich ganz seiner Erschöpfung überlassen und starrte auf die Schlappen an seinen Füßen. Wohin hatte man seine Stiefel gebracht?
»Möchten Sie noch Eis für Ihre Hand?«, fragte die Krankenschwester. »Denken Sie auch daran, Ihre Schmerzmedikamente einzunehmen? Einer der Ärzte wird morgen mit Ihnen sprechen. Er wird Ihnen alle Ihre Fragen beantworten. Saft? Möchten Sie etwas Apfelsaft, Mr. Reed?«
»Ich bin kein Mister!«, schrie er, an niemand Bestimmtes gerichtet. »Ich bin Reverend. Sprechen Sie mich mit Reverend Reed an, so wie Gott mich genannt hat. Und jetzt wird Gott meinen Sohn retten! Der Heilige Geist teilt nun dieses Bett mit meinem Sohn.«
Ezekiel und der Heilige Geist saßen bis tief in die Nacht hinein wachsam und aufrecht auf einem Metallstuhl mit gerader Rückenlehne, einen Meter von Lucas’ Kissen entfernt. Kurz bevor es dämmerte, wurde er in den dunkelsten Teil des Krankenhauses gebracht. Mit den Schlappen an seinen Füßen rutschte Ezekiel wie die würdelose Karikatur eines albernen Eisläufers mehrere lange Flure gewienerten Linoleums entlang; als jemand ihm einen Ellbogen anbot, um ihn zu stützen, lehnte er jedoch ab. Sein weiß gekleideter Begleiter wandte seine Aufmerksamkeit wieder ein paar Münzen zu, die er in seiner Hosentasche klimpern ließ, und spielte mit seinem Klemmbrett herum. Beide Männer räusperten sich mehrmals. Sie sprachen nicht und vermieden jeden Blickkontakt. Vollkommen wortlos, nur mit ein paar kleinen Bewegungen der Hand oder des Kinns oder einem steifen Nicken wies der Begleiter Ezekiel den Weg zum Ziel.
Mit einem Quietschen schloss sich eine Tür hinter ihnen; der fensterlose Raum, in dem sie nun standen, war eiskalt und lebensfeindlich. Am Ende des Zimmers war Lydias Körper deutlich zu sehen; Ezekiel erkannte die Form eines menschlichen Kopfes, erhellt von der wahren Endgültigkeit des Todes. Hier war es so kalt wie in der Tundra, so eisig, dass Ezekiel erwartete, seinen Atem zu sehen. Er ging einige Schritte und streckte die Hand aus, um nach den eisigen Rohren der Bahre zu greifen. Es war das Ende seiner Frau, die hier auf dem Rücken unter einem weißen Krankenhausbetttuch lag. Ezekiel atmete die eisige Luft ein, so tief, dass er bebte, während er hinter sich das gedämpfte Klimpern der Münzen und von oben das Zischen der Deckenbeleuchtung hörte.
Sein Begleiter nahm die Hände aus den Taschen und hob das Laken von Lydias Gesicht. »Ist das Ihre Frau, Mr. Reed? Ist das Lydia Ellen Reed?«, fragte er. Ezekiel, der sich nun nicht mehr im Blickfeld des Münzenklimperers befand, schloss die Augen. In seinem tiefsten Inneren ergab er sich dem Gedanken an die Endgültigkeit: Lydia war nicht mehr, was eine Folge seines Tuns war; sie gehörte nicht mehr zu ihm. Und nur wenige Stockwerke darüber war auch Lucas, der ebenso reglos dalag, von ihm gegangen, weil Ezekiel nicht achtsam genug gewesen war.
Er wurde erneut gebeten, seine Frau zu identifizieren. »Mr. Reed? Ist das Ihre Frau, Mr. Reed?«, wiederholte sein Begleiter und deutete mit einem Nicken auf Lydia. Lydia war weg, doch ihr Leib, der versagt hatte, war dageblieben: Die weltliche Ausgabe von Lydia Reed beanspruchte auch weiterhin Platz in dieser aquariumartigen Gruft mit ihren zischelnden Leuchtstoffröhren. »Ja«, antwortete Ezekiel. »Ja, das ist Lydia.« Er sprach, und seine Augen weiteten sich, während sich ihm der Hals zuschnürte. »Ja. Das war meine Frau.«
Tagebuch des Dr. Quintus Swann
Die umfangreichen Scans letzte Woche deuten auf eine Contrecoup-Verletzung des Kindes hin. Rückprall nach anfänglichem Frontalhirntrauma mit Schlag auch gegen den hinteren Schädelbereich. Großes Pech. Die Diffusions-Tensor-Bilder zeigen mögliche Schädigungen an den Axonen. Trauma linksseitig stärker als rechts. Wucht des Aufpralls deutlich stärker als erwartet. Eine Pupille zieht sich immer noch nicht zusammen. Insgesamt etliche Faktoren, die offensichtlich einen traurigen Ausgang verheißen. Lässt sich überhaupt eine präzise Prognose für ein Schädel-Hirn-Trauma bei einem Kleinkind stellen? Für ein kleines, unfertiges Gehirn von zwei Jahren, ein Gehirn, das zwei Schläge abbekommen hat und zweimal verletzt wurde? Ein Schlag für jedes Jahr. Schlimme Situation. Aber keine Anzeichen für Rotations- oder Abscherverletzungen. Das sind die guten Nachrichten. Aber es scheint doch für dieses kleine Kind nichts als Pech zu sein. Ich werde schon bald die Einstellung der lebenserhaltenden Maßnahme empfehlen müssen. Der Druck in der Kommission wird immer größer. Ein stiller, aber immenser Druck. Unerfreuliche Lage. Für morgen früh vertiefte Aufnahmen angesetzt, meine Fachberater halten weitere Scans allerdings für ein kostspieliges, überflüssiges Vorgehen. Ich erinnere sie dann: »Aufnahmen können ebenso wie Experten fehlerhaft sein.« Habe noch immer nicht mit der Familie gesprochen. Anscheinend gibt es da einen exzentrischen Vater, der hier herumschleicht. Mit einem ziemlichen Talent für Unheil. Und einer kleinen Gefolgschaft gleichgesinnter Seelen. Ich muss ihm bald die traurigen Alternativen auseinandersetzen. Wenn es denn überhaupt Alternativen gibt, traurige oder sonstige. So ein kleines Leben! Kaum größer als ein Weihnachtsschinken. Gibt es denn nichts, was ich für dieses Kind tun kann? Meinem Gefühl folgen und schauen, wo es hinführt? Doch selbst wenn: Es werden nicht alle Puzzleteile auf einmal zusammenpassen. Die aktuellen Daten könnten sich als unsystematische Artefakte herausstellen oder schlimmer noch: als Fiktion. Es ist verwerflich, Schaden zuzufügen. Noch viel verwerflicher ist es, nichts zu tun. Ich warte ängstlich auf die unweigerlich bevorstehende biochemisch-toxische Kaskade, die seine Überlebenschancen drastisch verringern wird, noch bevor ich handeln kann. Ticktack. Ich glaube, ich kann, ich muss etwas Gutes für dieses Kind tun. Und zwar schnell. Ich habe meinen ersten Pakt mit dem Teufel geschlossen. Ein Lokaljournalist. Ein würdeloser Beruf für Fieslinge und Schnüffler. In einem Krankenhaus voller viktorianisch Bornierter, die einem nicht von der Pelle rücken, werde ich aber jede Hilfe brauchen, die ich bekommen kann. Von allen denkbaren Seiten. Fieslingen. Schnüfflern. Geschäftemachern. Texanischen Altherrenriegen. Allen.
Tagebuch des Rodion Hunt
Heute wieder im Krankenhaus. Ich hatte gehofft, den Freakshow-Vater interviewen zu können. Reverend Ezekiel Reed. Im Krankenhaus erzählen sie, ich müsste lediglich dem Gestank folgen. Er sei ein Fan von billigem Parfum. Ein heiliges Stinktier. Das schreckt offensichtlich den Teufel ab. Habe mehrere Jesus-liebt-dich-Typen auf dem Parkplatz gesehen, die dort Flyer unter Scheibenwischer klemmten. Muss wohl eine Art menschlicher Schutt sein, ein Überbleibsel früheren Geredes, dass bei dem Kind der Stecker gezogen werden soll. Swann gibt zu, dass er wegen der unerwünschten Aufmerksamkeit nervös war. Hält den hirntoten Jungen hinter Schloss und Riegel verborgen. Die Krankenschwestern weigerten sich, selbst meine charmantesten Fragen zu beantworten. Quint hat seine Hausaufgaben gemacht, ich wollte nur die Lage sondieren. Die guten Sachen kommen manchmal von dort, wo das Boot leckt. Es ist klar, dass Quint vorhat, das Kind am Leben zu erhalten, bis der Junge alt genug ist, um wählen zu gehen. Behauptet, er könne einen Teil der geistigen Fähigkeiten des Kindes wiederherstellen. Hat sich fest vorgenommen, die ganze Welt der Neurologie aufzurütteln. Mit nur einem einzigen kleinen Kind. Tausenden verlorenen Kindern eine andere Zukunft zu ermöglichen. Und er ist bereit, mich an seinen spektakulären Ambitionen für das Kind teilhaben zu lassen. An allen schmutzigen Details. Alles für mich, wenn ich zusage, kein Wort über den Jungen zu schreiben, bis er mir grünes Licht gibt. Swann glaubt, beweisen zu können, dass Sexualität und Kognition getrennt voneinander sind. Vollständig getrennt. Selbst jemand, der wie ich mit Wissenschaft nichts am Hut hat, versteht, was das für eine Sprengkraft haben könnte. Wer hätte ahnen können, dass der Arzt viel interessanter ist als der Patient? Dieser Kerl hegt eine übermäßig gesunde Missachtung gegenüber dem Unmöglichen. Ich könnte wetten, dass er nicht durchgeknallt und auch kein Frankenstein ist. Die Geschichte hat es mit denen, die sich um eine Verlängerung der normalen Lebensspanne des Menschen bemühen oder an Gehirnen von Kleinkindern herumdoktern, bisher nicht gerade gut gemeint. Ich habe das Gefühl, der Mann könnte schon bald einen Vorkoster nötig haben, wenn er in der Krankenhaus-Cafeteria essen will. Aber ich habe eine Abmachung. Und eine Abmachung ist eine Abmachung.
Kapitel 2
(1996)
Obwohl Ezekiel aufgrund der Kopfverletzung auf dem linken Ohr nicht mehr so gut hörte, hatte ihn seine Trauer erstaunlich wachsam gemacht. »Ihr Herz ist so kalt, dass man daneben getrost ein Stück Fleisch zum Kühlen aufhängen könnte, Doktor.«
Reverend Ezekiel Reed saß mit der steifen Förmlichkeit eines Diakons in Dr. Quintus Swanns Büro, sprach jedoch immer noch wie ein Prediger. Er hatte sich zuletzt eine unbewusste Geste des Zweifels angewöhnt: Immer wieder berührte er sich seitlich am Hals oder am Handgelenk, um seinen Puls zu finden. Vorerst brauchte Ezekiel diese linkische Art der Rückversicherung noch: seinen Puls zu spüren, um sicher zu sein, dass nicht auch er in dem Moment vernichtet worden war, der seine Frau aus dem Leben gerissen und sein Kind versehrt hatte. Er hatte gerade erfahren, dass sein Sohn irreversibel geschädigt war. Irreversibel. Ebenso, wie Lydia irreversibel tot war. Ezekiel wusste, was das bedeutete, und doch wollte er es nicht wahrhaben. Er war außerstande, sich dem Entsetzen und dem Verlust zu stellen. Er weigerte sich anzuerkennen, dass es einen so schrecklich irrationalen Gott überhaupt geben konnte.
Dem Arzt hatte vor diesem Moment gegraut. Überbringer einer Botschaft zu sein, die eine so intime, so endgültige Trauer auslöste, war ein abscheulicher Aspekt der Arbeit als Mediziner. Dieser Augenblick war immer eine furchtbare, unerträgliche Verletzung der Privatsphäre. Das Ende des Lebens ist eine banale Komponente des Grauens, für einen Arzt so selbstverständlich wie sein Stethoskop.
»Reverend Reed«, begann der Arzt, »jeden Tag muss ich jemandem etwas sagen, das ich gar nicht sagen will. Ich mache das jetzt schon eine ganze Weile, und ich weiß immer noch nicht, wie ich es gut machen soll. Vielleicht stimmt es ja, dass es unter diesen Umständen einfach kein ‚gut‘ gibt. Ihr Verlust tut mir sehr, sehr leid. Der Verlust Ihrer Frau und nun auch der Verlust Ihres Sohnes. Es tut mir schrecklich leid.« Ezekiel erforschte Quints Gesicht, außerstande zu glauben, dass dieses Mitgefühl wirklich ihm galt. Während das starke Parfum des Predigers zu ihm herüberwehte, nahm Quint seine Brille ab und inspizierte sie, als wäre er überzeugt davon, eine Schicht des öligen Duftstoffs darauf zu entdecken. Ezekiel zerrte an der Kette seiner Taschenuhr. Seine Bewegungen wurden unruhiger, schließlich wurde er laut.
»Sie sind da einigen sehr hässlichen Irrtümern erlegen, Sir. Ich habe meinen Sohn noch nicht verloren. Gottes Wunder wird geschehen, um meinen Sohn zu heilen! Wenn die Zeit dafür reif ist. Bald schon, nehme ich an.«
Quintus war in einer ausweglosen Lage: Er wollte Ezekiel Trost spenden, gleichzeitig musste er ihm klarmachen, dass die Situation hoffnungslos war. Er musste jetzt nicht nur versuchen, seinen schnellen Verstand zu bremsen; er war auch bemüht, seinem Herzen etwas Mitleid und Güte für Ezekiel abzutrotzen.
»Es gibt kaum ein anderes Organ, über dessen Funktionsweise wir so wenig wissen wie das menschliche Gehirn«, fuhr Quintus fort. »Obwohl mir klar ist, dass das nur ein sehr schwacher Trost ist: Wir wissen, dass Ihr Sohn zurzeit keine Schmerzen hat.« Das war eine bewusste Verzerrung der Tatsachen: Er hörte sich lügen und dabei die wissenschaftlichen Fakten so weit dehnen, dass daraus Mitleid für Ezekiel wurde. Er versuchte, wieder etwas Vernunft und Ordnung in das Gespräch hineinzubringen. »Aber wir können ebenso sicher und genau vorhersagen, dass er keine glückliche Zukunft haben wird.« Genau? Der nächste Schwindel. In den Neurowissenschaften lässt sich keine Genauigkeit vortäuschen. »Es ist nicht mehr realistisch, an eine Verbesserung seiner Lage zu glauben. Es wird für ihn nicht besser. Es wird niemals besser«, sagte Quintus theatralisch. Doch schon während er diese Worte mit großer Ernsthaftigkeit aussprach, sah er insgeheim eine neue Entschlossenheit in diesem kurzen Moment des Selbsthasses aufleuchten: Könnte er womöglich all seine Fähigkeiten zusammennehmen, um Lucas wiederzuerwecken und ein Leben für ihn zu ersinnen, das auch andere wertschätzen würden?
Auf der anderen Seite des Schreibtisches fuhr Ezekiel mit grotesker biblischer Gewissheit fort: »Schwacher Trost? Nur Narren spotten über die Sünde, Doc. ‚Ihr seid allzumal leidige Tröster!‘ Hiob 16:2.«
Immer wieder räusperte sich Quintus und spielte mit seinen Rezeptblöcken herum, die er wie Schachfiguren auf dem aufgeräumten Schreibtisch hin- und herschob. Er war außerstande, Ezekiel in die Augen zu sehen. Sein Stethoskop fühlte sich wie eine Schlinge um seinen Hals an. Genau das hätte Ezekiel ihm in diesem Moment sicher gewünscht.
Beklommen und bedrohlich saß er da und sprach weiter, als würde er Geschosse durch seine zusammengebissenen Zähne pressen. Sein Verlangen nach Rache stank noch mehr als sein billiges Parfum. »Sie erkennen Gottes Wunder nicht an, Doc? Wenn die Zeit gekommen ist, wird Er seine Hand ausstrecken und meinen Sohn retten! Gott hat zu mir gesprochen. Gottes Wille geschehe. Und jetzt sagen Sie mir, dass Sie meinen Jungen verloren geben? Sie behandeln ihn ja schon jetzt, als wäre er als Unglückskind auf die Welt gekommen. Als wäre er so tot wie Pökelfleisch in der Büchse. Sie stellen sich einfach hin und geben auf!«
Quint tränten die Augen von Ezekiels Maßlosigkeiten. Er nahm sich vor, nie wieder allein mit diesem kauzigen, abstoßenden Mann in einem geschlossenen Raum zu bleiben. Sein Zorn war echt. Der Arzt wählte seine Worte mit Bedacht und sprach ruhig mit Ezekiel, als zitierte er aus einem Leitfaden für Medizinstudenten über den Umgang mit labilen Trauernden. Quintus hatte genug Tod und Sterben gesehen, um die unterschiedlichen Lebensumstände zu akzeptieren.