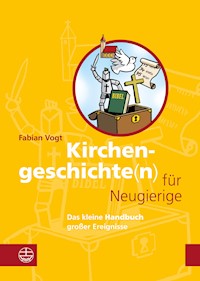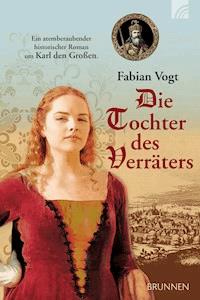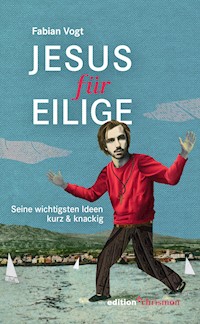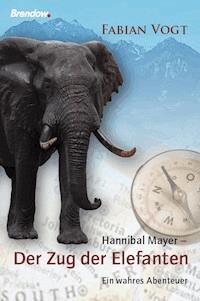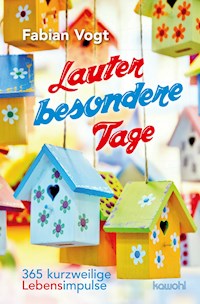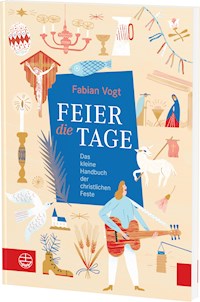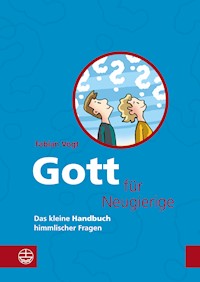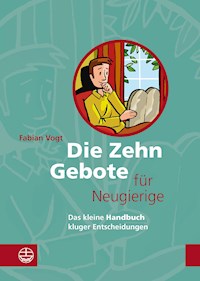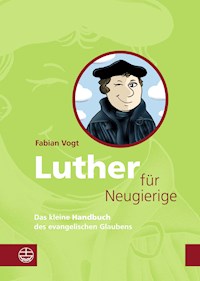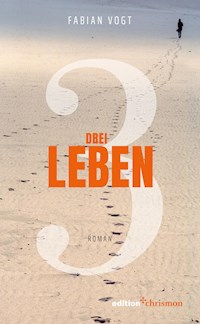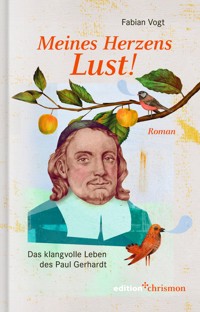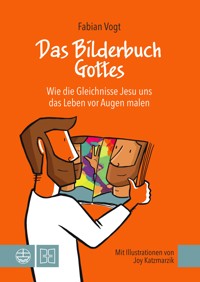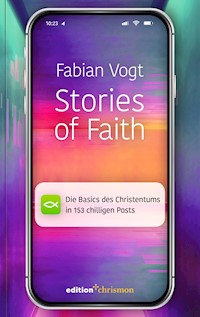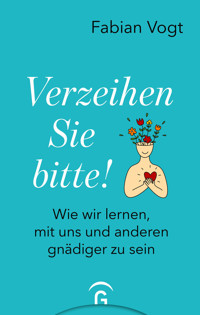
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Verzeihen kann man lernen!
Jeder Mensch hat im Leben schon Momente erlebt, in denen er/sie gerne gnädiger mit sich und anderen umgegangen wäre. Oft halten innere oder äußere Umstände davon ab und machen das Leben damit schwerer als es eigentlich nötig wäre.
Fabian Vogt erklärt in seinem neuen Buch, dass es gar nicht so schwer ist, mit sich und anderen gnädig(er) umzugehen. Mithilfe eines kurzen und sehr heiteren Ausflugs in verschiedene Modelle der Vergebung in der Menschheitsgeschichte analysiert er - immer mit einem Augenzwinkern -, wie Menschen Meister darin sind, sich selbst das Leben schwer zu machen. Anhand von aktuellen Beispielen und Geschichten zeigt er auf, wie ein leichterer und versöhnlicherer Umgang miteinander jetzt und in Zukunft möglich sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wie wäre es, wenn wir einfach mal
wieder ein bisschen gnädiger wären –
mit den anderen, aber auch mit uns selbst?
Weil letztlich unser Glück davon abhängt.
In einer Welt, die Fehler und Versagen (oder das, was man dafür hält) immer gnadenloser verfolgt, ermutigt Fabian Vogt dazu, den Schalter umzulegen und der (Ohn-)Macht der Vergeltung die befreiende Kraft der Vergebung entgegenzusetzen.
In diesem Buch erkundet er neugierig und lebensnah, was geschieht, wenn Gnade vor Recht ergeht und der Kreislauf von Kränkung und Gekränkt-Sein überwunden wird.
Eine Einführung in die Lebenskunst der Vergebung für einen wohlwollenden Umgang mit den anderen und mit sich selbst.
»Wenn du gut zu dir sein willst,
dann vergib den anderen.«
Buddhistische Weisheit
Fabian Vogt, geboren 1967, ist Schriftsteller, Künstler und Theologe. Er schreibt Romane, Kurzgeschichten und unterhaltsame Sachbücher – wenn er nicht gerade Ideen für den ThinkTank »midi« entwickelt. Für seinen Debütroman »Zurück« wurde er mit dem »Deutschen Science Fiction Preis« ausgezeichnet und hat zudem für seine künstlerische Arbeit mehrere Kleinkunstpreise erhalten. Der promovierte Geschichtenerzähler lebt in Berlin.‹
Fabian Vogt
Verzeihen Sie bitte!
Wie wir lernen, mit uns und anderen gnädiger zu sein
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht gelungen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.
Copyright © 2025 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: © Anna Leskinen – istockphoto.com
ISBN 978-3-641-33464-2V002
www.gtvh.de
Der Siege göttlichster ist das Vergeben.
Friedrich Schiller
Inhalt
Vorwort
Verzeihen Sie bitte!
Einleitung
Vergeben oder Vergelten?
1. Der Grund des Verzeihens
Von Schuld, Scham und Kränkung
2. Das Geheimnis des Verzeihens
Was Vergebung wirklich meint
3. Die Dimensionen des Verzeihens
Von mir, den anderen und dem Rest der Welt
4. Die Quelle des Verzeihens
Was Gnade, Freiheit und Heil ermöglichen
5. Das Wesen des Verzeihens
Von der Vergebung zur Lebenshaltung
6. Die Praxis des Verzeihens
Wie man’s konkret macht
7. Die Zukunft des Verzeihens
Was Vergebung mir und der Gesellschaft bringt
Nachwort
Danke
Zum WeiterLesen
Wir vergeben,
solange wir lieben!
François de La Rochefoucauld
Vorwort
Verzeihen Sie bitte!
Der Kanzlerkandidat Armin Laschet lacht. Und wie! Leider … tja, leider an der falschen Stelle. Nämlich während einer emotionalen Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im vom Hochwasser schwer getroffenen Rhein-Erft-Kreis. Als es gerade um die Opfer der Flut geht.
Armin Laschet lacht. Im Hintergrund. Und sofort beginnt ein medialer Shitstorm, der – da sind sich viele Beobachterinnen und Beobachter einig – den Kandidaten und seine Partei den Wahlsieg kostet. Ein Lachen. Ein kurzes Lachen! Zwei Sekunden.
War dieses Lachen unangebracht? Auf jeden Fall! Das gehört sich bei einer solchen Veranstaltung tatsächlich nicht. Sagt es etwas Wesentliches über die Qualifikation Laschets zum Bundeskanzler und über seine Persönlichkeit aus? Nein! Natürlich nicht. Außerdem betont der Politiker nachher gebetsmühlenartig, wie leid ihm sein Ausrutscher tue. Unendlich leid sogar.
Hilft aber alles nichts. Eine überraschend hohe Zahl an Deutschen scheint nicht bereit, Armin Laschet diesen einmaligen Fauxpas, einen blöden Ausrutscher, zu verzeihen. Vielleicht ist es deshalb kein Zufall, dass ausgerechnet Frank-Walter Steinmeier im ZDF-Sommerinterview 2024 betroffen erklärt, er nehme wahr, »dass der Ton in unserer Gesellschaft zunehmend unversöhnlicher wird.« Offensichtlich gibt es einen allgemeinen Trend, Fehler nicht mehr zu vergeben.
Die Folgen der wachsenden Gnadenlosigkeit erleben nicht nur Prominente wie Armin Laschet oder Margot Käßmann (die 2010 nach einer kurzen Autofahrt unter Alkohol-Einfluss von ihrem Amt als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland zurücktritt) … oder der Fußballer Kai Havertz (dem erboste Fans Anfang 2025 nach einem verschossenen Elfmeter beim AC Arsenal drohen, sein noch ungeborenes Kind zu töten); auch Millionen von Social-Media-Nutzerinnen und -nutzern, die sich zu irgendeinem x-beliebigen Thema äußern, werden täglich von Hass, Wut, Aggression, Drohungen und Beleidigungen überrollt. Wie gesagt: gnadenlos! Schonungslos! Erbarmungslos!
Inzwischen scheint es fast egal zu sein, was man öffentlich sagt, schreibt oder tut … erstaunlich viele Menschen kennen sprichwörtlich »keine Gnade mehr« und geben jeder und jedem im Netz Postenden zu verstehen, dass sie oder er nicht nur einen unverzeihlichen Fehler gemacht hat, sondern »vermutlich« selbst ein Fehler ist, ein bedauernswertes Missgeschick der Evolution. Eine Aussage, auf die in den Sozialen Medien jetzt garantiert jemand grantig reagieren würde: »WIESO ›VERMUTLICH‹ EINFEHLER? … GANZSICHER!«
Aus kritischer Auseinandersetzung wird so ganz schnell Verachtung. Aus Dialog wird Hetze. Aus Wahrheitssuche wird Abgrenzung. Unterstellt wird dem Gegenüber nämlich immer das Schlechteste! Und das serviert mit einer ordentlichen Portion Gift und Galle, Geifer und Groll. Tohuwabohu pur in einer abschreckenden Kulisse aus Feindbildern und Zwietracht.
Erschreckend an dieser befremdlichen Entwicklung ist vor allem eines: Ein derart omnipräsenter Geist der Intoleranz sorgt dafür, dass wir uns auch im privaten Bereich immer schwerer tun, anderen Personen, die uns ein Unrecht oder ein Leid angetan haben, zu vergeben … und das ist noch nicht alles.
Mindestens genauso verheerend wirkt es sich auf das gesamtgesellschaftliche Klima aus, dass wir auch mit uns selbst zunehmend unerbittlich ins Gericht gehen. Ja, immer mehr Frauen und Männer hadern damit, sich selbst zu verzeihen. Sprich, auch in diesem Bereich wächst die Gnadenlosigkeit: Aus Sorge, den Ansprüchen anderer (oder den eigenen) nicht zu genügen, kämpfen Menschen verzweifelt mit Bodyshaming, Leistungsdruck oder dem Impostor-Syndrom (der folgenschweren Angst, nicht gut genug zu sein).
Die Therapie-Praxen Europas und Amerikas sind voll mit verzweifelten Wesen, die sich irgendwelche Fehltritte, Entgleisungen oder missliche Entwicklungen in ihrer Vergangenheit nicht vergeben können – und darunter unglaublich leiden. Getrieben von dem destruktiven Gefühl: »Ich entspreche wohl nicht den Erwartungen.«
Auch mit uns selbst haben wir also nachweislich immer weniger Erbarmen. Anders ausgedrückt: Es passiert allzu oft, dass wir uns eben nicht verzeihen – beziehungsweise alles dafür tun, dass wir unsere vermeintlichen Fehler verdrängen. Wir bearbeiten unsere Selfies aus lauter Verzweiflung gnadenlos mit hanebüchenen Filtern oder lassen sogar unsere Körper plastisch-chirurgisch optimieren, damit wir bitte alle so ästhetisch, perfekt und filmreif aussehen wie Julia Roberts und Brad Pitt (oder wie Alicia Vikander und Nicholas Hoult – je nach Generation). Damit uns der Erfolg aus allen Knopflöchern strahlt. Und wehe, wenn nicht!
Wie wäre es, wenn wir einfach mal wieder ein bisschen gnädiger wären? Mit den anderen, aber auch mit uns selbst? In einer Welt, die immer unbarmherziger, perfektionistischer und ungnädiger wird. Warum? Weil letztlich unser Glück davon abhängt.
Dieses Buch will Mut (und Lust) machen, den Schalter umzulegen und der zerstörerischen (Ohn-)Macht der Vergeltung und des Verzagens die befreiende Kraft der Vergebung entgegenzusetzen. Gerade, weil es niemanden auf dieser Welt gibt, der nicht im Lauf seines Erden-Daseins irgendwann verletzt wird oder andere verletzt und desillusioniert.
Ja, jede und jeder von uns macht die Erfahrung, dass Menschen unsere Gefühle so schwer und so tief enttäuschen, dass der Schmerz darüber partout nicht mehr lockerlassen will. Alle, die das gelegentlich vergessen, seien noch mal daran erinnert: Diese verrückte, einzigartige Melange aus Gelingen und Misslingen nennt man »Leben«. Und das läuft nicht immer gradlinig. Leider.
Entscheidend ist deshalb nicht die Frage, wie wir derartige Verletzungen vermeiden (was gar nicht möglich wäre), sondern wie wir mit ihnen umgehen; besonders mit den tiefen Demütigungen, die auch nach Jahren nicht heilen wollen. Weil wir alle wissen: Es gibt Verletzungserfahrungen, die eine Existenz zerstören können. Schon in der Antike wurde in allen Schänken Italiens erzählt, dass die Römerin Lucrezia sich das Leben genommen habe, weil sie von einem Mann namens Sextus Tarquinius vergewaltigt worden war und mit der dadurch ausgelösten Scham nicht mehr leben konnte und wollte.
Bei unserem Thema geht es aber nicht nur darum zu verstehen, was Vergebung ausmacht und wie man sie erlernen, üben und praktizieren kann, sondern auch darum zu entdecken, dass »Verzeihen« letztlich eine Haltung meint, eine Lebenseinstellung … weil sich mit dem Vergeben ein ganz eigenes Menschenbild und ein neuer achtsamer Umgang mit den Herausforderungen des Daseins verbinden.
Mehr noch: Vergebung stellt letztlich ein Stück Lebenskunst dar. Eine Lebenskunst, die selbst langjährige Erbitterungen durchbrechen kann, die es ermöglicht, die tragischen Folgen der Opfer-Rolle hinter sich zu lassen und unbeschwert von den Belastungen der Vergangenheit die Zukunft zu gestalten.
Trotzdem wundert es nicht, dass sich viele Leute mit Vergebung, besonders mit der Idee der Gnade eher schwertun. Denn – ganz ehrlich – eigentlich ist Vergebung eine Sauerei. Ja: sogar eine Riesen-Sauerei! Eine Anstößigkeit sondergleichen. Weil sie unsere tiefsitzenden Vorstellungen von Gerechtigkeit über den Haufen wirft. Was mehr als dreist ist.
Um ehrlich zu sein: Wer einer Täterin oder einem Täter verzeiht, reißt uralte Ordnungen entzwei und rührt an tiefsitzende Selbstverständlichkeiten. Schließlich ahnen wir alle: Böse Taten sollten gesühnt werden. Als läge uns der Wille zum Heimzahlen irgendwie im Blut. Oder wäre genetisch in unserer DNA verankert.
Als die Holocaust-Überlebende Eva Mozes Kor zum 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz erklärte, sie habe den Nazis und ihren Peinigern im KZ deren Gräueltaten vergeben, gab es einen weltweiten Aufschrei. Quer durch alle Nationen und Religionen. Wer so etwas sage, selbst als Betroffene, der verspotte das Andenken der Millionen Ermordeten und werde der Widerwärtigkeit des Geschehenen auf keinen Fall gerecht. Ungeheuerlich sei das!
Der Philosoph Vladimir Jankélévitch erklärte in seinem Essay »Verzeihen?« daraufhin unmissverständlich, die Schuld der Deutschen bleibe ewig und lasse sich durch nichts entschuldigen. Im Gegenzug fand Marianne Bachmeier, die 1981 im Landgericht Lübeck kurzerhand den Mörder ihrer Tochter erschoss, in der Öffentlichkeit erstaunlich viel Zustimmung. Oder zumindest Verständnis: Das war doch nur gerecht.
Natürlich – und womöglich aus gutem Grund – verspüren wir ein tiefsitzendes Unbehagen, wenn der amerikanische Präsident Donald Trump in den USA die Gewalttäter des Kapitol-Sturms von 2021 so mir nichts, dir nichts begnadigt (die zudem in der Regel höchst uneinsichtig sind); so, wie wir auch nachvollziehen können, dass im Ruhrgebiet ein Großteil einer Kirchengemeinde den Gottesdienstraum verließ, als der anwesende Priester verkündete, man müsse selbst den sexuellen Missbrauchstätern in der Kirche verzeihen. Wie bitte? Wo kommen wir denn da hin? Da, wo »Gnade vor Recht« ergeht, werden das Recht und damit die Gerechtigkeit kurzerhand ausgehebelt. Oder nicht?
Svenja Flasspöhler, Philosophin und Journalistin, zumindest bemerkt treffend: »Wer verzeiht, handelt weder gerecht noch ökonomisch noch logisch.« Stimmt! Wer verzeiht, die oder der durchbricht das uralte Werte-Muster von Gut und Böse. Falsch und Wahr. Recht und Unrecht. Was uns verständlicherweise gegen den Strich geht: »So was gehört sich nicht!« Der Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth meint sogar: »Die Wirklichkeit der Gnade ist nicht ableitbar aus der Ordnung menschlicher Gründe und Normen. Gnade ereignet sich als Unterbrechung dieser Ordnung.«
Was das genau bedeutet und warum wir eine solche Unterbrechung vermeintlich festzementierter gesellschaftlicher Regelungen viel öfter brauchen, um der derzeitigen lebensfeindlichen Gnadenlosigkeit (die sich unter anderem in Polarisierungen, Feindbildern und einer emotionalen Eiszeit manifestiert), etwas Zukunftsweisendes entgegenzusetzen, wird in den folgenden Kapiteln neugierig erkundet.
Dabei gilt: Nicht nur weil ich Theologie studiert habe, kann ich in einem Buch über »Die Kunst der Vergebung« nicht anders, als auch die christliche Perspektive der Gnade miteinzubinden. Denn tatsächlich sind »Gnade« und »Vergebung« seit Jahrtausenden hochtheologische Begriffe – und keine andere Weltreligion hat sich so intensiv mit der Bedeutung von Vergebung und Barmherzigkeit auseinandergesetzt wie das Christentum.
Bis dahin, dass nach wie vor in jedem Gottesdienst in einem der bekanntesten Gebete der Welt, dem Vaterunser, von allen Beteiligten verkündet wird: »Vergib uns unsere Schuld – wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.« (Also: Wir vergeben auch denen, die an uns schuldig geworden sind.) Zeitloser kann eine Bitte um Verzeihen gar nicht sein. Aktueller. Und umfassender. Weil die Vision von einer Welt voller Gnade zur Kernbotschaft des Wanderpredigers Jesus von Nazareth gehört.
Bei all dem bin ich überzeugt: Wenn Sie einmal angefangen haben, sich und anderen zu vergeben, leben sie anders … gelassener, friedvoller, freier und zuversichtlicher. Außerdem ist das Leben viel zu kurz, um es verbittert, erbost und voller Groll zu verbringen. Die Philosophin Susanne Boshammer ist deshalb der Überzeugung: »Wer verzeiht, entscheidet sich dafür, den berechtigten Groll auf den anderen, den Hass und die Wut zu überwinden.«
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen: Wer verzeihen kann, der gibt seinem Leben einen neuen Rahmen – einen, der das Potenzial mitbringt, die Welt zu verändern. Weil die »verzeihende« Form der Weltbetrachtung einlädt, aus dem Kreislauf von Kränkung und Gekränkt-Sein kurzerhand auszusteigen. Weil sie bewusst »Gnade vor Recht« ergehen lässt – und so die mit dem geschehenen Unrecht verbundenen Bekümmernisse, Brüche und Verletzungen weise überwindet.
Nebenbei: Vergebung ist tatsächlich jederzeit möglich. Selbst dann, wenn die Täterin oder der Täter unerreichbar oder schon tot ist. Weil Vergebung nicht das Gleiche meint wie Versöhnung. Und weil sie gar nicht verlangt, dass die Missetat der oder des Anderen relativiert wird (auch das werden wir noch ausführlicher betrachten).
Das heißt zum Beispiel: Ein Mensch kann sehr wohl seiner Partnerin oder seinem Partner einen Seitensprung verzeihen – und sich trotzdem von ihr oder ihm trennen. So wie ich auch einem Missbrauchstäter verzeihen und ihn trotzdem vor Gericht bringen kann. Das eine hat mit dem anderen erstaunlich wenig zu tun. Umso wichtiger ist es, den Nuancen dessen nachzuspüren, was Vergebung genau meint und worin ihre heilsame Wirkung liegt.
Als der französische Journalist Antoine Leiris 2015 bei dem grausamen Terroranschlag im Pariser Konzertsaal Bataclan seine Frau Hélène verliert, veröffentlicht er wenige Tage später einen Aufsehen erregenden Brief an die Attentäter, den er mit dem Satz überschreibt: »Meinen Hass bekommt ihr nicht.« Was für eine wuchtige Formulierung: »Meinen Hass bekommt ihr nicht.«
Vermutlich würde Leiris das, was er damit sagen will, gar nicht als einen Akt des Verzeihens bezeichnen, trotzdem skizziert sein Satz einen der Kerngedanken der Vergebung: Ich gebe der Täterin, dem Täter, den Tätern keine Macht über meine Gedanken – und damit auch nicht über mein Leben. Das, was sie getan haben, ist schon abscheulich genug. Wenn ich zulasse, dass der Hass auf sie fortan mein ganzes Dasein bestimmt, dann haben sie wirklich gewonnen. Darum: »Meinen Hass bekommt ihr nicht.«
Diese freisetzende Perspektive gilt genauso für diejenigen, die sich selbst für etwas hassen, das sie schuldhaft ausgelöst haben. Denn ganz gleich, wie schrecklich eine Tat in der Vergangenheit war: Solange sie auch meine Gegenwart beherrscht, läuft etwas schief. Und zwar gehörig. Vergebung ist die liebevolle Systemsprengerin, die zu einem neuen Denken einlädt, das mich wieder frei und gestaltungsfähig sein lässt – und das es mir ermöglicht, destruktive Emotionen wie Hass und Wut in etwas Lebensstiftendes zu verwandeln.
In diesem Sinne: Verzeihen Sie bitte! Es lohnt sich.