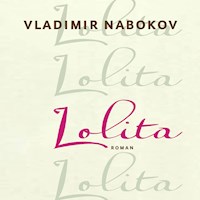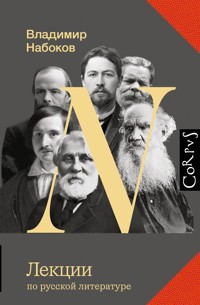9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Bluttat als Kunstwerk: In seinem frühen Roman erzählt Vladimir Nabokov, angeregt durch einen spektakulären Kriminalfall im Deutschland der zwanziger Jahre, die Geschichte eines mörderischen Versicherungsbetrugs. Verfilmt von R. W. Fassbinder unter dem Titel «Eine Reise ins Licht – Despair».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Vladimir Nabokov
Verzweiflung
Roman
Über dieses Buch
Die Bluttat als Kunstwerk: In seinem frühen Roman erzählt Vladimir Nabokov, angeregt durch einen spektakulären Kriminalfall im Deutschland der zwanziger Jahre, die Geschichte eines mörderischen Versicherungsbetrugs. Verfilmt von R.W. Fassbinder unter dem Titel «Eine Reise ins Licht – Despair».
Vita
Vladimir Nabokov ist einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Er entstammte einer großbürgerlichen russischen Familie, die nach der Oktoberrevolution von 1917 emigrierte. Nach Jahren in Cambridge, Berlin und Paris verließ Nabokov 1940 Europa und siedelte in die USA über, wo er an verschiedenen Universitäten arbeitete.
In den USA begann er, seine Romane auf Englisch zu verfassen, «Lolita» war Nabokovs Liebeserklärung an die englische Sprache, wie er im Nachwort selber schrieb. Nach einer anfänglich schwierigen Publikationsgeschichte wurde «Lolita» zum Welterfolg, der es Nabokov ermöglichte, sich nur noch dem Schreiben zu widmen.
Nabokov zog in die Schweiz, wo er schrieb, Schmetterlinge fing und seine russischen Romane ins Englische übersetzte.
Er lebte in einem Hotel in Montreux, wo er am 5. Juli 1977 starb.
Der Herausgeber, Dieter E. Zimmer, geboren 1934 in Berlin, 1959 bis 1999 Redakteur der Wochenzeitung «Die Zeit», seit 2000 freier Autor. Zahlreiche Veröffentlichungen über Themen der Psychologie, Biologie und Anthropologie, literarische Übersetzungen (u.a. Nabokov, Joyce, Borges).
Das Gesamtwerk von Vladimir Nabokov erscheint im Rowohlt Verlag.
Impressum
Geschrieben zwischen Juni und September 1932 in Berlin-Schöneberg auf Russisch unter dem Titel «Ottschajanije» (Verzweiflung). Erstveröffentlichung 1934 in Fortsetzungen in der Pariser Zeitschrift «Sowremennyje sapiski» und als Buch 1936 bei dem russischen Emigrantenverlag Petropolis, Berlin. 1937 übersetzte Nabokov den Roman ins Englische unter dem Titel «Despair» für den Verlag John Long, London.
In einer vom Autor überarbeiteten Übersetzung erschien die endgültige Fassung 1966 bei G.P. Putnam’s Sons in New York.
Die deutsche Übersetzung von Klaus Birkenhauer erschien 1972 im Rowohlt Verlag, Reinbek, und wurde 1997 in Band 3 der Gesammelten Werke übernommen.
Der Text folgt: Vladimir Nabokov, Gesammelte Werke, Band 3, Frühe Romane, herausgegeben von Dieter E. Zimmer.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, August 2017
Copyright © 1972, 1997, 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Despair» Copyright © 1965, 1966 by Vladimir Nabokov
Veröffentlicht im Einvernehmen mit The Estate of Vladimir Nabokov
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung neuebildanstalt/Crome
ISBN 978-3-644-40347-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Véra
Kapitel 1
Wenn ich meines schriftstellerischen Vermögens und meiner erstaunlichen Fähigkeit, Vorstellungen mit höchster Anmut und Lebendigkeit auszudrücken, nicht völlig sicher wäre … So etwa wollte ich eigentlich meine Geschichte beginnen. Weiter hätte ich die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Tatsache gelenkt, dass ich ohne dieses Vermögen, diese Fähigkeit und so weiter nicht nur davon abgesehen hätte, gewisse noch nicht lange zurückliegende Ereignisse zu schildern, sondern dann gar nichts zu schildern gewesen wäre, denn, geneigter Leser, es hätte sich ja überhaupt nichts ereignet. Närrisch vielleicht, aber zumindest klar. Allein die Gabe, die Schliche des Lebens zu durchschauen, eine angeborene Bereitschaft, meine Schöpferkräfte unablässig zu erproben, konnten mich instand setzen … An diesem Punkt wollte ich den Sünder wider die Gesetze, die so viel Aufhebens machen um ein bisschen vergossenes Blut, mit einem Dichter oder Schauspieler vergleichen. Aber wie mein armer linkshändiger Freund zu sagen pflegte: Das philosophische Spekulieren ist eine Erfindung der Reichen. Nieder damit.
Es mag so aussehen, als wüsste ich nicht, wie ich beginnen soll. Ein komischer Anblick, dieser ältere Herr, der mit wabbelnden Hamsterbacken vorbeigekeucht kommt, in kühnem Sturm auf den letzten Bus, den er schließlich einholt; aber er fürchtet sich, im Fahren aufzuspringen, und bleibt mit einem Schafslächeln zurück, immer noch in Trab. Habe ich wirklich nicht den Mut, diesen Sprung zu tun? Ein Aufdröhnen, die Geschwindigkeit wächst, gleich wird er unwiderruflich um die Ecke verschwinden, der Bus, der Omnibus, der mächtige Solemnibus meiner Geschichte. Recht schwergewichtige Metaphorik das. Ich renne immer noch.
Mein Vater war ein russischsprachiger Deutscher aus Reval, wo er eine berühmte landwirtschaftliche Hochschule besuchte. Meine Mutter, eine reinblütige Russin, entstammte einem alten Fürstengeschlecht. An heißen Sommertagen ruhte sie gewöhnlich in ihrem Schaukelstuhl, eine leidende Dame in lila Seide, fächerte sich Kühlung zu, knabberte Schokolade; alle Rouleaus waren herabgelassen, und der Wind von einem frisch gemähten Feld blähte sie wie purpurne Segel.
Während des Krieges wurde ich als deutscher Staatsbürger interniert … ein ziemliches Pech, wenn man bedenkt, dass ich gerade erst die Universität von St. Petersburg bezogen hatte. Von Ende 1914 bis Mitte 1919 las ich genau eintausendundachtzehn Bücher … habe sie gezählt. Auf dem Weg nach Deutschland blieb ich drei Monate in Moskau hängen und heiratete dort. Seit 1920 lebte ich in Berlin. Am 9. Mai 1930, ich war gerade fünfunddreißig Jahre alt …
Eine kleine Abschweifung: die Sache mit meiner Mutter – das war eine bewusste Lüge. In Wirklichkeit war sie eine Frau aus dem Volke, einfach und derb, schlampig mit einem Kittel bekleidet, der locker um ihre Hüften hing. Ich hätte es natürlich durchstreichen können, aber ich lasse es mit Absicht stehen – als Beispiel für einen meiner wesentlichen Charakterzüge: meine leichtherzige, einfallsreiche Lügenhaftigkeit.
Also, wie ich gerade sagte: Am 9. Mai 1930 befand ich mich auf einer Geschäftsreise in Prag. Ich war in der Schokoladenbranche. Schokolade ist eine gute Sache. Manche jungen Dämchen mögen nur Zartbitter … verwöhnte kleine Zierpuppen. (Ich weiß nicht recht, weshalb ich in diesem Ton schreibe.)
Meine Hände zittern, ich möchte kreischen oder irgendetwas mit einem Knall zerschmettern … Diese Stimmung dürfte der ungestörten Entfaltung einer ruhig fließenden Geschichte kaum förderlich sein. Mein Herz sticht, scheußliches Gefühl. Ruhig jetzt, nicht den Kopf verlieren. Sonst komme ich nicht voran. Ganz ruhig. Schokolade wird, wie jeder weiß … (Der Leser möge sich hier eine Beschreibung ihrer Fabrikation vorstellen.) Unser Warenzeichen auf der Verpackung zeigte eine Dame in Lila, mit einem Fächer. Wir drängten gerade eine ausländische Firma, die vor dem Bankrott stand, ihre Produktion mit der unsrigen zusammenzulegen, um gemeinsam die Tschechoslowakei zu versorgen, und aus diesem Grunde war ich in Prag. Am Morgen des 9. Mai verließ ich mein Hotel und fuhr mit einem Taxi nach … Stumpfsinnige Arbeit, all dies wiederzuerzählen. Langweilt mich zu Tode. Aber wie heftig ich auch danach verlange, schnell zum springenden Punkt vorzudringen – ein paar einführende Erläuterungen scheinen unerlässlich. Bringen wir sie hinter uns: Die Geschäftsstelle der Firma, so zeigte sich, lag ganz am Rande der Stadt, und den Mann, den ich sprechen wollte, traf ich nicht an. Man sagte mir, er werde in ungefähr einer Stunde zurück …
Ich glaube, ich sollte den Leser wissen lassen, dass gerade eine lange Pause verstrichen ist. Die Sonne hatte Zeit unterzugehen, und auf ihrem Weg hinab färbte sie die Wolken über dem Pyrenäenberg, der mich so an den Fujiyama erinnert, blutrot. Ich saß in seltsamer Erschöpfung da, horchte auf das Brausen und Krachen des Windes, kritzelte Nasen auf den Rand des Blattes, sank in einen unruhigen Schlummer und schreckte dann plötzlich hoch, am ganzen Körper zitternd. Und wieder wallte in mir jenes stechende Gefühl auf, jenes unerträgliche Beben … und mein Wille lag schlaff darnieder in einer leeren Welt … Es kostete mich große Anstrengung, das Licht einzuschalten und eine neue Feder in den Halter zu stecken. Die alte war abgewetzt und verbogen und sieht jetzt aus wie der Schnabel eines Raubvogels. Nein, dies sind keine Schöpferqualen … sondern etwas ganz anderes.
Also, wie ich gerade sagte: Der Mann war nicht da, in einer Stunde sollte er zurück sein. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, machte ich einen kleinen Spaziergang. Es war ein flotter, frischer, blauscheckiger Tag; der Wind, ein entfernter Verwandter des hiesigen, strich flügelschlagend durch die schmalen Straßen; von Zeit zu Zeit ließ eine Wolke die Sonne verschwinden und wieder auftauchen, wie ein Zauberkünstler die Münze in seiner Hand. Die Parkanlage, wo Invaliden in Rollstühlen herumkurbelten, war ein stürmisches Meer wogender Fliederbüsche. Ich sah mir Ladenschilder an, fand hier und da ein Wort, in dem sich eine mir vertraute slawische Wurzel verbarg, doch überwuchert von einer unvertrauten Bedeutung. Ich trug neue gelbe Handschuhe[1] und schlenkerte mit den Armen, während ich ziellos weiterbummelte. Dann plötzlich brach die Häuserzeile ab und gab eine weite, offene Fläche frei, die auf den ersten Blick sehr ländlich und anziehend wirkte.
Nachdem ich an Kasernengebäuden vorbeigekommen war, vor denen ein Soldat einen Schimmel bewegte, ging ich auf weicher, klebriger Erde; Löwenzahn zitterte im Wind, und ein Schuh mit einem Loch briet unter einem Zaun in der Sonne. Etwas weiter strebte eine Anhöhe stolz und steil zum Himmel auf. Beschloss, sie zu erklimmen. Das stolze Streben erwies sich als Täuschung. Zwischen verkümmerten Buchen und Holunderbüschen führte ein Zickzackweg, in den man Stufen geschlagen hatte, immer höher. Zunächst hoffte ich, gleich nach der nächsten Wendung des Weges zu einem Plätzchen von wilder und wundersamer Schönheit zu gelangen, aber es kam und kam nicht. Diese eintönige Vegetation konnte mich nicht befriedigen. Die Büsche wuchsen in unregelmäßigen Abständen aus einem kahlen Boden, der von Papierfetzen, Lumpen und zerdrückten Blechdosen übersät war. Man konnte die Stufen des Pfades nicht verlassen, denn er grub sich sehr tief in den Hang hinein, und beiderseits drängten Baumwurzeln und die Gerippe von faulendem Moos aus seinen Erdwänden, wie die zerbrochenen Sprungfedern altersschwacher Möbel in einem Haus, in dem ein Verrückter eines furchtbaren Todes starb. Als ich endlich die Höhe erreichte, fand ich dort ein paar schiefe Hütten, eine Wäscheleine und daran ein paar Hosen, die der Wind zu trügerischem Leben blähte.
Ich stützte die Ellbogen auf das knorrige Holzgeländer, schaute hinab und erblickte, weit unter mir und in einen leichten Dunstschleier gehüllt, Prag; flimmernde Dächer, rauchende Kamine, die Kasernengebäude, an denen ich gerade vorbeigekommen war, und einen winzigen Schimmel.
In der Absicht, auf einem anderen Weg hinabzusteigen, schlug ich die Straße ein, die ich hinter den Hütten entdeckte. Das einzig Schöne in dieser Landschaft war die Kuppel eines Gasometers auf einem Hügel: Gesund und rund vor blauem Himmel, sah er aus wie ein riesiger Fußball. Ich verließ die Straße und machte mich abermals ans Klettern, diesmal einen dünn mit Gras bewachsenen Hang hinauf. Trostloses Ödland. Das Rattern eines Lastwagens drang von der Straße herauf, ein Handkarren kam in entgegengesetzter Richtung vorbei, dann ein Radfahrer, dann, scheußlich regenbogenfarben, der Lieferwagen einer Anstreicherfirma. Im Spektrum dieser Halunken lag das grüne Band unmittelbar neben dem roten.
Eine Zeitlang blieb ich stehen und blickte den Hang hinunter auf die Straße; dann wandte ich mich ab, ging weiter, entdeckte einen kaum sichtbaren Pfad, der zwischen zwei kahlen Buckeln hindurchführte, und kurze Zeit später sah ich mich nach einem Rastplatz um. In einiger Entfernung, unter einem Dornbusch, lag ein Mann flach auf dem Rücken, die Mütze im Gesicht. Ich war im Begriff vorbeizugehen, aber irgendetwas an seiner Haltung zog mich in einen seltsamen Bann: die betonte Unbeweglichkeit, die Leblosigkeit der weit gespreizten Beine, die Steifheit des halb angewinkelten Arms. Er trug eine dunkle Jacke und eine abgewetzte Cordhose.
«Unsinn», sagte ich mir. «Er schläft. Er schläft ganz einfach. Kein Grund, ihn zu stören.» Doch nichtsdestoweniger trat ich näher und schnellte mit der Spitze meines eleganten Schuhs die Mütze von seinem Gesicht.
Einen Tusch bitte! Oder besser noch: jenen Trommelwirbel, der ein atemraubendes Akrobatenkunststück begleitet. Unglaublich! Ich zweifelte an der Wirklichkeit dessen, was ich vor mir sah, ich zweifelte an meinem gesunden Verstand, fühlte mich übel und matt – ehrlich, ich musste mich hinsetzen, so sehr zitterten mir die Knie.
Nun, wenn jemand anders an meiner Stelle gewesen wäre und hätte dasselbe gesehen wie ich, er wäre vielleicht in schallendes Gelächter ausgebrochen. Ich dagegen war zu benommen von dem hier mitschwingenden Geheimnis. Während ich hinschaute, schien alles in mir seinen Halt zu verlieren und zehn Stockwerke tief hinabzustürzen. Ich starrte auf ein Wunder. Seine Vollkommenheit, ohne jeglichen Grund oder Zweck, erfüllte mich mit sonderbarer Ehrfurcht.
An diesem Punkt, da ich beim Wesentlichen angekommen bin und der Feuerbrand dieser Neugier gelöscht ist, schickt es sich vermutlich, dass ich meiner Prosa das Kommando «Rühren» entbiete, ruhig meine Schritte zurückverfolge und versuche, meine genaue Stimmung an jenem Morgen zu kennzeichnen und den Weg zu beschreiben, den meine Gedanken wanderten, als ich den Vertreter der Firma nicht angetroffen hatte und jenen Spaziergang machte, jene Anhöhe erklomm und hinüberstarrte auf die rote Rundheit jenes Gasometers vor dem blauen Hintergrund eines windigen Maitages. Diese Angelegenheit muss unbedingt geklärt werden. Betrachten Sie mich deshalb noch einmal vor der Begegnung, als ich, mit hellen Handschuhen, aber ohne Hut, ziellos umherschlenderte. Was ging da in meinem Kopf vor? Überhaupt nichts, merkwürdigerweise. Ich war absolut leer wie ein durchscheinendes Gefäß, das dazu verdammt ist, noch unbekannte Inhalte aufzunehmen. Anflüge von Gedanken über das Geschäft, das ich abschließen wollte, über den Wagen, den ich kürzlich gekauft hatte, über diese oder jene Eigenart der mich umgebenden Landschaft umspielten sozusagen die Außenseite meines Verstandes, und wenn überhaupt etwas in der weiten Wildnis meines Innern widerhallte, dann lediglich das unklare Gefühl irgendeiner Kraft, die mich vorantrieb.
Ein kluger Lette, mit dem ich 1919 in Moskau Umgang pflegte, sagte mir einmal, jene Wolken der Düsternis, die gelegentlich ohne jeden Grund über mich kämen, seien ein sicheres Vorzeichen, dass ich einmal im Irrenhaus enden würde. Er übertrieb natürlich; im Laufe dieses letzten Jahres habe ich sie gründlich auf die Probe gestellt, die außerordentlichen Qualitäten meines klaren und schlüssigen Denkens, in dessen logischem Bauwerk sich mein stark ausgebildeter, aber völlig normaler Verstand wohlfühlte. Possenspiele aus einer Laune des Augenblicks, künstlerisches Vorstellungsvermögen, Erleuchtungen – all diese großartigen Dinge, die meinem Leben solche Schönheit verliehen haben, werden voraussichtlich den Laien, so klug er auch sei, als Vorboten milden Wahnsinns anmuten. Aber keine Sorge: Meine Gesundheit ist vortrefflich, mein Körper außen blank und innen rein, mein Gang locker und ungezwungen; weder trinke noch rauche ich im Übermaß, und ich lebe auch nicht in Ausschweifung. Dergestalt bei bester Gesundheit, gut gekleidet und jugendlichen Aussehens, durchstreifte ich die oben beschriebene Landschaft; und meine geheime Erleuchtung täuschte mich nicht. Ich fand den Gegenstand, dem ich unbewusst auf der Spur gewesen war. Lassen Sie es mich wiederholen – unglaublich! Ich starrte auf ein Wunder, und seine Vollkommenheit, ohne jeglichen Grund oder Zweck, erfüllte mich mit sonderbarer Ehrfurcht. Doch vielleicht begann meine Vernunft schon damals, während ich noch so starrte, die Vollkommenheit in Zweifel zu ziehen, nach dem Grund zu suchen, am Zweck herumzurätseln.
Mit scharfem Schnüffeln holte er Luft; Wellen des Lebens kräuselten über sein Gesicht – das Wunder wurde dadurch leicht beschädigt, aber es war noch da. Dann schlug er die Augen auf, blinzelte misstrauisch zu mir herüber, setzte sich und begann unter endlosem Gähnen – davon konnte er gar nicht genug kriegen – sich am Kopf zu kratzen, beide Hände tief in seinem braunen fettigen Haar vergraben.
Er war in meinem Alter, schlank, schmutzig, mit einem Dreitagebart; ein schmaler Streifen rosa Fleischs schimmerte zwischen der unteren Kante seines Kragens (weich, mit zwei ausgeweiteten Schlitzen für den fehlenden Kragenknopf) und dem Kragenbund seines Hemdes hervor. Sein dünn gestrickter Schlips hing schief, und an der Hemdbrust war kein einziger Knopf. Ein paar bleiche Veilchen welkten im Knopfloch seiner Jacke; eines hatte sich gelöst und hing mit dem Kopf nach unten. Neben ihm lag ein schäbiger Rucksack; die offen stehende Klappe enthüllte eine Salzbrezel und den größeren Teil einer Wurst – mit dem üblichen Beigeschmack von unpassender Lust und brutaler Amputation. Ich saß da und musterte den Strolch voll Staunen; er wirkte so, als habe er jene ungeschickte Verkleidung für einen altmodischen Lumpenball angelegt.
«Ich würde gern eine rauchen», sagte er auf Tschechisch. Seine Stimme klang unerwartet tief, ja sogar würdig, und er spreizte zwei Finger und machte die Geste des Zigarettehaltens. Ich schob ihm mein großes Etui hin; meine Blicke ließen keinen Augenblick von seinem Gesicht ab. Er beugte sich ein wenig näher, stützte sich dabei mit der Hand auf den Boden, und ich nutzte die Gelegenheit, sein Ohr und die eingefallenen Schläfen genau zu betrachten.
«Deutsche Zigaretten», sagte er lächelnd – und entblößte sein Zahnfleisch. Dieses enttäuschte mich, aber glücklicherweise verschwand sein Lächeln sofort wieder. (Zu diesem Zeitpunkt wollte ich mich keinesfalls mehr von dem Wunder trennen.)
«Sind Sie Deutscher?», fragte er in dieser Sprache, während seine Finger die Zigarette drehten und pressten. Ich bejahte und ließ mein Feuerzeug unter seiner Nase aufschnappen. Gierig hielt er seine Hände dachartig über die zitternde Flamme. Blauschwarze, spatenförmige Fingernägel.
«Ich bin auch Deutscher», sagte er nach den ersten Zügen. «Das heißt, mein Vater war Deutscher, aber meine Mutter war Tschechin, aus Pilsen.»
Ich wartete immer noch auf einen Ausbruch der Überraschung bei ihm, ein großes Gelächter etwa, doch er blieb gleichmütig. Da erst ging mir auf, was er für ein Dummkopf war.
«Hab geschlafen wie ein Ratz», sagte er in einfältigem Behagen vor sich hin und spuckte herzhaft aus.
«Arbeitslos?», fragte ich.
Trauervoll nickte er mehrere Male und spuckte wieder aus. Ich staune immer aufs neue darüber, wie viel Speichel einfache Leute offenbar besitzen.
«Ich bin besser zu Fuß als meine Stiefel», sagte er und blickte auf seine Schuhe. Sie waren in der Tat in einem traurigen Zustand.
Er rollte sich langsam auf den Bauch, und während er den fernen Gasometer betrachtete und eine Lerche, die aus einer Furche aufwärtsschoss, fuhr er nachdenklich fort:
«Das war eine gute Stellung, die ich voriges Jahr in Sachsen hatte, nicht weit von der Grenze. Gartenarbeit. Es gibt nichts Besseres auf der Welt! Danach hab ich in einer Konditorei gearbeitet. Jeden Abend nach der Arbeit sind wir über die Grenze gegangen, mein Freund und ich, auf ein Glas Bier. Elf Kilometer hin und elf zurück. Das tschechische Bier war billiger als unsers, und an den Mädchen war mehr dran. Es gab auch mal eine Zeit, da hab ich Geige gespielt und eine dressierte weiße Maus vorgeführt.»
Nun lassen Sie uns einen Blick von der Seite riskieren, aber nur beiläufig, ohne physiognomische Absichten; bitte nicht zu dicht, meine Herren, sonst kriegen Sie womöglich den Schock Ihres Lebens. Oder vielleicht auch nicht. Denn ach! – nach allem, was sich zugetragen hat, weiß ich jetzt, wie parteiisch und trügerisch das menschliche Auge ist. Aber wie dem auch sei, hier das Bild: Zwei Männer lagern auf einem Fleckchen kränklichen Grases; der eine, elegant gekleidet, klatscht einen gelben Handschuh auf sein Knie; der andere, ein Landstreicher mit leerem Blick, liegt der Länge nach da und macht seinem Groll auf das Leben Luft. Knisterndes Rascheln des benachbarten Dornbusches. Ziehende Wolken. Ein windiger Maitag mit kleinen Schaudern, wie sie das Fell eines Pferdes überlaufen. Das Rattern eines Lastwagens von der Straße. Das zarte Schlagen einer Lerche in den Lüften.
Der Landstreicher war in Schweigen verfallen; dann sprach er wieder, hielt inne, um auszuspucken. Sprach über dies und das. Immer weiter. Seufzte traurig. Lag flach auf dem Bauch, winkelte die Beine an, bis die Fersen sein Gesäß berührten, und streckte sie wieder aus.
«Jetzt schauen Sie mal her, Sie!», platzte ich heraus. «Merken Sie eigentlich gar nichts?»
Er rollte sich auf den Rücken und setzte sich.
«Wie meinen Sie?», fragte er, und ein misstrauisches Stirnrunzeln verfinsterte sein Gesicht.
Ich sagte: «Sie sind wohl blind.»
Etwa zehn Sekunden blickten wir einander unverwandt in die Augen. Langsam hob ich den rechten Arm, aber sein linker ging nicht mit in die Höhe, wie ich es beinahe erwartet hatte. Ich kniff das linke Auge zu, aber seine Augen blieben beide offen. Ich streckte die Zunge heraus. Er brummte nochmals:
«Was ist denn? Was ist denn?»
Ich zog einen Taschenspiegel hervor. Während er noch danach griff, betatschte er sein Gesicht und blickte dann auf seine Handfläche, fand aber dort weder Blut noch Vogeldreck. Er betrachtete sich in dem himmelblauen Glas. Gab es mir mit einem Achselzucken zurück.
«Sie Narr!», rief ich. «Sehen Sie nicht, dass wir beide … Sehen Sie Narr nicht, dass wir … Jetzt hören Sie mal zu …: Schauen Sie mich ganz genau an …»
Ich zog seinen Kopf neben den meinen, sodass unsere Schläfen einander berührten; im Spiegel tanzten zwei Augenpaare und verschwammen.
Als er sprach, war sein Ton herablassend:
«Ein Reicher sieht nie ganz so aus wie ein Armer, aber ich glaub wohl, Sie wissen das besser. Da fällt mir ein, einmal, da hab ich zwei Zwillinge gesehen, auf einem Jahrmarkt, im August 26 – oder war es im September? Lassen Sie mich überlegen. Nein. Im August. Also das war wirklich eine Ähnlichkeit! Kein Mensch konnte die beiden auseinanderhalten. Hundert Mark sollte man kriegen, wenn man den kleinsten Unterschied entdeckte. ‹Machen wir›, sagt Fritz (Große Mohrrübe, so hieß er bei uns) und haut dem einen Zwilling eine runter, aufs Ohr. ‹Da habt ihr’s›, sagt er, ‹einer hat ein rotes Ohr, der andere nicht, und jetzt rücken Sie mal den Zaster raus, wenn Sie nichts dagegen haben.› Haben wir gelacht!»
Seine Augen huschten über das taubengraue Tuch meines Anzugs, glitten den Ärmel hinunter, stolperten und hielten bei der goldenen Uhr an meinem Handgelenk inne.
«Könnten Sie mir nicht irgendwelche Arbeit verschaffen?», fragte er und hielt den Kopf schief.
Anmerkung: Er war es, nicht ich, der in unserer Ähnlichkeit als Erster das freimaurerische Band erkannte; und da die Ähnlichkeit selber von mir festgestellt worden war, befand ich mich ihm gegenüber – nach seiner unterbewussten Berechnung – in einem subtilen Abhängigkeitsverhältnis, so als sei ich die Nachahmung und er das Vorbild. Natürlich hört man immer lieber von sich sagen: «Er sieht dir ähnlich» statt umgekehrt. Indem er mich um Hilfe bat, erkundete dieser kleinkarierte Schurke schon den Boden, auf den zukünftige Forderungen fallen würden. In der verborgensten Tiefe seines verwirrten Gehirns lauerte vielleicht die Erwägung, ich müsse ihm dankbar dafür sein, dass er mir – durch die bloße Tatsache seiner Existenz – großzügig vergönnte, so auszusehen wie er. Mich berührte unsere Ähnlichkeit wie eine Laune der Natur, die ans Wunderbare grenzte. Ihn dagegen interessierte vor allem mein Wunsch, überhaupt eine Ähnlichkeit festzustellen. In meinen Augen erschien er als mein Doppelgänger, das heißt, als ein körperlich mit mir identisches Wesen. Allein schon diese absolute Gleichheit ließ mich zuinnerst erbeben. Er seinerseits sah in mir nur einen zweifelhaften Nachahmer. Ich möchte jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, wie unscharf diese seine Gedanken waren. Meine Erläuterungen dazu hätte er sicherlich nicht verstanden, der Dummkopf.
«Ich fürchte, im Augenblick kann ich nicht sehr viel für Sie tun», antwortete ich kalt. «Aber geben Sie mir Ihre Adresse.»
Ich zog mein Notizbuch heraus und einen silbernen Drehbleistift.
Er lächelte bedauernd: «Hat keinen Zweck, zu erzählen, ich wohne in einer Villa. Besser im Heuschober schlafen als auf dem Moos im Wald; aber besser im Moos als auf einer harten Bank.»
«Trotzdem wüsste ich gern, wo ich Sie erreichen kann.»
Er dachte darüber nach und sagte dann: «Diesen Herbst bin ich sicher im selben Dorf, wo ich voriges Jahr gearbeitet habe. Sie können mir einen Brief ans Postamt dort schicken. Es ist nicht weit von Tarnitz. Geben Sie her, ich schreib’s Ihnen auf.»
Er hieß Felix, wie sich herausstellte, «der Glückliche». Sein Zuname, geneigter Leser, geht Sie nichts an. Seine ungelenke Schrift schien bei jeder Schleife zu knirschen. Er schrieb mit der linken Hand. Es war an der Zeit aufzubrechen. Ich legte zehn Kronen in seine Mütze. Mit herablassendem Grinsen bot er mir die Hand, machte sich allerdings kaum die Mühe, sich aufzusetzen. Ich griff nur deshalb danach, weil dieser Händedruck mir das seltsame Gefühl eines Narziss gab, der die Nemesis an der Nase herumführt, indem er seinem Spiegelbild aus dem Bach heraushilft.
Dann kehrte ich, fast im Laufschritt, denselben Weg zurück, den ich gekommen war. Als ich noch einmal über die Schulter blickte, sah ich seine dunkle schlanke Gestalt zwischen den Büschen. Er lag auf dem Rücken, die Knie hoch übereinandergeschlagen, die Arme unter dem Kopf verschränkt.
Plötzlich fühlte ich mich schlapp, schwindlig, todmüde wie nach einer langen und ekelerregenden Orgie. Der Grund für diese widerlich-süße Nachglut war, dass er kaltblütig den Geistesabwesenden gespielt und meinen silbernen Drehbleistift eingesteckt hatte. Eine Prozession silberner Drehbleistifte marschierte einen endlosen Tunnel der Verderbtheit hinab. Während ich weiter den Straßenrand entlangging, schloss ich hin und wieder die Augen, bis ich fast in den Graben stolperte. Später dann, im Büro, im Laufe einer geschäftlichen Besprechung, verzehrte ich mich förmlich danach, meinem Gesprächspartner zu erzählen: «Mir ist da eben eine komische Sache passiert! Man möchte es kaum für möglich halten …» Aber ich sagte kein Wort und schuf so einen Präzedenzfall für Verschwiegenheit.
Als ich schließlich in mein Hotelzimmer zurückkam, entdeckte ich, dass dort, inmitten quecksilbriger Schatten und umrahmt von gekräuselter Bronze, Felix auf mich wartete. Feierlich und mit bleicher Miene trat er näher. Er war jetzt gut rasiert; sein Haar war glatt zurückgebürstet. Er trug einen taubengrauen Anzug und einen lila Schlips. Ich zog mein Taschentuch hervor; er zog sein Taschentuch ebenfalls hervor. Ein Waffenstillstand im Stadium der Unterhandlungen.
Etwas Ländlichkeit war mir in die Nase geraten. Ich putzte sie und setzte mich, während ich weiter den Spiegel befragte, auf die Bettkante. Ich erinnere mich, dass die kleinen Zeichen bewusster Existenz – etwa der Staub in meiner Nase, der schwarze Schmutz zwischen Absatz und Gelenk des einen Schuhs, mein Hunger und jetzt gerade der grobe braune Geschmack eines mit Zitrone beträufelten großen, flachen Kalbskoteletts vom Bratrost – auf seltsame Weise meine Aufmerksamkeit gefangen nahmen, so als wäre ich auf der Suche nach Beweisen und entdeckte sie (und bezweifelte sie immer noch ein bisschen), dass ich ich war und dass dieses Ich (ein zweitklassiger Geschäftsmann mit Phantasie) wirklich in einem Hotel wohnte, aß, über Geschäftsangelegenheiten nachdachte und nichts gemein hatte mit einem bestimmten Landstreicher, der sich im Augenblick unter einem Busch rekelte. Und dann wieder ließ die Erregung über dieses Wunder mein Herz einen Schlag aussetzen. Dieser Mann zeigte mir, besonders im Schlaf, wenn seine Gesichtszüge erstarrten, mein eigenes Gesicht, meine Maske, das makellos reine Bild meines Leichnams – ich benutze den letzteren Begriff nur, weil ich mit größter Klarheit ausdrücken möchte – was ausdrücken? Dies: dass wir identische Gesichtszüge besaßen und dass diese Ähnlichkeit im Zustand der absoluten Ruhe überraschend augenfällig war, und was ist der Tod, wenn nicht ein Gesicht im Zustand des Friedens – seine künstlerische Vollendung? Das Leben entstellte meinen Doppelgänger nur; so trübt eine Brise die Seligkeit des Narziss; so tritt in Abwesenheit des Malers sein Schüler ein und verunstaltet durch die überflüssige Glut unerwünschter Farben das Porträt von Meisterhand.
Und dann, so dachte ich: Brachte nicht ich selbst, der ich mein eigenes Gesicht kannte und liebte, bessere Voraussetzungen mit, meinen Doppelgänger zu bemerken, als andere? Denn nicht jeder beobachtet so sorgsam; und es geschieht häufig, dass jemand auf die erstaunliche Ähnlichkeit zweier Menschen hinweist, die einander zwar kennen, aber von ihrer eigenen Ähnlichkeit nichts ahnen (und sie entschieden abstreiten, sobald man die Rede darauf bringt). Gleichviel, ich hatte niemals zuvor für möglich gehalten, dass es eine so vollkommene Ähnlichkeit geben könne wie zwischen Felix und mir. Ich habe Brüder getroffen, die einander ähnlich sahen, Zwillinge. Im Kino habe ich einen Mann gesehen, der seinem Doppelgänger begegnete; oder, besser gesagt, einen Schauspieler, der zwei Rollen spielte, wobei, wie in unserem Fall, der Unterschied der gesellschaftlichen Stellung auf naive Weise hervorgehoben wurde, indem er sich in der einen Rolle als Verbrecher davonstahl und in der anderen als gesetzter Bourgeois im Auto fuhr – als ob ein Paar identischer Landstreicher oder identischer feiner Herren weniger Spaß gemacht hätte! Ja, ich habe das alles gesehen, aber die Ähnlichkeit von Zwillingsbrüdern wird, wie ein grammatischer Reim, durch den Stempel der Verwandtschaft verschandelt, während ein Filmschauspieler in einer Doppelrolle kaum jemanden zu täuschen vermag; denn gerade wenn er in beiden Verkörperungen gleichzeitig erscheint, wird das Auge unwillkürlich die Linie finden, an der die beiden Hälften des Bildes zusammengefügt wurden.
In unserem Fall jedoch handelte es sich weder um eineiige Zwillinge (die das für einen gedachte Blut teilen) noch um den Kniff eines Theaterhexenmeisters.
Wie sehne ich mich danach, Sie zu überzeugen! Und ich werde, ich werde Sie überzeugen! Ihr Schurken, ich werde euch alle zum Glauben zwingen … obwohl ich fürchte, dass Wörter, aufgrund ihrer besonderen Natur, allein nicht imstande sind, eine derartige Ähnlichkeit anschaulich zu vermitteln: Die beiden Gesichter müssten Seite an Seite abgebildet werden, in echten Farben, nicht in Worten; dann und nur dann würde der Zuschauer sehen, worum es mir geht. Es ist der Lieblingstraum eines Schriftstellers, den Leser in einen Zuschauer zu verwandeln; aber wird dies je erreicht? Die blassen Organismen literarischer Helden nähren sich unter Aufsicht des Autors vom Herzblut des Lesers und schwellen nach und nach davon an; sodass die Genialität eines Schriftstellers darin bestünde, dass er sie mit der Fähigkeit ausstattet, sich an diese – nicht sehr appetitliche – Speise zu gewöhnen und dabei zu blühen und zu gedeihen, mitunter jahrhundertelang. Doch im gegenwärtigen Augenblick brauche ich nicht literarische Methoden, sondern die ganz gewöhnliche, grobschlächtige Deutlichkeit der Malerei.
Schauen Sie, dies ist meine Nase; groß, vom nordischen Typus, ein festes Nasenbein, leicht gebogen, der fleischige Teil nach oben gekippt und fast rechtwinklig. Und das ist seine Nase, ein vollendetes Ebenbild der meinen. Hier sind die zwei scharfen Furchen zu beiden Seiten meines Mundes, dessen Lippen so dünn sind, dass sie wie weggeleckt erscheinen. Er hat sie ebenfalls. Hier sind die Backenknochen – aber dies ist eine bedeutungslose Reisepassaufzählung von Kennzeichen; eine sinnlose Konvention. Irgendjemand sagte mir einmal, ich sähe aus wie der Polarforscher Amundsen. Nun, Felix sah auch aus wie Amundsen. Aber nicht jeder kann sich an Amundsens Gesicht erinnern. Ich selbst erinnere mich nur dunkel daran, und ich bin mir auch nicht sicher, ob es da nicht irgendeine Verwechslung mit Nansen gegeben hatte. Nein, ich kann nichts erklären.
Ich lächle selbstgefällig, allerdings. Dass ich die Hauptsache bewiesen habe, weiß ich genau. Das läuft ja fabelhaft. Jetzt sehen Sie uns alle beide, lieber Leser. Zwei, aber mit einem einzigen Gesicht. Sie brauchen jedoch nicht zu glauben, dass ich mich möglicher Schnitzer und Druckfehler im Buch der Natur schäme. Schauen Sie genauer hin: Ich besitze große gelbliche Zähne; seine sind weißer und stehen dichter beieinander, aber was bedeutet das schon? Auf meiner Stirn tritt eine Ader hervor wie ein schlecht gezeichnetes großes M; doch wenn ich schlafe, ist meine Stirn so glatt wie die meines Doppelgängers. Und was die Ohren angeht … Die Windungen seiner Ohrmuscheln sind im Vergleich zu meinen nur ganz leicht verändert: hier dichter zusammengedrängt, dort etwas abgeflacht. Wir haben Augen vom gleichen Schnitt, enggeschlitzt, mit spärlichen Wimpern, aber seine Iris ist blasser.
Dies war ungefähr alles, was ich an unterscheidenden Merkmalen bei jener ersten Begegnung feststellte. Im Verlauf der folgenden Nacht prüfte mein rationales Gedächtnis unablässig diese winzigen Makel; mit dem irrationalen Gedächtnis meiner Sinne erblickte ich dagegen nach wie vor und trotz allem mich, mein eigenes Selbst in der schäbigen Verkleidung eines Landstreichers, das Gesicht regungslos, Kinn und Wangen von Bartstoppeln umschattet, wie es einem Toten über Nacht widerfährt.
Warum verweilte ich in Prag? Ich hatte meine Geschäfte abgeschlossen. Es stand mir frei, nach Berlin zurückzukehren. Warum ging ich am nächsten Morgen noch einmal zu jener Anhöhe, zu jener Straße? Es fiel mir nicht schwer, die genaue Stelle wiederzufinden, wo er tags zuvor gelegen hatte. Ich entdeckte dort eine vergoldete Zigarettenkippe, ein verwelktes Veilchen, einen Fetzen von einer tschechischen Zeitung und – jene rührend unpersönliche Spur, die der arglose Wanderer gewöhnlich unter einem Busch zurücklässt: ein großes, gerades, männliches Stück und ein dünneres darübergeschlungen. Ein paar smaragdgrüne Fliegen vervollständigten das Bild. Wohin war er gegangen? Wo hatte er die Nacht verbracht? Nichtige Rätsel. Irgendwie war mir, auf eine unbestimmbar bedrückende Weise, scheußlich unbehaglich zumute, als sei das ganze Erlebnis eine Schandtat gewesen.
Ich ging zum Hotel zurück, holte meine Koffer und eilte zum Bahnhof. Dort, am Eingang zum Bahnsteig, standen zwei Reihen bequemer, niedriger Bänke mit Lehnen, die in vollkommener Übereinstimmung mit dem menschlichen Rückgrat geschnitzt und geschwungen waren. Ein paar Leute saßen da; einige waren eingenickt. Mir kam der Gedanke, dass ich ihn dort plötzlich erblicken würde, in tiefem Schlaf, die Hände geöffnet und noch ein letztes Veilchen im Knopfloch. Die Leute würden uns zusammen beobachten, aufspringen, uns umringen, zur Polizeiwache schleppen … weshalb? Weshalb schreibe ich das? Einfach das übliche Vorwärtsstürmen meiner Feder? Oder ist es tatsächlich schon ein Verbrechen, dass zwei Menschen einander so ähnlich sind wie zwei Tropfen Blut?
Kapitel 2
Ich habe mich viel zu sehr daran gewöhnt, mich selbst von außen zu betrachten, gleichzeitig Maler und Modell zu sein; kein Wunder also, wenn meinem Stil die gesegnete Anmut der Natürlichkeit versagt bleibt. Wie ich es auch anstelle, es gelingt mir nicht, in meine ursprüngliche Hülle zurückzuschlüpfen, geschweige denn mich in meinem alten Selbst heimisch zu fühlen; die Unordnung dort ist viel zu groß; Dinge sind verrückt worden, die Lampe ist schwarz und tot, meine Vergangenheit liegt in Fetzen verstreut auf dem Boden.
Eine recht glückliche Vergangenheit, darf ich wohl sagen. Ich besaß in Berlin eine kleine, aber hübsche Wohnung, dreieinhalb Zimmer, einen sonnigen Balkon, fließend Warmwasser, Zentralheizung; Lydia, meine dreißigjährige Frau, und Elsi, unser siebzehnjähriges Hausmädchen. Ganz in der Nähe befand sich die Garage, wo jener reizende kleine Wagen stand, ein dunkelblauer Zweisitzer, auf Abzahlung gekauft. Auf dem Balkon wuchs tapfer, wenn auch langsam, ein buckliger, rundköpfiger, grauhaariger Kaktus. Ich kaufte meinen Tabak immer im selben Geschäft und wurde dort mit strahlendem Lächeln begrüßt. Ein ähnliches Lächeln hieß meine Frau in dem Laden willkommen, der uns mit Butter und Eiern versorgte. Samstagabends gingen wir in ein Café oder ins Kino. Wir gehörten zur Creme der gepflegten Mittelschicht, jedenfalls dem äußeren Anschein nach. Allerdings zog ich, wenn ich vom Büro nach Hause kam, nicht die Schuhe aus, um mich mit der Abendzeitung aufs Sofa zu legen. Auch bestand die Unterhaltung mit meiner Frau nicht ausschließlich aus kleinlichen Zahlwörtern. Und erst recht klebten meine Gedanken nicht ununterbrochen an den Abenteuern meiner Schokoladenfabrikation. Ich darf sogar gestehen, dass gewisse bohemehafte Neigungen meinem Wesen nicht ganz fremd waren.
Was meine Einstellung gegenüber dem neuen Russland betrifft, so möchte ich geradeheraus erklären, dass ich die Ansichten meiner Frau nicht teilte. Auf ihren geschminkten Lippen erhielt der Begriff ‹Bolschewik› einen Unterton von altgewohntem und trivialem Hass – nein, ‹Hass› ist hier wohl ein zu starkes Wort. Es war etwas Hausbackenes, Einfaches, Weibliches: Sie mochte die Bolschewiki nicht, so wie man Regen nicht mag (besonders sonntags) oder Wanzen (besonders in einer neuen Wohnung), und Bolschewismus bedeutete für sie ein Ärgernis, dem gewöhnlichen Schnupfen vergleichbar. Sie hielt es für selbstverständlich, dass die Tatsachen ihre Meinung bestätigten; alles lag klar auf der Hand, da gab es nichts zu diskutieren. Bolschewiken glaubten nicht an Gott; das war ungezogen von ihnen, aber was konnte man von Sadisten und Rowdys schon anderes erwarten?
Wenn ich ausführte, der Kommunismus sei auf die Dauer eine große und notwendige Sache, das junge neue Russland leiste Hervorragendes, auch wenn das für westliche Gehirne nicht einzusehen und für mittellose und verbitterte Emigranten unannehmbar sei, noch nie habe die Weltgeschichte ein solches Maß an Begeisterung, Selbstzucht, Uneigennützigkeit und Vertrauen auf die bevorstehende Gleichheit aller gesehen – wenn ich in dieser Weise sprach, erwiderte meine Frau im allgemeinen gelassen: «Ich glaube, du sagst das nur, um mich aufzuziehen, und ich finde das nicht nett von dir.» Doch tatsächlich war es mir ziemlich Ernst damit; ich bin schon immer davon überzeugt gewesen, dass der bunte Wirrwarr unseres flüchtigen Lebens solch einer grundlegenden Veränderung bedarf, dass der Kommunismus wirklich eine wunderbar ausgerichtete Welt von identischen Kerlen mit breiten Schultern und winzigen Köpfen schaffen wird und dass eine feindselige Einstellung ihm gegenüber ebenso kindisch wie voreingenommen ist, was mich an das Gesicht erinnert, das meine Frau jedes Mal schneidet – die Nüstern gebläht, eine Augenbraue hochgezogen (das kindische und voreingenommene Bild eines Vamps) –, wenn sie sich selbst im Spiegel erblickt.
Also das ist ein Wort, das ich verabscheue, schauderhaftes Ding! Seit ich aufgehört habe, mich zu rasieren, besitze ich keinen solchen Gegenstand mehr. Wie dem auch sei, seine bloße Erwähnung hat mir gerade einen hässlichen Schock versetzt und den Fluss meiner Geschichte unterbrochen (bitte, malen Sie sich aus, was hier folgen sollte – die Geschichte der Spiegel); dann gibt es da auch noch die verzerrenden, die Monstren unter den Spiegeln: ein entblößter Hals, einerlei, wie geringfügig entblößt, zieht sich plötzlich zu einer gähnenden Fleischschlucht in die Länge und trifft auf eine andere, die sich ihr von unterhalb des Gürtels entgegendehnt, und beide verschmelzen miteinander; ein Zerrspiegel entblößt seinen Mann, oder er beginnt ihn zu zerquetschen, und siehe da, unter dem Druck von zahllosen Glasatmosphären entsteht ein Stiermensch, ein Krötenmensch; oder man wird auseinandergezogen wie Teig und dann in zwei Teile zerrissen.
Genug – machen wir, dass wir weiterkommen –, brüllendes Gelächter ist nicht mein Fall! Genug, es ist nicht alles so einfach, wie ihr wohl glaubt, ihr Schweinehunde, ihr! Jawohl, ich werde euch verfluchen, niemand kann mir das Fluchen verbieten. Und keinen Spiegel in meinem Zimmer zu dulden – das ist ebenfalls mein gutes Recht! Sicher, gesetzt den Fall, ich stünde einem gegenüber (pah, was habe ich zu fürchten?), er würde einen bärtigen Fremdling zeigen – denn mein Bart hier hat sich ganz schön rausgemacht, und das auch noch in derart kurzer Zeit! Ich bin so ausgezeichnet vermummt, dass ich für mein eigenes Ich unsichtbar bin. Haare sprießen aus jeder Pore. Es muss ein gewaltiger Vorrat von Gekräusel in mir gewesen sein. Ich verstecke mich in dem natürlichen Dschungel, der aus mir hervorgewachsen ist. Ich habe nichts zu befürchten. Törichter Aberglaube!
Schauen Sie her, ich will das Wort noch einmal hinschreiben. Spiegel. Spiegel. Nun, ist irgendetwas passiert? Spiegel, Spiegel, Spiegel. Sooft Sie wollen – ich fürchte nichts. Ein Spiegel. Sich im Spiegel erblicken. Ich sprach von meiner Frau, als ich darauf kam. Schwierig, zu reden, wenn man dauernd unterbrochen wird.
Übrigens, auch sie war dem Aberglauben verfallen. Der Marotte, auf Holz zu klopfen. Hastig und mit einem Ausdruck der Entschlossenheit, die Lippen zusammengepresst, blickte sie sich jedes Mal nach rohem, unlackiertem Holz um, fand nur die Unterseite eines Tisches und berührte sie mit ihren Stummelfingern (kleine Fleischkissen rund um die erdbeerroten Nägel, die, obwohl lackiert, nie ganz sauber waren; die Fingernägel eines Kindes) – berührte sie schnell, solange die Erwähnung eines Glücks noch warm in der Luft hing. Sie glaubte an Träume: Der Traum, man habe einen Zahn verloren, kündigte den Tod eines Bekannten an; und wenn mit dem Zahn Blut hervorquoll, dann bedeutete das den Tod eines Verwandten. Ein Feld voller Gänseblümchen sagte voraus, man werde seiner ersten Liebe wiederbegegnen. Perlen standen für Tränen. Sehr schlimm war es, sich selbst ganz in Weiß am Kopf einer Tafel sitzen zu sehen. Schlamm bedeutete Geld; eine Katze Verrat; das Meer Seelenschmerz. Sie erzählte gern ihre Träume ausführlich und in allen Einzelheiten. Aber ach, ich schreibe von ihr in der Vergangenheitsform. Lassen Sie mich den Gürtel meiner Geschichte ein Loch enger schnallen.
Sie hasst Lloyd George[1]; wenn er nicht gewesen wäre, wäre das russische Zarenreich nicht untergegangen; und allgemein: «Ich könnte diese Engländer mit eigenen Händen erwürgen.» Die Deutschen bekommen ihr Teil ab für den plombierten Zug, in dem der Bolschewismus wie in einer Dose eingemacht war und Lenin nach Russland importiert wurde. Wenn die Rede auf Franzosen kommt: «Weißt du, Ardalion [ein Vetter von ihr, der in der Weißen Armee gekämpft hatte] sagt, sie haben sich in Odessa während der Evakuierung wie regelrechte Flegel aufgeführt.»[2] Gleichzeitig hält sie den englischen Gesichtsschnitt (nächst dem meinen) für den schönsten der Welt; hat Respekt vor den Deutschen, weil sie musikalisch und zuverlässig sind; und behauptet, sie schwärme für Paris, wo wir zufällig einmal ein paar Tage verbracht haben. Diese ihre Meinungen stehen starr wie Statuen in ihren Nischen. Im Gegensatz dazu hat ihre Einstellung zum russischen Volk alles in allem eine gewisse Entwicklung durchgemacht. 1920 sagte sie noch: «Der echte russische Bauer ist Monarchist»; jetzt sagt sie: «Der echte russische Bauer ist ausgestorben.»
Sie ist wenig gebildet und wenig aufmerksam. Wir entdeckten eines Tages, dass der Begriff ‹Mystiker› in ihrer Vorstellung irgendwie mit ‹müßig› und ‹stickig› zusammenhing, dass sie aber nicht die geringste Ahnung hatte, was ein Mystiker wirklich war. Der einzige Baum, den sie zu erkennen vermag, ist die Birke: Sie erinnert sie an ihre heimatlichen Wälder, sagt sie.
Bücher verschlingt sie geradezu, aber sie liest nur Schund, behält nichts im Gedächtnis und überblättert die längeren Beschreibungen. Sie holt sich ihre Bücher aus einer russischen Leihbibliothek; dort setzt sie sich bequem hin und lässt sich viel Zeit bei der Auswahl; betastet die Bücher auf dem Tisch; nimmt eines, blättert darin, blickt von der Seite hinein wie eine neugierige Henne; legt es weg, ergreift ein anderes, schlägt es auf – und dies alles geschieht auf der Tischoberfläche und mithilfe nur einer Hand; sie bemerkt, dass sie das Buch verkehrt herum hält, daraufhin dreht sie es um neunzig Grad – nicht mehr, denn sie legt es beiseite, um sich auf einen Band zu stürzen, den die Bibliothekarin gerade einer anderen Dame empfehlen will; der ganze Vorgang dauert über eine Stunde, und ich weiß nicht, was ihre endgültige Wahl bestimmt. Vielleicht der Titel.
Einmal brachte ich von einer Bahnreise einen miserablen Kriminalroman mit zurück, mit einer blutroten Spinne in einem schwarzen Netz auf dem Umschlag. Sie warf einen Blick hinein und fand ihn schrecklich aufregend, hatte aber das Gefühl, dass sie es einfach nicht aushalten und verstohlen das Ende lesen würde; doch weil dies alles verdorben hätte, kniff sie die Augen fest zu, riss das Buch, den Rücken hinunter, in zwei Hälften und versteckte den zweiten, den Schlussteil; später vergaß sie das Versteck und durchsuchte lange, lange Zeit das Haus nach dem Verbrecher, den sie selbst verborgen hatte; und sagte dabei immer wieder mit zartem Stimmchen: «Es war so aufregend, so schrecklich aufregend; ich werde bestimmt sterben, wenn ich’s nicht rauskriege …»
Inzwischen hat sie es rausgekriegt. Jene Seiten, die alles erklärten, waren gut versteckt; trotzdem, gefunden wurden sie – alle, bis auf eine vielleicht. Tatsächlich haben sich vielerlei Dinge zugetragen; jetzt sind sie ordnungsgemäß erklärt. Auch trat das ein, was sie am meisten fürchtete. Von allen Vorzeichen war es das unheimlichste. Ein zerbrochener Spiegel. Ja, es passierte wirklich, wenn auch nicht ganz in der üblichen Weise. Arme tote Frau.
Tam–ti–tam. Und noch einmal – TAM! Nein, ich bin nicht verrückt geworden. Ich gebe nur kleine Freudenlaute von mir. Jene Art von Freude, die man empfindet, wenn man jemanden in den April geschickt hat. Und ich habe jemanden verdammt gut in den April geschickt. Wer ist das? Lieber Leser, schau dich selbst im Spiegel an, da du offenbar für Spiegel so viel übrig hast.