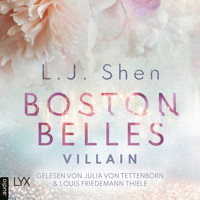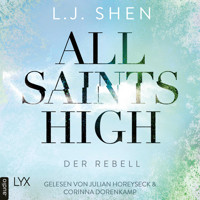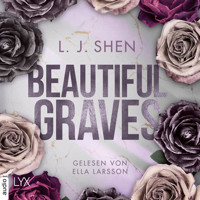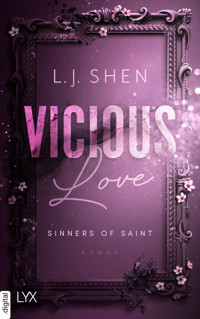
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sinners of Saint
- Sprache: Deutsch
Die Erfolgsreihe aus den USA — endlich auch auf Deutsch!
Emilia LeBlanc traut ihren Augen nicht, als sie nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder Baron "Vicious" Spencer gegenübersteht. Vicious, der ihr das Leben einst zur Hölle gemacht hat. Vicious, der nie nett, immer furchtbar zu ihr war. Vicious, der sie ans andere Ende der USA und weg von ihrer Familie getrieben hat. Vicious, der einzige Mann, den sie je geliebt hat.
Inzwischen ist er ein erfolgreicher Anwalt und leitet mit seinen drei besten Freunden ein Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen. Emilia, die es kaum schafft, sich und ihre kranke Schwester über die Runden zu bringen, weiß, dass Vicious der letzte Mann ist, den sie jetzt in ihrem Leben gebrauchen kann. Und doch kann sie sich wie damals schon einfach nicht von ihm fernhalten ...
Mitreißend und verboten — die Sinners of Saint werden dein Herz im Sturm erobern!
"Ich liebe diese Reihe!" Kylie Scott, Spiegel-Bestseller-Autorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Soundtrack
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von L. J. Shen bei LYX
Impressum
L. J. SHEN
Vicious Love
SINNERS OF SAINT
Roman
Ins Deutsche übertragen vonPatricia Woitynek
ZU DIESEM BUCH
Emilia LeBlanc traut ihren Augen nicht, als sie nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder Baron »Vicious« Spencer gegenübersteht. Vicious, der ihr das Leben einst zur Hölle gemacht und von dem sie nie ein freundliches Wort gehört hat. Vicious, der sie ans andere Ende der USA und weg von ihrer Familie getrieben hat. Vicious, der einzige Mann, den sie je geliebt hat. Inzwischen ist er ein erfolgreicher Anwalt und leitet mit seinen drei besten Freunden ein Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen. Emilia, die es kaum schafft, sich und ihre kranke Schwester über Wasser zu halten, weiß, dass Vicious der letzte Mann ist, den sie jetzt in ihrem Leben gebrauchen kann. Zu viel ist zwischen ihnen vorgefallen, zu schwer wiegt die Vergangenheit, in der er der reichste und mächtigste Junge der Highschool und sie »nur« die Tochter seiner Haushaltshilfe war. Emilia kann ihm nicht vertrauen – das sagt ihr Verstand ihr klar und deutlich. Doch ihr Herz spricht eine andere Sprache, zumal Vicious wild entschlossen scheint, die Fehler von damals wiedergutzumachen. Und wer ihn kennt, weiß: Vicious bekommt immer, was er will …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Für Karen O’Hara und Josephine McDonnell
SOUNDTRACK
»Bad Things« – Machine Gun Kelly & Camila Cabello
»With or Without You« – U2
»Unsteady« – X Ambassadors
»Fell In Love With a Girl« – The White Stripes
»Baby It’s You« – Smith
»Nightcall« – Kavinsky
»Last Nite« – The Strokes
»Teardrop« – Massive Attack
»Superstar« – Sonic Youth
»Vienna« – Billy Joel
»Stop Crying Your Heart Out« – Oasis
Die japanische Kultur misst der Kirschblüte seit Jahrhunderten große Bedeutung bei. Sie symbolisiert die Vergänglichkeit und Herrlichkeit des Lebens, das überwältigend schön und zugleich herzzerreißend kurz ist.
Dasselbe gilt für Beziehungen.
Darum seid klug, indem ihr dem Rat eures Herzens folgt. Und wenn ihr jemanden findet, der es wert ist – lasst ihn nie wieder los.
KAPITEL 1
EMILIA
Meine Großmutter sagte mir einmal, dass Liebe und Hass ein und dasselbe Gefühl seien, nur unter verschiedenen Vorzeichen erlebt. Bei beiden empfindet man Leidenschaft. Und Schmerz. Diese merkwürdige Empfindung, die sich wie Champagnerbläschen in der Brust anfühlt? Dito. Ich glaubte ihr nicht – bis ich Baron Spencer traf und er zu meinem Albtraum wurde.
Dann verwandelte sich mein Albtraum in meine Realität.
Ich dachte, ich wäre ihm entkommen. War sogar dumm genug, mir einzureden, er habe vergessen, dass ich überhaupt existierte.
Als er dann zurückkehrte, war er härter, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Und ich fiel um wie ein Dominostein.
Zehn Jahre zuvor
Ich hatte das Herrenhaus erst einmal betreten, kurz nachdem ich mit meiner Familie nach Todos Santos gezogen war. Das lag zwei Monate zurück. Damals stand ich wie festgewurzelt auf genau diesem Eisenholzboden, der nirgendwo knarrte.
Bei jenem ersten Besuch hatte meine Mutter mich mit dem Ellbogen in die Rippen gestoßen. »Wusstest du, dass das der härteste Fußboden auf der Welt ist?«
Sie ließ dabei unerwähnt, dass er dem Mann mit dem härtesten Herzen auf der Welt gehörte.
Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wieso wohlhabende Leute ihre Kohle für ein derart deprimierendes Haus verschwenden sollten. Zehn Schlafzimmer. Dreizehn Bäder. Ein Fitnessstudio und ein dramatischer Treppenaufgang. Die beste Ausstattung, die für Geld zu haben war … und bis auf den Tennisplatz und den zwanzig Meter langen Pool alles in Schwarz gehalten.
Sobald man durch die große, eisenbeschlagene Tür trat, erstickte Schwarz jedes positive Gefühl, das man bis dahin empfunden haben mochte. Den kalten, leblosen Farben und den mächtigen, metallenen Kronleuchtern, die von der Decke hingen, nach zu urteilen, hatte hier ein mittelalterlicher Vampir als Innenarchitekt fungiert. Sogar der Fußboden war so dunkel, dass es mir vorkam, als schwebte ich über einem Abgrund, um im nächsten Augenblick ins Nichts zu stürzen.
Ein Haus mit zehn Schlafzimmern und drei Bewohnern – von denen zwei kaum je da waren –, und dennoch hatten die Spencers beschlossen, mich und meine Familie in der Dienstbotenwohnung neben der Garage einzuquartieren. Obwohl sie größer war als unsere Bruchbude in Richmond, Virginia, hatte es mich genervt.
Jetzt tat es das nicht mehr.
Alles am Anwesen der Spencers war dafür konzipiert einzuschüchtern. Sie waren stinkreich und doch in vielerlei Hinsicht arm. Hier wohnen keine glücklichen Leute, dachte ich bei mir.
Ich starrte auf meine Schuhe – ramponierte weiße Vans, auf die ich farbige Blumen gemalt hatte, um zu vertuschen, dass es Imitate waren – und schluckte, fühlte mich klein, noch bevor er mich herabgewürdigt hatte. Bevor ich ihn überhaupt kannte.
»Wo er wohl steckt?«, flüsterte meine Mutter.
Das Echo, das von den nackten Wänden der Eingangshalle, in der wir standen, zurückgeworfen wurde, verursachte mir einen Schauer. Sie wollte fragen, ob sie und mein Vater ihren Lohn zwei Tage früher bekommen könnten, weil wir Medizin für meine jüngere Schwester Rosie kaufen mussten.
»Ich höre Geräusche, die aus diesem Zimmer kommen.« Sie zeigte zu einer Tür auf der anderen Seite des von einer Gewölbedecke überspannten Raums. »Los, klopf an. Ich gehe zurück in die Küche und warte dort.«
»Ich? Wieso ich?«
»Weil Rosie krank ist und seine Eltern verreist sind.« Sie taxierte mich mit einem Blick, der an mein Gewissen appellierte. »Du bist in seinem Alter. Er wird dir zuhören.«
Ich gehorchte – nicht um ihretwillen, sondern um Rosies willen –, ohne zu ahnen, was die Konsequenzen sein würden. Die nächsten paar Minuten ruinierten mein ganzes letztes Schuljahr und sorgten dafür, dass ich im Alter von achtzehn meiner Familie entrissen wurde.
Weil Vicious dachte, ich wüsste über sein Geheimnis Bescheid.
Was nicht der Fall war.
Er glaubte, ich hätte an jenem Tag mitbekommen, worum es bei dem Streit in der Bibliothek ging.
Ich hatte nicht den blassesten Schimmer.
Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, wie ich zu einer dunklen Tür tapse und meine Faust Zentimeter davor in der Luft verharrt, als ich den rauen Bass eines älteren Mannes vernehme.
»Du kennst die Regeln, Baron.«
Er klang nach einem Raucher.
»Meine Schwester sagt, dass du ihr wieder Ärger machst.« Die Worte waren nur undeutlich zu verstehen, doch dann hob er die Stimme und schlug mit der Hand auf eine harte Oberfläche. »Ich hab genug von deiner Respektlosigkeit ihr gegenüber.«
»Scheiß auf dich«, hörte ich einen jüngeren Mann in beherrschtem Tonfall sagen. Er klang … amüsiert? »Und auf sie auch. Moment mal, bist du deswegen hier, Daryl? Du willst auch ein Stück von ihr abhaben? Da gibt es gute Nachrichten für dich: Sie ist zu allem bereit, wenn man das nötige Bargeld hat.«
»Achte auf dein loses Maul, du kleiner Wichser.« Klatsch. »Deine Mutter wäre sicherlich stolz auf dich.«
Nach kurzem Schweigen: »Noch ein Wort über meine Mutter, und ich gebe dir einen echten Grund, dir diese Zahnimplantate zu besorgen, über die du mit meinem Vater gesprochen hast.« Seine vor Gehässigkeit triefende Stimme weckte Zweifel in mir, ob er wirklich so jung war, wie meine Mutter dachte.
»Bleib mir ja vom Leib«, fuhr Baron in warnendem Ton fort. »Sonst prügle ich die Scheiße aus dir raus, wozu ich inzwischen nicht nur imstande wäre, sondern auch gute Lust hätte. Und das schon verdammt lange. Ich lass mir diesen Dreck nicht länger von dir gefallen.«
»Wie, zum Teufel, kommst du darauf, dass du eine Wahl hast?« Daryl lachte unheilvoll.
Ich spürte seine Stimme bis in die Knochen, wie ein zersetzendes Gift.
»Hast du’s noch nicht gehört?«, stieß Baron zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Ich prügle mich gern. Der Schmerz törnt mich an. Vielleicht, weil ich mich dadurch viel leichter damit arrangieren kann, dass ich dich eines Tages umbringen werde. Denn das werde ich, Daryl. Irgendwann töte ich dich.«
Ich schnappte nach Luft, war vor Schreck wie gelähmt. Ein Geräusch wie ein Schlag ertönte, dann schien jemand zu Boden zu stürzen und mehrere Gegenstände mit sich zu reißen.
Da dieses Gespräch eindeutig nicht für meine Ohren bestimmt war, beschloss ich zu türmen, als er mich unvorbereitet ertappte. Ehe ich wusste, wie mir geschah, schwang die Tür auf, und ich sah mich einem Jungen in meinem Alter gegenüber. Nur war an ihm rein gar nichts Jugendliches.
Hinter ihm beugte sich der ältere Mann schwer keuchend über einen Schreibtisch, auf den er die Handflächen presste. Seine Lippe war aufgeplatzt und blutete, rings um seine Füße lagen Bücher verstreut.
Es war eine Bibliothek. Deckenhohe, mit Hardcovers bestückte Bücherregale aus Walnussholz säumten die Wände. Ich spürte einen Stich in der Brust, weil ich instinktiv ahnte, dass ich hier nie wieder Zutritt haben würde.
»Was fällt dir ein?«, zischte der Teenager. Er verengte die Augen zu Schlitzen. Es fühlte sich an, als würde die Mündung eines Gewehrs auf mich gerichtet.
Siebzehn? Achtzehn? Die Tatsache, dass wir ungefähr gleich alt waren, machte die Situation noch schlimmer. Ich zog den Kopf ein, während mir eine Hitze in die Wangen schoss, die gereicht hätte, um das ganze Haus abzufackeln.
»Hast du gelauscht?« An seinem Kiefer zuckte ein Muskel.
Ich schüttelte wild den Kopf, aber es war eine Lüge. Ich war schon immer eine grauenvolle Lügnerin gewesen.
»Ich habe überhaupt nichts gehört, das schwöre ich.« Fast blieben mir die Worte im Hals stecken. »Meine Mutter arbeitet hier. Ich habe nach ihr gesucht.« Noch eine Lüge.
Ich war immer eine mutige Person gewesen, nie ein Angsthase. Doch in diesem Moment fühlte ich mich kein bisschen tapfer. Immerhin durfte ich gar nicht hier sein, in seinem Haus, und schon gar nicht hatte ich das Recht, ihren Streit zu belauschen.
Er machte einen Schritt auf mich zu, ich wich einen zurück. Seine Augen waren tot, wohingegen seine vollen, roten Lippen überaus lebendig wirkten. Dieser Junge wird mir das Herz brechen, wenn ich es zulasse. Die Stimme kam irgendwo aus meinem Kopf, und die Eingebung verwirrte mich, weil sie überhaupt keinen Sinn ergab. Ich hatte mich noch nie verliebt, außerdem war ich viel zu eingeschüchtert, um auch nur auf seine Augenfarbe oder Frisur zu achten, geschweige denn, mich mit dem Gedanken zu tragen, Gefühle für ihn zu entwickeln.
»Wie heißt du?«, blaffte er. Er verströmte den unverwechselbaren Geruch eines Jungen auf dem Weg zum Mann, süßlicher Schweiß und säuerliche Hormone vermischt mit dem Duft frischer Wäsche – deren Erledigung zum vielfältigen Aufgabenbereich meiner Mutter gehörte.
»Emilia.« Ich räusperte mich und streckte ihm die Hand hin. »Meine Freunde nennen mich Millie. Das darfst du auch gern.«
Seine Miene gab keinerlei Regung preis. »Du bist verdammt noch mal erledigt, Emilia.« Er sagte meinen Namen mit einem undeutlichen Näseln, um meinen Südstaatenakzent zu verhöhnen, meine dargebotene Hand würdigte er keines Blickes.
Ich zog sie hastig zurück, meine Wangen wieder flammend rot vor Verlegenheit.
»Verdammt falsche Zeit, verdammt falscher Ort. Sollte ich dich noch einmal irgendwo in meinem Haus erwischen, mach ich dich fertig.« Sein muskulöser Arm streifte meine Schulter, als er an mir vorbeipolterte.
Mir blieb die Spucke weg. Ich sah zu dem anderen Mann, der meinen Blick erwiderte. Er schüttelte den Kopf und grinste mich auf eine Weise an, dass ich am liebsten im Erdboden versunken wäre. Blut tropfte von seinem Mund auf seinen Lederstiefel – schwarz, genau wie seine abgetragene Motorradjacke. Was hatte er überhaupt hier verloren? Er starrte mich einfach nur an, kümmerte sich nicht um das Blut.
Bittere Galle stieg in meiner Kehle auf und drohte überzulaufen. Ich drehte mich auf dem Absatz um und rannte davon.
Überflüssig zu erwähnen, dass Rosie in jener Woche ohne ihre Medizin auskommen musste und meine Eltern nicht eine Minute früher bezahlt wurden als vertraglich vereinbart.
Das war vor zwei Monaten.
Heute blieb mir keine andere Wahl, als die Küche zu durchqueren und die Treppe hochzusteigen.
Ich klopfte an Vicious’ Tür. Sein Zimmer lag im ersten Stock, am Ende eines breiten, bogenförmigen Flurs, gegenüber der freitragenden Steintreppe des gewölbeartigen Hauses.
Ich war nie auch nur in der Nähe seines Zimmers gewesen und legte auch keinen Wert darauf, das zu ändern. Dummerweise war mein Mathebuch geklaut worden. Wer immer meinen Spind aufgebrochen hatte, hatte meinen Kram rausgeräumt und durch Müll ersetzt. Kaum dass ich die Tür geöffnet hatte, waren mir leere Getränkedosen, Hygieneartikel und Kondomverpackungen entgegengepurzelt.
Eine weitere, zwar nicht sehr clevere, aber doch wirkungsvolle Methode der Schüler der All Saints Highschool, um mich daran zu erinnern, dass ich nicht mehr war als die Tochter von Dienstboten. Mittlerweile war ich dermaßen abgehärtet, dass ich kaum noch rot wurde. Als sich sämtliche Augenpaare im Gang auf mich richteten und von allen Seiten Glucksen und Kichern ertönte, schob ich trotzig das Kinn vor und marschierte auf direktem Weg zu meinem nächsten Unterricht.
Die Schule war ein Auffangbecken für verwöhnte, überprivilegierte Sünder. Wenn man sich nicht auf eine bestimmte Weise kleidete oder benahm, gehörte man nicht dazu. Gott sei Dank fügte Rosie sich besser ein als ich. Aber wegen meines schleppenden Südstaatenakzents, des unangepassten Kleidungsstils und der Tatsache, dass einer der beliebtesten Schüler – nämlich Vicious Spencer – mich auf den Tod nicht leiden konnte, war ich eine Außenseiterin.
Dass ich mich gar nicht integrieren wollte, machte es nur schlimmer. Diese Teenager beeindruckten mich absolut nicht. Sie waren nicht nett, nicht herzlich, noch nicht einmal sonderlich intelligent. Sie besaßen keine Einzige der Qualitäten, die ich bei Freunden suchte.
Aber ich brauchte unbedingt mein Mathebuch, wenn ich je von diesem Ort entkommen wollte.
Ich pochte dreimal an die Mahagonitür von Vicious’ Zimmer. Ich rollte meine Unterlippe zwischen den Fingern und versuchte, so viel Sauerstoff wie möglich zu inhalieren, aber es half nicht, um den hämmernden Puls in meinem Hals zu beruhigen.
Bitte, sei nicht da …
Bitte, benimm dich nicht wie ein Arsch …
Bitte …
Ein leises Geräusch drang unter der Tür hervor, und ich versteifte mich.
Jemand kicherte.
Vicious kicherte niemals. Sogar ein Lachen oder ein Lächeln hatten bei ihm Seltenheitswert. Abgesehen davon klang es eindeutig weiblich.
Ich hörte ihn mit seiner rauen Stimme etwas Unverständliches murmeln, das dem Mädchen ein Stöhnen entlockte. Mir rauschte das Blut in den Ohren, und ich rieb nervös die Hände an meinen abgeschnittenen gelben Jeansshorts. Dies war das mit Abstand schlimmste vorstellbare Szenario.
Er, zusammen mit einem anderen Mädchen.
Das ich schon hasste, ehe ich überhaupt seinen Namen kannte.
Es war lächerlich, trotzdem brodelte es in mir.
Aber immerhin war er da, und ich würde mich der Herausforderung stellen.
»Vicious?«, rief ich in bemüht ruhigem Ton. Obwohl er mich nicht sehen konnte, streckte ich den Rücken durch. »Ich bin’s, Millie. Entschuldige, dass ich störe. Ich wollte nur fragen, ob ich mir dein Mathebuch ausleihen darf. Meins ist verschwunden, und ich muss mich dringend auf den Test morgen vorbereiten.« Gott bewahre, dass du je selbst für eine Prüfung lernen würdest, fügte ich im Stillen hinzu.
Er antwortete nicht, aber ich hörte jemanden scharf nach Luft schnappen – das Mädchen –, dann das Rascheln von Stoff und das Geräusch eines Reißverschlusses. Der heruntergezogen wurde, daran bestand für mich kein Zweifel.
Ich kniff die Augen zusammen und presste die Stirn an das kühle Holz der Tür.
Beiß in den sauren Apfel. Vergiss deinen Stolz. In ein paar Jahren würde das hier keine Rolle mehr spielen. Vicious und sein dämliches Verhalten würden nur noch eine verblasste Erinnerung sein, die versnobte Stadt Todos Santos nicht mehr als ein verstaubter Teil meiner Vergangenheit.
Als Josephine Spencer meinen Eltern einen Job anbot, hatten sie die Chance kurzerhand ergriffen. Sie schleiften uns quer durchs Land nach Kalifornien, wegen des besseren Gesundheitswesens dort und weil wir keine Miete zahlen mussten. Mama fungierte als Köchin und Haushälterin der Spencers, mein Vater als eine Kombination aus Gärtner und Hausmeister. Das Paar, das zuvor in ihren Diensten stand, hatte gekündigt, was wenig verwunderte. Zweifelsohne waren auch meine Eltern nicht wirklich scharf auf den Job. Aber eine solche Gelegenheit ergab sich selten, und da Josephines Mutter mit meiner Großtante befreundet war, hatte man ihnen die Stellen angeboten.
Ich hatte fest vor, in Kürze von hier zu verschwinden. Sobald ich die erste Zusage auf eine meiner Bewerbungen für ein College in einem anderen Bundesstaat hätte, um genau zu sein. Allerdings benötigte ich zu diesem Zweck ein Stipendium.
Was wiederum Bestnoten voraussetzte.
Und für die benötigte ich dieses Schulbuch.
»Vicious«, presste ich den beknackten Spitznamen heraus. Ich wusste, dass er seinen echten Namen verabscheute, und wollte ihn aus naheliegenden Gründen nicht verärgern. »Ich leihe mir das Buch nur ganz kurz aus, um die Formeln zu kopieren, die ich wirklich dringend brauche. Es dauert nicht lange. Bitte.« Missmutig schluckte ich den Kloß in meinem Hals hinunter. Es war schon übel genug, dass man mir – wieder einmal – mein Zeug gestohlen hatte, auch ohne dass ich Vicious um einen Gefallen bitten musste.
Das Kichern wurde lauter. Der hohe, schrille Ton sägte an meinen Nerven. Es juckte mich, die Tür aufzustoßen und Vicious mit meinen Fäusten zu traktieren.
Ich hörte ihn genüsslich seufzen und wusste, dass es nichts mit dem Mädchen, das bei ihm war, zu tun hatte. Er liebte es, mich zu verhöhnen. Seit dem Vorfall in der Bibliothek vor zwei Monaten ließ er keine Gelegenheit aus, mir ins Gedächtnis zu rufen, dass ich nicht gut genug war.
Nicht für sein Haus.
Nicht für seine Schule.
Nicht für seine Stadt.
Das Schlimmste daran? Es war nicht nur so dahingesagt. Dies war seine Stadt. Bei Baron Spencer junior – wegen seiner kalten, rücksichtslosen Art Vicious genannt – handelte es sich um den Erben einer der reichsten Familien Kaliforniens. Den Spencers gehörten ein Pipeline-Unternehmen, die halbe Innenstadt von Todos Santos – inklusive des Einkaufszentrums – sowie drei Büroparks. Vicious besaß genug Geld für zehn weitere Generationen.
Ganz im Gegensatz zu mir.
Meine Eltern waren Hausangestellte. Wir mussten uns jeden Penny erarbeiten. Ich erwartete nicht, dass er das nachvollziehen konnte. Reiche Kids rafften das nie. Aber ich hatte angenommen, dass er, wie der Rest von ihnen, zumindest so tun würde, als ob.
Schulbildung war mir wichtig, und im Moment fühlte ich mich meiner Chancen beraubt.
Weil reiche Gören mir meine Bücher geklaut hatten.
Weil dieses spezielle Exemplar noch nicht einmal die Tür öffnete, damit ich mir kurz sein Mathebuch borgen konnte.
»Vicious!« Mein Frust ging mit mir durch, und ich schlug mit der Handfläche gegen die Tür. Ohne mich um den Schmerz zu kümmern, der durch meinen Unterarm schoss, rief ich entnervt: »Komm schon!«
Ich war drauf und dran aufzugeben, auch wenn das bedeutete, dass ich mir mein Rad schnappen und quer durch die Stadt fahren musste, um mir Sydneys Buch auszuleihen. Sie war meine einzige Freundin an der All Saints High, die einzige Person, die ich in meiner Klasse mochte.
Doch dann hörte ich Vicious lachen und begriff, dass er sich über mich lustig machte. »Bettle darum, Baby, und ich gebe es dir«, sagte er.
Nicht zu dem Mädchen in seinem Zimmer.
Zu mir.
Ich explodierte. Obwohl ich wusste, dass es falsch war, ich ihn damit gewinnen ließ.
Ich stieß die Tür auf und platzte ins Zimmer, meine Hand so fest um die Klinke gekrallt, dass die Knöchel weiß hervortraten und schmerzten.
Mein Blick zuckte zu dem Doppelbett, wobei ich das prachtvolle Wandgemälde dahinter – vier weiße Pferde, die in die Finsternis galoppierten – und die eleganten dunklen Möbel nur am Rande wahrnahm. Hoch und erhaben stand es mitten im Zimmer und erinnerte an einen mit schwarzem Satin bezogenen Thron. Vicious saß auf der Bettkante, auf seinem Schoß ein Mädchen, das ich aus dem Sportunterricht kannte. Sie hieß Georgia, und ihren Großeltern gehörte die Hälfte der Weinberge in Carmel Valley. Ihre langen blonden Haare bedeckten eine seiner breiten Schultern, die karibische Bräune ihrer makellosen Haut bildete einen perfekten Kontrast zu seinem hellen Teint.
Seine dunkelblauen Augen, die beinahe schwarz wirkten, taxierten mich, während er sie weiter gierig und unter Einsatz seiner Zunge küsste, als sei sie aus Zuckerwatte. Ich hätte wegsehen sollen, schaffte es jedoch nicht. Sein Blick hielt mich gefangen, lähmte mich bis in die Zehenspitzen, darum zog ich eine Augenbraue hoch, um ihm zu bedeuten, dass sein Verhalten mich nicht kratzte.
Nur tat es das. Gewaltig sogar.
So sehr, dass ich nicht aufhören konnte, die beiden schamlos anzustarren – die Mulden in seinen Wangen, als er die Zunge tief in ihren Mund stieß, während sein sengender, spöttischer Blick weiter auf mich fixiert war, um mir eine Reaktion zu entlocken. Mein Körper kribbelte auf eine unvertraute Weise, während ich stärker in seinen Bann geriet, als würde sich ein süßer, penetranter Nebel um mich legen. Es war eine sexuelle und unwillkommene Wahrnehmung, der ich mich dennoch absolut nicht entziehen konnte. Verzweifelt versuchte ich, mich loszureißen, aber es gelang mir nicht.
Schluckend verstärkte ich den Griff um die Türklinke, als ich sah, wie seine Hand zu ihrer Taille glitt und sie aufreizend knetete. Durch den Stoff meines weißen, mit gelben Sonnenblumen bedruckten Oberteils drückte ich die Finger in meine eigene Taille.
Was zur Hölle stimmte nicht mit mir? Zu beobachten, wie er ein anderes Mädchen küsste, war unerträglich und zugleich eigenartig faszinierend.
Ich wollte es sehen.
Ich wollte es nicht sehen.
So oder so konnte ich es nicht nicht sehen.
Blinzelnd gestand ich mir meine Niederlage ein und richtete den Blick auf eine schwarze Raiders-Kappe, die auf der Kopfstütze seines Schreibtischstuhls hing.
»Dein Mathebuch, Vicious. Ich brauche es«, wiederholte ich. »Ich werde nicht gehen, bevor ich es habe.«
»Verzieh dich, Helferlein«, sagte er an Georgias kicherndem Mund.
Eifersucht wühlte in meiner Brust, als würde ein Stachel darin stecken. Ich verstand meine Reaktion nicht. Den Schmerz. Die Scham. Die Lust. Ich verabscheute Vicious. Er war hart, herzlos und hasserfüllt. Ich wusste, dass er mit neun Jahren seine Mutter verloren hatte, aber inzwischen war er achtzehn, und er hatte eine Stiefmutter, die ihm alles durchgehen ließ. Josephine machte einen netten, fürsorglichen Eindruck.
Er hatte keinen Grund, so gemein zu sein, trotzdem war er es zu jedem. Besonders zu mir.
»Nein.« Innerlich bebte ich vor Zorn, doch nach außen gab ich mich unbeeindruckt. »Das Mathebuch.« Ich sprach betont langsam, als wäre er so unterbelichtet, wie er mich einschätzte. »Sag mir einfach, wo es ist. Ich lege es vor deine Tür, sobald ich fertig bin. Das ist der schnellste Weg, um mich loszuwerden und dich wieder deinen … Aktivitäten zuzuwenden.«
Georgia, deren weißes Etuikleid an der Rückseite bereits offen stand, hörte auf, an seinem Reißverschluss zu nesteln, und löste sich für einen Moment von seiner Brust.
Sie verdrehte die Augen und schürzte missbilligend die Lippen. »Ist das dein Ernst, Mindy?« Mein Name war Millie, das wusste sie. »Fällt dir nichts Besseres ein, womit du deine Zeit zubringen könntest? Er spielt in einer etwas anderen Liga, meinst du nicht?«
Vicious betrachtete mich, auf seinem Gesicht ein süffisantes Grinsen. Er sah unfassbar gut aus. Leider. Glänzende schwarze Haare, stylish geschnitten, an den Seiten kurz, oben länger. Funkelnde indigoblaue Augen, bodenlos tief, ihr Blick verhärtet. Keine Ahnung, warum. Derart blasse Haut, dass er an einen hinreißenden Vampir erinnerte.
Ich zeichnete gern und verbrachte viel Zeit damit, Vicious’ Äußeres zu bewundern. Seine ebenmäßigen, markanten, scharf geschnittenen Gesichtszüge. Er war dazu geboren, auf eine Leinwand gebannt zu werden. Ein Meisterwerk der Natur.
Auch Georgia war sich dessen bewusst. Ich hatte sie vor Kurzem nach dem Sportunterricht in der Umkleidekabine mit einer Freundin über ihn tuscheln hören. »Der Typ ist ein echter Leckerbissen«, hatte Letztere festgestellt.
»Alter, aber was für ein Scheißcharakter«, war es Georgia herausgerutscht. Nach einem kurzen Moment der Stille waren beide in Gelächter ausgebrochen.
»Wen kümmert’s«, hatte die Freundin gemeint. »Ich würde ihn trotzdem nicht von der Bettkante stoßen.«
Das Schlimmste war, dass ich es ihnen nicht einmal verdenken konnte.
Vicious war cool und dazu noch steinreich, ein beliebter Schüler, der redete und sich kleidete, wie es erwartet wurde. Das perfekte Aushängeschild der All Saints. Er fuhr die richtige Automarke – Mercedes – und verströmte diese geheimnisvolle Aura eines echten Alphatiers. Selbst wenn er sich komplett still verhielt, schien er den ganzen Raum einzunehmen.
Die Gelangweilte mimend, verschränkte ich die Arme vor der Brust und lehnte mich mit der Hüfte an den Türrahmen. Da ich wusste, dass mir die Tränen kommen würden, wenn ich direkt zu ihm oder Georgia sähe, richtete ich den Blick auf das Fenster.
»In einer anderen Liga?«, spottete ich. »Wir betreiben noch nicht einmal dieselbe Sportart. Ich kämpfe nicht mit unfairen Mitteln.«
»Dazu bringe ich dich schon noch«, konterte Vicious in dumpfem, humorlosem Ton. Es kam mir so vor, als hätte er mir die Eingeweide aus dem Leib gerissen und sie auf den makellosen Eisenholzboden geschleudert.
Ich blinzelte bedächtig, versuchte, mich gleichgültig zu geben. »Das Mathebuch?«, fragte ich zum gefühlt zweihundertsten Mal.
Anscheinend fand er, dass er mich für einen Tag genug gepiesackt hatte. Er wies mit einem Kopfnicken zu dem Rucksack unter seinem Schreibtisch. Das Fenster darüber ging auf die Dienstbotenwohnung, in der ich lebte, und gewährte ihm ungehinderten Blick direkt in mein Zimmer. Bis dato hatte ich ihn bei zwei Gelegenheiten dabei ertappt, wie er mich beobachtete, und mich jedes Mal gefragt, warum er das tat.
Warum, warum, warum?
Er hasste mich wie die Pest. Wann immer er mich ansah, was bei Weitem nicht so oft vorkam, wie ich es mir gewünscht hätte, schien mir die Intensität seines Blicks das Gesicht zu versengen. Aber da ich ein vernunftbegabtes Mädchen war, gestattete ich mir nicht, mich länger damit aufzuhalten.
Ich stakste zu dem gummibeschichteten Rucksack von Givenchy, den er jeden Tag mit zur Schule nahm, öffnete ihn seufzend und kramte geräuschvoll in seinen Sachen herum. Froh, dass mein Rücken ihnen zugewandt war, versuchte ich, die stöhnenden und schmatzenden Laute auszublenden.
Kaum dass meine Hand das vertraute, weiß-blaue Schulbuch berührte, wurde ich vollkommen regungslos. Ich starrte auf die Kirschblüte, die ich auf den Buchrücken gezeichnet hatte. Unbändiger Zorn wallte in mir auf und schoss durch meine Venen. Ich ballte die Hände zu Fäusten, öffnete sie wieder. Mir rauschte das Blut in den Ohren, mein Atem ging stoßweise.
Er hatte meinen verdammten Spind aufgebrochen.
Mit zitternden Fingern zog ich das Beweisstück aus dem Rucksack. »Du hast mein Mathebuch gestohlen?« Jeder Muskel in meinem Gesicht war angespannt, als ich mich zu ihm umdrehte.
Dies war eine Steigerung. Ein offener Angriff. Vicious hatte mich immer drangsaliert, jedoch nie auf eine solche Weise gedemütigt. Er hatte meine Sachen entwendet und meinen Spind mit Kondomen und gebrauchtem Toilettenpapier vollgestopft. War das zu fassen?
Unsere Blicke trafen sich, verschmolzen miteinander. Er schob Georgia von seinem Schoß, als wäre sie ein anhängliches Hündchen, mit dem er sich jetzt lange genug beschäftigt hatte, und stand auf. Ich ging auf ihn zu, bis unsere Nasenspitzen sich fast berührten.
»Warum machst du das mit mir?«, fauchte ich und musterte sein ausdrucksloses, zu Stein erstarrtes Gesicht.
»Weil ich es kann«, antwortete er mit einem Feixen, das den Schmerz in seinen Augen überdecken sollte.
Was lastet auf deiner Seele, Baron Spencer?
»Und weil es Spaß macht?« Er lachte leise und warf Georgia ihre Jacke zu.
Sie war eindeutig nicht mehr als eine Requisite. Ein Mittel zum Zweck. Er hatte mich absichtlich verletzen wollen.
Und Erfolg gehabt.
Ich sollte mir nicht den Kopf darüber zerbrechen, weshalb er sich so gebärdete. Es war vollkommen irrelevant. Ich hasste ihn, und basta. So sehr, dass es mich ganz krank machte, wie sehr er mir optisch gefiel, und das nicht nur auf dem Spielfeld. Ich hasste mich für meine Oberflächlichkeit und Unvernunft, weil ich nicht genug davon bekam, wie sein markanter Kiefer zuckte, wenn er mit einem Lächeln kämpfte. Von den klugen, witzigen Dingen, die aus seinem Mund kamen, wenn er vor der Klasse sprach. Ich hasste es, dass er ein zynischer Realist, ich hingegen eine hoffnungslose Idealistin war, und trotzdem liebte ich jedes Wort, das er laut äußerste. Und ich hasste es, dass mein Herz einmal pro Woche verrückte Sachen in meiner Brust anstellte, weil ich den Verdacht hatte, dass er derjenige sein könnte.
Ich hasste ihn, und er hasste mich eindeutig auch.
Ich hasste ihn, aber noch mehr hasste ich Georgia, weil sie es war, die er geküsst hatte.
Mir war vollauf bewusst, dass ich mich nicht mit ihm anlegen konnte, weil meine Eltern hier arbeiteten, darum biss ich mir auf die Zunge und stürmte zur Tür. Ich schaffte es gerade mal bis zur Schwelle, als seine schwielige Hand meinen Ellbogen packte und mich auf der Stelle herumdrehte, sodass ich gegen seine stahlharte Brust prallte.
»Wehr dich gegen mich«, flüsterte er und seine Nasenflügel blähten sich wie die eines wilden Raubtiers. Seine Lippen waren nah, ganz nah. Noch geschwollen von den Küssen, die er mit einem anderen Mädchen getauscht hatte, hoben sie sich rot von seiner Alabasterhaut ab. »Setz dich einmal im Leben durch, verdammt.«
Ich schüttelte seine Hand ab und drückte das Schulbuch wie einen Schutzschild gegen meinen Oberkörper. Dann stürzte ich, ohne Luft zu holen, aus dem Haus und bis zu unserer Wohnung. Ich riss die Tür auf, flüchtete mich in mein Zimmer, sperrte ab und ließ mich mit einem schweren Seufzen aufs Bett plumpsen.
Ich vergoss keine Tränen. Die hatte er nicht verdient. Aber ich war wütend, durcheinander und mehr als ein bisschen unglücklich.
In der Ferne hörte ich Musik aus seinem Zimmer schallen, die stufenweise lauter wurde, während er den Pegel bis zum Anschlag aufdrehte. Es dauerte ein paar Takte, ehe ich den Song erkannte. »Stop Crying Your Heart Out« von Oasis.
Einige Minuten später bretterte Georgia in ihrem roten Camaro – über den Vicious sich ständig mit dem Spruch »Welcher Trottel kauft sich einen Camaro mit Automatikgetriebe?« lustig machte – die dreispurige Einfahrt hinunter. Sie schien ebenfalls aufgebracht zu sein.
Vicious war, wie sein Name schon sagte, gemein. Dumm nur, dass mein Hass auf ihn von einer dünnen Schale umgeben war, die sich wie Liebe anfühlte. Aber ich gelobte mir, sie zu zertrümmern und nur noch den Abscheu zuzulassen, ehe er mich kaputtmachte. Erwird mich niemalskleinkriegen, schwor ich mir.
KAPITEL 2
VICIOUS
Zehn Jahre zuvor
Derselbe Scheiß wie immer, bloß ein anderes Wochenende. Ich gab mal wieder eine wilde Party bei mir zu Hause, machte mir aber nicht die Mühe, den Medienraum zu verlassen, um mit den Arschlöchern abzuhängen, die ich eingeladen hatte.
Ich wusste, welches Chaos mich draußen erwartete. Die kichernden und kreischenden Mädchen in dem nierenförmigen Pool hinter dem Haus. Das Plätschern des künstlichen Wasserfalls, der sich aus dem griechischen Rundbogen in das Becken ergoss, das Klatschen von Luftmatratzen an nackte, nasse Haut. Das Stöhnen der Pärchen, die in den umliegenden Zimmern rummachten. Die fiesen Lästereien der einzelnen Cliquen, die die exklusiven Sofas und Sessel im Erdgeschoss okkupierten.
Musik drang an mein Ohr – Limp Bizkit. Wer zum Henker hatte den Nerv, Langweiler Bizkit auf meiner Party zu spielen?
Ich hätte auch den ganzen Rest mitbekommen, aber ich hörte nicht hin. Stattdessen lümmelte ich breitbeinig in meinem Ohrensessel vor dem Fernseher und rauchte einen Blunt, während ich mir einen japanischen Zeichentrickporno reinzog.
Zu meiner Rechten stand ein Bier, doch ich rührte es nicht an.
Vor mir kniete irgendeine Tussi auf dem Teppich und massierte meine Schenkel, aber auch sie rührte ich nicht an.
»Vicious«, schnurrte sie und schob die Hand näher zu meinem Schritt. Dann richtete sie sich langsam auf und setzte sich rittlings auf meinen Schoß.
Eine namenlose, sonnengebräunte Brünette in einem Fick-mich-Kleid. Von der Optik her hätte sie eine Alicia oder Lucia sein können. Sie hatte letzten Herbst versucht, ins Cheerleading-Team aufgenommen zu werden. Ohne Erfolg. Ich tippte darauf, dass diese Party ihre erste Kostprobe in Sachen Popularität war. Mich oder irgendjemand anderen in diesem Zimmer aufzureißen, würde ihr im Schnellverfahren einen Promistatus an der Schule verleihen.
Schon allein deshalb war sie nicht interessant für mich.
»Dein Medienraum ist der Wahnsinn. Könnten wir vielleicht trotzdem irgendwohin gehen, wo es ruhiger ist?«
Ich tippte mit der Spitze meines Joints an den Aschenbecher auf der Armlehne, und die Asche rieselte hinein wie eine schmutzige Schneeflocke. Mein Kiefermuskel zuckte. »Nein.«
»Aber ich mag dich.«
Schwachsinn. Niemand mochte mich, und das aus gutem Grund.
»Beziehungen sind tabu für mich«, sagte ich automatisch.
»Ach nee. Das weiß ich doch, Dummerchen. Aber es ist doch nichts dabei, ein bisschen Spaß zu haben.« Sie stieß ein unattraktives, gurrendes Lachen aus, und ich hasste sie dafür, dass sie sich so sehr anstrengte.
Auf Selbstachtung hatte ich schon immer Wert gelegt.
Mit zusammengekniffenen Augen dachte ich über ihr Angebot nach. Sicher, ich konnte mir von ihr einen blasen lassen, aber ich war nicht so dumm, auf ihre gespielte Nonchalance reinzufallen. Die Weiber waren immer alle auf mehr aus.
»Du solltest von hier verschwinden«, sagte ich zum ersten und letzten Mal. Ich war nicht ihr Vater, darum lag es nicht in meiner Verantwortung, sie vor Typen wie mir zu warnen.
Sie zog eine Schnute, schlang die Arme um meinen Hals und rutschte meinen Schenkel rauf. Ihr entblößtes Dekolleté drückte gegen meine Brust, und in ihren Augen stand ein Ausdruck wilder Entschlossenheit. »Ich werde nicht ohne einen von euch HotHoles abziehen.«
Meine Lider vor Langeweile auf Halbmast zog ich eine Braue hoch und ließ Rauch durch meine Nase entweichen. »Dann solltest du es besser bei Trent oder Dean versuchen, weil ich heute Abend nicht mit dir schlafen werde, Schätzchen.«
Endlich fiel bei Alicia-Lucia der Groschen, und sie ließ von mir ab. Sie stolzierte auf ihren High Heels zur Bar, und mit jedem Schritt erstarb ihr falsches Lächeln etwas mehr. Dann mixte sie sich irgendeinen beschissenen Cocktail, ohne darauf zu achten, welchen Alkohol sie in das Glas goss. Ihre Augen glänzten, als sie sich im Zimmer umsah, um zu ergründen, welcher meiner Freunde – wir waren die vier HotHoles, die vier heißen Arschlöcher der All Saints Highschool – sich bereitwillig als ihre Eintrittskarte in die Welt der Prominenz zur Verfügung stellen würde.
Trent fläzte halb sitzend, halb liegend auf der Couch zu meiner Rechten, während irgendeine Grazie, deren Shirt bis zur Hüfte runtergezogen war, auf seinem Schoß saß. Er nippte derweil stumpfsinnig an seiner Bierflasche und tippte auf seinem Handy herum. Dean und Jaime saßen auf dem Zweiersofa links von mir und diskutierten über das Footballspiel nächste Woche. Keiner von beiden hatte eines der Mädchen angefasst, die wir ins Zimmer eingeladen hatten.
Bei Jaime kannte ich den Grund: Er war besessen von unserer Englischlehrerin, Miss Greene. Ich war nicht einverstanden mit seiner neuen, bescheuerten Obsession, aber ich würde ihm gegenüber deswegen niemals ein Wort verlieren. Was Dean betraf, hatte ich keinen Schimmer, was sein Problem war.
»Hey, Dean, wo ist dein Mädchen für heute Nacht?«, sprach Trent meinen Gedanken laut aus, während er durch die Playlist auf seinem iPod scrollte, offenbar hoffnungslos desinteressiert an dem Mädchen, das es ihm gerade besorgte.
Bevor Dean antworten konnte, schubste Trent sie mitten in der Bewegung von seinem Schoß und tätschelte ihr sanft den Kopf, als sie auf das Sofa purzelte. Ihr Mund stand offen, teils vor Lust, teils vor Schreck.
»Tut mir leid, aber das wird heute nichts. Liegt an dem Gips.« Er zeigte mit der Bierflasche zu seinem gebrochenen Knöchel und lächelte seine Gespielin entschuldigend an.
Von uns vieren war Trent der netteste.
Mehr musste man nicht über die HotHoles wissen.
Das Ironische war, dass Trent am meisten Grund hatte, verbittert zu sein. Er war am Arsch, und das wusste er. Ohne Football hatte er keine Chance, aufs College zu kommen. Seine Noten waren unter aller Sau, und seine Eltern hatten nicht einmal das Geld, um ihre Miete zu bezahlen, geschweige denn für seine Ausbildung aufzukommen. Seine Verletzung bedeutete, dass er in Südkalifornien bleiben und wie der Rest seiner Nachbarschaft irgendeiner schlecht bezahlten Arbeit – so er denn Glück hatte – nachgehen würde, nachdem er vier Jahre mit uns reichen Kids aus Todos Santos verbracht hatte.
»Alles bestens, Alter.« Deans Lächeln wirkte entspannt, was im Widerspruch dazu stand, dass er unaufhörlich mit dem Fuß auf den Boden klopfte. »Na ja, um ehrlich zu sein, will ich nicht, dass ihr von etwas kalt erwischt werdet. Hört ihr mir überhaupt zu?« Er grinste nervös und setzte sich gerade hin.
Genau in diesem Moment ging hinter mir die Tür auf. Wer immer es war, machte sich nicht die Mühe anzuklopfen. Dabei wusste jeder, dass dieses Zimmer tabu war. Dies war der private Partyraum der HotHoles. Die Regel war klar: Hier kam man nicht herein, wenn man nicht eingeladen war.
Die Mädchen im Zimmer starrten alle zur Tür, aber ich rauchte weiter Gras, während ich mir wünschte, dass Alicia-Lucia endlich von der Bar verschwand. Ich brauchte ein frisches Bier und war nicht in Plauderlaune.
»Wow, hi.« Dean winkte dem Neuzugang, und es schien, als würde sein ganzer dämlicher Körper lächeln.
Jaime nickte grüßend und spannte sich auf seinem Platz an, bevor er mir einen Blick zuwarf, den ich nicht entschlüsseln konnte, weil ich zu bekifft war. Trent wandte ebenfalls den Kopf zur Tür und grummelte etwas.
»Wer immer das ist, sollte besser eine Pizza dabeihaben, um bleiben zu dürfen.« Ich biss die Zähne zusammen und warf schließlich einen Blick über meine Schulter.
»Hallo, alle zusammen.«
Als ich ihre Stimme hörte, passierte etwas Seltsames in meiner Brust.
Es war Emilia. Die Tochter der Hausangestellten. Warum ist sie hier? Sie kam nie aus der Dienstbotenwohnung, wenn ich eine Party gab. Abgesehen davon hatte sie mich keines Blickes gewürdigt, seit sie vergangene Woche mit ihrem Mathebuch aus meinem Zimmer gestürmt war.
»Wer hat dir die Erlaubnis erteilt, hier aufzutauchen, Helferlein?« Ich zog an meinem Blunt, inhalierte tief und stieß eine Wolke widerlich süßen Qualms aus, bevor ich mich mit meinem Sessel zu ihr herumdrehte.
Ihre azurblauen Augen streiften mich flüchtig, dann erfassten sie jemanden hinter mir. Ihre Lippen verzogen sich zu einem schüchternen Lächeln. Der Partylärm wurde schwächer, ich sah nur noch ihr Gesicht.
»Hallo, Dean.« Sie senkte den Blick auf ihre Vans.
Ihr langes, karamellfarbenes Haar fiel ihr als Zopf über eine Schulter. Sie trug Boyfriendjeans und ein Daria-Shirt, das sie absichtlich mit einer nicht dazu passenden orangeroten Wolljacke kombiniert hatte. Ihr Kleidungsstil war pubertär und grauenvoll. Auf ihrem Handrücken prangte noch immer die Tintenzeichnung eines Kirschblütenbaums, die sie im Kurs für Englische Literatur angefertigt hatte. Warum sah sie trotz alledem so irre heiß aus? Egal. Ich verabscheute sie so oder so. Aber ihr offensichtliches Bemühen, nicht sexy zu wirken, gepaart mit der Tatsache, dass sie es war, bescherte mir wie gewohnt einen heftigen Ständer.
Ich riss mich von ihrem Anblick los und nahm Dean ins Visier. Er quittierte ihr Lächeln mit einem bescheuerten Grinsen, das geradezu darum bettelte, dass ich ihm die Zähne ausschlug.
Was. Zur. Hölle?
»Vögelt ihr zwei etwa?« Jaime ließ seinen Kaugummi knallen und fuhr sich durch seine lange blonde Surfermähne. Diese Frage wäre mir niemals über die Lippen gekommen. Ihm persönlich war es scheißegal, aber er wusste, dass es mich interessierte.
»Lieber Himmel.« Dean stand auf und gab Jaime einen Klaps auf den Nacken, markierte plötzlich den wohlerzogenen Jungen.
Ich kannte ihn zu gut, um ihm die Masche abzukaufen. Er hatte es auf dem Sofa, auf dem er eben noch gesessen hatte, mit so vielen Mädchen getrieben, dass seine DNA für immer darin eingeprägt war. Wir waren keine netten Kerle. Wir taugten nicht für Beziehungen und versuchten auch gar nicht, daraus einen Hehl zu machen. Und mit Ausnahme von Jaime, der wirres Zeug faselte und wie ein durchtriebener Zehntklässler daran feilte, Ms Greene zu erobern, praktizierten wir keine Monogamie.
Das – und nur das – störte mich an der Vorstellung, dass zwischen Dean und Emilia etwas lief. Ich hatte schon genug Drama zu bewältigen und wollte nicht miterleben, wie ihr das Herz gebrochen wurde. In meinem Haus. Zerschmettert auf meinem Fußboden. Und so sehr ich sie auch verachtete … stand es uns nicht zu, sie zu zerstören. Emilia war nur ein Landei aus Virginia, mit einem sonnigen Lächeln und einem nervigen Akzent. Ihre Persönlichkeit hätte einem verdammten Michael-Bublé-Song entsprungen sein können. So gut und naiv. Sie hatte mir sogar zugelächelt, als sie mich dabei erwischte, dass ich wie ein Spanner in ihr Zimmer glotzte.
Warum war sie so?
Es war nicht ihre Schuld, dass ich sie hasste. Weil sie mich und Daryl damals belauscht hatte. Weil sie aussah und klang wie meine Stiefmutter Jo.
»Ich freue mich, dass du es einrichten konntest. Entschuldige, dass du extra herkommen musstest. Ich hatte nicht gemerkt, dass es schon so spät ist. Dies ist kein Ort für eine Lady«, flachste Dean, bevor er seine Jacke von der Armlehne der schwarzen Ledercouch nahm und zur Tür eilte.
Er legte ihr den Arm um die Schulter, und mein linkes Augenlid flatterte.
Er strich ihr eine Haarsträhne, die sich aus ihrem Zopf gelöst hatte, hinters Ohr, und mein Kiefer verkrampfte sich.
»Hoffentlich bist du hungrig. Ich kenne ein wirklich gutes Fischrestaurant im Jachthafen.«
Sie lächelte. »Sicher. Ich bin dabei.«
Er lachte, und meine Nasenflügel blähten sich.
Dann gingen sie.
Verflucht, sie gingen einfach.
Ich klemmte mir den Blunt in den Mundwinkel und drehte mich wieder zum Fernseher um. Im Zimmer herrschte Stille, alle Augen waren auf mich gerichtet, als wartete man auf irgendwelche Anweisungen, und warum, zum Teufel, waren alle so nervös?
»He, du.« Ich zeigte auf das Mädchen, das eben noch auf Trents Schoß gesessen hatte. Sie stand vor dem Spiegel neben meinen Spielekonsolen und richtete ihre Haare. Ich klopfte auf meinen Schoß. »Komm her, und bring deine Freundin mit.« Ich fixierte die andere mit meinem Blick. Es war dasselbe Mädchen, das ich vor wenigen Minuten abgewiesen hatte. Zum Glück hatte sie beschlossen zu bleiben.
Sie kletterten auf mich, jede auf einen Schenkel. Ich zog an meinem Joint, dann deutete ich der Ersten an, sich vorzubeugen, und presste meine Lippen auf ihre. Ich atmete aus, blies den Rauch in ihren Mund. Sie seufzte beglückt und nahm ihn vollständig auf.
»Gib ihn weiter.« Die Augen halb zu, strich ich mit der Nase an ihrer entlang. Sie lächelte mit geschlossenen Lippen, dann küsste sie das andere Mädchen auf meinem Schoß und ließ den Rauch in seinen Mund entweichen.
Trent und Jaime ließen mich keine Sekunde aus den Augen.
»Bestimmt vögeln sie nur miteinander«, meinte Trent und fuhr sich mit der Hand über seinen rasierten Schädel. »Ich wusste bis heute Abend nichts von diesem Scheiß, und es ist wahrscheinlicher, dass ich bei einer Party in der Playboy-Mansion meine Hose anbehalten könnte, als dass Dean ein Geheimnis bewahrt.«
»Ganz genau«, pflichtete Jaime ihm bei. »Wir sprechen hier von Dean. Er hatte noch nie auch nur ansatzweise was Ernstes mit einem Mädchen.« Er stand auf und schlüpfte in seine marineblaue All-Saints-High-Jacke. »Wie auch immer. Ich muss jetzt los.«
Schon klar. Um sich auf einer Datingwebsite als irgendein Loser auszugeben und die Nacht damit zu verbringen, Miss Greene zu umgarnen.
»Aber ich rate dir«, fügte er hinzu, »der Sache nicht zu viel Bedeutung beizumessen. Er wird in New York aufs College gehen. Während ihr beide hierbleibt. Sie wurde nirgendwo angenommen, richtig?«
Richtig.
Und bislang konnte sie auch kein Stipendium ergattern. Ich wusste das, weil wir uns einen Briefkasten teilten und ich ihre Post durchstöberte, um herauszufinden, wohin es Emilia LeBlanc verschlagen würde. Bisher standen die Zeichen auf nirgendwo, zu ihrer immensen Enttäuschung.
Ich würde ein Elite-College in Los Angeles besuchen, ein paar Stunden von Todos Santos entfernt, und sie würde hier ausharren. Jedes zweite Wochenende würde ich zurückkommen, und sie wäre immer noch hier. Um für mein Wohlergehen zu sorgen.
Um mir zu Diensten zu sein.
Mich zu beneiden.
Sie würde klein und bedeutungslos bleiben. Und vor allem – mein.
»Tatsächlich geht es mir am Arsch vorbei.« Lachend packte ich beide Mädchen am Hintern und knetete das weiche Fleisch.
»Also, wo waren wir?«, fragte ich meine Freunde.
»Allem Anschein nach im Verleugnungsmodus. Herrje.« Jaime schüttelte den Kopf und trottete zur Tür. Auf dem Weg dorthin drückte er Trents Schulter. »Pass auf, dass die Mädchen keine allzu großen Dummheiten anstellen.«
»Du meinst, wie er?« Trent zeigte mit dem Daumen auf mich.
Ich sah ihn aus schmalen Augen an. Es kümmerte ihn nicht. Er war ein Junge aus dem Getto. Ihn konnte nichts einschüchtern, schon gar nicht eine reiche Arschgeige wie ich.
Ich brodelte vor Zorn. Bald würde ich überkochen.
Sie waren sich so sicher, mich zu kennen. So sicher, dass ich Emilia LeBlanc begehrte.
»Scheiß auf diesen Mist. Ich gehe runter zum Pool.« Ich stand so abrupt auf, dass die Mädchen mit einem weichen Plumps auf den Armlehnen des Sessels landeten.
Die eine jaulte protestierend, die andere kreischte: »Was fällt dir ein!«
»Schlechter Trip«, lautete meine lasche Erklärung.
»Ah, okay. Das kommt vor.« Sie lächelten verständnisvoll.
Mein Drang, den Vätern der beiden die Scheiße aus dem Leib zu prügeln, war fast so stark wie der, Daryl die Fresse einzuschlagen. Ihr devotes Verhalten widerte mich an.
»Wirst du mich anrufen?« Alicia-Lucia zupfte an meinem Shirt. Hoffnung schimmerte in ihren Augen auf.
Ich musterte sie eingehend. Sie sah gut aus, wenn auch nicht so gut, wie sie sich einbildete. Andererseits war sie beflissen, es mir recht zu machen, darum wäre sie vielleicht gar nicht so schlecht im Bett.
Ich hatte sie gewarnt.
Sie wollte einfach nicht hören.
Und ich war kein netter Kerl.
»Hinterlass deine Nummer auf Trents Handy.« Ich drehte mich auf dem Absatz um und verließ das Zimmer.
Im Flur machten die Leute mir den Weg frei, indem sie sich mit dem Rücken an die Wand drängten. Lächelnd prosteten sie mir mit ihren roten Einwegbechern zu, machten Männchen vor mir, als wäre ich der verdammte Papst. Und für sie war ich das. Dies war mein Königreich. Böse Jungs wie ich erfreuten sich großer Beliebtheit. Das war typisch für Kalifornien und der Grund, warum ich niemals von dort weggehen würde. Ich liebte alles daran, was andere hassten. Die Lügner und Heuchler, die Masken und das Gekünstelte. Die Tatsache, dass die Leute sich nur für dein Bankkonto interessierten und einen Scheiß auf innere Werte gaben. Dass sie sich von teuren Autos und billigen Witzen beeindrucken ließen. Ich liebte sogar die Erdbeben und die abartigen Gemüse-Smoothies.
Dieses Pack, das ich verabscheute, war meine Familie. Dieses Anwesen mein Spielplatz.
Überall im Gang wurde Gemurmel laut. Normalerweise beehrte ich diese Leute nicht mit meiner Anwesenheit, und wenn ich es doch tat, wussten sie, warum. Heute Nacht würde es Ärger geben. Die Aufregung war mit Händen zu greifen.
»Fell in Love With a Girl« von den White Stripes hallte von den dunklen Wänden wider.
Ich stellte zu niemandem Blickkontakt her, sondern starrte stur geradeaus, während ich mich durch den Pulk bewegte, bis ich den Vorratskeller unter der Küche erreichte. Es war still und finster dort, genau wie in mir. Ich zog die Tür hinter mir zu, lehnte mich mit dem Rücken dagegen, schloss die Augen und atmete die feuchte Luft tief in meine Lungen.
Dieser Stoff, den Dean mitgebracht hatte, war echt stark. Es war nicht ganz gelogen gewesen, als ich einen schlechten Trip vorgeschoben hatte.
Ich ging tiefer in den Raum hinein und sperrte den Rest der Welt im Geist aus. Daryl Ryler. Josephine. Selbst die Personen, mit denen ich nur halb auf Kriegsfuß stand, wie Emilia und meinen Vater. Meine Finger strichen über die Waffen, die ich seit Jahren sammelte. Ich betastete das Brecheisen, den Dolch, den Baseballschläger und die Lederpeitsche. Mir dämmerte, dass ich dieses Arsenal irgendwann – hoffentlich bald – würde aufgeben können. Ich hatte es nie benutzt, sondern besaß es nur, weil ich mich damit sicherer fühlte. Hauptsächlich wegen Daryl. Solange ich diese Waffen hatte, konnte er mir nicht mehr blöd kommen.
Ich war auf einen langsam eskalierenden, körperlichen Kampf aus. Auf eine Schmerzexplosion, die aus dem Nichts kam. Kurz gesagt, auf Ärger.
Mit leeren Händen ging ich wieder nach oben und hinaus zum Pool. Das Mondlicht erhellte mein Spiegelbild im klaren Wasser, als ich mich über den Rand beugte. Das Becken war voll mit Teenagern in Badehosen und Designer-Bikinis. Ich ließ den Blick schweifen, hielt nach Dean Ausschau. Er war derjenige, gegen den ich kämpfen wollte. Um ihm seine selbstgefällige Junge-von-nebenan-Fresse zu polieren. Aber ich wusste, dass er mit dem Helferlein ausgegangen war, abgesehen davon waren Regeln nun mal Regeln. Nicht einmal ich konnte sie brechen. Indem ich mit hochgerollten Ärmeln draußen auftauchte, war jeder, der Lust hatte, gegen mich zu kämpfen, eingeladen vorzutreten. Aber ich konnte niemanden im Speziellen dazu auffordern. Der Gegner musste sich freiwillig melden. Das war das gefährliche Spiel, mit dem wir, von der All Saints High, die Zeit totschlugen: Defy.
Defy war fair.
Defy war brutal.
Aber in erster Linie betäubte Defy den Schmerz und lieferte eine großartige Rechtfertigung für meine vernarbte Haut.
Ich war wenig überrascht, als ich das Poltern von Trents Gips hinter mir hörte. Er wusste, wie beschissen ich drauf war, und wollte das Schlimmste verhindern.
»Sag Dean, er soll die Finger von ihr lassen, sonst tu ich es«, drang seine Stimme an mein Ohr.
Ich schüttelte höhnisch grinsend den Kopf. »Er kann tun, was er will. Wenn er diese Hinterwäldlerin flachlegen will, ist das sein Bier.«
»Vicious«, sagte Trent in warnendem Ton.
Ich drehte mich zu ihm um und musterte ihn von Kopf bis Fuß. Seine ebenmäßige, hellbraune Haut schimmerte im Schein des Vollmonds, und ich hasste ihn für seine Fähigkeit, das andere Geschlecht mit solcher Sorglosigkeit zu genießen. Wahllos irgendwelche Bräute zu nageln wurde zu schnell öde. Dabei war ich noch nicht mal achtzehn.
»Das Theater um dieses Mädchen wird noch alles kaputtmachen.« Trent zog sein Hemd aus und entblößte seinen breiten, kraftstrotzenden Oberkörper. Er war der reinste Muskelprotz.
Wie immer behielt ich mein Shirt an. Die Leute beobachteten uns begierig, aber diese Arschlöcher hatten mich nie interessiert. Sie wollten ihr bedeutungsloses Dasein mit etwas füllen, worüber sie reden konnten. Ich gab es ihnen nur zu gern.
Ich ballte die Hand zur Faust und legte den Kopf schräg. »Oh, du machst dir Sorgen um mich. Ich bin echt gerührt, T-Rex.« Ich fasste mir über meinem schwarzen Shirt ans Herz und verspottete ihn mit einem künstlichen Lächeln.
Georgia und ihre Freundinnen behielten uns aufmerksam im Auge, während sie darauf warteten, dass das Monster in mir sich auf einen meiner besten Freunde stürzte. Meine Schulter streifte die seine, als ich mich an Trent vorbeischob und zu dem Tennisplatz marschierte, wo wir an den meisten Wochenenden kämpften. Er war groß, abgelegen und bot ausreichend Platz, damit die Zuschauer an einer Seite unseres provisorischen Achtecks sitzen konnten.
»Los, zeig, was du draufhast, Rexroth«, knurrte ich und versuchte, mich zu beruhigen, indem ich mir sagte, dass Trent und Jaime recht hatten. Das mit Dean und Emilia war nur ein Techtelmechtel. Bis zum Ende des Monats würden sie Schluss gemacht haben. Er würde sie sitzen lassen – hoffentlich jungfräulich. Verletzt, zornig und verunsichert würde sie auf Rache sinnen.
Und dann würde ich zuschlagen.
Ich würde ihr demonstrieren, dass sie nichts weiter war als mein Eigentum.
»Komm schon, Trent. Schaff deinen Arsch rüber zum Tennisplatz. Und versuch, meinen verdammten Rasen nicht vollzubluten, wenn ich mit dir fertig bin.«
KAPITEL 3
EMILIA
Die Gegenwart
»Pass doch auf, wo du langfährst, Arschloch!«, schimpfte ich, während ich an der Ecke des eindrucksvollen Bürogebäudes in der Upper East Side wartete.
Der Matschfleck auf meinem mit winzigen Smileys bedruckten Trägerkleid im Matrosenstil breitete sich schnell aus. Mein Handy zwischen mein Ohr und meine Schulter geklemmt, unterdrückte ich einen Wutschrei. Ich war pudelnass, hungrig, müde und wartete ungeduldig darauf, dass die Fußgängerampel endlich auf Grün umschaltete. Obendrein kam ich schon jetzt zu spät zu meiner Schicht bei McCoy’s.
Das Hupkonzert der Autos an einem typischen Freitagabend dröhnte in meinen Ohren. Problematisch beim unachtsamen Überqueren einer Straße in New York City ist, dass die meisten Autofahrer Einheimische sind und nicht davor zurückschrecken, einen notfalls umzunieten.
Oder eben deine Klamotten einzuweichen.
»Was ist denn los, Millie?« Rosie, mit der ich gerade telefonierte, hustete am anderen Ende der Leitung in mein Ohr. Sie klang wie ein asthmatischer Hund. Meine Schwester hatte den ganzen Tag das Bett gehütet. Ich wäre neidisch gewesen, hätte ich den Grund nicht gekannt.
»Ein Taxifahrer hat mich gerade absichtlich nass gespritzt«, erklärte ich.
»Reg dich ab«, tröstete sie mich auf ihre eigene, spezielle Weise, dann hörte ich, wie sie sich stöhnend im Bett umdrehte. »Wiederhol noch mal, was sie gesagt haben.«
Die Ampel sprang auf Grün. Die wilde Meute von New Yorker Fußgängern rannte mich fast um, als wir über die Straße hetzten und die Köpfe unter dem Baugerüst einzogen, das über uns aufragte. Meine in High Heels steckenden Füße kreischten vor Schmerz, während ich an Essensverkäufern und Männern in Caban-Jacken vorbeihastete und dabei inständig hoffte, noch rechtzeitig anzukommen, bevor das Personalessen in der Küche vorbei und meine Chance, etwas zu ergattern, vertan wäre.
»Sie haben gesagt, dass sie mein Interesse an der Werbebranche zwar durchaus zu schätzen wüssten, ich aber dafür bezahlt werde, Kaffee zu kochen und Akten abzuheften, anstatt bei Kreativmeetings Vorschläge zu unterbreiten und meine Ideen während der Mittagspause mit den Designteams zu erörtern. Ich sei natürlich überqualifiziert für den Job einer Sekretärin, aber sie hätten keinen Praktikumsplatz in der Grafikabteilung zu vergeben. Außerdem seien sie gerade dabei, aus wirtschaftlichen Gründen ›abzuspecken‹. Womit offenbar ich gemeint war.« Angesichts der Tatsache, dass ich nie zuvor dünner gewesen war – wenn auch nicht freiwillig –, konnte ich mir ein verbittertes Lachen nicht verkneifen. »Darum haben sie mich gefeuert.«
Ich stieß seufzend den Atem aus, und er formte sich zu einer weißen Wolke. Die Winter in New York waren dermaßen kalt, dass man sich wünschte, mitsamt der Decke, in die man sich nachts einmummelte, zur Arbeit erscheinen zu können. Wir hätten in den Süden zurückkehren sollen. Das wäre immer noch weit genug von Kalifornien entfernt gewesen. Abgesehen davon waren die Mieten dort um einiges billiger.
»Dann hast du jetzt nur noch deine Stelle bei McCoy’s?« Jetzt war es an Rosie zu seufzen, dabei erzeugten ihre Lungen ein seltsames Geräusch. In ihrer Stimme klang Angst mit.
Ich konnte es ihr nicht verdenken. Immerhin sorgte ich momentan für uns beide. Ich hatte als Sekretärin nicht viel verdient, aber verdammt, ich brauchte beide Jobs. Wegen Rosies Medikamenten kamen wir so nicht über die Runden.
»Mach dir keinen Kopf«, beruhigte ich sie, als ich eine geschäftige Straße entlangeilte. »Das ist New York. Es gibt überall freie Stellen. Du kannst dich vor Jobs buchstäblich nicht retten. Ich finde problemlos etwas anderes.« Pustekuchen. »Hör zu, ich muss jetzt aufhören, wenn ich meine abendliche Stelle nicht auch noch verlieren will. Ich bin schon drei Minuten zu spät. Hab dich lieb. Bis dann.«
Ich legte auf und blieb zappelig an einem weiteren Fußgängerübergang stehen. Vor mir wartete eine ganze Horde von Leuten darauf, die Straße zu überqueren. Ich durfte meinen Job bei McCoy’s, einer Bar im Stadtzentrum, auf keinen Fall riskieren. Ich sah zur Seite und heftete den Blick auf die lange, dunkle Gasse, die zwischen zwei riesigen Gebäuden hindurchführte. Eine Abkürzung. Das ist es nicht wert, flüsterte eine innere Stimme.
Ich war zu spät dran.
Und ich hatte gerade meinen anderen Job verloren.
Rosie war wieder krank.
Die Miete musste bezahlt werden.
Scheiß drauf, Augen zu und durch.
Ich sprintete los. Meine Wirbelsäule vibrierte jedes Mal, wenn meine Stöckelschuhe auf dem Asphalt aufkamen. Der kalte Wind schlug mir ins Gesicht, was sich wie Peitschenhiebe anfühlte. Ich rannte so schnell, dass mehrere Sekunden vergingen, ehe ich realisierte, dass mich jemand an der Umhängetasche über meiner Schulter nach hinten riss. Ich landete auf dem Hintern. Der Boden war nass und kalt, und ich war auf mein Steißbein gefallen.
Es war mir egal. Ich hatte nicht mal die Zeit, schockiert oder wütend zu reagieren. Die Tasche an meine Brust gepresst, schaute ich zu dem Angreifer hoch. Er war noch ein Kind. Ein Teenager, um genau zu sein, mit einem von entzündeten Pickeln übersäten Gesicht. Groß und schlaksig und aller Wahrscheinlichkeit nach genauso hungrig wie ich. Aber es war meine Tasche. Mein Zeug. New York war ein Betondschungel. Manchmal musste man gemein sein, um zu überleben. Gemeiner als seine Widersacher.
Ich stieß die Hand in meine Tasche, wühlte nach dem Pfefferspray. Ich wollte ihm nur Angst machen, ihm eine Lektion erteilen. Der Jugendliche zerrte abermals an meiner Tasche, und ich drückte sie fester an meinen Bauch. Endlich ertastete ich die kühle Spraydose. Ich zog sie heraus und zielte damit auf seine Augen.
»Hau ab, oder du wirst blind«, warnte ich ihn mit zittriger Stimme. »Ich finde, das ist es nicht wert, aber es ist deine Entscheidung.«
Er holte mit dem Arm aus, und ich drückte auf den Sprühkopf. Der Junge verdrehte mir brutal das Handgelenk. Der Sprühstoß verfehlte ihn um wenige Zentimeter. Er versetzte mir einen Rückhandschlag gegen die Stirn und stieß mich zur Seite. Von dem Hieb drehte sich mir der Kopf. Alles wurde schwarz, als ich das Bewusstsein verlor.
Ein Teil von mir war nicht allzu versessen darauf, es wiederzuerlangen.
Aus gutem Grund, denn als ich zu mir kam, stellte ich fest, dass meine Tasche verschwunden war. Mein Handy, mein Portemonnaie, mein Führerschein, mein Bargeld – zweihundert Mäuse, die ich verflixt noch mal meinem Vermieter schuldete – alles weg.
Der dreckige Asphalt grub sich in meine Handflächen, als ich mich auf die Füße rappelte. Bei meinem Sturz war an einem meiner billigen Schuhe der Absatz abgebrochen. Beim Aufstehen schnappte ich ihn mir. Ich erspähte die sich entfernende Silhouette des Straßenräubers, der meine Tasche umklammerte, und wedelte drohend mit dem Holzabsatz in meiner Faust hinter ihm her. Dann tat ich etwas, das mir überhaupt nicht ähnlich sah: Zum ersten Mal seit Jahren fluchte ich lauthals.
»Weißt du was? Fick dich!«
Meine Kehle brannte vom Brüllen, als ich humpelnd den restlichen Weg zu McCoy’s zurücklegte. Zu heulen hätte nichts gebracht, auch wenn ich mir ziemlich leidtat. Am selben Tag ausgeraubt und gefeuert zu werden? Oh ja, ich würde mir definitiv ein paar Schnäpse genehmigen, wenn mein Boss, Greg, gerade nicht hersah.
Ich kam zwanzig Minuten zu spät zur Arbeit. Mein einziger kleiner Trost bestand darin, dass der Griesgram nicht da war und ich somit nicht Gefahr lief, zum zweiten Mal an diesem Tag rausgeworfen zu werden.
Rachelle, die Managerin, war eine Freundin von mir. Sie wusste über meine prekäre finanzielle Situation Bescheid. Über Rosie. Über alles.
Als ich durch die Hintertür eintrat und ihr im Gang vor der Küche begegnete, zuckte sie zusammen, dann strich sie mir das fliederfarbene Haar aus dem Gesicht.
»Ich schließe abartigen Sex mal aus und tippe auf Ungeschicklichkeit«, sagte sie und runzelte mitleidsvoll die Stirn.
Ich stieß den Atem aus und schloss für einen Moment die Augen. Anschließend blinzelte ich die ungeweinten Tränen weg, die mir die Sicht verschleierten. »Ich wurde auf dem Weg hierher überfallen. Der Mistkerl hat meine Tasche geklaut.«
»Oh Süße.« Rachelle schloss mich fest in die Arme.
Ich lehnte die Stirn an ihre Schulter und seufzte tief. Obwohl ich noch immer aufgebracht war, fühlte sich die Berührung gut an. Tröstlich. Zudem war ich erleichtert, dass Greg nicht da war. Somit konnte ich still und leise meine Wunden lecken, ohne dass er uns Kellnerinnen mit Schaum vor dem Mund anschrie.
»Es kommt noch besser, Rach. R/BS Advertising hat mir gekündigt«, flüsterte ich in ihre dunkelrote Mähne.
Sie erstarrte. Als wir uns voneinander lösten, stand keine Besorgnis mehr in ihrem Gesicht, sondern blankes Entsetzen. »Millie …« Sie biss sich auf die Lippe. »Was willst du jetzt tun?«
Das war eine sehr gute Frage. »Mehr Schichten hier übernehmen, bis ich mich wieder berappelt und einen neuen Ganztagsjob gefunden habe? Bei einer Zeitarbeitsfirma anheuern? Eine Niere verkaufen?«
Der letzte Vorschlag war selbstverständlich ein Witz, trotzdem merkte ich mir vor, diesbezüglich ein paar Recherchen anzustellen. Aus purer Neugierde. Schon klar.