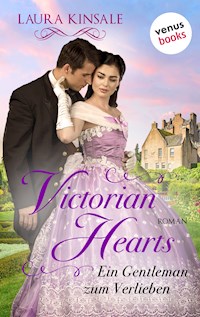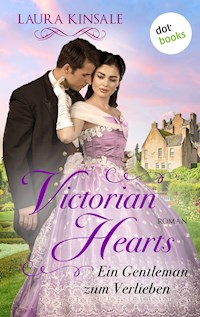4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Victorian Hearts
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Eine Liebe, die allen Stürmen trotzt: Der historische Liebesroman »Victorian Hearts – Der Kuss des Marquess« von Laura Kinsale jetzt als eBook bei venusbooks. West Sussex, 1863. Tess Collier, die Tochter des Earl of Morrow, sollte eigentlich ganz englische Lady sein – ist aber am fernen Ufer des Amazonas wie eine Abenteurerin aufgewachsen. Darum ist sie auch alles andere als begeistert davon, nun wieder in England zu sein, denn hier soll sie auf die Suche nach einem standesgemäßen Ehemann gehen. Noch dazu stellt man ihr den ruppigen Gryphon, Marquess of Ashford, an die Seite, der ebenfalls wenig begeistert davon zu sein scheint, eine gute Partie für den Wildfang zu finden. Schneller, als Tess lieb ist, bekommt sie den Heiratsantrag eines vermögenden Mannes – und muss sich eingestehen, dass ihr Herz doch längst für Gryphon schlägt. Aber eine Verbindung mit ihm scheint unmöglich zu sein … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die historische Romanze »Victorian Hearts – Der Kuss des Marquess« von Laura Kinsale. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Ähnliche
Über dieses Buch:
West Sussex, 1863. Tess Collier, die Tochter des Earl of Morrow, sollte eigentlich ganz englische Lady sein – ist aber am fernen Ufer des Amazonas wie eine Abenteurerin aufgewachsen. Darum ist sie auch alles andere als begeistert davon, nun wieder in England zu sein, denn hier soll sie auf die Suche nach einem standesgemäßen Ehemann gehen. Noch dazu stellt man ihr den ruppigen Gryphon, Marquess of Ashford, an die Seite, der ebenfalls wenig begeistert davon zu sein scheint, eine gute Partie für den Wildfang zu finden. Schneller, als Tess lieb ist, bekommt sie den Heiratsantrag eines vermögenden Mannes – und muss sich eingestehen, dass ihr Herz doch längst für Gryphon schlägt. Aber eine Verbindung mit ihm scheint unmöglich zu sein …
Über die Autorin:
Nach ihrem Masterabschluss an der University of Texas war Laura Kinsale als Geologin tätig, bis sie begann, Romane zu schreiben. Ihre Bücher standen mehrfach auf der Auswahlliste für den besten amerikanischen Liebesroman des Jahres und stürmten immer wieder die Bestsellerlisten der New York Times. Die Autorin lebt mit ihrem Mann David abwechselnd in Santa Fé/New Mexico und Texas.
Bei venusbooks erscheinen von Laura Kinsale:
»Eine eigensinnige Lady«
»Victorian Hearts – Ein Gentleman zum Verlieben«
»Die Leidenschaft des Dukes«
»In den Fängen des Piraten«
***
eBook-Neuausgabe September 2021
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1986 unter dem Originaltitel »The Hidden Heart« bei Avon Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 unter dem Titel »Verborgene Sehnsucht« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1986 by Laura Kinsale
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1996 Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © Period Images, © shutterstock / Erhan Inga / cowardlion / Iakov Kalinin
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-866-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Kuss des Marquess« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Laura Kinsale
Victorian Hearts - Der Kuss des Marquess
Roman
Aus dem Amerikanischen von Helmut Gerstberger
venusbooks
Prolog
Inmitten des verlorenen Häufchens fast völlig nackter Indianer war sich Lady Tess Collier nur allzu deutlich bewußt, daß sie nicht gerade wie eine Lady aussah. Auch ohne die pikierten Blicke der vornehmen europäischstämmigen Bewohner von Pará wußte sie sehr wohl, daß sie eine reichlich unvorteilhafte Erscheinung abgab. Nach dem Anlegen der Pirogen am Ufer war ihr Rock zerrissen und schwer vom Wasser und vom Sand; ihre Haare waren ungekämmt und zu einem schlichten Knoten im Nacken zusammengerafft; die Fingernägel abgestoßen und gebrochen von den Anstrengungen beim Ausladen ihrer kostbaren Sammlung von Pflanzen und Tieren – nein, sie hatte wahrlich wenig Ähnlichkeit mit der einzigen Tochter des Earl of Morrow.
Sie strich sich eine Strähne ihres rabenschwarzen Haars aus dem Gesicht und erklärte den Indianern im Brustton der Überzeugung, daß die Dschungelungeheuer mit Löchern statt Gesichtern sie nun nicht mehr verfolgten und daß sie jetzt, da die Pirogen entladen waren, vollkommen sicher nach Hause zurückkehren konnten. Der Anblick ihrer erleichtert wirkenden Gesichter war traurig und komisch zugleich. Sie hatten die weiße Frau von Barra do Rio Negro bis hierher begleitet, um sich vor den schrecklichen Dämonen in Sicherheit zu bringen, die – wie sie ihnen versichert hatte – auf sie herabfahren würden, falls sie sich weigerten. Den ganzen langen Weg den Fluß herab hatten sie ängstliche Blicke über die Schultern geworfen.
Nachdem Tess sie entlassen hatte, trollten sie sich davon, und sie wirkten in der ihnen ungewohnten städtischen Umgebung ebenso verloren und unglücklich, wie ihr selbst zumute war. Sechs Monate. Sechs Monate und tausend Meilen flußabwärts, und sie hatte sich noch immer nicht ganz mit dem Tod ihres Vaters abgefunden. Er war am Neujahrstag an Gelbfieber gestorben, in einem kleinen Dorf am Fluß oberhalb von Barra. Am 1. Januar 1863 – auf den Tag genau zehn Jahre, nachdem er seine damals elfjährige, mutterlose Tochter bei der Hand genommen und seinem feudalen Landsitz in West Sussex für immer den Rücken gekehrt hatte, um als Naturforscher die Welt zu erkunden.
»Geh nach Hause«, hatte er geflüstert, als er vom Fieber geschwächt und schweißnaß in jener elenden Indianerhütte gelegen hatte. Sie hatte nicht geweint. Sie hatte ihm mit einem Lächeln ins Gesicht gesehen, als er hinübergedämmert war, und ihm versichert, daß er sich um sie keine Sorgen zu machen brauche. Sie begrub ihn in der roten Erde des Dschungels unter den mächtigen Bäumen, die er so geliebt hatte – nur sie und ein portugiesischer Priester und ein kleiner nackter schwarzer Junge hatten seinen Tod betrauert. Geh heim, hatte seine tonlose Stimme unter den stummen Bäumen geflüstert. Geh heim.
Ein verdrießliches Kreischen drang an ihr Ohr, während sie, in Gedanken versunken, zwischen ihren Habseligkeiten auf der sandigen Straße stand. Tess drehte den Kopf zur Seite und redete beruhigend auf den buntgefiederten Papagei auf ihrer Schulter ein. Der kleine Vogel sah sie mit einem glänzenden, mißtrauischen Auge an und begann dann, mit seinem gelben Schnabel an ihren schwarzen Haaren zu zerren. Lächelnd neigte sie den Kopf zur Seite. »Du hast es dir doch nicht etwa anders überlegt, du willst doch mit mir nach England kommen – oder, Isidora?«
Isidora beäugte sie mit ernstem Blick, Tess hatte versucht, den freundlichen Papagei freizulassen, bevor sie von Barra fortgegangen war, doch als sie das Türchen seines geflochtenen Käfigs geöffnet hatte, war Isidora lediglich auf ihre Schulter gehüpft und hatte es sich dort bequem gemacht. Ihr stattlicher Vorrat an Nüssen hatte als Lockmittel genügt, um den Papagei davon zu überzeugen, daß der beste Platz auf Erden auf ihrer Schulter war, und er war die lange Reise den Fluß hinab bei ihr geblieben und schien die Absicht zu haben, sie überallhin, auch bis nach England, zu begleiten. Zunächst hatte Tess wegen seiner unverschämten Bettelei mit ihm geschimpft, aber insgeheim war sie froh gewesen, wenigstens einen Freund auf ihrem Weg zu haben, auch wenn es nur ein kleiner Vogel war. Der Gedanke, in ihr altes Zuhause zurückzukehren, erfüllte sie mit mehr Angst als die Fahrt den Amazonas hinab, allein in einer winzigen Piroge. Eingeborene, Moskitos und Flußüberschwemmungen waren Schwierigkeiten, die sie kannte und mit denen sie zurechtkam. Was ihr Kopfzerbrechen bereitete und wovon sie keine Ahnung hatte, war das Leben einer reichen englischen Erbin.
Geh heim. Wie einfach das klang und wie beängstigend zugleich. Es war, als habe ihr Vater auf seinem Totenbett mit einemmal begriffen, wie allein und schutzlos seine einzige Tochter ohne ihn sein würde. In all den Jahren, in denen sie von einem Abenteuer zum anderen gezogen waren, schien er sich nie irgendwelche Sorgen um ihre Zukunft gemacht zu haben, und Tess – mit dem festen Vertrauen eines Kindes – ebensowenig. Sie hatte geglaubt, daß das Umher-, reisen immer so weitergehen und ihr Vater auf ewig bei ihr sein würde.
Sie hob das Kinn. Es hatte keinen Sinn, jetzt darüber zu grübeln. Es waren fast zwei Meilen vom Fluß zum Landhaus von Abraham Taylor, dem britischen Konsul in Pará. Sie wußte von dem, was ihr Vater ihr über die Papiere gesagt hatte, die sie seinem alten Eton-Freund geben sollte, daß Mr. Taylor der Treuhänder und Verwalter ihres Besitztums war. Dies war ein beruhigender Gedanke – einer der wenigen in einem Meer von beunruhigenden Vorstellungen. In den länger werdenden Schatten des späten Nachmittags eilte sie mit stolpernden Schritten, mit einer Hand ihren langen Rock raffend und in der feuchten Luft schwitzend, über die mit buckligen Steinen gepflasterten Straßen von Pará und schließlich über sandige Nebenstraßen.
Sobald sie das Zentrum der Stadt hinter sich gelassen hatte, umfing sie von allen Seiten üppig wucherndes Grün. Leuchtend blau und grün gestreifte Eidechsen huschten zwischen die Steine oder rannten mit aufgestelltem Schwanz über den Sand davon. Begleitet von mattem Vogelgezwit scher, folgte sie der stillen Straße bergan; ein wunderschöner metallblauer Schmetterling, den sie automatisch als Morphos identifizierte, begleitete sie ein Stück des Wegs in taumelndem Flug. Dann tauchte das verwitterte Gartentor der Taylors auf; sie schleppte sich die Stufen zu der breiten, von einer üppig wuchernden Rosinha überrankten Veranda hinauf und ließ den Klopfer gegen die Tür fallen.
Ein schwarzes Hausmädchen öffnete. Tess folgte der Frau in eine große hohe Halle, in der es angenehm kühl war und nach frischem Grün roch. Eine Vampirfledermaus flatterte hektisch nach oben im Schatten des Dachgebälks; sie war zu früh, denn die Abenddämmerung war noch nicht hereingebrochen. Die Räume der weitläufigen Villa waren noch immer von dem goldenen Licht der letzten Strahlen der untergehenden Sonne erfüllt, das durch die hohen Fenster und Türen fiel. Tess folgte dem Hausmädchen durch die kahle Halle in ein spärlich möbliertes Wohnzimmer, in dem eine hagere grauhaarige Frau saß und ihrem Mann vorlas.
Mrs. Taylor legte die Bibel beiseite und erhob sich mit einem überraschten kleinen Aufschrei. Auch Mr. Taylor kam Tess mit einem strahlenden Lächeln in seinem markanten, von einem mächtigen Backenbart beherrschten Gesicht entgegen. »Lady Tess! Dem Himmel sei Dank!« rief sie. »Wir haben uns solche Sorgen gemacht! Wir haben so lange nichts mehr von Ihnen gehört! Ihr Kleid … Was ist passiert? Wo ist Ihr Vater?«
Tess holte tief Luft und ging Mrs. Taylor entgegen. Sie nahm die zitternden Hände der alten Frau in ihre und hielt sie fest. »Papa ist gestorben, Mrs. Taylor«, sagte sie sanft. »Das Fieber hat ihn umgebracht.«
Mrs. Taylors Gesicht erstarrte. Tess spürte, wie das Zittern ihrer Hände stärker wurde, und sie preßte sie fester. »Bitte Ma’am, setzen Sie sich doch wieder«, flehte sie. »Verzeihen Sie – es war grausam von mir, Sie nicht darauf vorzubereiten, aber ich konnte Ihnen keine Nachricht schicken.«
Mrs. Taylor sank in ihren Sessel, und Tess kniete sich neben sie und sah durch den Tränenschleier, der jetzt auch ihre Augen bedeckte, zu ihr empor. Die schreckliche Nachricht den ältesten und treuesten Freunden ihres Vaters zu überbringen, ließ alles erst im ganzen Umfang wirklich werden. Sie würde ihren Vater nie wiedersehen; nie wieder würde sie seine geliebte Stimme hören, mit der er ihr irgendein botanisches Wunder erklärte, das er entdeckt hatte. Die Anstrengungen der Reise hatten die Ungeheuerlichkeit dieses Verlusts verdeckt; während sie den Widrigkeiten des Flusses getrotzt hatte, hatte Tess ihn immer neben sich gefühlt. Jetzt, da sie ihr Ziel erreicht hatte, begann ihre Unterlippe verräterisch zu zittern.
»Wann?« fragte Mr. Taylor mit leiser Stimme.
Tess hatte Mühe, ihre Stimme zu beherrschen. »Am Neujahrstag. Ein Stück flußaufwärts von Barra.«
»Am Neujahrstag …« murmelte Mrs. Taylor. »Schon so lange …«
»Sie sind seitdem ganz allein?« unterbrach sie Mr. Taylor. Sein Ton war barsch, doch Tess erkannte den Schmerz hinter seinen Worten. Sie konnte sehen, wie er die Tage und die Meilen zählte und an die Gefahren auf dem Fluß dachte.
Sie nickte. »Es … Es war so weit hierher zurück.«
Ein ersticktes Geräusch entrang sich seiner Kehle, und er wandte sich ab. Mrs. Taylor legte ihre zitternden Hände auf Tess’ Haar. »O mein armes Kind!« flüsterte sie.
»Ich bin schon in Ordnung«, murmelte Tess trotz des Kloßes, der in ihrer Kehle steckte. Mechanisch stubste sie mit dem Finger Isidora, die entschlossen schien, auch die letzten Reste von ihrem Chignonknoten zu zerzupfen.
»Sie sind …« Mr. Taylor verstummte und sagte dann: »Ich glaube, Sie sind die tapferste junge Frau, der ich je begegnet bin, Lady Tess.«
»O nein«, erwiderte sie matt. »Ich bin ganz und gar nicht tapfer.«
Mrs. Taylor streichelte über Tess’ Haar, ohne sich von Isidoras schnarrendem Protest stören zu lassen. »Wie auch immer … Hauptsache, Sie sind jetzt in Sicherheit hier bei uns.«
»Aber ich kann nicht bleiben.« Tess sah zu ihr auf. »Ich muß nach England zurück. Ich hab’s ihm versprochen.«
Mrs. Taylor berührte Tess’ Wange mit sanften, zitternden Fingern, eine Folge der schleichenden Krankheit, die die alte Frau langsam auszehrte. »Möchten Sie denn nicht nach Hause zurück?«
»Nein.« Tess biß sich auf die Lippe. »Bestimmt nicht.«
»Aber Liebes – weshalb denn nicht?«
»Weil … weil …« Zu ihrem eigenen Entsetzen hörte sie, wie ihre Stimme brach wie die eines Kindes. Sie versuchte sich zu beherrschen, doch die ganze Anspannung und Erschöpfung und der Kummer der vergangenen sechs Monate brachen in einem plötzlichen, heftigen Schluchzen aus ihr heraus. »Weil …« begann sie erneut und vergrub schluchzend das Gesicht in Mrs. Taylors Rock, »weil all die Leute in England … von mir erwarten, daß ich mich wie eine Lady benehme! Sie werden mich auslachen und schlecht von Papa denken, weil er mich so erzogen hat, und ich bin …« sie erhob sich und wischte wütend die Tränen fort. »O verdammt – ich will nicht heulen! Aber ich habe ihm versprechen müssen, daß ich heiraten werde!« Ihre Stimme hob sich zu einem unglücklichen Sforzato, während sie die Arme in einer verzweifelten Geste ausbreitete, die ihre ganze Misere umfaßte – den zerrissenen Rock, ihr zerzaustes Haar und den Papagei, der respektlos auf ihren Kopf gehüpft war. »Sehen Sie mich doch an, Mrs. Taylor! Welcher Gentleman würde ein Gör wie mich zur Frau haben wollen?«
Kapitel 1
Gryphon Meridon trat in den warmen Dezemberregen hinaus und wischte sich mit einer unwilligen Bewegung die Tropfen aus dem aristokratischen Gesicht – eine wenig aristokratische Geste, die seinen generellen Widerwillen ausdrückte. Wenn er es sich verkniff, die schwächliche Tür des Zollhauses von Santa Maria de Belém do Gran Pará hinter sich zuzuknallen, dann gewiß nicht aus Zartgefühl, sondern weil er fürchtete, das morsche Ding könnte aus den Angeln fallen. Er nahm seinen zerbeulten, tropfnassen Hut ab und schüttelte wild den Kopf, einen Schauer glitzernder Tropfen aus seinen wirren Locken versprühend, die naß an seiner Stirn klebten und durch den Regen die Farbe von dunkler Bronze angenommen hatten.
Mit Hilfe eines großzügig bemessenen Quantums mexikanischen Silbers hatte er soeben das Anlegen seines Schiffes im Hafen registrieren lassen – der Arcanum, aus Liverpool kommend, im Besitz und unter dem Kommando von Captain G. Frost. Es spielte keine Rolle, daß alle diese Angaben dreiste Lügen waren, solange sie mit den Papieren übereinstimmten. Für die Welt war er im Augenblick Captain Frost, und der Name kam ihm über die Zunge, als sei es sein eigener.
Mit einem einzigen federnden Satz setzte er über eine Pfütze am Fuß der Treppe und landete auf der vom Regen aufgeweichten, morastigen Straße. Es regnete so stark, daß nicht einmal sein Schiff zu sehen war, obwohl es direkt vor ihm, am Ende des Kais, festgemacht hatte. Er fluchte erbittert und hoffte inständig, daß sein Steuermann mit der neuen Crew fertig würde. Grady würde sicherlich alle Register seiner tyrannischen Veranlagung ziehen, um die ihm fremden Männer bei der Arbeit zu halten, aber sie waren ein verdammt erbärmlicher Haufen.
›Normal‹ war nicht unbedingt die Bezeichnung, die Gryf oder sonst irgend jemand für die typischen Unternehmungen der Arcanum gewählt hätte, doch die gegenwärtige Situation des Schiffes war weit entfernt von seinem üblichen Standard. Weit darüber, würden die meisten sagen, aber Gryf war sich dessen nicht so sicher. Es war zwar richtig, daß die Arcanum diesmal mit einer vollen Crew von dreiundzwanzig Mann segelte, statt mit der normalen Zehnmannbesatzung – Gryf und Grady eingerechnet –, aber mit den Galgenvögeln, die die Crew vervollständigten, war es schlimmer als mit der üblichen Notmannschaft.
Und alles natürlich wegen Ihrer Verwöhnten Hoheit, Lady Terese Collier! Gryf hatte mitansehen müssen, wie sich sein Klipper innerhalb von zwei Monaten von einem geheuerten Blockadebrecher in so etwas wie ein elegantes schwimmendes Pensionat für höhere Töchter verwandelt hatte.
Bis zu dieser idiotischen Mission, die ihm und seinem Schiff bevorstand, war er immer einigermaßen zufrieden gewesen, für den exzentrischen Earl of Morrow zu segeln. Als der Earl seinerzeit die Arcanum gechartert hatte, war dies für Gryf ein Glücksfall gewesen. Anstelle seines Schiffes hätte Morrow auch einen der pfeilschnellen Steamer heuern können, die extra dafür gebaut wurden, die Blockade der Yankees zu umgehen, was der Earl sicherlich auch getan hätte, wäre es ihm darum gegangen, seine Profite zu vervielfachen. Doch das war nicht der Fall; er wollte einfach nur, daß die Fracht ihre Bestimmung erreichte und seine Rebellenfreunde hinter den Blockadelinien nicht zu verhungern brauchten. Es gab nicht viele, die sich in diesen Jahren auf einen solchen Handel einließen, wenn mit demselben Risiko schwindelerregende Profite zu erzielen waren.
Aber diese heikle und riskante Unternehmung war nun zu Ende. Gryf hatte seinen Bestimmungshafen Nassau angelaufen, um weitere Instruktionen und möglicherweise einen neuen Auftrag entgegenzunehmen, obwohl die Blockade allmählich gefährlich engmaschig wurde. Insgeheim hatte er gehofft, der Earl würde vielleicht sogar auch nach dem Krieg noch Verwendung für ihn und seinen Segler haben. Dies wäre die Erfüllung seiner jahrelangen Gebete um einen permanenten Chartervertrag für die Arcanum gewesen. Doch in diesen unsicheren Zeiten grenzte es an ein Wunder, wenn die nächste Mahlzeit gesichert war. Mit fünfundzwanzig hatte Gryf vergessen, welch beruhigendes Gefühl dies war; er konnte es sich nicht einmal mehr vorstellen. Und so war er nicht wirklich enttäuscht – zumindest versuchte er, sich das einzureden –, daß nichts daraus geworden war.
Der Agent des Earls in Nassau hatte Gryf einen letzte Charter angeboten. Nein, das war sicherlich nicht das richtige Wort dafür: Der Mann hatte darauf bestanden. Ein Brief war aus Brasilien gekommen – der Earl sei gestorben, und seine Tochter wolle nach England zurück. Der Agent hatte sich die Arcanum angesehen und sie als absolut taugliches Beförderungsmittel für einen solchen Zweck befunden – vorausgesetzt, es würden ein paar ›Verbesserungen‹ vorgenommen. Gryf war einverstanden gewesen, bis er erfahren hatte, was die Umbauten kosteten und wer die Rechnung bezahlen sollte.
Als er protestiert hatte, hatten sie ihn schlichtweg erpreßt – etwas, das ihnen nicht weiter schwer gefallen war: ein bekannter Blockadebrecher, ein diskreter Hinweis an die Yankees, und von ihm wären nur mehr ein paar verkohlte, irgendwo im Atlantik treibende Planken übrig. Lord Morrow hatte ihn immer fair bezahlt und nie gedroht. Er war ein Gentleman gewesen. Seine Agenten und Anwälte waren etwas ganz anderes.
Und seine Tochter ebenfalls.
Gryf zog sein Ölzeug fester um sich. Diese neue Situation beunruhigte ihn; er fühlte sich unbehaglich mit einer Mannschaft, die ihm lächerlich groß vorkam, und einem Schiff, das er nach all den Umbauten und neuen Dekorationen kaum wiedererkannte. Sie würden Lady Collier in der Kajüte des Kapitäns einquartieren, ein Gedanke, der Gryf einigen Kummer bereitete und einen alten, tiefsitzenden Schmerz anrührte. Er war dumm, dieser Schmerz, und sinnlos. Die Arcanum war damals schnell und neu gewesen und unter ihrem wirklichen Namen gesegelt, vor vielen Jahren, bevor Piraten sie in einen Hinterhalt gelockt hatten und von ihr nur ein manövrierunfähiges, schwelendes Wrack übriggeblieben war, leer bis auf die vielen Toten. Auf dieser verhängnisvollen Fahrt war Gryfs Mutter und Vater und seinen beiden hübschen Schwestern die Kapitänskajüte überlassen worden. In Gryfs Erinnerung würde es immer ihre Kajüte sein. Genau wie die Arcanum oder Aurora oder Antiope für ihn immer die Arcturus sein würde. Er schlief vorschiffs mit Grady, weit weg von jenen Geistern, und breitete seine Seekarten auf dem Tisch in der Messe aus.
Idiotisch, wie dieser Name noch immer an sein Herz rührte, es vor törichtem Stolz ein wenig schwellen ließ: Arcturus. Wütend über sich selbst, versetzte er einer friedlichen Wasserpfütze einen Fußtritt, daß es aufspritzte. Sentimentaler Schwachsinn! Sein schwacher Punkt war – und schuld daran war nur seine verdammte Empfindsamkeit –, daß er etwas brauchte, das er lieben konnte, und alles, was ihm geblieben war, waren Grady und das Schiff. Was ohne seinen alten Freund und die Arcturus aus ihm geworden wäre, wollte sich Gryf lieber gar nicht vorstellen.
Er beschleunigte seine Schritte, und seine Gedanken kreisten um naß gewordene Fracht und verminderte Gewinne und darum, was sie als nächste Charter auftun könnten, wenn dieser Auftrag erledigt war. Niemand, der auf der sicheren Seite des Gesetzes stand, würde ihm eine Charter auf einem unterbesetzten, veralteten Clipper von zweifelhafter Registrierung anvertrauen, und so blieb ihm gar nichts anderes übrig, als seine Fracht auf eigenes Risiko zu kaufen und zu verkaufen oder hin und wieder einen Auftrag für Konterbande anzunehmen. Es war ein endloser Kreis, in dem er sich drehte: Er mußte genug Gewinn machen, um neue Fracht kaufen und laden zu können, und während er die Fracht an ihren Bestimmungsort brachte, nutzte er das Schiff ab, und die Ausbesserungsarbeiten und die Instandhaltung verschlangen die mageren Gewinne mit schöner Regelmäßigkeit. Doch dies war unumgänglich, wollte er das Schiff seetüchtig erhalten und mit einer anderen Fracht neuerlich sein Glück wagen, womit der Kreis wieder von neuem begann.
Er hatte gehofft, mit den Einsätzen als Blockadebrecher würde dies alles ein für allemal ein Ende haben, bis der Agent eine gründliche Überholung, erhebliche Umbauten und eine größere Crew angeordnet hatte und Gryfs Ersparnisse dahingeschmolzen waren wie Morgennebel in der Sonne. Und schlimmer als das: Er war im Begriff, einen Ruf zu bekommen, was bedeutete, daß es Zeit war für eine neuerliche Namensänderung, denn solche Bekanntheit war das letzte, was er gebrauchen konnte – vor allem in Häfen, in denen man sein Schiff bereits unter anderem Namen kannte. Er war nur ein kleiner Fisch, unbedeutend und unbemerkt in den Weiten der Ozeane, und er wollte, daß dies so blieb. Zu viele Jahre, zu viele Namen, gefälschte Papiere und unbezahlte Schulden standen zwischen ihm und jenem fernen Nachmittag irgendwo im Indischen Ozean, als ein verängstigter und schluchzender Junge mitansehen mußte, wie sein Onkel – der letzte seiner Blutsverwandten – starb, nachdem er mit krakeliger Hand das Papier unterschrieben hatte, welches den damals zwölfjährigen Gryphon Meridon zum Kapitän und Eigner der Arcturus machte und zugleich auch zu seiner eigenen Mannschaft, denn kaum einer der alten Crew hatte den Überfall der Piraten überlebt. Zu viele Jahre des Davonlaufens, des Knauserns und Schielens auf jeden Penny, des Feilschens um irgendwelche Fracht. Ob legal oder illegal, die er für die Laderäume seines Clippers auftreiben konnte. Er war kein Krimineller von Natur aus – er war nicht einmal besonders gut in diesem Metier, aber die Anforderungen, die sein Schiff an ihn stellte, duldeten kein Ausruhen. Er wußte nicht, wie er sonst hätte überleben sollen.
Grady tauchte aus den dichten Regenschleiern vor Gryf auf; sein von grauen Strähnen durchzogenes Haar und sein roter Bart waren sogar in der wie aus Kübeln niederprasselnden tropischen Regensuppe unverwechselbar. »Cap’n!« Die Stimme des Steuermanns war noch um eine Spur eindringlicher und heiserer als gewöhnlich, als habe die Bestürzung, die seine milchigblauen Augen weitete, einen Weg hinab in seine Kehle gefunden und schnüre ihm nun die Luft ab. »Da haben wir uns einen riesigen Sack voll Schwierigkeiten eingehandelt, Cap’n!«
Gryf fühlte, wie sich sein Magen zusammenkrampfte. Doch das war nur die vertraute Reaktion auf die ständigen Sorgen, die sein Leben begleiteten, seit er erwachsen war. »Womit?« Wenn es Schwierigkeiten gab … wenn es Schwierigkeiten gab … Seine Gedanken setzten für einen Augenblick aus und überschlugen sich dann in dem Versuch, die ganze unerfreuliche Palette der Möglichkeiten Revue passieren zu lassen.
»Was für Schwierigkeiten denn, um Gottes willen?«
Grady machte mit seiner freien Hand eine Bewegung in Richtung des Vorderdecks, das durch die dichten Regenschleier nur verschwommen zu erkennen war. »Dort oben, Cap’n«, stieß er krächzend hervor. »Der Teufel soll sie holen, verdammter Schietkram!«
Gryf folgte mit dem Blick der Handbewegung und konnte an Deck nichts Beunruhigendes entdecken, außer einem dichten Gestrüpp aus Grünzeug, das aussah, als seien ein paar Quadratmeter Dschungel direkt auf das Deck der Arcanum verpflanzt worden, und irgend jemanden von der Crew, in glänzendem Ölzeug, der ohne viel Erfolg an einer der größeren Pflanzen herumzerrte.
Er entspannte sich ein wenig, als er nirgendwo eine unmittelbare Bedrohung ausmachen konnte. »Sie haben uns gesagt, daß wir damit rechnen müssen, Grady«, brummte er, einigermaßen überrascht, daß sein Steuermann so viel Gewese um ein paar Pflanzen machte. »Das sind die seltenen Exemplare des Earls. Mach sie in dem Laderaum mittschiffs fest, so gut es geht.«
Grady blieb breitbeinig stehen und blickte Gryf mit einem Gesichtsausdruck an, der eindeutig als rebellisch zu bezeichnen war. »Du machst das, bei Gott! Ich hab’ anderes zu tun.« Er nickte wütend, um seine rebellische Courage nicht zu verlieren. »Ich hab’ dir von Anfang an gesagt, Cap’n, was ich von dieser Fahrt halte. Purer Unsinn, das ganze. Jawoll, das habe ich gesagt. Du kümmerst dich besser um dieses … Dschungeldickicht.« Und damit wandte er sich um und stapfte davon.
Gradys Kapitän blinzelte verdutzt hinter seinem alten Freund her und war für einen Augenblick sprachlos. Nachdenklich nagte Gryf an seiner Lippe und blinzelte durch den Regen erneut zum Schiff empor. Derselbe Matrose oder ein anderer – sie waren in ihrem Ölzeug von hinten nicht zu unterscheiden – zerrte und schob noch immer beharrlich an den Pflanzen herum. Gryf grübelte noch ein paar Augenblicke über Gradys merkwürdiges Benehmen nach, für das er jedoch keine plausible Erklärung fand, und strebte dann auf die Planke zu.
»Du da«, rief er dem unverdrossen um die Pflanzen bemühten Matrosen zu. »Vergiß das Grünzeug. Du wirst an der Dockseite beim Laden und Vertäuen der Fracht gebraucht.«
Der Mann stand über eine der Pflanzen gebeugt und ignorierte Gryfs Befehl. Gryf zögerte, leise Flüche vor sich hin murmelnd, die nicht nur dem Matrosen galten, sondern auch seiner eigenen Erfolgslosigkeit. Er war zwar der Kapitän – ja, aber der Kapitän einer zehnköpfigen Crew, der ein beunruhigend demokratisches Schiff im Winde hielt.
Die Neuen in der Mannschaft verunsicherten Gryf. Einmal war ihm einem der Männer gegenüber aus Versehen ein ›bitte‹ entschlüpft, was ihm einen so befremdeten Blick eingebracht hatte, daß er in seiner Verwirrung ›Sir‹ hinzugefügt hatte, um dann sogleich die Lächerlichkeit des ganzen zu erkennen: Der Kapitän nannte einen Steward ›Sir‹! Er fühlte, wie ihm die erniedrigende Erinnerung die Schamröte ins Gesicht trieb, und bellte den widerborstigen, noch immer über die Pflanze gebeugten Matrosen mit zornig erhobener Stimme an: »He, du!« Mit drei langen Schritten hatte er das Deck überquert, packte den Matrosen bei der Schulter und wirbelte den Burschen herum, um ihm ins Gesicht zu sehen.
Noch während er ihn herumzerrte, bereute er sein Tun bereits. Der Wutausbruch, der ihn überkommen hatte, würde nicht ausreichen, um eine Konfrontation bis zum Ende durchzustehen, und sein Zorn richtete sich bereits gegen ihn selbst. Verzweifelt suchte er nach dem überzeugenden Maß an gerechter und zugleich einschüchternder Ungehaltenheit, wie sie einem Kapitän zustand, dessen Befehle nicht ausgeführt wurden, doch es mangelte ihm an innerer Überzeugung, und so begnügte er sich damit, seinen Gefangenen mit sprachlosem Zorn anzufunkeln, der jedoch sogleich in Bestürzung umschlug.
Der Matrose war eine Frau!
Der Augenblick, in dem er dies realisierte, schien eine Ewigkeit zu umspannen; Gryf erstarrte zur Salzsäure, und tausend winzige Details stürmten auf ihn ein, zu schnell und chaotisch, um sie einzuordnen. Sie war groß für eine Frau, aber bei weitem nicht so groß wie er; sie hatte dunkles Haar und eine Haut wie Elfenbein, hohe Wangenknochen und ein zartes Kinn. Ihre Augen waren blaugrün oder blaugrau oder von einer anderen Farbe, die so verwirrend und kompliziert war, daß er sie nicht genau erkennen konnte; ganz sicher aber waren sie von einer strahlenden Intensität und umsäumt von verwirrend langen, dichten und tiefschwarzen Wimpern.
Er fühlte, wie ihm das Kinn herabklappte und seine Hand von der Schulter rutschte, dann fügten sich die Details wie mit einem Donnerschlag zu einer Einheit. Sie war wunderschön. Atemberaubend, verwirrend und herzzerreißend schön – selbst in ihren ausgebeulten, sackartigen Regenklamotten. Er blinzelte und fühlte, wie sich sein Herz zusammenzog – was es gewöhnlich nur tat, wenn die Fragen seitens irgendwelcher Hafenbehörden zu bohrend und argwöhnisch wurden. Der vermehrte Blutandrang, der gegen seine Schläfen pochte, hätte ihn eigentlich retten müssen, denn normalerweise fielen ihm in diesem Zustand der gedanklichen Panik die besten und elegantesten Lügen ein. Statt dessen jedoch war seine in den Hafenkneipen und den Docks geschulte Zungenfertigkeit wie weggeblasen. Alles, was ihm einfiel, war »Äh …«,
Ihre dunklen Brauen wölbten sich amüsiert und angriffslustig zugleich. Sie musterte ihn mit einem Blick, in dem er nicht eine Spur von Angst oder Schüchternheit entdecken konnte. Gryf beschlich ein scheußlicher Verdacht – die entsetzliche Vision einer Möglichkeit, die sehr schnell in Gewißheit umschlug. Er biß sich auf die Zunge und schmeckte Blut, bevor er seine Stimme wieder unter Kontrolle hatte. »Lady Collier?« erkundigte er sich mit einem vor Bestürzung heiseren Flüstern, während er sich noch immer an die schwindende Hoffnung klammerte, daß er sich möglicherweise doch geirrt habe.
Sie nickte mit einem Lächeln, das durch ihn hindurchging wie Licht durch klares Wasser. Er versuchte ebenfalls zu lächeln, doch es war nur ein Reflex schierer Verzweiflung, der über sein Gesicht huschte. Ein endloser Augenblick verlegenen Schweigens schleppte sich quälend langsam dahin, ehe Gryf wieder die Sprache fand. »Oh«, machte er.
»Und Sie sind …?«
Den peinigenden Bruchteil einer Sekunde lang hatte Gryf den Namen vergessen, den er gegenwärtig benutzte. Doch sein in vielen Jahren geschulter Überlebensinstinkt war stark; er fixierte einen Punkt neben ihrem rechten Ohr, der eine Spur weniger hypnotisch war als der direkte Blick in ihre kühlen, meerfarbenen Augen. Seine Zunge gehorchte ihm wieder und formulierte die Worte »Gryphon Frost«.
Er hatte das Gefühl, daß er sich verbeugen sollte oder zumindest ihre Hand küssen, denn nur seinen Namen zu sagen, erschien ihm zu schroff und ungelenk.
»Natürlich«, sagte sie leise. »Der Kapitän.«
Ihre Stimme war weich und melodisch und ebenso bezaubernd wie ihr Gesicht. Gryf bemerkte eine nasse, schwarzglänzende Locke, die hinter ihrem delikaten Ohrläppchen hervorlugte, und er fragte sich, ob er in seinem Leben je wieder etwas so Schönes sehen würde. Er fühlte, wie das idiotische Grinsen wieder in sein Gesicht kroch, als er daran denken mußte, wie grob er sie soeben an der Schulter gepackt hatte, und er wünschte sich, unter achtzig Tonnen Ballast begraben zu sein.
»Verzeihen Sie«, stammelte er verlegen, »ich dachte, Sie wären … Ich habe Sie für einen von der Crew gehalten.«
Sie lachte glockenhell, wobei sie zwei Reihen kleiner weißer Zähne entblößte, und griff mit der Hand nach der triefenden Krempe ihres Huts. »Ich kann mir gar nicht vorstellen, weshalb.«
Gryf zermarterte sich das Gehirn, wie er seine Zerknirschtheit besser zum Ausdruck bringen könnte – etwas tun, das der demütigenden Situation angemessener wäre, wie zum Beispiel, sich vom Achterdeck zu stürzen und in den Fluten zu ertrinken. Sein eigener Hut fiel ihm ein und hastig riß er ihn sich vom Kopf. Der Regen lief ihm übers Gesicht und tropfte ihm in den Kragen. »Lady Collier …« begann er.
»Setzen Sie Ihren Hut wieder auf!« rief sie. »Oder wollen Sie sich eine Erkältung holen?«
Er gehorchte ihr ohne Widerspruch. Diese von gesundem Menschenverstand zeugende Bemerkung flößte ihm Mut ein. Sie machte ihm klar, daß sie trotz ihrer überirdischen Schönheit und der Tatsache, daß sie eine reiche Erbin war, ein menschliches Wesen war. »Sie brauchen sich nicht um das Verladen zu kümmern, Lady Collier, vor allem nicht an einem Tag wie diesem. Wir verstauen die Pflanzen umgehend unter Deck.«
Dies war nicht ganz richtig; die Pflanzen standen weit unten auf seiner Liste der Dinge, die zu erledigen waren. Die Nahrungsmittelvorräte kamen zuerst und dann die relativ kleine Menge an Kautschuk, die er auf eigene Kasse erstanden hatte. Jerome Gould, der Agent des Earls in Nassau, hatte darauf bestanden, das Schiff auf den Inseln mit geschmuggelter Baumwolle aus den Südstaaten zu beladen, und war höchst zufrieden mit sich und dem Gang der Dinge gewesen, weil er Gryf gezwungen hatte, erneut über das Tiefgangslimit zu laden. Doch Gryf hatte dem guten Mann verschwiegen, daß er im Verlauf der Umbauarbeiten, bei denen auch der Laderaum und der Rumpf einen neuen Anstrich bekamen, die Ahmingsmarke am Rumpf des Schiffes um fünf Inches tiefer als die alte Markierung hatte anbringen lassen. Auf diese Weise hatte er Platz für weitere zwanzig Tonnen Fracht zur eigenen Disposition gewonnen, ohne irgendwelche Sicherheitsrisiken einzugehen.
Tess hatte nicht die geringste Vorstellung von der richtigen Reihenfolge, in der die Fracht eines Schiffs geladen werden mußte, doch sie war entschlossen, sich hinsichtlich der Behandlung ihrer Pflanzen nicht wieder abspeisen zu lassen. Sie hatte sich deshalb bereits mit einigen sturen Schiffsoffizieren angelegt. Sie war bereit, für ihre Pflanzen zu kämpfen, egal, mit welchen Mitteln – ob mit Schmeicheleien, Befehlen oder undamenhaften Wutanfällen.
Captain Frost war offensichtlich noch immer in tiefster Verlegenheit ob seines Irrtums, sie für ein Mitglied seiner Mannschaft gehalten zu haben, denn er sah zu Boden und wieder hoch und überallhin, nur nicht in ihr Gesicht. Seine Betretenheit gab ihr ausreichend Gelegenheit, ihn genauer in Augenschein zu nehmen. Er sah genauso aus, wie ein Blockadebrecher auszusehen hatte, fand sie, mit seinem verwegen in den Nacken geschobenen Südwester über den markant ausgeprägten und wohlgeformten Zügen seines glattrasierten und braungebrannten Gesichts. Sie konnte nichts Weiches an ihm erkennen, außer in seinen rauchgrauen Augen, in denen eine unerwartete Jugendlichkeit lag, die einen starken Kontrast zu den harten Linien um seinen Mund bildete. Tess ertappte sich dabei, daß sie sich für ihn erwärmte, auch wenn sie im selben Augenblick überlegte, wie sie aus seiner Verlegenheit am besten Kapital schlagen konnte. Sie hob das Kinn und lächelte verführerisch. »Aber die Pflanzen werden auf dem Deck bleiben, Captain.«
»Nicht lange«, erklärte er. »Ich verspreche Ihnen, Ma’am, daß wir sie innerhalb von einer Stunde aus dem Regen geschafft haben.«
»Sie werden nichts dergleichen tun«, widersprach sie, unauffällig die Taktik wechselnd. »Ich möchte, daß die Töpfe achtern vom Vorderdeck sicher festgemacht werden. Ihr Steuermann hat sich geweigert, es zu tun, also habe ich versucht, es selber zu machen, aber wie es scheint, sind die größeren zu schwer für mich.«
Gryf sah irritiert auf seinen vornehmen Passagier hinab, und mit einemal ergab Gradys Rebellion einen Sinn. »Sie haben versucht, sie alleine zu bewegen?«
»Da Ihre Crew offenbar nicht bereit war, mir zu helfen. Angeblich stellen meine Pflanzen an Deck eine Gefahr dar, was Unsinn ist. Wenn wir sie hier hinstellen – zwischen dem Achterdeck und dem Ankerspill sind sie sicher nicht im Weg.«
Die Vorstellung, daß Lady Collier nicht nur Backbord von Steuerbord unterscheiden konnte, sondern sogar wußte, wo das Ankerspill war, ließ Gryfs Augenbrauen in erstauntem Zweifel in die Höhe wandern. Mechanisch wischte er sich den Regen aus dem Gesicht. »Ich bin sicher, Grady meinte, daß die Pflanzen hier nicht sicher wären«, versuchte er sich herauszureden. »Im Laderaum …«
»… ist es dunkel«, beendete sie den Satz für ihn. »Captain, einige dieser Pflanzen sind an Deck eines Schiffs schon um den halben Erdball gereist. Ich bin mir sicher, daß sie sich hier am wohlsten fühlen.«
Er holte tief Luft. »An Deck eines Dampfers vielleicht. Aber die Arcanum ist ein Clipper unter vollen Segeln, Ma … – äh, Eure Lordschaft. Wenn wir in schweres Wetter geraten, bekommen wir jede Menge Wasser über den Bug.«
»Wenn schlechtes Wetter droht, schaffen wir sie natürlich unter Deck. Aber als mein Vater und ich auf einem amerikanischen Clipper von Neuguinea nach San Francisco gesegelt sind, hat es sogar bei schlechtem Wetter und hoher See so weit vorne nie ein Problem mit dem Salzwasser gegeben. Das ist einer der Gründe, warum ich die Pflanzen hier haben will.«
Gryf sah zur Seite, unfähig, in ihr liebliches Gesicht zu blicken und zugleich mit ihr über Decksprung und Freibordhöhe zu diskutieren oder über den Unterschied zwischen seinem in Aberdeen gebauten Clipper und einem Yankee-Segler. Wenn sie in schwere See kamen, würde jede Menge Salzwasser über das Vorderdeck gehen – genug, um einen Mann über Bord zu spülen, und ganz sicher genug, um die Pflanzen für immer zu ruinieren. Aber die Antwort war einfach: Sollten die Pflanzen vorläufig bleiben, wo sie waren, wenn die Arcanum auf hoher See war, würde er sie nach unten schaffen lassen.
»Wie Sie wünschen«, sagte er. »Ich werde mich darum kümmern, daß sie auf Deck festgemacht werden.«
Er wurde für sein Einlenken mit einem so strahlenden Lächeln belohnt, daß er blinzeln mußte.
»Vielen Dank. Sie sind sehr verständnisvoll, Captain Frost. Ich werde Ihnen nicht länger im Weg sein. Ich weiß, daß Sie mich nicht enttäuschen werden. Sie haben meine Nachricht erhalten? Die Taylors würden sich freuen, heute abend mit uns zu speisen.«
Alles, was Gryf zustande brachte, war ein verlegenes Nikken. Er fühlte einen beunruhigenden Druck in seiner Brust, das Aufkeimen sehnsüchtiger Hoffnung, und versuchte es zu verbergen, doch er fürchtete, daß ihm dies nicht ganz gelang. Er machte eine Verbeugung in ihre Richtung, folgte ihr zur Reling und wurde mit einem glockenhellen Lachen abgewiesen, als er ihr anbot, sie nach Hause zu begleiten. Sie schritt die Laufplanke hinab und ließ ihn wie einen ergebenen Schoßhund, dem befohlen worden war zu bleiben, an der Reling zurück. Auf seinem Gesicht spiegelte sich offenbar ein ähnlicher Ausdruck inbrünstiger Ergebenheit wider, wie er zu seinem Leidwesen feststellen mußte, denn als Grady ein paar Augenblicke später an Bord kam, sah er in den Augen des älteren Mannes ein mißbilligendes Funkeln.
Aber das störte ihn nicht. Gryf sah ihr nach, wie sie mit entschlossenen und, trotz ihres viel zu weiten Ölzeugs, anmutigen Schritten davonging. Nichts in seinem Leben – außer seinem Schiff und seinen Träumen – hatte ihn je zuvor einen ähnlich sehnsuchtsvollen Schmerz empfinden lassen.
Kapitel 2
Die kleine Gruppe von Gästen, die sich zum Dinner auf der Taylorschen Veranda eingefunden hatte, gehörte nicht unbedingt zur Creme de la Creme der englischen Gesellschaft, doch Tess war trotzdem nervös. Es waren nicht die Taylors, die sie beunruhigten, und auch nicht die Campbells. Die methodistischen Missionarseheleute mit den strengen schottischen Gesichtern und dem eigenwilligen Sinn für Humor, die sie als Beschützer und Anstandsdame auf ihrer Heimreise begleiten würden, waren ein reizendes und ergötzliches Paar. Es war, dachte Tess wütend, ganz allein Captain Frosts Schuld.
Sie hatte sich mit großer Sorgfalt schöngemacht und trug ein weißes Leinenkleid mit blaßgrauer Schärpe, die auf dezente Weise ihre Trauer zum Ausdruck brachte. Aufgeregt und voll ungeduldiger Erwartung, die ihr jetzt kindisch vorkam, hatte sie es sich in den Kopf gesetzt, denselben Ausdruck überraschter und hingebungsvoller Bewunderung, den sie am Morgen in Captain Frosts Gesicht gesehen hatte, auch auf die Gesichter der anderen zu zaubern. Es war für sie eine neue, schwindelerregende Erfahrung, einen Gentleman durch ihre bloße Gegenwart nervös zu machen. Captain Frost war natürlich nicht unbedingt das, was Tess unter einem Gentleman verstand, aber in Ermangelung eines geeigneteren Kandidaten mußte er im Augenblick genügen. Sie und das Mädchen hatten drei Stunden daran gearbeitet, ihr Haar zu einer glatten, blauschwarz schimmernden Rolle hochzutürmen, wie sie es in dem alten Exemplar der Illustrated London News gesehen hatte, die sie hinter einem Wörterbuch in Mrs. Taylors Bibliothek gefunden hatte. Als sie vor dem Dinner den Salon betreten hatte, um die Gäste zu begrüßen, hatte sie sich in der Erwartung, alle mit ihrer Schönheit zu beeindrucken, selbstsicher wie eine Königin gefühlt.
Doch dann war es leider Captain Frost gewesen, der Eindruck gemacht hatte. Die finstere Seemannsgestalt in dem nassen und abgetragenen Ölzeug, der sie an Deck der Arcanum begegnet war, hatte sich verwandelt; statt ihrer war ein großgewachsener goldblonder Fremder erschienen, der ihre Hand so kurz und zurückhaltend geküßt hatte, daß sie es kaum wahrgenommen hatte. Er war ein überaus attraktiver Mann – viel hübscher, als Tess anfangs gedacht hatte. Seine perfekt geschneiderte Kleidung betonte seine aristokratischen Gesichtszüge; statt des Ölzeugs trug er eine weiße Krawatte mit goldener Nadel und einen makellos blauen Rock. Er verbreitete eine Aura strenger Eleganz, die Tess nicht nur überraschte, sondern auch einschüchterte. Als er ihre Hand losgelassen hatte, hatte sie mit einem, wie sie fand, gekonnten Augenaufschlag den Blick in der Hoffnung gehoben, in seinen Augen die Bewunderung wiederzufinden, die sie am Morgen dort gesehen hatte, doch er hatte sich abgewandt, ohne ihr scheues Lächeln zu erwidern, und auch danach hatte er sie nicht ein einziges Mal direkt angesehen.
Nun saß Tess ihm am Tisch gegenüber, löffelte langsam und ohne rechten Appetit ihre Gurkensuppe und versuchte, nicht zu oft zu ihm hinüberzusehen. Sein Gesicht erschien ihr im unstet flackernden Kerzenlicht schön und fern; ein goldener, düsterer Luzifer nach dem Sündenfall. Sie wünschte, sie wäre jemand anderes. Eine Frau, die hübsch und anmutig war und interessant und kokett über den neuesten Gesellschaftsklatsch zu parlieren wußte wie die erst kürzlich eingetroffene Tochter des neuen Bankdirektors von Pará zum Beispiel. Eine Frau, die alle Neuigkeiten aus England kannte und mit den Gesellschaftsskandalen und der politischen Entwicklung vertraut war und davon mit einer amüsanten Unbekümmertheit erzählen konnte, die alle zum Lachen brachte. Vielleicht würde Captain Frost dann nicht so schweigsam und distanziert am Tisch sitzen. Vielleicht würde Tess ihn dann zum Lächeln bringen und erreichen, daß er sie ansähe und …
Und was noch?
Sie seufzte betrübt über ihrer Suppe. Es war ihr egal! Es war ihr egal, was Captain Frost von ihr dachte. Wenn er sich in ihrer Gesellschaft tödlich langweilte, wie seine stumme Konzentration auf sein Essen vermuten ließ, war ihr das gleichgültig. Schließlich war er nur ein armseliger Blockadebrecher und nicht der Prince of Wales.
Bei dem Gedanken, den Prince of Wales kennenzulernen, noch bevor das nächste Jahr vorüber war, freute sie sich. Ihr Vater hatte etwas in dieser Richtung angedeutet, als er versucht hatte, ihr die Rückkehr nach England schmackhaft zu machen. Er hatte von rauschenden Ballnächten und Abendgesellschaften gesprochen und davon, daß sie bei einer der jedes Jahr im Buckingham Palace stattfindenden Drawing-Room-Zeremonien der Queen vorgestellt werden würde. Doch dieser Gedanke war beängstigend. Wenn sie so wenig Erfolg hatte, bei dem Versuch einen Blockadebrecher zu unterhalten, was würde dann Ihre Majestät von ihr halten? Offensichtlich hatte sie sich am Morgen getäuscht, als sie gedacht hatte, Captain Frost wäre von ihr fasziniert. Er war nur überrascht gewesen, sonst nichts – überrascht und vermutlich abgestoßen von einem Mädchen ohne Manieren, das die Frechheit besaß, sich im Ölzeug eines Matrosen auf seinem Deck herumzutreiben.
Wieder stieg Groll gegen ihn in ihr auf. Was für ein Recht hatte er, ihr Vorwürfe zu machen? Captain Frost war selbst alles andere als der Inbegriff der Respektabilität, wenn man an seine Beschäftigung dachte. Wenn sie nicht in den Hafen gegangen wäre, als sie gehört hatte, daß sein Schiff angekommen war, hätte seine Crew ihre Pflanzen im Laderaum verstaut! Morgen würde sie sich vergewissern müssen, daß sie sich ordentlich um ihre Tiere kümmerten. Dieser elegante Schnösel von einem Kapitän hatte sicherlich keine Ahnung, was die armen Kreaturen brauchten, und würde wahrscheinlich ihr Faultierbaby zusammen mit der Boa Constrictor in einen Käfig stecken.
Die fröhliche Unterhaltung zwischen den Taylors und den Campbells verstummte, als die Suppenteller abgetragen waren und eine große Platte mit Fisch herumgereicht wurde. Tess starrte vor sich auf den Tisch, während sie mechanisch eine Ecke ihrer Serviette auf und zu faltete. Nach einer Weile wagte sie wieder einen verstohlenen Blick auf Captain Frost, und ihr Herz tat einen erschreckten Sprung, als sie bemerkte, daß er sie ansah.
Es war jedoch kein offener Blick, mit dem er sie betrachtete, sondern wirkte vielmehr wie eine zufällige Bewegung seines Kopfs, bei der sein Blick sie streifte. Er konnte ebensogut dem farbigen Lakai gelten, der Mrs. Campbell den Fisch servierte. Allerdings schien ihn der Schnitt von Tess’ Kleid zu faszinieren, denn jetzt starrte er unter gesenkten Lidern und mit einem verträumten Ausdruck im Gesicht auf ihr Dekolleté, scheinbar ohne sich bewußt zu sein, daß sie ihren Blick gehoben hatte.
Sie fühlte, wie ihre Wangen in der Überzeugung zu glühen begannen, daß er irgendeinen Makel an ihrer Garderobe entdeckt habe. Mit quälender Langsamkeit wanderte sein Blick höher, und sie war sich sicher, daß ihm irgendeine Unzulänglichkeit an ihrem weißen Spitzenkragen oder ihrer Frisur ins Auge gefallen war. Wahrscheinlich war sie hoffnungslos altmodisch gekleidet, dachte sie niedergeschlagen. Die Zeitschrift, die sie hervorgekramt hatte, war mehrere Jahre alt, und die Tochter des Bankiers trug ihr Haar ganz anders.
Beschämt senkte Tess den Blick, doch die Spannung war so unerträglich, daß sie verstohlen die Lider hob und durch ihre Wimpern spähte um zu sehen, was er als nächstes in Augenschein nahm. Seine aschgrauen Augen begegneten den ihren direkt und unverhüllt, und die flammende Intensität in ihnen erschreckte sie. In seinem Blick lag eine versteckte Wildheit und weit mehr: Einen Augenblick lang sah sie darin Romantik und Abenteuer und eine Art Besessenheit, eine unterdrückte Verzweiflung, die er schnell mit einem Blinzeln seiner goldenen Wimpern verscheuchte, bevor er den Blick abwandte.
Sie hatte das erschreckend, beinahe beängstigende Gefühl, als sei sie nur knapp den Fängen eines Tigers entkommen, den sie noch immer vor sich sah, obwohl er sich in eine harmlose, friedlich schnurrend vor dem Kamin liegende Hauskatze verwandelt hatte. Das vage Unbehagen, das sie einen Moment lang erfaßt hatte, verflog jedoch und machte einer anderen Empfindung Platz: einem seltsam angenehmen Zusammenschnüren ihrer Kehle, das mit dem Wahrnehmen der weichen, anschmiegsamen Enge ihres Hemds über ihrer Brust verbunden war. Zum ersten Mal in ihrem Leben nahm sie sich deutlich und unmißverständlich als Frau wahr und Captain Frost als … als etwas anderes.
Im selben Augenblick, in dem dieses Gefühl in ihr Gestalt annahm, ahnte sie, daß es unrecht war. Sündig. Tess wußte über Sexualität und Fortpflanzung durchaus Bescheid; sie hatte unaussprechliche Dinge gesehen und studiert, die die meisten jungen Damen ihrer Gesellschaftsschicht in Ohnmacht hätten sinken lassen. Sie hatte sich dem Thema mit der Rationalität genähert, die ihr Vater sie gelehrt hatte, und die Tatsachen und Fakten, die nun einmal Teil des Studiums der Natur waren, mit einem distanzierten, klinischen Interesse registriert.
Doch hier, in den verdeckten Blicken eines schweigenden Mannes, lag etwas Geheimnisvolles, etwas Gefährliches und Dunkles: eine reißende Strömung unter der scheinbar harmlosen Oberfläche, in der sie ertrinken konnte. Sie fühlte, daß die Unsterblichkeit ihrer Seele an einem dünnen Faden hing und schreckte vor diesem schwindelerregenden Abgrund zurück, den entsetzten Blick auf ihren gedünsteten Fisch auf dem Teller vor ihr gerichtet, als habe sich dort jäh die Pforte zur Hölle aufgetan.
Einen Herzschlag später verflog das Gefühl. Der Fisch war wieder nur ein Fisch und ein weitaus sicherer Betrachtungsgegenstand als das Gesicht gegenüber. Was Captain Frost in dem Augenblick empfunden hatte, wußte sie nicht zu sagen, und ihn erneut anzusehen wagte sie nicht. Mrs. Campbell sagte etwas zu ihm, aber Tess verstand kaum mehr, als sie beim Geschnatter einer Gans verstanden hätte. Das einzige, was klar in ihr Bewußtsein drang, war der Tonfall seiner Antwort: nicht die Worte, sondern nur Rhythmus und Klang seiner Stimme und die reservierte Zurückhaltung, die wie ein dünner Schutzschild über tieferen Regungen lag.
Tess bemühte sich, denselben schützenden Mantel über ihre eigenen Gefühle zu decken, doch er erschien ihr verräterisch dünn. Den Rest des Dinners saß sie stumm über ihren Teller gebeugt. Der Fisch schmeckte in ihrem Mund wie Staub. In ihr regten sich Gefühle, die ganz und gar nichts mit lukullischen Genüssen zu tun hatten. Sie sah die Hand des Kapitäns auf seinem Weinglas ruhen und sehnte sich danach, ihn zu berühren. Sie sah die sonnengebleichten goldfarbenen Härchen auf seinem Handgelenk und wünschte sich, sie glattzustreichen. Sie sehnte sich danach, in seinen Armen gehalten zu werden, das Gesicht an seinen Rock zu pressen und seinen warmen, lebendigen Körper darunter zu spüren. Und mit jeder Versuchung, die über sie kam, empfand sie sich selbst ein Stück mehr als eine Fremde, als jemand Neues und Geheimnisvolles in ihrer eigenen Haut.
Es war eine Erleichterung für sie, als sich Mrs. Taylor vom Tisch erhob; eine Erleichterung und zugleich auch eine Enttäuschung, denn die Männer blieben mit ihrem Port auf der Veranda und die Frauen gingen nach drinnen. Ihre Enttäuschung machte Tess wütend; und sie war wütend auf sich selbst, weil sie in den Tenor der Damen einstimmte, die die Männer mahnten, nicht zu lange draußen zu bleiben. Es gab genug andere Dinge, die zu bedenken waren, schalt sie sich streng. Wichtige Dinge. Vorbereitungen mußten getroffen werden, damit sie alle Pflanzenarten ihres Vaters katalogisieren konnte, wenn sie in England eintrafen. Mr. Darwin würde einige der Orchideen sehen wollen, und es gab mehrere wissenschaftliche Abhandlungen ihres Vaters, die sie nach einiger Überarbeitung bei einer Tagung der Linnéschen Gesellschaft vorstellen konnte, falls sie ein Mitglied fand, das sich bereit erklärte, sie bei dieser Gelegenheit vorzulesen. Sie mußte an so viele Dinge denken, und jedes einzelne davon war interessanter als ein Schiffskapitän, der sich als Blockadebrecher verdingte.
Entschlossen versuchte sie, ihre Gedanken auf all diese faszinierenden Dinge zu konzentrieren, während sie mit den Damen im Salon saß, doch immer, wenn das Lachen einer Männerstimme durch das offene Fenster an ihr Ohr drang, ertappte sie sich dabei, daß ihr Blick zur Tür hinüberhuschte. Mrs. Taylor und Mrs. Campbell waren in ein angeregtes Gespräch über den Preis irischer Butter vertieft, ein Thema, zu dem Tess nichts beitragen konnte und das kaum die Zeit und die Mühe lohnte, die sie darauf verwandten.
Verdrossen starrte sie auf die Nadel und die zu stopfenden Strümpfe in ihrem Schoß. So wird es sein, wenn ich verheiratet bin, dachte sie niedergeschlagen – geduldig auf die Männer warten und über Butter reden oder, noch schlimmer, über Mode, Skandale und Geld wie die Tochter des Bankdirektors.
Eine Zukunft wie diese erschien Tess schrecklich trostlos und langweilig. Bei ihren vergeblichen und sogleich wieder beendeten Versuchen, Freundschaft mit der erst kürzlich eingetroffenen jungen Dame zu schließen, hatte sie sehr schnell herausfinden müssen, daß ihre Geschichten über die diversen Unwägbarkeiten beim Versuch, Affen lebendig zu fangen, auf keinerlei Interesse gestoßen waren. Ähnliche Anekdoten über Begegnungen mit davonhuschenden Schlangen und flüchtenden Leguanen hatten nur entsetztes Kreischen statt Gelächter ausgelöst, und auch ihr schüchterner Versuch, über die Schönheit des brasilianischen Regenwalds zu erzählen, hatte nur betretene Blicke und höfliches Unverständnis hervorgerufen. Tess hatte es nach einem Besuch im Haus des Bankdirektors aufgegeben und auch keine weiteren Einladungen mehr erhalten, die Bekanntschaft zu vertiefen.
Sie ließ das Stopfzeug in ihren Schoß sinken, verschränkte die Finger und preßte sie fest ineinander. Wie sehr sie sich wünschte, nach Tahiti statt nach England zurückzukehren. Dort hatte sie eine Freundin gehabt, eine wahre Freundin: Mahina mit den dunklen, lachenden Augen und der unternehmungslustigen Art. Zusammen hatten sie die grünbewachsenen Berge bis hinauf zu den von Dunstschleiern eingehüllten Gipfeln erklettert, in der Lagune geschwommen und waren zu einer kleinen Insel hinausgesegelt, wo sie ihr Lager aufgeschlagen und gespielt und über jeden Unsinn gelacht und von den selbstgefangenen Fischen gelebt hatten, bis ihr Trinkwasservorrat zur Neige gegangen war und sie wieder nach Papeete zurückgekehrt waren.
Die unbekümmerte, mädchenhafte Tess jener Tage schien in weite Ferne gerückt zu sein. Fünf Jahre waren vergangen, seit sie Tahiti verlassen hatte – härtere Jahre als die idyllische Zeit auf den Inseln, voller Abenteuer und Herausforderungen. Während sie herangewachsen war, hatte sie die Begeisterung ihres Vaters für die Natur übernommen. Sie hatte vieles von ihm gelernt und sich unter seiner behutsamen Unterweisung logisches Denken und Disziplin angeeignet. Allmählich hatte sie immer mehr Verantwortung für die praktischen Dinge ihrer Reisen übernommen: das Beschaffen der Vorräte, ihren Transport und Ähnliches, Dinge, die ihr Vater nur mit Ungeduld und nicht immer zufriedenstellend erledigt hatte. Unter Tess’ Regie waren sie zwar nicht immer in großem Luxus gereist, doch selten waren ihnen Salz oder Zucker oder die Gläser, in denen sie ihre Sammlungen aufbewahrten, ausgegangen.
Auf der Veranda waren Schritte zu hören. Tess blickte auf und schlug, als sie sich dessen bewußt wurde, hastig die Augen wieder nieder. Sie versuchte, das plötzliche Hämmern ihres Herzens mit einigen entschlossenen Stichen der Stopfnadel zu verbergen, bis sie bemerkte, daß sie keinen Faden eingefädelt hatte.
Keiner der Gentlemen erschien an der Tür. Mrs. Taylor und Mrs. Campbell plauderten weiter, ohne aufzusehen. Hin- und hergerissen zwischen der hoffnungsvollen Erwartung, die Männer würden endlich hereinkommen, und der Befürchtung, daß sie nur einen anderen Platz auf der Veranda einnehmen könnten, fiel es Tess schwer, die Hände stillzuhalten. Nervös drehte sie den Strumpf, den sie stopfen sollte, hin und her, während sie fieberhaft überlegte, was sie zu Captain Frost sagen könnte, falls er hereinkäme. Doch dann preßte sie wütend die Lippen aufeinander und schalt sich ein dummes Ding. Als ihre Gedanken, ohne daß sie es wollte, erneut zu ihm zurückkehrten, warf sie das Stopfzeug mit einer widerwilligen Bewegung hin.
Überrascht sahen die beiden Frauen zu ihr herüber. Tess fühlte, wie sie rot wurde, sah sich suchend um und klammerte sich an die erste Erklärung für ihr Tun, die ihr ins Auge fiel. Sie griff nach der großen Bibel auf dem Tischchen neben ihrem Stuhl und fragte aufgeräumt: »Soll ich Ihnen etwas vorlesen?«
Mrs. Taylor lächelte. »Verzeihen Sie, meine Liebe. Wir alten Waschweiber sind ins Plaudern gekommen, nicht wahr? Gerne. Haben Sie einen Vorschlag, Mrs. Campbell, was sie lesen soll?«
Mrs. Campbell hatte. Tess drehte die Öllampe auf dem Tisch höher, um das fahle gelbliche Licht der Gaslampe zu unterstützen, die leise über ihnen an der Decke zischte. Sie suchte die Passage, die Mrs. Campbell nannte, holte tief Luft, um ihre durcheinanderwirbelnden Gedanken zu sammeln und begann zu lesen.
Gryf stand draußen auf der Veranda nah am offenen Fenster. Er erstarrte, als er die klare Stimme von Lady Collier vernahm, doch dann entspannte er sich wieder, als er den Text aus der Bibel erkannte, der aus ihrem Mund wie die süßen Töne einer Flöte klang. Ihm war etwas schwindlig von dem Wein, den es zum Dinner gegeben hatte, dem Port und dem lieblichen, betörenden Parfüm, das, wie es ihm schien, noch immer in der Luft hing, seit sie sich vom Tisch erhoben hatten. Die Unterhaltung der beiden anderen Männer war für ihn ein ärgerliches Nebengeräusch, er wünschte, sie würden ruhig sein, damit er ihr zuhören konnte.
Seine Mutter hatte dasselbe getan, als er noch ein Kind gewesen war. Nach dem Abendessen hatte sie aus der Bibel vorgelesen, während er auf der Veranda ihres Hauses in Kalkutta gesessen und ihr gelauscht hatte. Es hatte ihm immer ein Gefühl der Sicherheit gegeben, die Gewißheit, daß das Leben in Ordnung und unveränderbar sei – die kleine sichere Welt eines Jungen, für den die Zukunft nichts anderes als endlose Tage und Stunden des Vergnügens bedeutete.
Seine wirkliche Zukunft war nur zu plötzlich gekommen: Von einem Tag auf den anderen war aus dem behüteten und geliebten Kind ein einsamer und verstörter kleiner Erwachsener geworden. Für Gryfs Familie war die Heimreise nach England auf dem neuen und stolzen Schiff seines Onkels Alexander der Untergang gewesen. Sie waren das Opfer ihrer eigenen Hilfsbereitschaft gewesen: Ein brennendes Schiff, ein Hilferuf waren nichts anderes als die gemeine List von Piraten gewesen, denen sie in die Falle gegangen waren. Nur Gryf und Grady, der damals Zweiter Offizier gewesen war, hatten das Massaker überlebt – und Gryfs Onkel, doch nur für kurze Zeit.
Gryf drehte das Glas Port in seiner Hand und nahm einen Schluck, der die alptraumhaften Erinnerungen langsam verblassen ließ. Er konzentrierte sich auf die beruhigende Stimme von drinnen, die eine Saite in seiner Brust anrührte, ein einsames Echo in der Leere, das ihn mit Sehnsucht nach Dingen erfüllte, die für ihn unerreichbar waren. Er wußte, daß er jetzt besser dorthin, wo er hingehörte, gehen sollte – doch er brachte es nicht über sich, den Zauber zu brechen, der ihn wie ein Sirenengesang fesselte.
So blieb er stehen, wo er war, seinen Gedanken und Gefühlen ausgeliefert, bis sich Mr. Campbell entschuldigte, um nach drinnen zu gehen, und der Gastgeber das Wort an Gryf richtete.
»Sie sind so schweigsam, Captain. Darf ich Ihnen noch einen Port anbieten?«
Gryf wandte seinen Blick auf jene Stelle in der Dunkelheit, wo Taylor in einem Korbstuhl saß und nur als Silhouette mit einem rotglühenden Pfeifenkopf auszumachen war. »Nein, vielen Dank.«
»Ich fürchte, wir langweilen Sie mit unserer Lokalpolitik.«
»Überhaupt nicht«, erwiderte Gryf ehrlich, denn er hatte von dem Gespräch viel zuwenig mitbekommen, um gelangweilt zu sein.
Der ältere Mann schwieg eine Weile. Gryf gab sich Mühe, sich aus seiner Trance zu lösen, denn er wollte auf keinen Fall unhöflich erscheinen. Er hatte eine vorsichtige Zuneigung zu Taylor gefaßt. Wie es schien, hatte der Konsul mit kompetenter Hand die Kontrolle über die Angelegenheiten des verstorbenen Earls übernommen und zu Gryfs Überraschung und grenzenloser Erleichterung keine neugierigen Fragen über die Arcanum und ihre fragwürdige britische Registrierung gestellt. Er wünschte sich nur, der Umgang mit dem Agenten des Earls in Nassau wäre ebenso unkompliziert gewesen.
Als habe der Konsul Gryfs Gedanken gelesen, fragte er unvermittelt: »Sagen Sie, Captain Frost, was halten Sie von Jerome Gould?«
Gryf, mit einem Schlag in die Wirklichkeit zurückversetzt, befeuchtete seine Lippen. Er versuchte, die körperlose Stimme nach feineren Nuancen auszuloten, unsicher, ob die Frage rhetorisch oder ernst gemeint war. Falls Gould mit den Konten des Earls Schindluder getrieben hatte, hatte Gryf nicht das geringste Interesse, in diese Sache hineingezogen zu werden. Außerdem befand er sich nicht in der Position, Anschuldigungen auszusprechen. Und obwohl er für den Earl of Morrow immer ehrliche Arbeit geleistet hatte, war Gryfs eigener Ruf nicht gerade makellos. Wer das Wasser um jemand anderen herum aufwühlte, mußte damit rechnen, daß auch an ihm etwas Schlamm hängenblieb.
»Wir haben die Dinge nicht immer vom selben Standpunkt aus gesehen«, sagte er vorsichtig. Es hatte keinen Sinn, so zu tun, als habe es zwischen ihm und Gould nie Unstimmigkeiten gegeben. Der Konsul brauchte Gould nur zu fragen, um die Wahrheit herauszufinden.
»Ach ja?« sagte Taylor, ohne erkennbare Regung in seiner Stimme. »Und jetzt haben Sie Baumwolle geladen?«
Gryfs Hand schloß sich etwas fester um sein Glas. Die Frage war eindeutig rhetorisch, denn Taylor wußte genau, was und wieviel die Arcanum – abgesehen von dem Kautschuk – geladen hatte. »Ja, Sir.«
»Es hat mich beeindruckt, wie Sie den Auftrag des Earls erledigt haben, Captain.«
»Danke, Sir.« Worauf, zum Henker, wollte der Mann hinaus? »Wir hatten Glück.«
Die Pfeife glühte einen Augenblick heller auf. »Vielleicht. Aber kommen Sie doch hier herüber, weg vom Fenster, und setzen Sie sich zu mir. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten.«
Verdammt, dachte Gryf. Mit einem unbehaglichen Gefühl folgte er Taylors Einladung, ließ sich neben ihm in einen Korbstuhl sinken und wartete.
»In meiner Eigenschaft als Lady Colliers Treuhänder würde ich Sie gerne eine Weile länger beschäftigen. Wären Sie dazu bereit?«
Gryf zögerte. Er war nicht gerade versessen darauf, weiterhin als Blockadebrecher seinen Hals und den seiner Mannschaft zu riskieren, und von Jerome Gould hatte er definitiv die Nase voll. Aber nach dieser Fahrt war er ohne Charter und finanziell ziemlich am Ende. Gestrandet. Das Problem verfolgte ihn seit Nassau – und hier war die Lösung.
»Ja, Sir, das wäre ich.«
»Ohne zu wissen, was ich von Ihnen verlange?«
»Noch einmal die Blockade der Yankees durchbrechen, nehme ich an, Mr. Taylor.«
»Sie sind entweder ein sehr mutiger oder ein sehr verzweifelter Mann – wenn ich das so sagen darf.«
Dies war für Gryfs Geschmack ein wenig zu nah an der Wahrheit. Weil ihm keine plausibel klingende Erwiderung einfallen wollte, hüllte er sich in ein verlegenes Schweigen.
»Ich will nicht, daß Sie Ihr Schiff noch einmal auf diese Weise riskieren, Captain. Der Earl ist tot, und sein ganzes Vermögen – als dessen Treuhänder ich eingesetzt wurde – ist an seine Tochter gefallen. Ich bin verpflichtet, mich nach ihren Wünschen zu richten, und sie hat kein Interesse daran erkennen lassen, die Blockadeunternehmung weiterzuführen.«
Gryf blickte in die Dunkelheit zu seinen Füßen. Wie gewonnen, so zerronnen, dachte er sarkastisch.
»Ich möchte, daß Sie eine Weile in England bleiben. Haben Sie dort Verwandte?«
Überrascht sah Gryf auf. Er hoffte, daß seine Stimme nicht zu sehr schwankte. »Nein, nicht mehr.«
»Nein? Nun, dann werden Sie sich welche zulegen müssen.«
»Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz …«