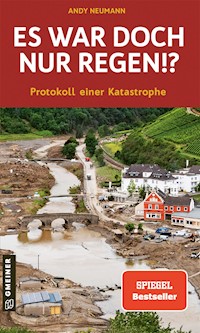Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Zahlen-Morde
- Sprache: Deutsch
Der Düsseldorfer Mordermittler Martin Paulus und die BKA-Beamtin Tamara Foster jagen gemeinsam einen Mörder, dessen Schwert ohne Gnade seine Opfer fordert. Vier Jahre nach dem Anschlag auf das Kölner Stadion köpft er Menschen, die mit dem damaligen Attentäter in Verbindung standen. Rolf Niessen, Ex-Reporter und erfolgreicher Buchautor, ahnt nicht, in welcher Gefahr er schwebt. Denn für den Mörder hat auch er Blut an den Händen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andy Neumann
Vier
Thriller
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Lutz Eberle
ISBN 978-3-7349-3330-1
Prolog
Ich könnte über das Leben mehr erzählen.
Würde aber niemanden interessieren.
Was ihr wirklich wissen wollt, ist doch, warum ich diese Menschen umgebracht habe.
Ich hatte meine Gründe.
Gute Gründe.
Vier gute Gründe.
Aber der Reihe nach …
Dienstagabend, 01.09.2020
»Ihr habt den Falschen!«
Patrick Zanner saß in einem tristen Vernehmungszimmer des PP Düsseldorf, das selbst Menschen enttäuscht hätte, die keine Krimis mögen. Hier gab es nichts, wirklich gar nichts, was eine Vernehmung fernsehtauglich gemacht hätte. Geschweige denn, kinoreif! Es war ein olles Büro mit 80er-Jahre-Beamtenmobiliar, ein Ikea-Sofa zierte die Wand, Computer, Bildschirm und Drucker. Das war’s. Nicht mal eine Lampe, mit der sie ihn hätten anstrahlen können. Die Realität war bitter. Ebenso wie der Kaffee, an dem er nippte, während er versuchte herauszufinden, welcher der Bullen welche Rolle spielen würde. Der großmäulige, allerdings auch hünenhafte Junge würde sicher den bösen Bullen geben. Geben wollen. Patrick schmunzelte.
Der etwas ältere und weiß Gott auch entspanntere Kollege sah bisher nicht so aus, als wolle er überhaupt irgendetwas tun. Gesagt hatte er auch noch nichts. Aber er machte ein wichtiges Gesicht, das war auch schon was. Er mochte an die 40 sein, vielleicht jünger. Das war schwer einzuschätzen. Nicht unbedingt der Typ, bei dem sich alle umdrehten, wenn er einen Raum betrat. Aber mit etwas Glück der, für den sich alle interessierten, falls sie sich doch umgedreht hatten. Hier hieß es abwarten.
Die dritte im Bunde war spannend. Sie hatte diese Ausstrahlung, vor der man sich in Acht nehmen musste. Der Typ Frau, auf den man sich nie einlassen durfte, wenn man nicht wollte, dass sie einen komplett in der Hand hatte. Smart, hübsch, ganz sicher verflucht scharfsinnig. Und in der Kombination jemand, der zeitlebens unterschätzt worden war. Ja, dachte er sich. Bei der muss ich mich vorsehen.
»Ich glaube nicht, dass Sie der Falsche sind, Herr Zanner. Ich glaube viel eher, dass Sie ganz gut beraten wären, die Karten auf den Tisch zu legen. Viel bessere Chancen werden Sie nicht mehr bekommen«. Das war der Ältere. Paulus, wenn er es richtig verstanden hatte. Er konnte also doch sprechen. Eloquent, ruhig, besonnen. Fast wie ein Therapeut.
»Über meine Chancen machen Sie sich mal keine Gedanken. Mein Anwalt wird bald hier sein, kurz darauf spaziere ich entspannt hier raus, und die einzige Karte, die auf dem Tisch liegen bleibt, ist die meines Anwalts.«
»Ach kommen Sie, wen wollen Sie verarschen, Zanner? Sie säßen doch gar nicht hier, wenn’s so einfach wäre.« Der Junge. Klar. Hatte auch zu gut gepasst. Er grinste unfreiwillig.
»Es erscheint: der böse Bulle!«, höhnte er. »Nehmen Sie es mir nicht übel, aber wenn Sie auch nur im Ansatz zu mir recherchiert haben, dürfte Ihnen klar sein, dass Sie mir mit einem stumpfen Klischee keine wahnsinnig große Angst machen.« Das saß. Kurz wirkte es, als würde der Junge die Beherrschung verlieren. Da hatten sie sich aber eine tickende Zeitbombe ins Boot geholt. Jemand mit so wenig Selbstbeherrschung musste noch eine Menge lernen. Aber er fing sich. Immerhin.
»Ich möchte Ihnen keine Angst machen, wir müssen uns von Ihnen aber auch keinen Blödsinn anhören«, sagte er, sichtlich um einen ruhigeren Tonfall bemüht. Dass er dadurch beinahe weinerlich klang, hatte eine rührende Situationskomik.
Patrick entschied, das Spiel noch ein wenig weiterzutreiben. Bislang hatte ihn nicht einmal jemand belehrt, geschweige denn etwas zum Schreiben ausgepackt. Sie wollten ihn also antesten. Schauen, was sie in Erfahrung bringen konnten, bevor seine Rechte ihnen einen Strich durch die Rechnung machen würden. Mutig. Für ihn aber dadurch ungefährlich.
»Sie haben nichts, und das wissen Sie. Wer immer diese Morde begangen hat, ich war es nicht. Ich wüsste also zu gern, was Sie überhaupt von mir wollen.« Direkte Fragen hatten keinen Sinn, das wusste er. Da würden selbst bei unerfahrenen Bullen die Alarmglocken läuten. Die Fragen immer schön die stellen lassen, die dafür bezahlt werden; mit etwas Glück findet man dann schon jemanden, der gern ins Quatschen kommt.
»Netter Versuch, Herr Zanner. Aber nein.« Das war wieder Paulus. Der Mann verstand seinen Job. Gut. Es würde so viel mehr Spaß machen. Paulus sprach weiter.
»Sie können sich vorstellen, dass kein Ermittlungsrichter einen Durchsuchungsbeschluss ausstellt, wenn die Polizei überhaupt nichts in der Hand hat. Und selbst ohne diese Tatsache hätten Sie ein Problem, denke ich.«
Jetzt war er neugierig. Was hatten sie gefunden? Mehr als das Buch konnte es nicht gewesen sein. Oder hatte er etwas übersehen? Er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen; sein Gesicht blieb vollkommen ausdruckslos, als er Paulus direkt ins Gesicht sah und sagte:
»Ist das so?«
»Ich denke schon, ja«, sagte Paulus. »Sie kennen das hier sicher?« Er warf das Buch auf den Tisch. Patrick hatte Mühe, sein Lächeln diesmal zu unterdrücken. Es war alles so verdammt vorhersehbar.
»Ja, ich und 50 Millionen andere Menschen in diesem Land, schätze ich«, sagte er. »Das Ding steht gefühlt seit Jahren auf der Bestsellerliste«.
»Das ist richtig. Aber nur wenige, die es gelesen haben, dürften so darin herumgeschmiert haben wie Sie.«
»Jetzt verstehe ich!« Patrick setzte eine überraschte Unschuldsmiene auf. »Sie haben mich wegen Sachbeschädigung mitgenommen. Man darf keine Bücher beschmieren, das hat mir meine Lehrerin schon immer gesagt. Es ist soooo falsch!«, flötete er. Doch dieser Paulus ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Der Junge neben ihm schien fast zu platzen, hatte aber offenbar genug Verstand – oder Respekt vor seinem älteren Kollegen –, um die Situation nicht noch mal ins Kippen zu bringen. Die Frau allerdings saß immer noch regungslos da und starrte ihn einfach nur an, als wollte sie seine Gedanken lesen. Nope! Die mochte er wirklich nicht.
»Okay, schon gut, kam nicht an wie geplant. Aber Sie werden mir doch beipflichten, dass Kritzeleien in einem Buch nicht so wahnsinnig verwerflich sind?«
»Diese hier schon«, sagte Paulus. »Sie haben in Niessens Buch praktisch jede einzelne Stelle markiert, die etwas mit den jetzigen Opfern zu tun hat. Sie haben genau dort Notizen gemacht, wo es auch nur entfernt um Lebensumstände oder Aufenthaltsorte geht. Das – in Verbindung mit Ihrem Motiv – ergibt doch ein klares Bild, finden Sie nicht?«
»Motiv? Welches Motiv? Aus welchem Grund sollte ich vier völlig unterschiedliche Menschen umgebracht haben? Menschen, denen ich nie begegnet bin. Die mir nichts getan haben. Deren einzige Gemeinsamkeit ist, dass sie alle vier im Buch eines Ex-Reporters auftauchen, der aus der Story seines Lebens einen Bestseller gemacht hat. Von den beiden Polizisten mal ganz abgesehen, die nicht einmal damit etwas zu tun hatten.«
»Hören Sie auf mit den Spielereien, Herr Zanner. Sie kennen den Grund. Und wir kennen ihn auch.« Das war die Frau. Sie hatte eine tiefe, angenehme Stimme, sprach ruhig, souverän, langsam. Mit der unumstößlichen Gelassenheit eines Menschen, der mindestens 100 Jahre älter hätte sein müssen als sie. Verdammt, er hasste sie. Flucht nach vorne.
»Und der wäre?«
»Ihre Familie, Herr Zanner. Welchen besseren Grund könnte es geben, die Menschen, die Sie für verantwortlich halten, zu töten? Sie hatten nicht einen Grund, Herr Zanner. Sie hatten vier Gründe. Gründe, die sehr vielen Menschen ausreichen würden. Gründe, die selbst ein Teil von mir verstehen kann. Ihre Frau.« Sie machte eine Pause.
»Ihre Kinder.« Wieder eine Pause.
»Ihre Namen waren: Rebecca, Tanja, Ben und Lana Zanner.«
Patrick stockte der Atem. Sein Gesicht zuckte. Kurz. Natürlich hatte er gewusst, dass sie nicht aus heiterem Himmel bei ihm aufgetaucht waren. Paulus hatte recht, einen Beschluss kriegte man nicht hinterhergeschmissen. Aber die traurige Wahrheit so deutlich aus dem Mund dieser Frau zu hören, entwaffnete ihn. Er riss sich mit aller Kraft zusammen. Konzentrierte sich. Jetzt hübsch locker bleiben, dachte er bei sich. Sie können dir gar nichts – wenn du ihnen nichts gibst.
»Hören Sie, Frau …?«, begann er.
»Foster. Kriminalhauptkommissarin, BKA.«
»BKA? Wow! Ich wusste nicht, dass ihr inzwischen auch Mordfälle klärt.« Er lächelte breit.
Sie blieb staubtrocken und sagte kein Wort. Verflucht cooles Biest, dachte er. Er konnte es nicht ändern, sie rang ihm ernsthaften Respekt ab. Also zurück auf Anfang.
»Aber sei es, wie es sei, Frau Foster. Ich habe es schon einmal gesagt. Und ich sage es auch Ihnen gern noch einmal, zum Mitschreiben: Sie! Haben! Den! Falschen!«
Und obwohl er wusste, dass es so war: In diesem Moment war er gar nicht mehr so sicher, dass es reichen würde.
Band I Kopflos
Kapitel 1
Samstag, 26.05.2001
Tom von Haehling hatte sie im Urlaub kennengelernt, in einer Weinbar, auf die Isabelle und er einige Tage zuvor eher zufällig in der Stadt gestoßen waren. Der Besitzer schien ihm ein netter Kerl zu sein, der genug von Wein verstand und den nötigen Geschmack hatte, um seinem Anspruch, die beste Weinbar in der Steiermark – oder besser noch ganz Österreichs – zu werden, vielleicht schneller gerecht zu werden, als ihm lieb war. An diesem Abend war er allein in die Bar gegangen. Isabelle wollte nach den anstrengenden Wandertouren, die sie unternommen (und die ihn schrecklich gelangweilt) hatten, früh ins Bett gehen. Er hingegen beschloss, auch diesen Tag möglichst angenehm ausklingen zu lassen. Also hatte er es sich hier gemütlich gemacht und mit Ben, dem Inhaber des Ladens, gefachsimpelt, wann immer der eine ruhige Minute hatte.
Und dann, irgendwann zwischen dem zweiten und dritten Glas Wein, stand sie neben ihm an der Theke, um sich ein weiteres Glas zu bestellen. Offenbar hatte sie etwas zu feiern, denn sie hielt einen kleinen Strauß Blumen in der Hand. Also hatte er sie gefragt, was es denn zu feiern gäbe. Es stellte sich heraus, dass sie in ähnlichen Berufsfeldern unterwegs waren: Sie war Beamtin, allerdings in der Chefetage. Es sollte nicht die einzige Gemeinsamkeit bleiben, die sie an diesem Abend entdeckten.
Charlotte, so hieß sie, war eine dieser Frauen, die man nicht anmachen, sondern, wenn man das nötige Glück hatte, lediglich entdecken durfte. Er hatte dieses Glück. Und es dauerte keine Stunde, bis er kurz davor war, sich rettungslos in sie zu verlieben. In dem sicheren Wissen, dass er genau das nicht konnte. Denn während er hier saß, lag Isabelle wahrscheinlich wach im Bett und grübelte, ob die Tischdekoration zur Hochzeit nächstes Jahr lindgrün oder doch lieber rot sein sollte. Andererseits: Was konnte ein harmloser Flirt schon schaden?
Charlotte jedenfalls war eine zweifache alleinerziehende Mutter, gebildet, mitten im Leben, mit einer Energie, die bisweilen übersprudelte, einen – oder zumindest ihn – aber nie völlig überrollte. Doch vor allem trug sie diese Art von Schönheit an sich, die einen in den Wahnsinn treibt. Weil sie mit jeder Sekunde, die man sie ansah, mit jedem Wort aus ihrem Mund, mit jedem Zentimeter Nähe, den man gewann, wuchs und wuchs, bis man sich unweigerlich fragte, ob man je zuvor wahre Schönheit gekannt hatte.
Ihre Haare waren dunkelbraun, und sie trug sie so kurz, wie es nur Frauen konnten, die Charlottes Ausstrahlung und ihre Gesichtszüge hatten. Bei diesen Frauen würde man niemals auf die Idee kommen, die Haare länger sehen zu wollen. Ihre Lippen waren voll, sanft, verheißungsvoll, ihre Haut so strahlend, dass man an nichts anderes denken konnte, als sie berühren zu wollen. Und ihre tiefgrünen Augen verbargen unter dem vordergründigen fröhlichen Leuchten eine innere Tiefe, die einen erschaudern ließ bei der Vorstellung, was man alles erfahren könnte, wenn man dieser Tiefe je auf den Grund kam. Als er zum ersten Mal die Kraft aufbrachte, verstohlen an ihr herabzublicken, zeichnete sich unter dem engen schwarzen Kleid ein Körper ab, der jeder 20-Jährigen zur Ehre gereicht wäre, eine zweifache Mutter allerdings zu einer Göttin machte.
Was ihm jedoch endgültig den Rest gab, war ihr Duft; unaufdringlich, aber unmöglich zu ignorieren, wenn man ihn einmal erfasst hatte. Eine Mischung aus frischer, blumiger Süße, Gewürzen und Holz, verheißungsvoll und in einer solchen Perfektion auf den Duft ihres Körpers abgestimmt, dass nur jahrelange Suche nach genau dieser Perfektion der Grund sein konnte. Zu allem Überfluss verband er sich, kam man Charlotte nah genug, mit einem, durch das enge Kleid und die warme Bar hervorgerufenen, sanften Schweißgeruch, der seinerseits so angenehm war, dass Grenouille für ihn getötet hätte. Tom konnte gar nicht anders, als jegliche Distanz zu überwinden, um nur noch sie einzuatmen. Und Charlotte, das wurde schnell deutlich, legte es genau darauf an.
Und so fand er sich, vollkommen und rettungslos ausgeliefert, zwei Straßen von der Bar entfernt wieder, berauscht von einer Frau, die er gar nicht kennenlernen sollte, deren schiere Präsenz ihm aber keine Wahl ließ. Also nahm das Schicksal seinen Lauf. Die lediglich zwei Stunden, die dieser spontanen Begegnung folgen durften, waren viel zu schnell vorbei. Und doch für sehr viele Jahre die folgenschwersten seines ganzen Lebens.
Kapitel 2
Mittwochnacht, 19. August 2020
»Ich gehe jetzt in den Himmel, und du kommst dann einfach nach. Okay?« Rolf Günther Niessen erwachte wie jedes Mal zitternd, schweißgebadet und erfüllt von Trauer, Wut und einer Verzweiflung, die so tief war, dass sie ihn stets aufs Neue zerriss. Er kannte diese Situation nur zu gut. Der Traum suchte ihn seit Jahrzehnten heim, und jedes Jahr, wenn das Datum näher rückte, betete er, dass er ihn verschonen würde. Meist war jedoch jede Hoffnung umsonst. Das Tragische daran war, dass es ihm in den wenigen Jahren, in denen der Traum ausblieb, noch schlechter ging. Denn so weh es tat und so sehr es ihn auch aus der Bahn warf, von Sophia zu träumen, waren die Träume doch die einzigen Gelegenheiten, seine Tochter noch einmal sehen zu dürfen. Und das war, wie er sich seit jeher erfolgreich einredete, den tagelangen Schmerz mehr als wert.
»Ich gehe jetzt in den Himmel, und du kommst dann einfach nach. Okay?«
Das waren die letzten Worte gewesen, die seine Tochter an ihn gerichtet hatte, bevor sie die Augen endgültig geschlossen und ihrem Leiden ein Ende gesetzt hatte. Dem Leiden, das sie so viele Monate ihres nicht einmal fünf Jahre währenden Lebens kostete und am Ende ein Kind hinterlassen hatte, das gar nicht mehr wusste, was es hieß, ein Kind zu sein. Ein Kind, dessen Augen eine solche Tiefe, Weisheit, aber auch Schmerz ausstrahlten, dass es allzu oft unerträglich war hineinzusehen. Ein Kind, das trotz all der körperlichen Qualen noch immer so viel stärker gewesen war als er, stärker selbst als ihre Mutter. Am Ende jedoch nicht stärker als der Krebs. Er hatte sie zerfressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit ihr zugleich ihre Eltern, deren letzte Reserven an Kraft, Leidensfähigkeit und Hoffnung schon erschöpft gewesen waren, als Sophia noch aufrecht kämpfte und ihnen täglich mit strahlenden Augen versicherte, dass alles gut werde. Bis zu diesem schönen und doch so zerstörerischen Tag im August.
Die Ärzte hatten Niessen und seine Frau abgefangen, bevor sie in Sophias Zimmer gehen konnten, und ihnen die jüngsten Ergebnisse mitgeteilt. Wie immer gelang es den Ärzten nicht, Klartext zu reden, sie verschanzten sich hinter ihren Konjunktiven und Beschwichtigungen, dabei wollten sie doch nur auf eines hinaus, und das hatte Niessen ihnen schließlich auch gesagt:
»Ich habe das Gefühl, Sie agieren gar nicht mehr. Sie reagieren nur noch. Also reden Sie bitte, bitte nicht weiter drumherum. Quälen Sie mich nicht noch mehr, als die Wahrheit es ohnehin tun wird. Also: Wie lange hat sie noch?« Er dachte damals, die Antwort des Arztes habe ihm den Boden unter den Füßen vollständig weggezogen. Erst Tage später wusste er, dass ihm selbst in diesem Moment immer noch ein hauchdünnes Sprungtuch geblieben war, in dem er mit einem Bein hängen blieb. In bedingter und sehr wackliger Sicherheit, doch unter ihm sichtbar der unendliche Abgrund, der ihn erwarten würde, wenn das Tuch riss. Es hatte gehalten. Noch. Bis zu diesem sanft fragenden, fröhlichen, kindlich-süßen »Okay?« wenige Tage später, das für alle Ewigkeiten in seinem Kopf und seinem Herzen nachhallen und mit bitterstem, erbarmungslosen und jede Schutzwand zerschmetternden Schmerz verbunden sein würde. Gefolgt von ihrem Tod.
Erst dann folgte sein Fall. Quer durch die Hölle. Er sollte monatelang andauern. Ein Fall, für den er weder für andere noch für sich selbst jemals die richtigen Worte fand. Monate später nicht, Jahre später nicht und noch heute nicht. Es war pures, ungehemmtes Leid gewesen, das alles ersticken musste, was Leben war. Ein Funktionieren am Rand der eigenen Existenz, ohne Zeit, ohne Raum, ohne jegliches Gefühl mit Ausnahme dieses einen. Es war die Erkenntnis, dass eine Ewigkeit nicht ausreichen würde, um der Trauer Herr zu werden. Es war Bitterkeit, Zorn, Hass, Zerstörungswut, Elend, Zerbrechlichkeit, es war »lasstmichinRuhelasstmichsterbenichverflucheGottichverflucheeuchalleichzerbrecheichzerreißeich …«, es war …
Es war vorbei gewesen. Eines Tages. Nach Monaten auf diesem bitterdunklen Pfad. Er hatte einen Weg gefunden, sein Leben weiterzuleben. Trotz der Gewissheit, dass er alles verloren hatte, was er wahrhaft und bedingungslos geliebt hatte. Nach Sophie auch ihre Mutter. Sie hatte seinen Weg nicht mitgehen können und wählte den vermeintlich leichteren: allein. Niessen weinte.
Wenn die Erinnerung derart stark in ihm wütete, hatte es keinen Zweck, Kontrolle erzwingen zu wollen. Er überließ sich der Welle, war wieder dort, in diesem Krankenhauszimmer, sah seine Tochter, hörte sie und spürte die Verzweiflung, diese immense, alles erstickende Verzweiflung, die niemand nachfühlen konnte, der nicht sein eigenes Kind verloren hat. Und weinte. Eine knappe Stunde später gab es keine Tränen mehr. Langsam und mühevoll kämpfte Niessen sich zurück aus dem dichten Nebel ins Jetzt, um schließlich – erschöpft, leer, kraftlos – wieder einzuschlafen.
Kapitel 3
Mittwochnacht, 19. August 2020
»Berauscht«, was für ein bescheuertes Wort. Dennoch ging es Toni Schüttler nicht aus dem Kopf, und so sehr er sich auch dagegen wehrte, er fand keines, das passender war. Er war berauscht. Wie alt hatte er werden müssen, um endlich einer Frau zu begegnen, die ihn derart umhauen konnte? Wahnsinn!
Dabei war er ohne jede Erwartung zu dem Date gegangen. Überhaupt hielt er wenig von solchen wohlmeinenden Verkupplungsversuchen, und wenn Horst ihn nicht derart eindringlich bearbeitet hätte, wäre das auch so geblieben. Sein Leben war schließlich okay. Er brauchte keine Frau. Ihm fehlte nichts. Also – wenig. Und wenn er ab und zu bezahlen musste, um ein bisschen Spaß zu haben, war das nichts, was Männer nicht schon seit Jahrhunderten getan hätten. Nein, eigentlich war sein Leben völlig in Ordnung so. Und er hätte jederzeit auf jedes Date der Welt verzichten können.
Bis heute Abend. Heute hatte er Petra getroffen. Und schon wieder rauschte sein Innenleben einmal rauf und runter, bloß weil er an sie dachte. Er lachte auf. Kindischer Unfug, so was. Schmetterlinge im Bauch? Er war doch keine zwölf mehr! Dummerweise schien das seinen Körper so gar nicht zu interessieren; da waren nämlich mit völliger Sicherheit Schmetterlinge drin. Er stieg aus dem Auto und versuchte, sich abzulenken. Ging im Kopf alles durch, was er sich für morgen vorgenommen hatte. Und das war eine Menge, wie üblich. Er hätte ehrlicherweise deutlich mehr Schlaf gebraucht heute Nacht. Doch es war spät, sogar schrecklich spät. Er würde den Wecker etwas später stellen müssen, da half alles nichts. Doch das war es wert gewesen. Sei doch geschissen auf den Schlaf.
Verdammt, die Lampe im Durchgang funktionierte schon wieder nicht. Diesen Hausmeister sollte doch der Kuckuck holen, ehrlich. Wäre das sein Gebäude, würde hier ein anderer Wind wehen. Ständig klappte irgendwas nicht, und dann dauerte es Wochen, bis selbst einfachste Handwerkerarbeiten erledigt wurden. Die neue Birne dürften sie wohl um Weihnachten rum erwarten. Was soll’s, dachte Toni bei sich, Weihnachten wohne ich schon nicht mehr hier, bis dahin sind Petra und ich bestimmt längst zusammengezogen. Er lachte erneut. Was für eine elende Schwärmerei, das war ja nicht auszuhalten. Andererseits bot die fast völlige Dunkelheit in der Unterführung eine perfekte Kulisse für romantisches Träumen. Er schob es also darauf und ging weiter. Hatte er eigentlich noch Bier im Haus? Er hatte das Gefühl, ein kleiner Absacker auf den tollen Abend ging noch. Was für eine Frau.
Was für eine …
Das kalte, erbarmungslose Schwert trennte seinen Kopf schneller vom Hals, als er seinen letzten Gedanken zu Ende bringen konnte.
Toni Schüttler starb mit einem Lächeln.
Kapitel 4
Donnerstag, 20.08.2020
»Nun ja, wenigstens dürfte er nichts gespürt haben.« Martin Paulus war sich noch nicht sicher, ob er beeindruckt war oder einfach nur fassungslos. Vermutlich beides, irgendwie. Pietät wäre natürlich auch hilfreich, dachte er sich.
»Alter Schwede!« Ramon Almeida stand der Mund offen. Er wusste nicht einmal, wie er sich verhalten sollte. Die Situation war dermaßen absurd, er wollte eigentlich lachen. Andererseits war Lachen nicht wahnsinnig angebracht, wenn man einen toten Körper vor sich liegen sah, dessen passender Kopf einen Meter weiter an die Wand gekullert war. Bei der Vorstellung wollte er schon wieder lachen. Er verkniff es sich.
»Highlander«, sagte Paulus. Ramon verstand nicht.
»Hä?«
»Highlander!« Paulus sah ihn erwartungsvoll grinsend an, als müsse Ramon irgendetwas wissen. Dann trübte sich das Lächeln allmählich, und der Blick seines »Bärenführers« wurde beinahe mitleidig.
»Kennst du nicht, oder? Was lernt ihr Kids eigentlich noch?«
»Was soll ich kennen? Ich kenn kein Highlander!« Ramon verstand nur Bahnhof. Was zur Hölle wollte Paulus von ihm?
»Vergiss es«, sagte der schmunzelnd. »Und tu mir einen Gefallen, such dir zur Abwechslung mal eine etwas ältere Freundin, vielleicht bringt die dir endlich ein Minimum an Kultur nahe.«
»Is klar.« Ramon wusste, wann es keinen Zweck hatte nachzubohren. Er nahm sich allerdings fest vor, bei nächstbester Gelegenheit »Highlander« zu googeln.
»Also, was machen wir jetzt, mein Herr und Gebieter?«, fragte er feixend. Paulus hatte derlei Sprüche viel zu oft gehört, um sie ernst zu nehmen. Er betrachtete die Leiche, immer vorsichtig darauf bedacht, keine Spuren zu zerstören. Ging hinüber zu dem sauber abgetrennten Kopf, der blut- und dreckverschmiert an der Hauswand lag, und beugte sich so dicht darüber, dass es beinahe schien, als wolle er auch noch daran riechen.
Der Strich auf der Stirn machte ihm zu schaffen. Denn er konnte einiges bedeuten. Vielleicht sogar alles. Oder, und das war der Punkt, der ihm Sorgen bereitete: nur eines. Ein senkrechter Strich. Ein I. Oder eine 1. Lass das keine 1 sein, dachte er. Bitte, bitte, lass das keine 1 sein. Und wenn, dann lass wenigstens keine 2 folgen! Doch was half sein Flehen? Wenn es eine 1 wäre, würden nur sehr schnelle und sehr effektive Ermittlungen eine 2 verhindern können. Wenn überhaupt. Und es war nicht sein Stil, sich ohne Not den Kopf über ungelegte Eier zu zerbrechen. Er stand auf, blickte sich in Ruhe nach allen Seiten um und dachte nach. Dann sah er Ramon eindringlich an – wie er es eigentlich immer tat, wenn er mit jemandem sprach – und sagte:
»Jetzt, mein Lieber, besorgen wir mir erst mal einen schönen, kräftigen Cappuccino, damit ich endlich wach werde. Und dann suchen wir mit Vollgas nach jemandem, der allen Ernstes im Jahr 2020 in Deutschland rumläuft und Leute mit einem Schwert köpft. Und dann beten wir, lange und inbrünstig, dass er das nur einmal macht.«
Kapitel 5
Donnerstag, 20.08.2020
Tamara schnaufte.
Sie konnte sich nicht besonders gut konzentrieren. Wieder mal. Dabei hätte sie ein wenig Konzentration bitter nötig gehabt. Den Vermerk hier wollte sie gestern schon fertig geschrieben haben. Sie hasste es, unter Druck zu arbeiten, und wenn sie heute nicht vorankam, wurde es langsam knapp. Den Generalbundesanwalt ließ man nicht warten, schon gar nicht, wenn es um eine Haftsache ging. Und diese hier hatte es in sich. Ein ehemaliger General aus Ruanda, der, selbst wenn man nur den wenigen und sicher eher zurückhaltenden Zeugenaussagen Glauben schenkte, ganze Dörfer niedergebrannt, Hunderte Männer getötet, Kinder verschleppt und die Frauen seinen Männern als Sklavinnen überlassen hatte. Es waren Fälle wie diese, für die sie zum BKA gegangen war. Unendlich komplex, hoch politisch, oft genug mit unbefriedigendem Ausgang – aber es waren die ganz großen Dinger, und nichts anderes hatte sie je gewollt.
In Wiesbaden war sie, dienstlich betrachtet, noch glücklicher gewesen. Im Bereich »Internationaler Menschenhandel« hatte sie damals alles, was sie sich je vorgestellt hatte. Vor allem Erfolg. Ihr Team war klasse gewesen, selbst mit den Chefs hatte sie im Grunde immer Glück gehabt. Da sie ursprünglich aus der Gegend kam – ihr Vater war zu aktiven Zeiten in Ramstein stationiert gewesen und hatte ihre Mutter dort kennen und lieben gelernt – hatte sie außerdem ihre Familie und ihren Freundeskreis um sich gehabt. Was damals gefehlt hatte, war nur der perfekte Mann für dieses ansonsten unglaubliche Leben gewesen. Den lernte sie eines Tages kennen. Er kam aber nicht aus Wiesbaden. Sondern aus Meckenheim. Diesem Provinzkaff inmitten von Obstplantagen, in das es sie nie im Leben gezogen hätte. Wäre es nicht für Matthias gewesen. Matthias und sie waren sich nähergekommen, als sie beide 2016 wegen des Anschlags in Düsseldorf waren. Das BKA hatte damals die Ermittlungen übernommen, die »Besondere Aufbauorganisation«, kurz BAO, hatte »Drohne« geheißen, wegen des Tatmittels, das der Täter, Thomas von Haehling, damals eingesetzt hatte. Da es absolut keinen Hinweis auf ein politisches Motiv gab, musste ihre Abteilung ran, die für schwere und organisierte Kriminalität zuständig war. Und bei derart großen Lagen damals noch nicht ganz so viel Erfahrung hatte wie die Staatsschützer. Also unterstützte man aus Meckenheim, so gut es ging. Der Einsatzabschnitt in Düsseldorf bestand zu fast 80 Prozent aus Kolleginnen und Kollegen von dort. Und sie war, als eine der wenigen aus dem Wiesbadener Referat, in dem das Ermittlungsverfahren bearbeitet werden sollte, ebenfalls vor Ort.
Ihr Schwerpunkt: taktische Opferbetreuung. Sie musste wissen, wer in welcher Art Opfer oder Betroffener des Anschlags war; und vor allem, wer davon etwas zu sagen hatte, das für die Ermittlungen wichtig sein konnte. Es war die mit Abstand aufregendste Zeit ihrer beruflichen Laufbahn gewesen; und die anstrengendste. 20-Stunden-Schichten waren keine Seltenheit, monatelang nahm sie kaum einen freien Tag, und ihr üblicher Alltag verabschiedete sich ganz dezent ins Nirvana.
Was ihr aber viel mehr zu schaffen gemacht hatte damals, das waren die Schicksale. Sie kannte sie alle. Oder zumindest die meisten. Von Haehling hatte ganze Arbeit geleistet. Nicht nur, dass er, ein Polizist, von 2007 bis 2015 insgesamt neun Menschen ermordet hatte, ohne dass ihm jemand auf die Spur gekommen wäre. Nein, er hatte, nachdem er kurz zuvor noch einen Reporter namens Niessen für Monate ins Krankenhaus befördert hatte, im Sommer 2016 den Drohnenanschlag auf das Depeche Mode- Konzert im Kölner Stadion durchgeführt. Grundlos! Wie all seine Morde. Einfach nur, weil er es wollte. Und weil er es konnte. Was für ein niederträchtiges Schwein.
32 Menschen waren an diesem Tag gestorben, Hunderte weitere wurden teils schwerst verletzt. Die Massenpanik, von der abstürzenden und beim Aufprall explodierenden Drohne ausgelöst, war gnadenlos gewesen. Allein 15 der Opfer wurden sprichwörtlich zu Tode getrampelt, sieben hatte die Drohne erwischt. Die weiteren erlagen in der Folge ihren Verletzungen. Es war schrecklich. Was für eine sinnlose, widerwärtige und abgrundtief böse Tat. Tamara war stets sehr auf ihre Professionalität bedacht, aber damals hatte sie ihre Freude darüber nicht unterdrücken können, dass dieses Schwein auch sein Fett abbekommen hatte. Und zwar sieben Kugeln. Von der eigenen Frau. Isabelle von Haehling. Was für eine Heldin! Tamara hatte mit ihr gesprochen, mehr als einmal. Isabelle hatte aus ihrer Sicht das einzig Richtige getan – und die Tat trotzdem nicht verhindern können. Womit sie ihr Leben lang zu kämpfen haben würde.
Allerdings war das alles nicht mehr ihr Problem. Ihres war und blieb Matthias, dessen Hin und Her ihr wirklich auf die Nerven ging. Und dieser blöde Vermerk, auf den sie sich endlich konzentrieren musste.
Tamara schnaufte.