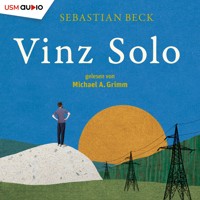
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: USM Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vinzenz Karl Bachmeier, 1968 geboren in Artlhofen bei Landshut, unendlich weit entfernt von der Weltstadt München, ist Vollwaise, verhinderter Rockgitarrist, Beziehungstrottel und unehrenhaft entlassener Oberministrant. Vinz kämpft sich durch die späte Pubertät – im Grunde immer nur auf der Suche nach der einen großen Liebe. Eine Jugend in den 1980er-Jahren mitten in der tiefsten bayerischen Provinz, dort wo Kirche und Wirtshaus das Leben dominieren und wo die Oberlinke, die von Ihrem Hof aus einen Drogengroßhandel betreibt, genauso dazugehört wie Hochwürden "Onkel Willi", der Spendengelder veruntreut. Ob die drei Wünsche, die Vinz quälen, am Ende überhaupt noch eine Rolle spielen? Ob seine Suche nach einem Leben, das sich zu leben lohnt, ihn erwachsener gemacht hat? Schau ma moi, dann seng ma's scho ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sebastian Beck
Vinz Solo
Roman
Distanzierungserklärung:
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen. © 2023 Langen Müller Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotive: aarrows/shutterstock, We are/Getty Images
Satz und E-Book Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-7844-8450-1
www.langenmueller.de
Für Johannes und Max
Heilige Maria Goretti,
lass mich werden, wie du warst:
rein in Gedanken,
edel in Worten,
sittsam im Benehmen.
Amen.
(Monsignore Breitwieser)
Get up
Get on up
Get up
Get on up
Stay on the scene
Get on up
Like a sex machine
(James Brown)
Prolog
Dietrich trat ans Mikro. Seine schwarzen Locken klebten ihm klatschnass am Kopf, als sei er gerade aus der Dusche gestiegen. Simmerl kaute Kaugummi. Meine Hände fühlten sich steif und kalt an, obwohl es immer noch 20 Grad warm war. So würde ich nicht einmal den C-Dur-Akkord greifen können. Nur Spy stand verträumt und mit frisch gefärbtem Iro in seiner Bomberjacke da.
Zweitausendsiebenhundertachtunddreißig Augenpaare richteten sich auf uns. Mit einem Mal wurde es still.
»Auf geht’s!«, brüllte wer. Stille.
»Ansage«, soufflierte Wolfi von hinten. »Ansage.«
Dietrich aber glotzte nur. Schweiß tropfte ihm vom Kinn. Es schien so, als winde sich etwas aus seinem Bauch in Richtung Hals, etwas sehr Mächtiges, Wildes, Gefährliches. Eine Schlange vielleicht. Aber als er dann seinen Mund öffnete, da kam nur ein Krächzen raus, das sich wie »Ärrrrggg« anhörte, gefolgt von einem »Ähhhh«.
Stille.
Teil 1
Gras und Ufer
Vor meinem 18. Geburtstag plagten mich drei unerfüllte Wünsche: Erstens hätte ich Rainer gerne die Freundin ausgespannt, zweitens träumte ich von einer 61er-Fender-Stratocaster-E-Gitarre und drittens brauchte ich endlich ein eigenes Auto.
Wunsch eins konnte ich komplett vergessen. Genauso gut hätte ich sagen können, ich steige jetzt bei The Police als neuer Sänger ein.
Allein schon ihr Name. R-I-C-A-R-D-A. Nicht Gerti oder Tini oder Franzi. Ricarda von Straten aus Herford, um ganz genau zu sein, also eine Jungfrau von Adel, was sie noch unerreichbarer erscheinen ließ, als sie es ohnehin schon war. Ihr rotbraunes Haar, dieser Duft der Patschuliwolke, die sie wie eine königliche Schleppe hinter sich herzog. Ihr Lachen auf dem Pausenhof, mit dem sie Regenbögen und Blitze in den Himmel zauberte.
Leider machte ich den Fehler, Simmerl in meine Gefühle einzuweihen, jedenfalls andeutungsweise. »Die Ricarda ist gar nicht übel«, ließ ich mal so nebenbei fallen. Simmerl schaute mich entgeistert an. Er sagte, abgesehen davon, dass Ricarda die eingebildetste Kuh sei, die er jemals gesehen habe, spiele sie in einer ganz anderen Liga als ich. Der Rainer habe ihm erzählt, Ricarda arbeite nebenbei als Fotomodell für eine Unterwäschefirma. So einen Job könne er sich für mich nur ganz schwer vorstellen. Ich solle mich doch lieber auf ein realistisches Projekt konzentrieren. Auf die Gisela zum Beispiel, die wegen ihrer Zahnspange keinen finde, aber sonst einigermaßen passabel sei.
Simmerl war ein Bauerntrampel. Ihm fehlte jeglicher Sinn für Romantik. Er wusste zwar, wie man eine Wiese mäht oder eine Sau mästet, aber mit Frauen wie Ricarda hatte er keinerlei Erfahrung. Ich allerdings auch nicht. Um ehrlich zu sein: Ich hatte null Komma null Ahnung von Frauen, ich war in der Hinsicht total blank, und es deutete wenig darauf hin, dass sich das jemals ändern würde, weil ein Typ wie ich, den alle nur Vinz riefen, was stark nach Zwerg klang, nicht einmal bei einer Gisela landen könnte.
Der Rainer dagegen. Er trug diese schwarze Motorradjacke aus Echtleder und brachte es im Weitsprung auf 6,22 Meter, obwohl er nur ein halbes Jahr älter war als ich. Ich kam auf 4,30 Meter, mein beiges Cordblouson hatte mir meine Mutter zum 16. Geburtstag geschenkt. Im Biologiebuch erkannte ich mich in der Darstellung eines dürren Männleins auf Seite 124 wieder, unter dem stand: »Leptosomer Körperbau. Kennzeichen sind seine schwache Muskulatur und zarte Erscheinung.« Alle drei Monate nahm ich mir einen Fünfer aus der Haushaltskasse und ließ mir im Salon Adelwarth die Haare schneiden. Wenn mich die Frau Adelwarth in ihrem blauen Arbeitskittel fragte, was sie beim jungen Herrn machen dürfe, antwortete ich jedes Mal: »Vorne und an der Seite eher kurz, hinten mittellang.« Während sie meine Spaghettihaare zurechtstutzte, zählte ich im Spiegel meine Pickel. 24 waren Rekord, auf weniger als 15 brachte ich es nie.
Immerhin fuhr ich ein Mofa, aber nur die alte grüne Piaggio Ciao von Onkel Rudi mit 1,4 PS. Rainer brachte es mit seiner auffrisierten Kreidler zwischen Artlhofen und Unhofen auf 110 Spitze. Ich musste an der Steigung vor dem Gymnasium in Moosbach in die Pedale treten, weil die Piaggio sonst röchelnd zusammengebrochen wäre. Eine Ciao war ungefähr so lässig wie der Elektrorollstuhl, mit dem der Haubensteiner, dem sie beide Beine bei Kursk weggeschossen hatten, jeden Vormittag zum Hofwirt zockelte, um seinen Rausch aufzuwärmen.
Was Wunsch zwei betrifft, so wäre ich lieber als Rory Gallagher denn als Vinzenz Bachmaier auf die Welt gekommen. Aber wenn Jesus der Herr mir schon das Vinzdasein auferlegt hatte, dann hätte er mir doch zumindest Rorys 61er-Stratocaster oder wenigstens eine Kopie davon auf dem Altar von Sankt Anton darreichen können. Technisch war er dazu in der Lage, siehe Matthäus 15, 32, die Speisung der Viertausend.
Es hätte nicht viel gefehlt, und ich wäre damals im Circus Krone in Ohnmacht gefallen, als Rory auf seiner Strat Shadow Play anspielte. Es war, als würde durch die Strat ein göttliches Wesen sprechen. Ich pennte zwar die meiste Zeit beim Ministrieren und im Religionsunterricht und auch sonst gerne am Nachmittag, aber soweit ich mich erinnerte, fuhren an Pfingsten himmlische Feuerzungen in die Jünger, und sie waren von da an erleuchtet oder so. Jedenfalls auf einem ganz anderen Level als vorher. Rorys Stimme klang noch viel klarer als der Sopran von der Roswitha Geiger aus dem Kirchenchor, wenn sie an Weihnachten Süßer Trost, mein Jesus kömmt sang. Rorys Strat verkündete mir: Siehe, du bist zwar bloß ein Depp aus Artlhofen, aber da draußen gibt es tatsächlich noch eine andere Welt. Die Welt der Coolness.
Nicht einmal Rainer besaß eine 61er-Stratocaster, obwohl er sonst alles hatte. Das deutete ich als winzige Schwäche in seinem Leben der Superlative. Womöglich war das ein Einfallstor in seine Bastion der Männlichkeit. Eines Tages würde ich Ricardas Herz in der Manier von Rory Gallagher erobern. Also theoretisch jedenfalls, man darf ja mal träumen. Ich würde mir eines von Rorys karierten Flanellhemden anziehen, die Tracht eines ehrlichen Arbeiters, eines Kumpels wie Bruce Springsteen, und dann würde ich oben auf der Bühne stehen und lakonisch zwei Worte sagen, in denen sich die ganze Tiefe meines Empfindens spiegelte: »Für Ricarda.« Einfach so nebenbei. Und dann würde ich zum längsten Solo aller Zeiten ansetzen, länger noch als das von Rory in Shadow Play im Circus Krone, bei dem er und ich am Ende um ein Haar zusammengebrochen wären, Rory oben auf der Bühne und ich unten im Parkett. Sogar dem Simmerl hatte es da Tränen in die Augen getrieben. »So was von brutal geil!«, schrie er mir ins Ohr. »Ich scheiß gleich in die Hose.«
Nach dem Konzert beschlossen wir auf der Heimatfahrt im D-Zug nach Landshut, unsere Karrieren als Musiker zu starten. Ich als Gitarrist, Simmerl als Schlagzeuger, weil er mehr so der robuste Typ war. Drei Wochen später spielten wir in der neuen Rhythmusgruppe der Pfarrjugend Sankt Anton. Ein Anfang immerhin, aber kein vielversprechender. Wenigstens bekamen wir die Instrumente kostenlos gestellt, ich traktierte eine vergilbte Hohner mit speckigen Saiten, die nach Faschingsbällen roch. Der Herr schwieg, wenn ich Smoke on the Water übte, womöglich hielt er sich sogar die Ohren zu. Er schickte keine einzige Feuerzunge, nicht mal ein kleines Fünkchen, nichts.
Dafür entsprach das Repertoire der Tonis, wie wir hießen, ganz den Vorstellungen von Pfarrer Willi Schleginger, der sich selbst zum Bandleader ernannte. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer hieß unser Hit, zu dem Schleginger in seiner Tenorstimme knödelte. D, Em, A, diese Akkorde schaffte ich noch, aber beim Bm, diesem verfluchten Bm zu Wie Wind und Weite blieb ich mit meinen Pfoten regelmäßig hängen. Es hörte sich an, als ob man ohne zu kuppeln im Unimog den Gang reinhaut.
Simmerl hatte ja recht, bei Ricarda wäre damit nichts zu holen gewesen. Ich war von dem lässigen Typen, der ich sein wollte, so weit entfernt wie München von Artlhofen, mein Heimatkaff, das sich zwischen Wäldern und Äckern ins Hügelland duckte, als ob es sich verstecken wollte. Eine Metzgerei, zwei Wirtshäuser, eine Bäckerei mit angeschlossener Quelle-Agentur, ein Friseur, das waren schon so ziemlich alle Höhepunkte des Dorfs mit seinen 853 Einwohnern. Hätte man allerdings noch Schweine und Legehühner mitgezählt, Artlhofen wäre eine Großstadt gewesen.
Commodore
Wenigstens ging Wunsch drei in Erfüllung, jedenfalls ansatzweise. An meinem 18. Geburtstag absolvierte ich die Führerscheinprüfung in der Fahrschule Zeller. Zum Abschied schärfte mir der alte Grantler Zeller noch ein, die Waldkurve nach Steinbach dürfe ich niemals mit mehr als 80 Stundenkilometern nehmen. »Auf keinen Fall, Bachmaier! Sonst bist ruck, zuck weg vom Suppenteller.« Die Frau Neumann radle jetzt schon seit zehn Jahren jeden Tag drei Kilometer bis zum Marterl, das die Stelle markiere, an dem ihr Bub, der Günther, dieser Raserdepp, verreckt sei, anders könne man das gar nicht ausdrücken.
Als Geschenk zur Volljährigkeit überreichte mir meine Mutter den Schlüssel für den Opel meines Vaters. Sie tat das mit großer Geste, so als wolle sie mir die Kommunion spenden, wie sie das als Helferin in der Sonntagsmesse machte. Seit sie neuerdings Vorträge von Monsignore Breitwieser in Landshut besuchte, setzte sie noch öfter als zuvor diese leidende Miene auf. Der Breitwieser zog auch dauernd eine Schnute und sprach die Wörter ganz vorne im Mund aus, weil sie dann heiliger rüberkamen. Wenn er »Roratemesse« sagte, dann hätte gerade mal ein Strohhalm durch die runde Öffnung seiner gespitzten Lippen gepasst. Meine Mutter verkündete auf Breitwieserisch: »Fahr mit dem Schutz der Schmerzensmutter.« Dann legte sie mir die Schlüssel in die Hände, und fast hätte ich Amen gesagt, als ich sah, dass sie den Paulaner-Flaschenöffner am Schlüsselbund durch ein Medaillon der Heiligen Mutter von Wigratzbad ersetzt hatte.
»Aber fürs Autofahren ist doch der Christophorus zuständig«, wagte ich einzuwenden.
»Die Heilige Mutter von Wigratzbad soll dich ja auch vorm Satan schützen, mein Bub«, belehrte sie mich. »Wer weiß, wo du dich mit dem Schinderkarren überall rumtreibst.«
Draußen in der Auffahrt wartete Kowalczyk, den meine Mutter herbestellt hatte, damit er sich das Auto ansah. »Jungchen, mach, ich muss heut noch einen Radlader fertig kriegen«, sagte er in seinem seltsamen osteuropäischen Akzent. Kowalczyk genoss schon deshalb den Ruf als bester Mechaniker von ganz Artlhofen, weil er der einzige war. Sein Overall schlackerte ihm um die dürren Beine, und aus der Brusttasche lugten filterlose Reval hervor, von denen er sich zwei Packungen am Tag reinzog. Die John-Deere-Baseballkappe setzte er nur ab, wenn er sich mit seinen öligen Fingern die paar Haarsträhnen, die ihm noch geblieben waren, nach hinten wischte.
Das Auto döste seit jenem Tag vor zwei Jahren vor sich hin, als beim Gruberbauern ein Zuchtstier auf meinen Vater losgegangen war. Erst hatte er meinen Alten aufgespießt, dann den Gruber, bis endlich die Polizei anrückte und das Vieh erschoss. Nach der Beerdigung fing meine Mutter sofort damit an, alle Spuren ihres toten Gatten zu beseitigen, seine Klamotten, seine Schallplatten, seine Werkbank im Keller, alles flog raus, auch seine heilige Geweihsammlung und die Jagdwaffen. Das Ölbild mit der Graf Spee in schwerer See wich einer Reproduktion von Botticellis Verkündigung an Maria. Auch das Auto wollte sie erst verkaufen, weil sie keinen Führerschein hatte, doch als ich protestierte, ließ sie es wenigstens im Schuppen vergammeln.
Und so stand der Opel noch genau dort, wo ihn der Onkel Rudi eingeparkt hatte. Ein mumifizierter Commodore, Viertürer, bronzemetallic, Baujahr 1974, 2,8 Liter Hubraum, und damit genau das Gegenteil eines BMW 323i oder eines Porsche 924. Keine Spur von Kult wie eine Ente oder ein Mini. Auch kein Witz wie ein Fiat Bambino. Der Commodore war einfach nur ein humorloses Spießerauto für Komödienstadel-Glotzer und Typen aus der Dinosaurierzeit. Als mein Vater so alt war wie ich, marschierte er im Stechschritt durch Paris. Und bevor die Arthrose seine Hüften zerfraß, drehte er an schönen Tagen manchmal die Stereoanlage im Wohnzimmer auf und paradierte mit mir zum Alten Kameraden durch den Garten. An der Birke vorbei ums Kartoffelbeet herum. »Im 114er-Schritt die Champs-Élysées runter!«, brüllte er. Seine Augen strahlten in Erinnerung an die beste Zeit seines Lebens, als Ignaz Bachmaier aus Wallern in Böhmen, 1,66 Meter groß und kurzsichtig wie ein Maulwurf, für ein paar Monate zu jenen gehörte, vor denen die Welt erschauderte.
Zu so einem passte der Commodore. Mit ihm zeigte mein Vater allen im Dorf, dass er es zu was gebracht hatte, aber dennoch einer von ihnen geblieben war. So ein Commodore machte mehr her als ein VW Käfer oder Opel Kadett, die jeder Kasperl fuhr, der Onkel Rudi zum Beispiel, mit seinem Holzhandel, der ihm nichts einbrachte. Zugleich aber bewegte sich der Commodore noch innerhalb der Neidgrenzen, wogegen ein Fünfer-BMW oder gar ein Mercedes als ein Indiz für neureiche Arroganz gedeutet werden konnten. Das ging gar nicht.
Aber bitte, es war trotzdem ein Auto. Mein Auto. Und das zählte.
Als Erstes würde ich damit eine Spritztour nach München unternehmen, wo dieses verruchte Schwabing lag. Mick Jagger spazierte da einfach so auf der Straße herum, und keine Sau drehte sich nach ihm um. Das war da ganz normal. Nun gut, in Artlhofen hätte sich auch keine Sau nach Mick Jagger umgedreht, aber bloß deshalb, weil ihn hier niemand kannte. Oder sollte ich lieber gleich zur ganz großen Tour aufbrechen und über den Brenner zum Gardasee fahren? Neben mir würde Ricarda in ihrem blauen Badeanzug sitzen, sie würde ihre sonnenbraunen Beine auf das Armaturenbrett legen. Es würde nach ihrem Patschuli und Rosmarin und Oregano und Zitronen duften. Und dann, aus einer Laune heraus, würde sie hinter Bozen sagen: »Ach, fahren wir lieber nach Korsika.« Und ich würde einfach so nach Korsika abbiegen, und sie würde mich für immer lieben.
Leider sprang der Commodore nach zwei Jahren im Schuppen nicht an. Wir mussten ihn runter zur Werkstatt schieben. Zwei Wochen lang schraubte Kowalczyk daran herum. Wenn ich ihn zwischendurch besuchte, jammerte er, die Reparatur koste ihn mehr, als er von einem Habenichts wie mir verlangen könne.
Als ich den Commodore abholte, kassierte Kowalczyk unglaubliche 350 Mark. Ohne Rechnung, versteht sich. Er zählte auf: Kupplungsscheibe gewechselt, alle vier Bremsen inklusive Bremsleitungen erneuert, Auspuff geschweißt, Ölwanne eingebaut, Vergaser eingestellt, Batterie getauscht.
»Dafür, dass ich die Schrottkiste zum Laufen gebracht habe, bist du mir noch einen großen Gefallen schuldig«, sagte er. »Und jetzt schleichst dich vom Hof.«
Schnitzel
»Also ins Trash«, sagte Simmerl, als er sich auf den Beifahrersitz fallen ließ und seine Beine aufs Armaturenbrett wuchtete. Er trug wie immer Ledersandalen samt Socken und dazu die kurze Hose mit Gürtel. Schon mit 15 konnte er sich einen Vollbart stehen lassen, was ihn zehn Jahre älter aussehen ließ, dafür fraßen sich jetzt Geheimratsecken in seine blonden Locken. Nach allen Regeln der Coolness war Simmerl maximal uncool. Doch für ihn galten eigene Maßstäbe.
Simmerl und ich waren seit der ersten Klasse Freunde. Damals schenkte er mir als Beweis seiner Zuneigung eine Ratte, die er im Kuhstall gefangen und dann auf den Namen Otto getauft hatte, weil er ein Fan von Otto Waalkes war. Meine Mutter brachte sie noch am selben Tag in einer Schuhschachtel zurück. »Bei den Schmalhofers draußen geht es zu wie bei den Asozialen, die fressen ohne Gabel und Löffel«, raunzte mein Vater. Ich aber beneidete Simmerl fast so sehr wie später den Rainer, weil er alles machen durfte, was bei uns verboten war. Er fuhr mit dem Bulldog über die Felder, fischte im Weiher und schoss mit dem Luftgewehr Tauben ab. In der Küche der Schmalhofers herrschte seine Mutter über einen unendlichen Vorrat an Schmalznudeln, abends holte sein Vater die Ziehharmonika raus und sang Gstanzl, wenn er gut drauf war. Und er war oft gut drauf.
Bei uns Bachmaiers dagegen war meistens tote Hose. Im Sommer fuhren wir immer für eine Woche zum Wandern ins Fichtelgebirge, wo außer uns nur Menschen Urlaub machten, die sich beim Essen Geschichten von der Inflation 1923 in die Hörgeräte schrien.
Simmerl und ich blieben sogar Freunde, als er auf die Realschule wechseln musste, weil seine Eltern befürchteten, als Abiturient werde ihr Sohn sich zu fein für die Hofnachfolge sein. Er war frei von all den Selbstzweifeln, die mich Tag und Nacht heimsuchten. Ihm ging es vor allem um Gaudi, und die hatte bei ihm fast immer was mit Bier und AC/DC zu tun.
Ich war jetzt doch ein bisschen stolz auf meinen Commodore, aber Simmerl interessierte sich nicht dafür. Er kurbelte das Fenster runter und hielt den Arm raus.
»Wir brauchen eine richtige Band, nicht so einen Pfarrjugendmist. Dann wird’s auch mit den Mädels was«, schrie er gegen den Fahrtwind an.
»Ich glaube, ich bin im Moment nicht offen für eine Beziehung«, schrie ich zurück. Das war gelogen.
»Hä? Du betest doch die Tussi aus Herford an.«
»Ich habe drüber nachgedacht. Eine Beziehung würde mich in meiner Freiheit zu sehr einschränken.« Das war wieder gelogen, aber ich hatte den Satz so ähnlich zuvor im Fernsehen gehört und fand, dass er sich sehr reif anhörte.
»Bachmaier, du bist einfach ein verklemmter, feiger Hund. Deshalb redest so viel Mist daher.«
Simmerl zog unter seinem Hintern eine Kassette meines Vaters hervor. Laut las er »Marschmusik aus vier Jahrhunderten«, dann warf er sie aus dem Fenster.
Das Trash gab es schon seit Anfang der Siebzigerjahre, seit der Dorfwirt von Eberfing aufgegeben hatte. Sein Ruf war seitdem konstant schlecht, jedenfalls unter Opelfahrern. Ein Münchner Anwalt hatte damals das Anwesen gekauft und es ausgerechnet an Wolfi Zollner verpachtet, den Sohn von Landrat Theodor Zollner von der Bayernpartei. Wolfi galt schon mit Mitte zwanzig als dubiose Existenz. Erst hatte er den Wehrdienst verweigert, danach studierte er in München ein Semester Politik und Soziologie und anschließend auch noch Jura, bis er nach Eberfing zurückkehrte, den Dorfwirt in Trash umbenannte und hinten im Stadel Rockkonzerte veranstaltete.
Jedes Mal, wenn wir auf dem Weg zu Tante Mechthild daran vorbeifuhren, redete sich mein Vater in Rage. Das Trasch, wie er es mangels Englischkenntnissen nannte, sei eine Absteige für Gammler, Hascher, Hippies und Arbeitsscheue. Der Wolfi, dieser ungewaschene Baader-Meinhof-Sympathisant, habe seinen Eltern Schande gemacht und sogar noch im Wahlkampf gegen den eigenen Vater gehetzt. Kein Wunder, dass der Theo jetzt ein gebrochener Mann sei. Meine Mutter ergänzte an der Stelle gerne, die Weiberleut in der Drecksbude hätten nicht einmal einen BH an. Ich fand, das klang sehr geil und sehr furchterregend zugleich. »Lass dich da bloß nie erwischen«, drohte mein Vater. »Sonst kannst du dein Zeug packen.«
Als ich den Commodore in eine Parklücke an der Stadelwand bugsierte, beschlich mich für einen Moment das Gefühl, eine Sünde zu begehen: Du sollst nicht mit dem Auto deines Vaters ins Trash fahren und so sein Andenken beschmutzen. Würde er noch leben, so würde er dich völlig zu Recht rausschmeißen. Verheimliche es wenigstens deiner leidgeprüften Mutter und sag einfach, du wärst mit Simmerl im Don-Bosco-Club in Landshut gewesen. Da freut sie sich gewiss.
Drinnen im Stadel war es voll, dunkel und vor allem laut. Ein paar Deckenscheinwerfer beleuchteten die Bühne, auf der die Punkband Rotten System ihr Konzert gab. Hinter ihr spannte sich ein meterlanges Transparent. Nein zur WAA, stand darauf.
Simmerl und ich drückten uns durch die Menge zur Bar. Vorne schubste und rempelte sich das Publikum gegenseitig zur Musik. Wenn einer dabei zu Boden ging, wurde er von den anderen mit Bier überschüttet. Fast alle trugen Springerstiefel, auch Silke, die Sängerin. Ich erkannte sie wieder, obwohl sie ganz anders aussah als damals in der fünften Klasse des Gymnasiums, das sie nach der Probezeit verlassen musste. Ihr Kopf war kahl rasiert, und auch sonst entsprach Silke ziemlich genau den Vorstellungen, die meine Mutter von den Weiberleuten im Trash hatte. Was Silke ins Mikro brüllte, vermischte sich mit Gitarre, Bass und Schlagzeug zu einem Inferno aus Rückkopplungen und Verzerrungen.
Simmerl deutete auf einen Mann, der sich am Rand der Bühne hinter den Lautsprechern postiert hatte.
»Der Wolfi!«
Das war er also. Ein Typ mit Metallbrille, steinalt, mindestens so um die vierzig. Die graubraunen Haare hingen ihm bis auf die Schultern herab. Schweiß tropfte von seiner Nase. Unter dem weißen T-Shirt wölbte sich eine Wampe, die vorne über den Gürtel seiner Jeans quoll. Er hatte beide Hände in den Hosentaschen vergraben und nickte mit dem Kopf im Rhythmus des Schlagzeugs. Und weil Rotten System nur schnelle Beats spielte, sah es aus, also ob Wolfi unter nervösen Zuckungen litte.
»Ich habe mir den irgendwie anders vorgestellt«, sagte ich. »Der hat doch studiert und ist Anwalt.«
»Der ist ein Intellektueller«, sagte Simmerl. »Die schauen alle ein bisserl ungesund aus.«
Während unten die Menge tobte, standen oben die Musiker von Rotten System steif herum. Ich war mir nicht sicher, ob es bloß Unvermögen oder doch ein Teil ihrer Show war.
»Das nächste Stück heißt: Wir spucken auf den Atomstaat!«, rief Silke ins Gejohle hinein. Es waren die ersten Worte von ihr, die ich verstand, seit ich den Stadel betreten hatte. Wieder hob der rasende Rhythmus an, Wolfi zuckte mit dem Kopf, die Menge schubste sich auf dem glitschigen Boden hin und her.
»Wir scheißen auf euch! Wir kotzen auf euch! Wir spucken auf euch!«, lautete der Refrain. Um die Bedeutung der Zeilen noch zu verstärken, spuckte Silke tatsächlich in Richtung Publikum.
Einige aus der torkelnden Menge spuckten sogleich zurück in Richtung Silke, die nun doch überrascht wirkte, als habe sie nicht mit einer solch prompten Reaktion gerechnet. Sie blickte auf einmal ziemlich angewidert drein. In diesem Moment kam von ganz hinten, wo die Tische standen, in hohem Bogen etwas Dunkles über die Köpfe des Publikums geflogen. Es sah aus wie ein Putzlappen, aber als das Geschoss Silke im Scheinwerferlicht genau an der Stirn traf, da konnten alle sehen, dass es ein Schnitzel Wiener Art war, das im Trash für 7,90 Mark inklusive Kartoffelsalat, Pommes und wahlweise Preiselbeersauce oder Ketchup auf der Speisekarte stand. Es gab ein riesiges Gejohle, und einen Augenblick später flog schon das nächste Schnitzel auf die Bühne. Es verfehlte die Silke aber knapp und streifte das Schlagzeugbecken.
»Saustark, jetzt geht’s richtig los«, freute sich Simmerl. Mir dagegen war so mulmig zumute, als ob ich bei einer verbotenen Demonstration mitmarschieren würde, und ich erinnerte mich wieder an die Mahnung meines Vaters.
Silke schrie auf, die Musik brach ab. Der Schlagzeuger, ein dürrer Kerl mit nacktem Oberkörper, stieß das Standtom zur Seite, sprang von der Bühne und stürmte in Richtung der Schnitzelwerfer. Er kam aber nicht weit, weil er sogleich in ein Handgemenge mit dem Publikum geriet. Als der Gitarrist zu Hilfe eilte, sah alles nach einer Massenschlägerei aus. Silke war verschwunden, nur der Bassist mit dem rosa Irokesenschnitt und der grauen Bomberjacke stand noch da und glotzte teilnahmslos auf das Durcheinander.
Jetzt watschelte Wolfi zum Mikro. Die Hände behielt er noch immer in den Hosentaschen. »Erdinger Weißbier« prangte auf seinem T-Shirt, das vom Schweiß durchsichtig geworden war. Er sprach fast so ruhig wie Onkel Willi bei der Predigt in der Sonntagsmesse.
»Ihr da hinten. Mit Schnitzel wird hier nicht geschmissen. Und ihr da vorne, ihr hört jetzt sofort auf, sonst muss ich die Bullen holen.« Ein Pfeifkonzert hob an. »So, jetzt ist Pause«, sagte Wolfi noch. »Und die Liste für den Bus am Pfingstsamstag nach Wackersdorf liegt an der Theke.«
Die große Stadeltür ging auf. Kühle Luft zog durch den Saal. Nur der Schlagzeuger regte sich schon wieder fürchterlich auf und drosch nach allen Seiten um sich.
»Halt mal.« Simmerl drückte mir sein Bier in die Hand. Mein Gott, was musste sich der jetzt auch noch einmischen. Er ging zum Schlagzeugwicht, packte ihn mit der einen Hand hinten am Gürtel und drehte ihm mit der anderen den Arm auf den Rücken. Dann schob er ihn zum Ausgang. Ich zahlte die zwei Bier und folgte ihnen.
Draußen stand Wolfi und bedankte sich bei Simmerl. Der Schlagzeuger rieb sich den Arm und fluchte.
»Die Bullen sind immer nur die allerletzte Option«, dozierte Wolfi mit seiner Bassstimme. »Ich möchte im Grunde genommen mit dem Polizeiapparat nichts zu tun haben.«
»Passt schon«, sagte Simmerl.
Wolfi musterte mich. »Du bist doch der Bub vom Bachmaier, dem Besamer aus Artlhofen.«
»Ja, schaut ganz so aus«, antwortete ich. Mir war fast alles peinlich, aber besonders peinlich war es mir, wenn jemand den Beruf meines Vaters erwähnte. Besamer. Das klang fies. Ich kannte alle Witze dazu.
»Kommts mal wieder vorbei«, sagte Wolfi. Er wirkte so unfassbar souverän. Ein Typ wie ein Berg. Ich wollte zwar nicht so aussehen wie er, sondern mehr wie Rainer. Aber den Rest hätte ich gerne von ihm kopiert. Und natürlich von Rory.
Wir gingen zum Auto. Daneben lehnte eine Gestalt im Dunkeln an der Stallwand. Es war der Bassist mit dem Irokesenschnitt.
»Sag, willst du mal in einer echten Band spielen?«, fragte ihn Simmerl, der anscheinend immer noch nicht genug hatte. »Nicht in so einer Kiffergang. Wir wollen was in Richtung Rory Gallagher und AC/DC aufziehen. Hast Bock?«
»Spinnst du«, warf ich ein. »Was willst du denn mit dem Typ? Der ist total breit.«
Der Bassist schwankte leicht. Dann würgte er und kotzte auf die Motorhaube meines Commodore.
Ich wich zurück. »Was soll das, verdammt noch mal?«
Simmerl zuckte mit den Schultern. »Ich glaube, er hat Ja gesagt.«
Onkel Willi
Seit mein Vater vor zwei Jahren vom Stier aufgespießt worden war, kam jeden zweiten Sonntag Pfarrer Willi Schleginger zum Mittagessen. Onkel Willi. Keine zwei Wochen nach der Beerdigung pflanzte er sich zum ersten Mal ans Kopfende des Esstisches. Zu seiner Rechten saßen meine Mutter und meine ältere Schwester Elvira, zu seiner Linken saß ich. »Ihr dürft gerne Onkel Willi zu mir sagen«, verkündete er.
Vor der Suppe schloss er stets die Augen und sprach ein improvisiertes Gebet. Meistens ging es darin um die Armen, die weniger zu essen hatten als wir. Nur bei besonderen Anlässen wich er davon ab. Einmal sagte er: »Herr, behüte deine Tochter Elvira, die jetzt eine Ausbildung zur Bürokauffrau beim Betonwerk Schachtner und Söhne absolviert. Möge sie einen guten Abschluss machen, danach heiraten und viele Kinder gebären. Amen.« Elvira lief rot an, und meine Mutter tätschelte ihr zur Bestärkung den Arm.
Onkel Willi genoss einen Ruf als moderner Pfarrer, weil er im Sommer manchmal in Jeans und T-Shirt durch Artlhofen radelte. Mit seinen schwarzen Haaren, die er für einen katholischen Geistlichen eine Spur zu lang trug und vor Gottesdiensten auch noch mit Festiger traktierte, erinnerte er die Älteren an den Schmalzsänger Neil Diamond aus Amerika. Wäre da nicht diese Knödeltenorstimme gewesen, über die wir uns als Ministranten lustig machten, aber nur heimlich, weil er in der Sakristei gerne Watschen austeilte. Pfarrer Willi war als Würdenträger ein begehrter Gast an den Esstischen der Gemeinde und darüber hinaus. Das wusste auch meine Mutter, und sie setzte alles daran, um ihre Trophäe mit kiloschweren Bratenstücken ans Haus zu binden.
Dafür nahm sie auch in Kauf, dass Willi sich wenigstens drei Halbe reinschüttete und lange Monologe über das Ordinariat hielt, speziell über seinen Intimfeind, den Generalvikar Wagner. Der sei eine ausgesprochen dumme Sau, ein Arschkriecher des Bischofs, der von seelsorgerischer Arbeit keine Ahnung habe und bloß Rechnungen vom Pfarrfest sehen wolle. Dabei habe sich Jesus die wundersame Brotvermehrung am See Genezareth auch nicht quittieren lassen. Gelebte Spiritualität verhalte sich zur kirchlichen Bürokratie in Regensburg wie der Teufel zum Weihwasser.
Ich hörte nie zu bei diesen Mittagessen, genauso wenig, wie ich in der Kirche zuhörte, obwohl ich seit acht Jahren ministrierte. Aber pro Gottesdienst kassierte ich 50 Pfennig, für Beerdigungen 1,50 Mark. Bei Hochzeiten waren sogar bis zu 10 Mark Trinkgeld drin. In guten Monaten brachte ich es auf 15 Mark, dafür hatte ich auch schon die Predigten von Pfarrer Dotterweis, dem Vorgänger von Willi, ausgesessen.
»Vinz!«
Die Stimme meiner Mutter wurde lauter.
»Vinzenz!«
»Ähm, ja?«
»Sag mal, wo bist du eigentlich mit deinem Hirn? Der Onkel Willi möchte mit dir was besprechen.«
Das klang bedrohlich, zumal sich meine Mutter mit Elvira in die Küche zurückzog. Onkel Willi kaute noch an seinem letzten Bissen Rinderbraten. Mit dem kleinen Finger stocherte er zwischen den Zähnen herum, dann wischte er sich den Mund mit der Serviette ab. Er faltete die Hände auf der Tischdecke.
»Lieber Vinz, ich muss mit dir heute eine ernste Sache besprechen, sozusagen von Mann zu Mann.«
Ich wünschte mich auf die Cook-Inseln, die genau auf der anderen Seite des Erdballs im Südpazifik lagen. Dort schliefen die Menschen in Hängematten, die sie zwischen Palmen spannten, und blickten um diese Uhrzeit auf die Lagune hinaus. Das Meer rauschte.
»Ich habe den Eindruck gewonnen, dass deine Entwicklung zurzeit in die falsche Richtung läuft. Deine schulischen Leistungen sind mau, und alleine im Mai hast du zwei Frühmessen verschlafen.«
Auf den Cook-Inseln musste niemand schwer arbeiten. Wenn man Hunger hatte, schnappte man sich entweder eine Kokosnuss oder man warf ein Fischernetz in der Lagune aus.
»Gestern hast du all dem die Krone aufgesetzt, indem du mit Simmerl ins Trasch gefahren bist, obwohl wir eine Bandprobe für Maria Himmelfahrt angesetzt hatten. Der Don-Bosco-Club ist seit einem Jahr geschlossen. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Und besorgt.«
Irgendjemand musste mich verpfiffen haben.
Er nahm einen Schluck Bier, stieß auf, wobei das Gemisch aus Bier, Bratensaft und Magensäure bis zu mir herüberwehte, dann fuhr er fort.
»Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass du seit dem Tod deines Vaters aus dem Ruder läufst. Es ist an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Ich gebe dir eine einmalige Chance. Im Herbst beginnt Heinrich Lang sein Theologiestudium in Rom. Ich möchte, dass du seine Nachfolge als Oberministrant antrittst. Das ist das schönste Amt, um zum Manne zu reifen.«
Nachmittags zog über dem Atoll eine frische Brise auf, es war die Zeit, um ein Gläschen Kava-Tee zu genießen und dann eine Runde Fußball am Strand zu spielen. Wahrscheinlich hatten einige um diese Uhrzeit sogar Sex am Strand. Nachmittagssex.
Dem Onkel Willi hätte ich jetzt gerne von den Cook-Inseln aus zugerufen, dass ihn meine Entwicklung einen Dreck anging, dass mich sein ganzes heiliges Getue ebenso ankotzte wie sein Geschiele auf die Blusenknöpfe von Elvira, dass Heini Lang von mir aus zur Hölle fahren konnte, dass alle hintenrum über Willis Geknödle lachten. Aber es war schon eine große Sünde, das auch nur zu denken.
Deshalb schwieg ich. Denn er war Pfarrer Willi Schleginger und ich ein überführter Lügner, der das Trash-Verbot missachtet hatte.
»Und, was sagst du dazu?«, fragte er.
»Danke«, sagte ich.
»Sehr schön«, sagte Willi mit einer betont versöhnlichen Stimme. Er tätschelte mich an der Schulter, dann stand er auf. Er nahm das Bistumsblatt und ging aufs Klo zum Scheißen. So hielt er es immer nach dem Mittagessen. Er fühlte sich ganz daheim bei den Bachmaiers.
Sankt Pauli
Unser Haus lag am Ortsrand von Artlhofen, Siedlerweg 21, mein Vater hatte es nach dem Krieg als Heimatvertriebener selbst gebaut, wie er immer wieder gerne betonte. »Stein für Stein. Ohne Kran. Wir haben ja nichts gehabt. Alles verloren. Alles vom Tschechen geraubt«, sagte er dann eine Spur zu laut. »Das kann sich heute kein Schwein mehr vorstellen.« Und meine Mutter ergänzte: »Nichts, absolut nichts.« Dazu setzte sie ihre Pietà-Miene auf, die sie sich als Mädchen vier Jahre lang im Internat der Franziskanerinnen antrainiert hatte.
Der Hausbau blieb der einzige Kraftakt im Leben meiner Eltern. Nachdem sie damit fertig waren, durfte nichts mehr verändert werden. Weder an ihrem Haus noch an ihrem Leben. Alles hatte von nun an seinen festen Platz. Das Nordmende-Radio auf der Konsole an der Küchenwand, die Siemens-Bügelmaschine im Hauswirtschaftsraum, der Weihwasserkessel mit den betenden Händen am Hauseingang. Das Wohnzimmer hieß bei uns das Gute Zimmer. Wenn nachmittags die Sonne hineinschien, tanzte der Staub in der Luft, und ins Ticken der Wanduhr mischte sich das Schnarchen meines Vaters auf dem Kanapee. Wie er da mit seinem Bierbauch unter der Graf Spee lag, erinnerte er mich an einen Seehund auf der Sandbank.
Meine Mutter saß dann meistens in der Küche und löste die Kreuzworträtsel in der Hörzu oder las im Straubinger Heimatkalender. Auf dem Tisch stapelten sich neben dem Blutdruckmessgerät ihre Tablettenschachteln. Sie schien immer zu leiden, auch wenn ich nicht wusste, ob es an mir oder an meinem Vater oder an meiner Schwester lag oder generell an der irdischen Existenz. Als ich zur Welt kam, war sie 42, weshalb sie auf mich immer schon wie eine Oma wirkte, ein Eindruck, der durch ihre ausgemergelte Gestalt und ihre früh ergrauten Haare im Laufe der Zeit nur noch verstärkt wurde. Nach dem Tod meines Vaters redete sie fast gar nichts mehr. Wie ein Geist schwebte sie durchs Haus, und es kam mir vor, als verabschiede sie sich allmählich ins Jenseits. Irgendwann würde sie sich in einen Lufthauch auflösen und in den Himmel aufsteigen. Doch einmal in der Woche nahm sie wieder ganz ihre fleischliche Gestalt an, wenn sie mit dem Bus nach Landshut zum Freundeskreis Maria Goretti fuhr, um sich bei Monsignore Breitwieser Vorträge über Keuschheit oder die Freuden des Leids anzuhören und danach im Café Amalie mit den anderen alten Schachteln das Kuchenbuffet leer zu räumen.
Als mein Vater noch lebte, kamen ab und zu der Postbeamte Günther Huber und seine Frau Renate zum Abendessen. Dann brachten sie immer ihren Norbert aus der Parallelklasse mit, ein seltsamer Kerl mit HJ-Haarschnitt, der immer noch Hosenträger trug, obwohl sogar ich mit Gürtel in die Schule gehen durfte. Der alte Huber hatte nur noch einen Arm, den linken blöderweise. Der rechte lag, wie er gerne erzählte, seit Dezember 1944 in der Nähe von Bastogne irgendwo unter einem Acker vergraben. Damit ihm seine Renate nicht alles klein schneiden musste, kochte meine Mutter stets Rehgulasch, wenn die Hubers kamen. Nach dem Essen wurden wir hinauf ins Zimmer geschickt, wo sich Norbert über meine Legos hermachte, als ob er selbst kein Spielzeug hätte. Unten ging es hoch her, das Thema war jedes Mal das gleiche. Meistens fing als Erster der Huber zu schreien an.
»Dünkirchen! Dünkirchen! Niemand hat das verstanden. Das war der entscheidende Fehler, gleich am Anfang. Aber bitte, Führerbefehl, da kannst du nichts machen.«
Einmal fragte mich der Norbert unvermittelt: »Schon mal welche beim Ficken gesehen? Schwanz? Muschi?«
Ich hielt die Luft an. Solche Wörter durften bei uns weder gedacht noch ausgesprochen werden. Die Bachmaiers waren sauber bis unters Sofa.
»Willst mal was sehen?«, fragte Norbert. Er grinste. Es war ein seltsames Grinsen, nicht so, wie man beispielsweise grinst, wenn man die Augsburger Puppenkiste im Fernsehen anschaut.
»Nein«, sagte ich, weil ich immer Nein sagte, wenn ich Ja meinte. Das gehörte sich so in einem katholischen Haus.
Norbert zog ein zusammengerolltes Heft aus der Innentasche seines Parkas hervor. »Das versteckt mein Alter hinterm Ehebett am Kopfende, aber er weiß nicht, dass ich es weiß.«
»Sei leise«, zischte ich.
»Manteuffel!«, schrie mein Vater unten in einer Lautstärke, die nach einer Flasche Asbach Uralt klang.
Oben im Kinderzimmer tat sich ein neues Universum mit nie da gewesenen Sauereien auf. In dem Heft waren praktisch keine Texte drin, sondern nur Fotos. Der Norbert erklärte jedes im Flüsterton. »So ein Fledermausanzug aus Leder ist in Sankt Pauli ganz normal«, raunte er.
»Brutal«, sagte ich. »Aber wozu die Löcher?«
»Wie blöd bist du eigentlich?«, fragte der Norbert. Ich kam dann aber auch selber drauf, wozu die da waren.
Wir blätterten so konzentriert, dass wir nicht merkten, wie sich Elvira heranschlich. Mit einem Mal riss sie das Heft an sich. »Das sag ich jetzt, was ihr für Hammel seid.«
Weg war sie. Norbert riss seine Augen vor Schreck weit auf. Es war etwas sehr Schlimmes passiert, es war maximal schlimm, und trotzdem würde es gleich noch viel grässlicher kommen.
Wir hörten Elvira unten nur noch »Die spielen gar nicht Lego« sagen, dann war es mit einem Mal still, bis ein scharfer Ruf ertönte: »Norbert, aber sofort!«
Norbert sprang auf und rannte die Treppe runter, eine linkshändige Watschen klatschte, die Haustür fiel ins Schloss. Die Hubers kamen danach lange nicht mehr und später nur noch ohne Norbert. Meine Eltern verloren nie ein Wort über den Vorfall, aber ich kapierte auch so, dass Sex, speziell in Sankt Pauli, eine teuflische und widerwärtige Sache war, vielleicht nicht ganz so schrecklich wie der Zweite Weltkrieg. Aber fast.
Sonnenfinsternis
Ich mochte mein Zimmer unter der Dachschräge mit den Blümchentapeten, denn von dort konnte ich über die Felder blicken und den Lerchen zuhören. An den Nachmittagen träumte ich auf dem Fensterbrett in der Sonne vor mich hin, statt Hausaufgaben zu machen.
Es war August geworden, die Ferien gähnten mich an. Maria Himmelfahrt rückte näher und damit der erste Auftritt der Tonis im Rhythmusgottesdienst. Ich schämte mich schon jetzt dafür, denn Scham gehörte nicht erst seit dem Skandal um das Pornoheft zu meiner Grundausstattung. Die Sache lag zwar schon acht Jahre zurück, hatte sich mir aber eingebrannt. Seitdem galt für mich die Peinlichkeitsskala von 0 bis 10, wobei der Maximalwert von Hubers Wichsvorlage mit den Fledermausanzügen markiert wurde.
Im hintersten Winkel meines Hirns ahnte ich inzwischen, wie übertrieben die Aufregung darüber war. Wahrscheinlich lag daheim bei Rory in seiner Villa sogar eine ganze Sammlung von Pornoheften und Playboys offen rum, und jeder konnte darin blättern, wie er wollte. Aber das war in der fernen Welt der Coolness. In Artlhofen herrschten Pfarrer Willi und das Wort Gottes. Geilheit hatte der Teufel geschickt. Aber das Perfide daran war, dass sich die Erinnerungen an den Fledermausanzug und all die anderen Sauereien in Hubers Heft weder wegdenken noch wegbeten ließen. Sie führten inzwischen ihr Eigenleben in meinem Kopf. Da halfen selbst die schönsten Jugendwallfahrten nach Altötting nichts.





























