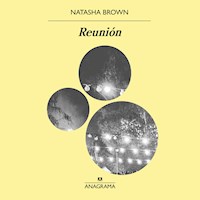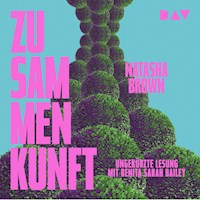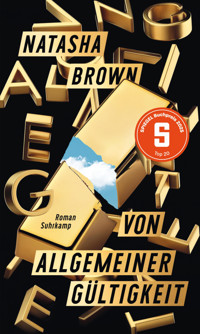
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf einer verlassenen Farm in Yorkshire wird ein Mann mit einem Goldbarren fast totgeschlagen. Für die junge Londoner Journalistin Hannah ist es nicht bloß eine Geschichte mit Potenzial, sondern ihre letzte Hoffnung, nicht abzurutschen: in berufliche Bedeutungslosigkeit, Armut, Provinz. Sie recherchiert – mit letzter Kraft – und bringt einen moralisch bankrotten Investmentbanker, eine antiwoke-Kolumnistin und eine radikale anarchistische Bewegung mit dem Goldbarren in Verbindung. Was sie dann schreibt, geht viral, big-time, und bringt Hannah zurück ins Gespräch, mit Freundinnen, Redakteuren, einer Netflix-Produktionsfirma. Doch ihre spektakuläre Reportage und der sich einstellende Erfolg werfen schnell eine grundsätzlichere Frage auf: Was ist von allgemeiner Gültigkeit in diesem zerbrochenen Land?
In ihrem neuen Roman stellt Natasha Brown ›Macht‹ und ›Wahrheit‹ als Rhetorik bloß. Mit voyeuristischer Lust und einmaliger Brillanz vermisst sie unsere Worte und das, was wir sagen. Von allgemeiner Gültigkeit wird so zu einem verdorbenen Freudenfest der Sprache und ihrer ungeheuren Gestaltungskraft. Und zur gnadenlosen Familienaufstellung einer Gesellschaft, die jeden Halt zu verlieren droht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Natasha Brown
Von allgemeiner Gültigkeit
Roman
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel Universality bei Faber & Faber, London.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025© Natasha Brown, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Bookjacket Design und Art Direction / Zeren, Nurten
Nurten Zeren, Berlin
eISBN 978-3-518-78199-9
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Anmerkung der Autorin
NARRENGOLD
EDMONTON
WEYBRIDGE
CARTMEL
SHOWTIME
Danksagung
Informationen zum Buch
Von allgemeiner Gültigkeit
Anmerkung der Autorin
Dieser Roman ist ein fiktionales Werk. Alle Ereignisse, Beschreibungen und Aussagen über real existierende Personen oder Institutionen sollten nicht als Fakten oder Tatsachen aufgefasst werden.
Tatsächlich bin ich, bis ich mich selbst einhole,
die einzig fiktive Figur in diesem Buch.
NARRENGOLD
Erstmals erschienen
in der Zeitschrift Alazon am 17. Juni 2021
Ein Goldbarren ist überraschend schwer. Vierhundert Feinunzen, an die 12,5 Kilogramm reinstes, in Blockform gegossenes Gold – als hätte man einen kleinen Ziegelstein mit einer Pyramide gekreuzt. An einem kalten Septemberabend im vergangenen Herbst hielt der dreißigjährige Jake einen solchen Barren in der Hand und staunte über das sperrige Gewicht; die harten Kanten fühlten sich unnachgiebig und doch irgendwie organisch an. Im Hintergrund erhob sich das Haupthaus einer Farm in West Yorkshire, unter dem dunklen Nachthimmel pulsierten Musik und bunte Lichter. Ungefähr hundert zumeist junge Menschen trotzten dem von der Regierung verhängten Lockdown und feierten eine Party. Jake nahm das lärmende Haus, in dem er einen Großteil des aufreibenden Jahres 2020 verbracht hatte, kaum wahr, genauso wenig wie das Gold in seinen Händen.
Bei dem Barren in Jakes’ Besitz handelte es sich um einen »London Good Delivery«, der buchstäbliche Goldstandard für Goldbarren und über eine halbe Million Dollar wert. Die Vorstellung erscheint obszön; Jake konnte nicht fassen, dass es möglich war, eine solche Summe in den Händen zu halten, geschweige denn damit zuzuschlagen. Wieder und wieder. Und noch einmal. Bis der Getroffene sich nicht mehr rührte. Aber nun war es wirklich passiert, oder? Ja. Jake konnte die Augen nicht abwenden: Zu seinen Füßen lag ein regloser Mensch.
Irgendwann im Laufe der Nacht, vielleicht auch erst im Morgengrauen, als das Licht über den Horizont kroch, konnte Jake sich endlich von dem Anblick losreißen und einen klaren Gedanken fassen.
Er beschloss zu fliehen.
In den Wochen nach Jakes Verschwinden berichteten die Lokalzeitungen von Queensbury und Bradford über die Vorfälle jenes Abends: ein illegaler Rave, drei Verletzte im Krankenhaus, beträchtlicher Sachschaden am Gebäude, polizeiliche Ermittlungen. Doch weil der mediale Fokus weiterhin auf der Covid-19-Pandemie und auf den von der Regierung geplanten Maßnahmen für die kommenden Wintermonate lag, geriet die Geschichte bald in Vergessenheit. Es lohnt sich jedoch zu rekonstruieren, was den seltsamen und verstörenden Ereignissen dieser Nacht vorausging, denn dahinter verbirgt sich eine moderne Parabel. Sie offenbart das zerfasernde Gewebe der britischen Gesellschaft, verschlissen durch den pausenlosen Abrieb des Spätkapitalismus. Der verschwundene Goldbarren ist das verbindende Element zwischen einem amoralischen Banker, einer bilderstürmenden Kolumnistin und einer radikal-anarchistischen Protestbewegung.
Natürlich will ich ihn zurück – es ist mein Gold.«Richard Spencer hat die Ereignisse jener Nacht nicht vergessen. Tatsächlich hat er als Eigentümer des Hofs an kaum etwas anderes mehr gedacht. »Ich will mein Leben zurück«, jammert er.
Als ich zum ersten Mal mit Spencer rede, sitzt er mir gegenüber und stützt die Ellenbogen auf die stumpfe Platte eines Aluminiumtischs. Den Treffpunkt, ein ernsthaft ironisches American Diner im Londoner Covent Garden, hat Spencer selbst ausgesucht. Auf der Karte steht ein Frischkäsebagel mit Avocado für £ 11,50. Spencer trägt ein tiefblaues, gestärktes, aber ungebügeltes Hemd von Ted Baker, die aufgerollten Ärmel verleihen seinen gestikulierenden Händen und Unterarmen eine körperlose Theatralik. Er ist sehr mitteilsam und will mir unbedingt erklären, wie sich sein Leben »in eine absolute Shit-Show« verwandeln konnte.
Die Formulierung klingt selbstmitleidig, wenn nicht gar egoistisch. Schließlich haben, seit die Pandemie im Jahr 2020 über den Globus fegte, viele Menschen Furchtbares erlitten und ihr Leben oder geliebte Angehörige verloren. Spencer hingegen lebt und ist wohlauf. Seine Angehörigen sind in Sicherheit, auch wenn sie ihn zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht gerade innig zurücklieben. Doch Spencer hat etwas Wichtiges verloren: seinen Status. Noch im Jahr 2019 fuhr er die exzessive Ernte des Spätkapitalismus ein. Er besaß mehrere Immobilien, Ackerland, Firmenbeteiligungen und Autos; er hatte Hausangestellte, eine hübsche Frau und dazu eine sehr viel jüngere Geliebte. Als ehrgeiziger Stockbroker einer großen Investmentbank genoss er immensen Einfluss, er hatte Macht und Vermögen. Er hatte alles. Nun, da es ihm genommen wurde, ist er nur noch der Mann, der mir gegenübersitzt: ein zu Boden gegangener Riese, ausgesperrt aus seinem Schloss in den Wolken.
In Spencers Fall trägt der junge Märchenheld, der das Gold gestohlen und die Bohnenranke gekappt hat, den Namen Jake. Spencer vermutet, dass Jake, ein Bewohner der Farm, sich mit dem Goldbarren abgesetzt hat. »Selbstverständlich hat er das verdammte Ding mitgenommen«, sagt er. Er ist Jake nie begegnet, glaubt aber fest an dessen Schuld.
Eigentlich weiß Spencer praktisch nichts über den Mann, den er für seinen Ruin verantwortlich macht. Er habe Jake nur auf den Hof eingeladen, »um Lenny einen Gefallen zu tun«. Lenny ist eine Nachbarin aus seinem Wohnblock. »Sie suchte nach einem Ort, an dem ihr Freund für ein paar Tage in Quarantäne gehen konnte«, erklärt Spencer achselzuckend. Auch über Lenny weiß er nur wenig. Sie war eine der wenigen Nachbarinnen, die während des Lockdowns in dem Apartmenthaus in Kensington geblieben waren; die meisten anderen Bewohner hatten sich auf ihre Landsitze zurückgezogen. Weiß er ihren Nachnamen? »Nein.« Ihr Alter? »Hm, schon ein bisschen älter.« Die Nummer ihres Apartments? »Keine Ahnung.« Was wusste er eigentlich über die Frau, der er die Schlüssel zu seiner Farm überließ? »Nun ja …« Er zögert. »Ich kannte sie ganz gut in dem Sinne, dass …« Er verstummt.
Widerwillig bestätigt Spencer, mit ihr intim geworden zu sein. Er lebt getrennt von seiner Frau Claire, die im Haus der Familie geblieben ist und dort die gemeinsame Tochter Rosie, drei Jahre alt, allein großzieht. »Nicht ganz allein«, beeilt Spencer sich zu sagen, »sie hat an vier Tagen die Woche ein Kindermädchen, abgesehen davon geht Claire nicht arbeiten.« Claire und Spencer haben sich 2019 getrennt, der Grund war seine Affäre mit einer fünfzehn Jahre jüngeren Kollegin.
So typisch. Dass er das sagt.« Wenige Tage sind vergangen, ich besuche Claire in Cobham. Sie öffnet mir die schwere Haustür mit einer Hand, ein schüchtern neugieriges Kleinkind hält ihre andere. Wir setzen uns an den Küchentisch, zwischen uns steht eine Kanne Filterkaffee. Die kleine Rosie liegt auf einem Spielteppich in der Ecke. Sie trägt geringelte Leggings, einen winzigen Bauarbeiterhelm und ein Glitzertutu, murmelt leise vor sich hin und lässt dabei zwei Spielzeuglaster ineinanderkrachen. »Ich bin Designerin«, erzählt Claire. Seit Rosie 2018 auf die Welt kam, war Claire hauptsächlich als Freiberuflerin für ein paar ausgesuchte Kunden tätig, davor arbeitete sie in einer kleinen Branding-Agentur. Ursprünglich hatte sie Kunstgeschichte in Oxford studiert und dort auch Spencer kennengelernt. Das Paar heiratete bald nach dem Studium, lebte für ein paar Jahre in London und zog dann an diesen exklusiven Ort, um zwischen prominenten Fußballern und Finanziers eine Familie zu gründen.
Was die Trennung anbelangt, gibt Claire sich gelassen. »Menschen ändern sich eben.« Spencer habe sich in Cobham nie heimisch gefühlt. »Er blieb meistens in London. Und arbeitete immer so lange, dass die Fahrt sich ohnehin nicht gelohnt hätte.« Doch dann irgendwann habe er begonnen, auch die Wochenenden in seiner Stadtwohnung in Kensington zu verbringen. »Ich bin nicht blöd«, sagt Claire über die Affären. »Ich wusste, was läuft.« Doch einen offiziellen Schlussstrich zog sie erst, als sie dahinterkam, welche Ausmaße seine Beziehung zu der jüngeren Kollegin angenommen hatte. »Irgendwo ist eine Grenze«, sagt sie, und die habe Spencer überschritten.
2015 war Spencers Vater nach längerer Krankheit gestorben. »Ab da war er wie besessen von dem Gedanken, eine Farm zu besitzen«, berichtet Claire. Er ging jedes Wochenende zu Auktionen und fuhr weite Strecken mit dem Auto, um sich Grundstücke und Gutshöfe anzusehen. Womöglich ein später, von der Trauer ausgelöster Versuch, dem Vater nachzueifern, einem »ganzen Kerl«, der mit nichts angefangen und eine erfolgreiche Baufirma gegründet hatte. »Sein Vater hat ihn nie verstanden«, sagt Claire. »Aber Rich hat ihn verehrt.« Schließlich erwarb Spencer das auf einem Hügel gelegene Gut Alderton in Queensbury, einem kleinen, ruhigen Dorf im Westen von Yorkshire. Claire hielt von dem Anwesen nicht viel. »Es war eine komplette Ruine. Ein Trümmerhaufen auf einem Hügel über einer hässlichen Siedlung. Kein vernünftiger Mensch hätte da zugegriffen.«
Dass Claire so abfällig über die Gegend spricht, trifft mich persönlich. Ich bin in Queensbury aufgewachsen, nur einen Steinwurf vom Hof entfernt. Als Kind lief ich fast täglich daran vorbei, und später als Teenager gehörte es an den Sommernachmittagen einfach dazu, bei den Aldertons mit anzupacken. Bei uns zu Hause gab es immer frisch geerntetes Gemüse. Kein Supermarktprodukt kann sich mit warmer, schäumender, unpasteurisierter Kuhmilch messen, die frisch aus dem Melkeimer geschöpft wurde. Obwohl Queensbury wirtschaftlich benachteiligt war und die Bevölkerung aus einfachen, hart arbeitenden Leuten bestand, verlebte ich dort eine idyllische Kindheit. Der Ort bedeutet mir viel. Doch aus unerfindlichem Grund sind selbst unsere Dörfer mit ihren Familienbetrieben zum Spielzeug der Londoner Eliten geworden. Nach der Finanzkrise 2008 fielen staatliche Subventionen, die das Gut trotz der bescheidenen Gewinne über Wasser gehalten hatten, einfach weg, und Alderton machte schwere Zeiten durch. Die Kühe wurden verkauft, Scheunen und Ställe vernagelt. Doch ohne die Einnahmen aus dem Landwirtschaftsbetrieb erwies sich das Leben im Gutshaus als unbezahlbar. »Wir haben alles verloren«, erzählt mir Mrs Alderton am Telefon. Ihre Stimme bebt vor Schmerz. »Das Gut war seit Generationen im Familienbesitz.« Die Aldertons suchten einen Käufer, der die an der Gemeinde orientierte Landarbeit fortsetzen würde, fanden aber kaum Interessenten. »Am Ende mussten wir an einen Immobilieninvestor verkaufen. Uns blieb keine Wahl.« Der Hof wechselte weitere Male den Eigentümer, ohne dass jemand dort investiert oder etwas saniert hätte. Er stand leer, bis Richard Spencer 2016 bei der Auktion den Zuschlag erhielt.
»Er hängt seltsamen ›Prepper‹-Fantasien nach. Er glaubt, er könnte da draußen das Ende der Welt überleben.« Claire ist skeptisch. »Meines Wissens hat er nicht mal den Garten gewässert.« Spencer ließ das Haupthaus renovieren und baute es zu einem Rückzugsort aus für den Fall, dass die gesellschaftliche Ordnung zusammenbricht – eine möglicherweise durch seine Beteiligung am Crash von 2008 befeuerte Vorstellung, und tatsächlich entpuppte sich die gesellschaftliche Ordnung bei den nachfolgenden ökonomischen Erschütterungen als äußerst fragil. Doch als die globale Katastrophe dann tatsächlich eintrat, in Gestalt des neuartigen Coronavirus, klammerte Spencer sich an sein vertrautes Londoner Umfeld, an Restaurantessen zum Mitnehmen, seine Haushälterin und am selben Tag gelieferte Mode von Mr Porter. Er blieb in seiner Wohnung in Kensington, und das renovierte Gutshaus stand leer.
Bis Jake kam.
Die Ermittler führen derzeit keine Verdächtigen in dem Fall. In der Nacht des Rave schrieb die Polizei über dreißig Bußgeldbescheide wegen Verstoßes gegen die Lockdown-Regeln. Spencer als Eigentümer des Veranstaltungsortes musste £ 10000 Strafe zahlen. Das Partyvolk war vor dem Eintreffen der Polizei verschwunden, die Befragung der wenigen Verhafteten unergiebig – die meisten stammten nicht aus Queensbury und wussten über das Gut nur wenig. Eine unbekannte Person wurde bewusstlos aufgefunden und ins örtliche Krankenhaus eingeliefert, die Kopfverletzungen deuteten auf stumpfe Gewalteinwirkung hin. Zwei weitere Partygäste mussten sich wegen leichter Verletzungen behandeln lassen. In den ersten Berichten war von »Hausbesetzern« die Rede sowie von offenkundigen Versuchen, »im kleinen Stil Marihuana anzubauen«. Die Beamten erstickten die Bemühungen im Keim und beschlagnahmten alles. Spencer wurde befragt, doch die Polizei gab keine Informationen zu seiner Aussage weiter und berief sich auf laufende Ermittlungen. Dennoch wird bis heute nicht nach einem verschwundenen Goldbarren gefahndet, genauso wenig wie nach Jake. Ein Polizeisprecher gab eine knappe Erklärung ab: »Es handelt sich um ein Drogendelikt, Verstöße gegen die Lockdown-Bestimmungen und mutmaßliche Körperverletzung, nicht um die fruchtlose Jagd nach einem Goldschatz.«
Unabhängig von der schiefen Metapher sind die Ermittlungen im Sande verlaufen. Bis der ins Krankenhaus eingelieferte Unbekannte wieder bei vollem Bewusstsein ist, wird über die Geschehnisse auf dem Hof vermutlich wenig ans Licht kommen. Das Gelände ist immer noch durch Flatterband abgesperrt, eine unübersehbare Mahnung an alle Dorfbewohner.
»Furchtbar, dass es so weit gekommen ist«, klagt Mrs Alderton. »Drogen, Gewalt und wer weiß, was alles noch? Das war einmal unser Zuhause.« Die Aldertons glauben, dass Richard Spencer bei den kriminellen Machenschaften eine aktive Rolle spielte. »Das ist ein großes Geschäft«, lautet die Einschätzung von Mr Alderton, die seine Frau sofort an mich weitergibt. Die monatelangen Renovierungsarbeiten in dem anschließend leerstehenden Gebäude hatten unter den Einheimischen ohnehin für Spekulationen gesorgt. »Da stimmt irgendwas nicht«, vermutet Mrs Alderton. »Solche Männer geben ihr Geld nicht für nichts aus.«
Ich koche gerade einen Fond«, erklärt der Historiker und Dozent Rodger Walters, um das Chaos in seiner Küche zu erklären. In einer feuerfesten Form liegt ein Hühnchengerippe zwischen einem großen, auf eine Buchstütze gestellten Kochbuch und einer beeindruckenden Vielfalt von Wurzelgemüse, teils zerhackt, teils noch von Erde verkrustet. Walters dirigiert mich durch einen Wintergarten auf einen Rasen. Dort sitzt seine Lebensgefährtin, die Kolumnistin Miriam Leonard, und hält trotz der schneidenden Kälte ein Whiskyglas in der Hand.
Zu sagen, dass eine Figur wie Leonard, die sich Lenny nennt, entgegen allen Wahrscheinlichkeiten existiert, wäre nicht übertrieben. »In dieser verwirrenden Zeit von medialer Polarisation und moralischer Orthodoxie ist Leonard eine der letzten kritischen Stimmen; sie hat den Mut, das Unsagbare zu sagen«, heißt es im Vorwort zu ihrem 2018 erschienenen Schluss mit Woke, ein Sammelband mit Artikeln aus ihrer über zwanzigjährigen Tätigkeit als Kolumnistin. Anscheinend hatte der Verlag bemerkt, dass das, was Lenny sagte, durchaus sagbar war, zudem hatte er vermutet, dass es sich profitabel als Buch vermarkten ließe. 2016 erhielt Lenny einen »beträchtlichen« Vorschuss für einen Vertrag über zwei Bücher und machte sich daran, ihre verschiedenen Kolumnen zu einem kohärenten Band zusammenzufassen, ihrem Opus magnum, das mit polemischer Leidenschaft die unmittelbare Bedrohung durch »die Woke-Kultur und anti-weiße Ressentiments« darlegt.
»Das Problem war«, sagt Lenny, »dass sich das Buch nicht gut verkauft hat.« Anscheinend besaßen die meisten der Leute, denen es nicht peinlich gewesen wäre, sich Schluss mit Woke ins Bücherregal zu stellen, kein Bücherregal. Zunächst hatte alles gut ausgesehen: Der Band heimste begeisterte oder zumindest wohlwollende Rezensionen von allen möglichen Zeitungen ein. Die Times attestierte ihm, »frischen Wind« in die Debatte zu bringen, und selbst der stabil nach links ausgerichtete Guardian rang sich zu einem vorsichtigen Lob durch, obschon mit einem kleinen Seitenhieb gegen den »unglücklich gewählten« Titel. »Dabei war der Titel genial«, grinst Lenny, und in dem Punkt hat sie recht. Er sorgte für Aufregung und Widerspruch, zugleich erschien jeder, der ihn kritisierte, nun ja, woke. Selbst heute, drei Jahre nach der Veröffentlichung, hat sich #SchlussMitWoke in den sozialen Medien als beliebter Hashtag gehalten.
Lennys Lektor Rob Neeson – »ein Fünfunddreißigjähriger mit alberner Brille« – riet ihr, die Sache beim zweiten Buch anders anzugehen. »Irgendwie mehr in Richtung Cohen, weniger Shriver. Das hat er wortwörtlich so gesagt. Als wüsste ich nicht, wie ich meine Kolumne zu schreiben habe!« Lennys Empörung ist teilweise berechtigt. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov belegt sie auf der Rangliste der einflussreichsten britischen Kolumnisten Platz siebzehn. Nachdem sie in den Neunzigerjahren hauptsächlich für Frauen- und Lifestyleredaktionen geschrieben hatte, erkämpfte sie sich mit der Zeit einen Stammplatz auf den Meinungsseiten der konservativen Zeitungen. Trotz ihrer stets betonten Abneigung gegen Social Media hat Lenny Twitter seit Jahren genauestens im Blick und ist immer bereit, sich mit einem vernichtenden Urteil über das neueste Internetphänomen zu Wort zu melden. Sie dampft ihre Prosa zu hochkalorischen Bonbons ein, ihr Ton zielt auf maximale Erregung. Die Zeitungen wissen das; ihre Beiträge sind Garanten für Klicks und Shares.
Der Sammelband war der Versuch von etwas Größerem. Das Publizieren in Zeitungen hatte Lenny zunehmend desillusioniert. »Letztendlich«, sagt sie, »fühlte es sich billig an. Ich war nur noch ein Kampfhund.« In ihren Augen sollte eine Kolumne mehr vermitteln als die eigene Gelehrsamkeit. »Uns geht es nicht darum, Ansichten zu ändern. Ich muss den Argwohn meiner Leserschaft verstehen … ihre tiefsten Befürchtungen. Meine Aufgabe ist es, ihre Bedenken zu untermauern, indem ich relevante Fakten beisteuere.« Sie argumentiert, dass ihre polternde Art des Journalismus den Lesern hilft, das Tagesgeschehen in einen Kontext zu setzen und zu deuten. »Ich biete einen Blick auf das große Ganze«, erklärt sie und breitet demonstrativ die Arme aus. »Ich enthülle, wie all diese Bäume einen Wald ergeben.«
Zurück zu den Bäumen. Wer ist Jake?, frage ich Lenny. Wie kam er auf Spencers Hof? Rodger hatte ich auf Anhieb im Wählerverzeichnis gefunden, und als ich ihn in der Universität anrief, antwortete er fröhlich, er kenne in der Tat eine »Lenny«. Doch nach der zweistündigen Unterhaltung, die ich draußen in der Kälte mit Lenny führte, bin ich der Lösung des Rätsels um Jake und die Farm kein bisschen näher gekommen. Statt auf meine Fragen einzugehen, lädt Lenny mich zum Abendessen ein. Eine überaus großzügige Auslegung der geltenden Lockdown-Regeln, immerhin herrscht Stufe drei; ich sage dennoch zu in der Hoffnung, dass die Wärme, der Wein und das Essen zu mehr Offenheit führen.
Im November 2011 schlug Indiya auf dem Londoner Paternoster Square ein nagelneues Wurfzelt von Quechua auf. In Vorbereitung auf den Occupy-Wall-Street-Protest hatte sie Permanentmarker, Feuchttücher und einen Strohhalm mit Wasserfilterfunktion in ihren Rucksack gepackt. Indiya war gerade erst neunzehn geworden und begleitete ihre Mitbewohner von der Kunsthochschule Central Saint Martins, um sich bei dem beispiellosen Aufstand den neunundneunzig Prozent anzuschließen. »Damals wurden mir die Augen geöffnet, wie viel Macht das Volk hat«, sagt sie heute über diese Erfahrung. Im Bradford Royal Infirmary, der nächstgelegenen Klinik im Umkreis des Alderton-Hofs, begegne ich ihr am Krankenbett des inzwischen halb aufgewachten und halb identifizierten Unbekannten. »Sein Name ist Pegasus«, erklärt Indiya, zupft die Bettdecke des reglosen Mannes zurecht und streicht ihm die Haare glatt. »Ein echter Visionär.«
Pegasus reagiert kaum auf äußere Reize und starrt mit weit geöffneten Augen ins Leere. »Er hat einen minimalen Bewusstseinszustand wiedererlangt«, sagt Indiya. »Ein gutes Zeichen. Er ist auf dem Weg der Besserung.« Nachdem die Polizei den unidentifizierten Verletzten ins Krankenhaus transportiert hatte, lag er riskante vierzig Stunden lang im künstlichen Koma. Indiya behauptet, nicht zu wissen, wie Pegasus zu seinen Verletzungen kam, stattdessen beschreibt sie das »Chaos«, das ausbrach, als die Beamten auf dem Hof eintrafen. »Alle rannten durcheinander und die Musik war so laut, dass keiner wusste, was los ist.« Hinterher habe sie tagelang nach Pegasus gesucht und ihn schließlich hier in der Klinik gefunden.
Indiya ist groß, über eins achtzig, und trägt das dunkelblonde Haar in langen, locker zurückgebundenen Dreadlocks. Wenn sie spricht, bewegt sich ihre Maske aus Biobaumwolle. Sie trägt eine übergroße Wachstuchjacke und schwere Stiefel, Leggings und ein abgeschnittenes T-Shirt, das gelegentlich ihre blasse Taille entblößt; sie sieht aus wie eine Hippie-Revoluzzerin aus der Kartei einer Casting-Agentur. »Occupy hat alles für mich verändert«, erzählt sie. Drei Wochen lang übernachtete sie immer wieder im Camp, bis ihre Eltern eingriffen: »Die hat nur mein Abschluss interessiert, nicht die weltweite Ungleichverteilung.« Zur großen Erleichterung ihrer Eltern schloss Indiya 2014 tatsächlich ihr Studium ab, doch sie blieb in Kontakt mit dem bunt zusammengewürfelten Haufen, den sie während der Besetzung kennengelernt hatte, vor allem Pegasus. »Er besitzt große Anziehungskraft«, sagt sie über den verletzten Kameraden. »Er schafft es, die Leute zusammenzubringen.«
Obwohl Indiya gelegentlich als Entwicklerin für Videospiele arbeitet, hat sie den traditionellen Karrierevorstellungen abgeschworen und sich stattdessen für das experimentelle Zusammenleben in verschiedenen Kommunen entschieden. In einigen ging es relativ formell zu, es gab Mietverträge oder eine Absprache mit einer Genossenschaft, in anderen sah es anders aus. »Ich bin Hardcore-Marxistin«, erklärt sie ernst. In den Jahren seit Occupy hat sie sich in verschiedenen soziopolitischen Fragen engagiert, und derzeit gehört sie einer Zelle von Extinction Rebellion an, jener führungslosen Gruppe von Umweltaktivisten, die überall in Großbritannien durch politische Stunts und Proteste von sich reden machen. »Aktivismus«, erklärt sie, »ist unumgänglich. Jetzt oder nie.«
Vor diesem Hintergrund lud Pegasus im vergangenen Juli eine kleine Aktivistengruppe auf den ehemaligen Hof der Aldertons ein. Sie planten, dort eine neue »autonom wirtschaftende Community« zu gründen. Sie tauften sich die Universalisten und betrachteten die Übernahme des Hofs nicht als Hausbesetzung, sondern als politischen Aktivismus. »Die Immobilie war ungenutzt«, sagt Indiya. »Überall in Großbritannien gibt es solche Häuser – sie stehen einfach leer. In einer Zeit, in der so viele Menschen Wohnraum brauchen, ist das ein Verbrechen.« Die Universalisten betrachteten den Hof als eine Gelegenheit, als die Chance, ihre besondere Vision von gemeinschaftlichem Leben zu verwirklichen.
Heute ist es mit dem Traum ganz offiziell vorbei. Nach Ende der Besuchszeit radelt Indiya die über fünfzehn Kilometer zum Hof zurück. Ein schweres Schloss an einer Kette sichert die Tür des Hauptgebäudes, ein pittoreskes, zweigeschossiges Steinhaus mit kleinen Bleiglasfenstern am Kopf einer leichten Anhöhe. Davor stapeln sich ausgebeulte Müllsäcke und ein paar Koffer neben vereinzelten Möbelstücken. Ein Billy-Bücherregal, zwei abgewetzte Sessel und Einzelteile einer mutmaßlich professionellen Soundanlage. Zerrissene Überreste von Absperrband flattern im Wind, während drei junge Männer die Gegenstände in einen vor dem Haus geparkten Van einladen.
Indiya ist enttäuscht. »Wir haben hier etwas aufgebaut«, sagt sie wehmütig. Obwohl nur »etwa ein Dutzend« Personen dauerhaft auf dem Hof lebten, glaubte Pegasus fest an das Expansionspotenzial der Bewegung. Das Haupthaus war fast schon überbelegt, erzählt Indiya, doch die Gruppe plante, sich weiter auszubreiten und eines der Nebengebäude zu einer Unterkunft auszubauen. »Das an dem Abend war kein Rave, sondern eine offene Veranstaltung. Wir hatten potenzielle neue Mitglieder eingeladen, damit die Bewegung wächst.« Die Pandemie war offenbar kein ausreichender Grund, derlei Expansionspläne zu verschieben. »Das Virus konnte sich ja nur wegen des ungezügelten Kapitalismus verbreiten. Wegen der Globalisierung und der vom Profit getriebenen Zerstörung natürlicher Ökosysteme. Das hier« – sie deutet auf die traurigen Verladearbeiten – »war die Lösung, an der wir gearbeitet haben. Selbstverständlich konnte das nicht warten!«