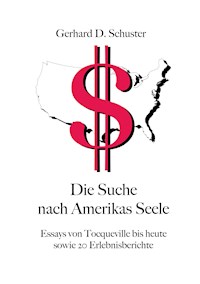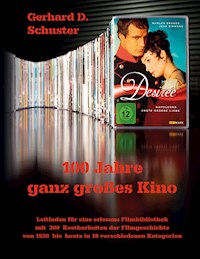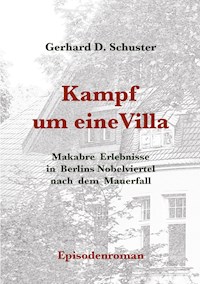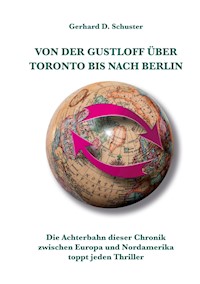
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Memoiren eines vielseitig begabten, Turbulenzen geradezu herausfordernden internationalen Geschäftsmannes, der nach mehr als 80 Jahren Leben seine Erinnerungen aufgeschrieben hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Dieses Buch widme ich in großer Dankbarkeit meinen Eltern:
Dipl. Ing. Gustav Schuster, 1905-1997, geboren in Stanislau, &Eva Schuster, geb. Knispel, 1915-1992, geboren in Danzig.
Beide verstorben in Victoria, B.C., Kanada.
Inhalt
Über das Glück im Leben
1. Route der Ahnen: Pfalz – Galizien – Danzig
2. Kindheit in Danzig, Einschulung in Wien
3. Untergang der „Wilhelm Gustloff“ 30.1.1945 – Wunder Nr. 1
4. Nachkriegsjahre im zerstörten Deutschland
5. Ankunft im „Kanadischen Sibirien“, Weihnachten 1949
6. Anpassung im stockkonservativen Toronto der 1950er Jahre
7. Wie meine ältere Schwester zu Torontos MM mutierte
8. Erstaunliche Organisation eines kanadischen Gymnasiums
9. Warum Tennis zum Sport meiner Jugend wurde
10. Ron Boyce – der Freund der mich kanadische Noblesse lehrte
11. Freund Bill Dunn – von ihm lernte ich „The Rules of Life“
12. Eine Woche zu Gast auf Parliament Hill (1955)
13. Europas „Coup de Foudre“: ein Jahr Stuttgart (1957/58)
14. Der schleudernde VW am 8. Mai 1960 (Wunder Nr. 2)
15. Drei Europäer als Trainees in den USA (1961)
16. Begegnung zweier Kondore: 24.12.1962 (Wunder Nr. 3)
17. Brüssel zum Ersten: 1963-65 (Geburt des Sohnes)
18. Stippvisite in Frankreich: 1965-68 (Geburt der Tochter)
19. Mobbing zum Ersten: Rendsburg im Norden, 1968-1970 Persönliche Fotos aus acht Jahrzehnten
20. Brüssel zum Zweiten: Unsere liebste Adresse (1970)
21. Kinderfeindlichkeit in Deutschland (1971)
22. Mobbing zum Zweiten: Oldenburg im Nordwesten, 1971-73
23. Befreiungsschlag durch den MBA in Toronto, 1974
24. Lehrjahre als Europa-Chef der Beneke Corp., 1975-83
25. Mein berufliches Pearl Harbour: 6. Dezember 1983
26. Wie eine Lagerleiterin mir Benesan entreißen wollte
27. Der Casanova und meine Frau - eine Lektion
28. Der polnische Gangster und die Grunewald-Villa
29. Drangvolle Enge in einem brandenburgischen Dorf
30. Schließen der Benesan GmbH, Wohnen in einer Remise in Potsdam
Schlusswort
Über das Glück im Leben
Es waren in erster Linie zwei Gründe, warum ich das in diesem Buch geschilderte Krisen-Stakkato – die lebensgefährlichen Schicksalsschläge wie den Untergang der Gustloff und meinen Überschlagunfall außer Acht gelassen – unbeschadet überstanden habe. Mein genialer, langjähriger Chef, der Hüne mit den Adleraugen, der zu mir immer sehr offen war, wenn er über den Atlantik nach Europa kam, brachte es auf den Punkt:
Gerry, du bist der flexibelste Konservative, der mir je begegnet ist. Und außerdem: Wie hast Du es geschafft, ausgerechnet diese Frau zu heiraten?
Bud Sanderson CEO Beneke Corporation
Es war die Verwegenheit des Anfängers, die Kühnheit des Unbefangenen, der unbekümmerte Wagemut des Träumers, was mich getrieben hatte. Und das Beste war, dass ich nicht die geringste Angst vor dem hatte, was mich erwartete.
Fred Hildenbrandt „Ich soll Dich grüßen von Berlin, 1922-32“ Ehrenwirth Verlag, 1960
Aber geheime und verborgene Eigenschaften sind es, die Glück erzeugen, ein gewisses Etwas, das der Mensch in sich trägt, und wofür man keinen Namen hat. Das spanische Wort „desenvoltura“ drückt es zum Teil aus. Gemeint ist, dass keine Hemmungen und kein Starrsinn im Charakter eines Menschen vorhanden sind, so dass die Räder seines Geistes mit den Rädern seines Glücks Schritt halten.
Francis Bacon Englischer Staatsmann Essays, 1597 (Reclam) „About Fortune“
Gerhard D. Schuster
im Sommer 2022
1. Route der Ahnen: Pfalz – Galizien – Danzig
Unmittelbar vor Ausbruch der Französischen Revolution hatte nur eine deutsche Provinz eine fallende Bevölkerungskurve, die linksrheinische Kurpfalz. Die Gründe waren sich ablösende Wirtschafts- und Finanzkrisen, administrative und religiöse Streitigkeiten.
Als mit dem Beginn des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges 1776 die englische Kriegsmarine die Pforten des „neuen Kanaan“ für acht Jahre verschloss, konzentrierten sich auswanderwillige Pfälzer auf Südosteuropa. Das entscheidende Signal für die österreichische Provinz Galizien (heute westliche Ukraine) gab das 2. Ansiedlungspatent Kaiser Josef II. vom 17. September 1781.
Schon im Frühjahr 1782 meldete „Hofagent“ Joseph Velty in Wien tausend kurpfälzische Familien an. Zwischen Mai und Juli 1784 ließen sich gar 5700 Auswanderer für Galizien registrieren. Hunger, Finanzkrisen, fehlende Erwerbsmöglichkeiten sowie die permanente Benachteiligung der nichtkatholischen Bevölkerung veranlassten sie, Haus und Hof zu verlassen. Auch meine Urahnen väterlicherseits waren darunter.
Der Neubeginn in Galizien mit der Hauptstadt Lemberg gelang nicht allen, denn ohne ein gewisses Sendungsgefühl und die Überzeugung von den eigenen Fähigkeiten kann ein Auswandern nicht gelingen. Gleichwohl konnten sich die meisten Einwanderer aufgrund des fruchtbaren Bodens und ihrer westlich-überlegenen Agrartechnik bald eine solide wirtschaftliche Basis schaffen.
Insgesamt wanderten zwischen 1802 – 1805 mehr als 15.000 Menschen aus dem übervölkerten südwestdeutschen Raum nach Galizien aus. Sie wurden dort in 184 Dörfern, Kolonien genannt, angesiedelt.
Die kulturellen Mittelpunkte der Ansiedlungen bildeten die evangelischen Kirchen, weshalb in den Erzählungen meines Vaters immer wieder ein „Pfarrer Zöckler“ auftauchte, der eine besondere Führungspersönlichkeit gewesen sein muss.
In einem dieser Dörfer, dem zur Stadt angewachsenen Stanislau, wurde der Vater des Autors 1905 in eine kinderreiche Handwerkerfamilie geboren. Er hatte sieben Geschwister, seine Mutter sogar 11, die im Übrigen samt und sonders nach Nordamerika auswanderten.
Die Bewahrung der eigenen Sprache und Kultur war den Auswanderern extrem wichtig, zumal die deutschen Bauern und Handwerker infolge ihrer Tüchtigkeit leicht Neid erregten. Die mir erzählten Schlägereien unter Jugendlichen aus anderen Volksgruppen erinnern mich heute an Western-Filme, zumal die drei Brüder meines eher schmächtigen Vaters keinem Streit aus dem Wege gingen.
Wie bei den nach Amerika ausgewanderten Europäern nagte auch unter den Nachkommen der Auswanderer nach Galizien die Sehnsucht nach der Heimat an ihren Seelen. Aus Sicht der heutigen Globalisierung wundert es überhaupt nicht mehr, dass es meinen schulisch besonders begabten Vater, der Jüngste der Brüder, zum Studium der Elektrotechnik an die TH Danzig zog, die damals neben Darmstadt und Aachen zu den besten Technischen Hochschulen Deutschlands zählte.
Trotz gesundheitlicher Schwierigkeiten – er litt an Lungenspitzenkatarrh – bestand er das Studium mit Auszeichnung und ermunterte zwei seiner Brüder, ihm nach Danzig zu folgen. Es war die Geburtsstunde der Apparatebau-Firma Gebr. Schuster in Danzigs Vorort Gotenhafen, die bei Kriegsende über einhundert Mitarbeiter beschäftigte.
Mein Vater Gustav bildete das „technische Hirn“ der Firma. Er hätte Professor werden können, so wunderbar konnte er physikalische Vorgänge erklären.
Sein nächst älterer Bruder Eduard hatte einen Meisterbrief und wurde Werksleiter. Der zweitälteste Bruder Wilhelm war ein „Meister der Verführung“ nicht nur der Kunden, er wurde kaufmännischer Geschäftsführer. Der älteste Bruder Ludwig konnte sich überhaupt nicht einordnen und wanderte nach Argentinien aus.
Mein Vater heiratete die einzige Tochter des Oberingenieurs Kurt Knispel der damals größten deutschen Werft Schichau, dieser war u. a. Mitglied der Freimaurer-Loge. Leider war er den Diadochenkämpfen unter den Topmanagern gesundheitlich nicht gewachsen, er starb schon mit 49 Jahren an Magenkrebs.
Zwei Dekaden später bemerkte meine Mutter des Öfteren zu mir: „Du bist gar kein Schuster, sondern eher ein Knispel!“ Das heißt, aus ihrer Sicht besaß ich weit mehr Eigenschaften ihrer Verwandtschaft, als der meines Vaters. Doppelt bedauerlich war deshalb, dass ich meinen Großvater mütterlicherseits aufgrund seines frühen Todes nie kennenlernen durfte.
Der wirtschaftliche Erfolg der Firma schlug sich auch im Leben der Brüder nieder. Alle drei besaßen Strandhäuser im Badeort Glettkau. Wilhelms Familie lebte in einer feudalen Villa im Badeort Zoppot. Mein Vater erwarb eine luxuriöse Zweitwohnung in Wien, um die Familie vor den Bomben zu schützen.
Aber das ist schon ein Thema fürs nächste Kapitel.
2. Kindheit in Danzig, Einschulung in Wien
Meine erste Erinnerung besteht aus einem Sandkasten hinter dem Haus meiner Eltern in Danzig-Langfuhr. Dort spielte ich manchmal mit einem Nachbarjungen. Die zweite Erinnerung ist das Strandhaus meiner Eltern in Glettkau, einem Badeort vor den Toren von Danzig.
Weder an die Großstadt Danzig1 noch an die berufliche Tätigkeit meines Vaters gibt es Erinnerungen bei mir, nur der Name der Hauptstraße von Danzigs berühmter Altstadt, nämlich „Langgasse“ ist mir geblieben.
An eine der Satellitenstädte Danzigs erinnere ich mich dagegen sehr gut. Es handelt sich um den riesigen Badeort Zoppot (heute Sopot) früher mal mit dem Adelsprädikat „Nizza des Nordens“ ausgezeichnet. Dort wohnte nicht nur meine Großmutter mütterlicherseits (in Kapitel 3 mit auf der Gustloff), sondern auch einer der Fabrikanten-Brüder meines Vaters.
In dem Badeort, in dem Kaiser und Könige zur Kur weilten, gab es nicht nur ein gigantisches Casino, sondern auch die breiteste Seebrücke, die ich jemals in meinem Leben sehen sollte, auf der unsere Familie häufig spazieren ging. Bei einem kürzlichen Besuch, durch unseren Sohn vermittelt, konnten wir feststellen, dass die heutigen Eigentümer durchaus verstehen, mit solch einem Kleinod umzugehen.
Die tiefste Erinnerung meiner ersten fünf Lebensjahre war der Schock von Stalingrad. Tagelang träumte ich davon, wie deutsche Soldaten hinter einem Stacheldrahtzaun hin und her rannten. Den Schrecken des russischen Winters blendete das kindliche Gehirn dabei aus, das wäre zu viel auf einmal gewesen.
Als die Bombardements sich häuften, verfielen meine Eltern auf die Idee, meine Mutter und uns Kinder nach Wien umzusiedeln, in eine eigens angemietete Wohnung, ziemlich teuer ausgestattet (nach dem Krieg holte ein Onkel per Gerichtsbeschluss Gemälde von einem Pfarrer (!) und einem Anwalt in der Nachbarschaft zurück).
Leider war der Umzug nach Wien ein „Schuss in den Ofen“, denn was die Bombardements betraf, kamen wir dort vom Regen in die Traufe. Wir brachten viele Stunden im Luftschutzkeller unter dem Hause zu, mit Sitzbänken ausgestattet. Der Ton der Warnsirenen und das Brummen der Bomber-Schwadronen klingt mir bis heute in den Ohren. Einen Einschlag in der Nähe gab es allerdings nicht.
Wien ist mir vor allem auch deshalb in Erinnerung, weil ich dort eingeschult wurde.
Beim ersten Schultag wollte ich meine etwas überfürsorgliche Mutter partout nicht gehen lassen, sodass der Rektor als Ablenkungstrick einen Fußball aus seinem Schrank holen musste. Und als ich einmal mit der Großmutter spazieren ging, bemerkte ein älterer Herr:
„Den müssen Sie studieren lassen!“ Was den guten Mann wohl darauf gebracht haben mag?
Leider zwang die Wiener Volksschule den Linkshänder zum Schreiben mit der rechten Hand, sodass ich zu meinem Leidwesen im Fach „Schönschrift“ auf Jahre hinaus eine vier erhielt. Heute weiß man es bekanntlich besser, waren doch sechs der letzten sieben US-Präsidenten Linkshänder. Allein beim Tennisspielen behielt ich diesen Vorteil, überrumpelte damit regelmäßig meine Gegner.
Was blieb noch von Wien? Ach ja, die Tatsache, dass man dort im Alltag statt mit „Guten Tag“ tatsächlich mit „Heil Hitler“ grüßte. Dann das erste wirklich beeindruckende Spielzeug, ein herrlicher Leiterwagen, ich glaube, heute sagt man Bollerwagen dazu, und natürlich Schloss Schönbrunn, in dessen Park wir infolge seiner Nähe öfters spazieren gingen, vor allem oben bei der sogenannten Gloriette.
Viele Jahre später äußerte meine Mutter, dass sie in keiner anderen Stadt so gern gelebt hätte wie in Wien. Da sie ein sehr musischer Mensch war – sie spielte begeistert Klavier, und mein Elternhaus war nie ohne dieses Instrument – muss es wohl die künstlerische Atmosphäre, plus das österreichische „savoir vivre“ gewesen sein, auch „Wiener Schmäh“ genannt.
1 Im Mittelalter neben Köln die größte Stadt Deutschlands
3. Untergang der „Wilhelm Gustloff“ 30.01.1945 – Wunder Nr. 1
Nachdem meine Mutter auf eigene Faust überraschend mit uns vier Kindern aus Wien zurückgekehrt war, überlegten meine Eltern im Herbst 1944 fieberhaft, wie angesichts der näher rückenden Roten Armee unsere Evakuierung nach Westen am besten zu bewerkstelligen sei.
Ein Treck mit Pferden im Winter kam angesichts von vier kleinen Kindern nicht wirklich infrage, zumal Gotenhafen (heute Gdynia) damals einer der größten Häfen Deutschlands war. Dort ankerte unter anderem die riesige „Wilhelm Gustloff“, das ehemalige Paradeschiff von Hitlers „Kraft durch Freude“-Flotte. Das Schiff hatte eine Länge von 208 Metern, und ein Volumen von 25.481 Tonnen.
Aus dem was später geschah, muss geschlossen werden, dass es meinem Fabrikanten-Vater durch Beziehungen und wohl auch mit Geld gelungen war, zwei Kabinen auf einem der obersten Decks zu ergattern.
Das unbeschreibliche Gedränge der Verzweifelten wird in dem Film mit Sonja Ziemann von 1949: „Nacht fiel über Gotenhafen“ oder dem späteren ZDF-Zweiteiler in Starbesetzung viel anschaulicher beschrieben als ich es je könnte.
Wir waren zu acht – neben unseren Eltern und uns vier Kindern (8, 7, 2 ½ und 1/2 Jahr alt) – auch noch die Großmutter mütterlicherseits sowie eine Tante, frisch verheiratet mit meinem Lieblingsonkel, damals bei der Wehrmacht.
Die Erwachsenen hatten Wertsachen in ihre Mäntel eingenäht, und wir Kinder bekamen Namensschilder mit Geburtsdatum und Zieladresse um den Hals. Nie mehr hat meine Mutter die Pein verlassen, dass sie ausgerechnet der verlorengegangenen Zweitjüngsten (Isolde) im Schlaf das Schildchen abnahm, weil es ihren Hals drückte.
Wir waren völlig übermüdet und ohne uns auszuziehen eingeschlafen, als es um 21:16 Uhr zum ersten Mal „rumste“ – ein russischer Torpedo hatte das Vorderschiff getroffen. Danach schlugen noch zwei Torpedos ein, der nächste ins Schwimmbad, ebenfalls im Vorderschiff gelegen und mit 400 schlafenden Marinehelferinnen überfüllt, die von jetzt auf gleich ertranken, und schließlich Nr. 3 in den Maschinenraum in der Schiffsmitte, und besiegelten damit das Schicksal des Schiffes. Das russische U-Boot hatte ganze Arbeit geleistet!
Nach Treffer Nr. 3 fiel die Beleuchtung aus, und das Schiff bekam starke Schlagseite. Im Innern des Schiffes brach unter den 10.000 Passagieren sofort die Hölle los, Panik im Dunkeln und Todesangst trieben die Menschen nach oben zu den Rettungsbooten.
Nur weil unsere Kabinen auf dem „Oberen Promenadendeck“ lagen (dem höchsten von insgesamt sechs Decks), brauchten wir lediglich eine Treppe hoch zum sogenannten „Sonnendeck“ mit den Rettungsbooten zu klettern, sonst wären wir Kinder in der Massenpanik unweigerlich zu Tode getrampelt worden.
In der Erinnerung fällt mir nach 75 Jahren auf, wie leer es auf dem Sonnendeck noch war, als wir dort ankamen, das heißt, mein in der Katastrophe über sich hinauswachsender Vater musste uns unerbittlich zur Eile angetrieben haben.
Nachdem wir oben angekommen waren, schrie die junge Tante plötzlich auf:
„Ich muss zurück, ein Schuh fehlt mir!“
Nicht eine Sekunde versuchte mein Vater, die unter Schock stehende, angeheiratete Verwandte aufzuhalten, die soeben ihr eigenes Todesurteil ausgesprochen hatte, wir haben sie nie wieder gesehen.
Vorwärts zu den Booten, nichts als vorwärts! Mein Vater ging mit der sechs Monate alten Gabi auf dem Arm voran, meine Mutter folgte mit den beiden Mädchen, die Großmutter mit mir. Der Boden des Decks war vereist und stark geneigt, man musste im Dunkeln höllisch aufpassen, nicht ins Meer zu stürzen.
Dies erkannte ein Soldat, der uns plötzlich erreicht hatte, als seine Chance: Er bot an, die zweieinhalbjährige Isolde auf den Arm zu nehmen, vor allem, um sich – mit einem Kleinkind auf dem Arm – selbst zu retten.
In seiner Not stimmte mein Vater zu. Der Soldat griff sich Isolde, nahm sie auf den Arm und eilte voran – so schnell, dass wir ihm nicht folgen konnten. Im Dunkel verloren wir die Beiden aus den Augen, wir sollten Isolde nie wieder sehen. Ein lebenslanger Schmerz für meine Eltern, zumal auch Jahrzehnte von Recherchen über den DRK Suchdienst scheiterten.
Jetzt waren wir nur noch zu sechst, aber dafür bei einem Rettungsboot angekommen und kletterten als Erste unverzüglich hinein. Die Matrosen ließen das Boot, nachdem es voll besetzt war, tatsächlich erfolgreich zu Wasser, trotz der bei minus 18 Grad vereisten Taue. Denn wir sahen andere Boote infolge gebrochener Taue vollbesetzt ins Meer stürzen!
Als Siebenjähriger ist man anscheinend noch zu unbedarft, um „die Hölle auf Erden“, wie die Erwachsenen die Todesschreie der Tausenden von Ertrinkenden und Erfrierenden erleben mussten, bewusst zu registrieren. Ich weiß lediglich, dass unsere beiden Ruderer zügig Abstand zum Todesschiff gewannen und ich mich als einziger der Passagiere umdrehte, um das Schauspiel des Versinkens zu erleben. Wie in einem Horrorfilm ging die Beleuchtung plötzlich noch einmal an, die Sirenen erklangen, und danach gab es nur noch gespenstische Nacht, das Klatschen des Meeres an der Bootswand und das Geräusch der Ruderschläge.
Wir trieben ein paar Stunden auf der nächtlichen Ostsee, bis das Torpedoboot T36 – diese Ziffern haben sich mir bis heute eingeprägt – uns aufnahm. Vermutlich nahm ein Matrose meinem Vater die Baby-Schwester ab, sonst hätte er es wohl kaum die Strickleiter nach oben geschafft.
Noch heute habe ich den Geschmack der Suppe auf der Zunge, die uns nach der Rettung verabreicht wurde, und ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, an ihre Farbe, denn sie war braun.
Mit am gruseligsten war, dass unsere eigenen Landsleute unsere Familie auf dem Rettungsboot im Dunkeln bestahlen, weil die Pelze und Ledertaschen meine Eltern als wohlhabend kennzeichneten. Damit war es nach der Landung auf Rügen schlagartig vorbei, denn als mein Vater dort bei der Dresdner Bank Geld abheben wollte, wurde ihm eiskalt beschieden:
„Die Dresdner Bank in Danzig hat aufgehört zu existieren!“
Meine ehemals vermögenden Eltern (Fabrik-Anteil der Gebr. Schuster, Haus in Danzig-Langfuhr, Strandhaus Glettkau, Luxuswohnung in Wien) waren jetzt arm wie die Kirchenmäuse! Auf Rügen musste sich mein Vater sogar verstecken, weil Kämpfer für Hitlers „Volkssturm“ gesucht wurden.
Zeit ihres Lebens konnten meine Eltern nicht über den Untergang der Gustloff sprechen, der Schock der Jahrhundertkatastrophe, wozu auch der Verlust meiner Schwester Isolde gehörte, saß einfach zu tief.
Und mich schmerzt es heute, dass ich meinem Vater nicht wiederholt meinen tiefen Dank für die größte Tat seines Lebens ausgesprochen habe. Ich habe nämlich Jahrzehnte später die Namen der Überlebenden in Heinz Schöns diversen Büchern (damals Zahlmeister-Assistent, später Kurdirektor von Bad Salzuflen) einsehen können. Unter den ca. 900 Überlebenden gab es nur ein halbes Dutzend Familien, der Rest waren Einzelpersonen. Aus diesem Grund bekommt das Kapitel über die Gustloff in meinen Lebenserinnerungen den Zusatz „Wunder Nr. 1“.
4. Nachkriegsjahre im zerstörten Deutschland
Über den Apparatebau der Firma Gebr. Schuster bei Danzig hatte mein Vater Beziehungen zur DEA, der Deutschen Erdöl Aktiengesellschaft. Von Rügen fuhren wir nach Rositz in Thüringen, wo sich eine der großen Raffinerien Deutschlands befand, die aus Braunkohle Treibstoffe und Paraffine herstellte.