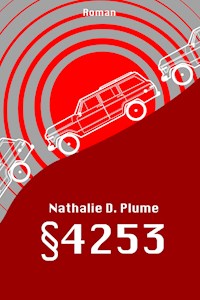5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Mann fällt aus dem Himmel. Stürzt aus dem Nichts aus den Wolken, schlägt in die Äste einer alten Eiche ein und weiß nicht mehr wer er ist. Woher ist er gekommen? Wie heißt er? Was für ein Leben hat er geführt? Auch das kleine, achtjährige, Mädchen, das ihn findet und den verwirrten Mann mit zu sich nach Hause nimmt, kann ihm keine seiner vielen Fragen beantworten. Gemeinsam beginnen die Beiden jedem noch so kleinen Hinweis hinterherzulaufen und in einem Leben zu forschen, das nicht seins seien, will, das ihm seltsam, fremd und mysteriös vorkommt und das immer mehr Unklarheiten aufwirft. Zusätzlich verfolgt den Mann dieses warnende Gefühl sich fernzuhalten, von dem, der er mal war. Die Hinweise führen ihn in ein Leben, das ihm Angst macht, das mit Wirtschaftsdesign, Massenvernichtungswaffen, Krieg, Decknamen und einer Formel zu tun hat, die so mächtig ist, dass sie Krieg und Frieden für immer verändern könnte. Ist er der Chemiker, der so skrupellose Waffen herstellte? Ist es seine Formel? Und wer sind die Menschen, die hinter ihm und der Formel her sind, an die er sich nicht mehr erinnern kann. Will er sich am Ende überhaupt noch erinnern? Eine mysteriöse Reise durch das Leben eines Fremden, die nicht nur Fragen, sondern auch Gefahren verbirgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Nathalie D. Plume
Vor dem Fall
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1.
2. 35 Jahre vor dem Fall
3. Gegenwart
4. 35 Jahre vor dem Fall
5. Gegenwart
6. 35 Jahre vor dem Fall
7. Gegenwart
8. 14 Jahre vor dem Fall
9. Gegenwart
10. 12 Jahre vor dem Fall
11. Gegenwart
12. 7 Jahre vor dem Fall
13. Gegenwart
14. 7 Jahre vor dem Fall
15. Gegenwart
16. 6 Jahre vor dem Fall
17. Gegenwart
18. 3 Jahre vor dem Fall
19. Gegenwart
20. 1 Jahr vor dem Fall
21. Gegenwart
22. 2 Monate vor dem Fall
23. Gegenwart
24. Zwei Wochen vor dem Fall
25.Gegenwart
26. Drei Stunden vor dem Fall
27. Gegenwart
28. 35 Jahre vor dem Fall
29. Gegenwart
30. Gegenwart
31. Gegenwart, die nächsten 7 Tage
Epilog
Impressum neobooks
Prolog
Vor dem Fall
Fallen ist weder gefährlich noch eine Schande.
Liegenbleiben ist beides.
Konrad Adenauer
Fallen, Jeder kennt das Gefühl der Kontrolllosigkeit, die es mit sich bringt. Das Gefühl, als würde da Nichts sein, das einen stoppen könnte, als würde man unendlich lange auf ein unbekanntes Nichts zu rasen, ohne ein Bewusstsein dafür, wo oben und wo unten ist. Fallschirmspringer sprechen von einem kontrollierten Fall, nicht von einem Absturz. Aber kann Fallen jemals kontrolliert sein? Wie soll das Zurasen auf den Boden, in immer schneller werdender Geschwindigkeit, kontrolliert werden? Sind es nicht gerade Fallschirmspringer, die sich aus atemraubender Höhe aus einem Flugzeug stürzen, mit Nichts mehr als ein bisschen Stoff in einem Rucksack und einem Griff, den sie im richtigen Moment ziehen müssen, um nicht für immer Teil des Bodens zu werden? Wo ist die Kontrolle, von der sie sprechen und wo der Unterschied zwischen Sturz und Fall?
1.
Wind ist das Erste, was er spürt. Wind, der an ihm zieht, der ihm die Kleider vom Leib reißen will, der seine Haut in alle Richtungen drückt und sie seltsam verformt. Das Zweite ist die Kälte, die ihm in jede Pore kriecht, die sich vom Wind getragen ihren Weg unter die Haut sucht. Langsam folgen auch seine restlichen Sinne. Er kann das Tosen hören, das der Wind mit sich bringt, kann hören, wie es ihn fast taub werden lässt. Riechen kann er nichts. Sollte es um ihn herum einen Geruch geben, ist er vom Wind davongetragen worden. Langsam öffnet er seine Augen, um auch den letzten seiner Sinne zurückzuholen. Es fällt ihm viel zu leicht, fast so als hätte der Wind keine Auswirkungen auf seine Lider. Blau, Weiß, Grau ist das Einzige, was er sehen kann. Stetig wechseln sich die Farben ab, vermischen sich ineinander, weichen und formen Muster. Muster, die ihn an Wolken erinnern, die fransig aufeinander liegen und nie dieselbe Farbe zu haben scheinen. Vorsichtig versucht er sich zu bewegen, die Kontrolle über seinen seltsam weichen Körper zu bekommen, die Arme an den Brustkorb zu ziehen, die vom Wind nach oben gedrückt werden, versucht sich zu drehen, hinter sich zu sehen, nach etwas zu suchen das ihm Aufschluss über seinen Aufenthaltsort gibt. Kraftlos zieht er die Arme an sich, doch an Stelle der erhofften Kontrolle, verliert er sie nun komplett. Unkontrolliert schlagen seine Arme umher, flattern im Wind, wie Fahnen im Sturm, drehen seinen Körper im Kreis, reißen seine Beine umher, drehen ihn in alle erdenklichen Richtungen. Braun und Grün mischen sich in sein Blickfeld, trennen sich klar vom Blau und Weiß, drehen sich vor seinen Augen im Kreis, wie ein Karussell. Blau, Weiß. Braun, Grün. Blau, Weiß. Braun, Grün. Immer und immer wieder bis er es endlich schafft seine Arme und Beine neben sich zu stemmen, die Kontrolle über seinen Körper zurückgewinnt und endlich begreift was mit ihm passiert.
Er fällt. Sekunden schnell fällt er aus dem Himmel, immer näher auf den Boden zu. Der Wind wird immer lauter, immer bedrohlicher zieht er an ihm und versucht ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Panik überkommt ihn. Nicht die Panik auf dem Boden aufzuprallen, nicht die Panik dem Tod ins Auge zu sehen, sondern die Panik Nichts dagegen tun zu können. Keine Chance zu haben etwas an seinem Schicksal zu ändern. Phobisch tastet er sich ab, sucht nach etwas, das ihm Halt geben kann, das ihm vor dem Sturz ins Nichts bewahren könnte. Seine kalten Hände ertasten eine Schlaufe, sie ist mit einem Rucksack auf seinem Rücken verbunden und leuchtet in freundlichem, aber warnendem gelb. Ein Fallschirm. Viel zu hektisch zieht er mit aller Kraft an der Schlaufe, reißt sie aus dem Rucksack und entlässt den weißen Pilotschirm in den reißenden Wind. Drei Sekunden später folgt ihm der Flächenfallschirm mit seinem leuchtendem Orange. Einen Moment scheint er ihn zu halten, seinen Sturz in einen Flug zu wandeln, doch irgendetwas bringt den Schirm ins Straucheln, zerknüllt ihn wie ein weggeworfenes Papier und bringt ihn nur noch mehr ins Schleudern. Angsterfüllt schreit er in den Wind, verflucht das dünne Nylon und sucht nach dem Reserveschirm. So viele Seile, so viele Schlaufen, die um ihn herumschlagen wie Peitschen. Links an seiner Brust ist es kalt und hart, rechts weich und warm. Er ertastet links einen Metallgriff und rechts ein kleines weiches Kissen, das sich in seine Hand schmiegt. Welche Seite sollte er nun ziehen? Welche würde ihm den Rettungsschirm schenken? Instinktiv folgt er dem weichen warmen Kissen. Ein Ruck durchzieht seinen Fall, lässt ihn schlagartig aufhören zu straucheln. Der orangene Hauptfallschirm gleitet zur Seite und entfernt sich von seinem Besitzer. Wieder ist er im freiem Fall Richtung Boden, der nun immer schneller und deutlicher vor ihm liegt. Er schließt die Augen und zieht an dem Metallgriff, der immer noch in seiner Hand liegt. Wieder durchzieht seinen Fall ein Rucken, diesmal wirft es ihn jedoch nicht weiter nach unten, sondern reißt ihn nach oben. Er öffnet seine Augen, blinzelt nach oben und beobachtet das weiße Nylon, das sich über ihm ausgeworfen hat. Einen Moment ist es ruhig. Der Wind hat sich in ein leichtes Säuseln verwandelt und die Kälte weicht der Hitze, die sich in seinem Körper ausbreitet. Nur einen Moment sortieren sich seine Gedanken, hat er die Möglichkeit einen unbeschwerten Atemzug zu tun, bevor sich der Schirm über ihm krümmt und einer Böe folgend zur Seite schlägt. Die dutzenden Seile über ihm verdrehen sich, wie die Stahlseile einer Schaukel und drehen ihm erneut im Kreis. Durch die Todesangst getrieben, greift er in die Seile, versucht sie gegen ihre Richtung zu drehen, sie zu entwirren und ihnen erneut eine Funktion abzuverlangen.
Der Boden wird deutlicher. Klar zeichnen sich Felder und Wiesen, Bäume und Täler, Häuser und Scheunen vor ihm ab. Näher, immer näher fliegen sie auf ihn zu und vermischen sich im Fall zu einer Todeszone. Ein letztes Mal greift er nach den Seilen, reißt sie mit aller Gewalt voneinander, dreht sich im Kreis, fällt ein kleines Stück, strauchelt und gewinnt erneut die Kontrolle über den Reserveschirm. Langsamer werdend gleitet er über einige Bäume und Felder, tastet den Boden mit seinen Augen nach einem geeigneten Landeplatz ab und fokussiert seinen Blick auf freie Flächen. Einige Sekunden hat er Zeit dafür, bis die Bäume und Felder erneut auf ihn zurasen und er bemerken muss, dass er immer noch viel zu schnell auf sie zu fällt. Hektisch versucht er zu lenken, doch der Schirm hat sein ganz eigenes Ziel im Blick. Ein großer Busch in dessen Mitte eine alte Eiche hervorragt, schnellt auf ihn zu, will ihn mit ihren großen Armen fangen, ihm vor dem Boden bewahren. Erneut schließt er seine Augen, will nicht mit ansehen, was als nächstes passieren wird.
Der Aufprall ist hart. Dicke Äste reißen an ihm, versuchen ihn zu fassen, ihn an seinem Sturz zu hindern, doch wie eine stumpfe Säge bricht er durch den Baum und seine Arme rutschen über Blätter und Rinde, fällt weiter und schlägt mit der Wucht eines 80 kg schweren Sandsackes auf den Boden auf.
Bei einem schweren Sturz sollte man sich nicht bewegen. Man sollte sich ruhig verhalten und warten bis Hilfe eintrifft. Zu viele Dinge können sich verschlechtern, sollte man hektisch werden oder sogar unbedacht sein und aufspringen. Die meisten Menschen verletzen sich nach einem Unfall, nicht wären dessen. Sie sterben, weil sie durch Panik getrieben aus ihren Autos springen und benommen in den Verkehr rennen. Sie lähmen ihren Körper, weil sie ihre angebrochenen Knochen zur Bewegung drängen. Sie versuchen sich selbst zu befreien und stürzen nur noch weiter in die Tiefe. Sie verdrängen alles, was sie gelernt haben, alles, was sie wissen und alles was ihre Vernunft ihnen ins Ohr flüstert und folgen einem Trieb, der über all diese Dinge hinweg schreit: Lauf! Bring dich in Sicherheit, flieh von diesem Ort, renn um dein Leben! Was aber wenn keine Hilfe kommen wird, wenn man sich ruhig verhält, wartet, die Vernunft gewinnen lässt, sich nicht bewegt und trotzdem keiner kommen wird, um einen zu retten. Gedanken, die einem durch den Kopf schießen, wenn man da liegt, sich nicht traut die Beine zu regen, aus Angst man könnte sie nicht mehr spüren, kein Wort über die Lippen bringt, weil der Schmerz einem die Kehle zuschnürt, einem heiß ist, obwohl man unterkühlt und viel zu wenig Luft in den Lugen Platz zu haben scheint. Experten sprechen ab jetzt von der „Golden Hour of Shock“. Innerhalb dieser Stunde sollte der Verunglückte medizinisch versorgt, behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Jede weitere Stunde sinkt die Wahrscheinlichkeit zu überleben.
So liegt er nur da, atmet flach, blinzelt in die zerlöcherte Baumkrone, versucht nicht an seine Beine zu denken, nicht in Panik auszubrechen und die Kälte nicht gewinnen zu lassen, die sich von Minute zu Minute enger um ihn legt. Das Problem ist nur, dass eine Stunde lang werden kann, vor allem wenn man auf ihr Ende wartet oder darauf, dass jemand kommen wird und ihr Ende mit sich bringt. Er hält es nicht lange aus, bewegt langsam und vorsichtig seine Zehen, öffnet und schließt seine Hände, hebt seine Arme, streicht sich über Gesicht und Brustkorb, tastet die Rippen, Hüfte und Beine ab und richtet sich behutsam und schwerfällig in eine sitzende Position. Unsicher dreht er seinen Kopf umher und erfasst mit bangen Augen seine Umgebung. Er sitzt in einem wilden Ligusterbusch, die spitzen Äste bohren ihm in die Haut. Vor ihm liegt ein Feld. Grüner Roggen wiegt leicht im Wind, gibt den Böen nach und tanzt vor seinen Augen. Über ihm hängt der weiße Rettungschirm, zerfetzt von den Ästen der Eiche. Vom Hauptschirm ist nicht zu sehen, er könnte vom Wind kilometerweit getragen worden sein. Langsam dreht sich sein Kopf nach rechts, weg von dem Schirm und weg von dem Roggen auf die andere Seite. Ein Zucken durchdringt ihn, lässt seinen Körper schlagartig in Angriffsposition gehen, zwingt seine schmerzenden Glieder sich zu erheben und aufzuspringen, ohne an die Folgen zu denken.
Ein Mädchen steht vor ihm, sie starrt ihm genau in die Augen, sieht aus als hätte sie genau hier auf ihn gewartet, als hätte sie gewusst, dass ihn diese Eiche in diesem Moment fangen würde. Ihre hellen braunen Haare reichen normalerweise bestimmt bis auf die Schultern, werden nun aber von einem gelben Haarband in einem zerzausten Zopf gefangen. Sie trägt eine grüne Wachsjacke und einen dunklen roten Pullover darunter, der sich ganz fürchterlich mit den fliederfarbenen Gummistiefeln beißt. Auf dem Kopf trägt sie einen gelben Regenhut, der nass und schwer herunterhängt und in ihren Händen hält sie einen seltsam aussehenden Gegenstand, der anscheinend aus Pappmaché selbst hergestellt wurde und nun auf ihn gerichtet ist wie eine Kamera. „Guten Tag.“ Der Mann starrt das Mädchen ungläubig an, bevor er das Gleichgewicht verliert und erneut in den Liguster fällt. Das Mädchen klettert ihm in den Busch nach und schiebt sich in sein Blickfeld. „Alles ok?“ Der Mann schluckt, stammelt wirres Zeug und schüttelt dann unsicher den Kopf. „Nein, ich… ich… ich weiß nicht… ich glaube nicht.“ Das Mädchen zieht die Augenbrauen nach oben. „Wie, du weißt nicht? So etwas muss man doch wissen.“ Wieder richtet sich der Mann auf, diesmal bleibt er aber sitzen, um einem weiteren Sturz zu entgehen. „Wo bin ich?“ Das Mädchen zieht neugierig an den Seilen des Rettungsschirms. „Auf der Erde.“ Der Mann verzieht das Gesicht, als verstehe er nicht was sie meint. „Man kann also auch auf einem anderen Planeten sein?“ Die Kleine lacht. „Hä? Nein, ich meine du bist hier auf dem Boden.“ Sie bückt sich, zieht ein wenig Erde zwischen den Ästen hervor und zermahlt es vor den Augen des Mannes. „Hier Erde. Du bist ganz schön lange gefallen, bis du hier unten warst. Sah verdammt unkontrolliert aus. Wie heißt du eigentlich?“ Immer noch in den Seilen des Rettungschirm verheddert reibt sich der Mann nachdenklich übers Gesicht, immer heftiger, immer intensiver, bis er wieder zu stammeln anfängt. „Ich heiße… ich… mein Name ist…ich… ich… ich weiß es nicht. Oh Gott, ich weiß nichts mehr.“ Das Mädchen lässt die Seile los und gafft ungläubig auf den Mann herunter. „Du weißt nicht, wie du heißt? Hast du dir den Kopf gestoßen? Siehst du helle Lichter? Ist dir übel? Weißt du, wann du geboren bist?“ Immer noch reibt sich der Mann übers Gesicht. „Nein, nein Nichts von all dem. Ich habe mir nicht den Kopf gestoßen, ich weiß nicht, wann ich geboren bin oder wieso ich hier bin, ich weiß nicht einmal wer ich bin.“ Das Mädchen nickt fachmännisch. „Du hast vermutlich eine Bellastungsreaktion oder einen Schock, wie man umgangssprachlich sagt, dein Körper versucht deine Organe zu versorgen und blendet dein Trauma aus, um dich zu beruhigen. Du hast dir aber ganz sicher bei dem Sturz nur den Kopf gestoßen.“ Das Mädchen fasst ihm ungefragt ins Gesicht, lässt etwas unter seinem Kinn klicken und deutet auf seinen Kopf. „Gut, dass du den Helm anhattest, sonst wäre dein Kopf jetzt vermutlich Pudding.“ Ein Kopfschütteln. „Ich habe mir nicht den Kopf gestoßen, ich wusste schon da oben nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich bin plötzlich zu mir gekommen und fand mich in dieser Situation.“ Der Mann springt erneut auf und packt das Mädchen an den Schultern, seine Seite schmerzt dabei so heftig, dass er kaum das Gleichgewicht behalten kann. Seine Worte sind aufgeregt, als wäre ihm etwas eingefallen. „Das Flugzeug! Hast du das Flugzeug gesehen, aus dem ich gesprungen bin?“ Ein heftiger Tritt gegen sein Schienbein bringt ihn schnell zurück auf den Boden und der seltsame Gegenstand, den das Mädchen noch immer in den Händen hält, wird ihm auf die Brust gedrückt. „Fass mich noch einmal so an und du verlierst auch das andere Bein!“ Der Mann schluckt. „Das andere Bein?“ Ängstlich tastet er an die Stelle, an der normalerweise sein rechtes Bein sein sollte, aber schon kurz nach dem Knie ist da nichts mehr, dass es zu ertasten gibt. Er wird bleich, atmet schwerer und schnappt nach Luft. „Mein Bein! Ich habe mein Bein verloren, es muss beim Sturz abgerissen wurden sein.“ Ein Prusten und das Mädchen klopft ihm mit dem Pappmaschee auf den Helm. „Ok, vielleicht ist dein Kopf doch zu Pudding geworden. Erstmal ist da kein Blut, bedeutet das dein Bein nicht abgerissen wurde und was dein Flugzeug angeht, ich habe keins gesehen, da war kein Flugzeug, du bist einfach durch die Wolken gebrochen und warst da. Das hier ist eine No-Flight-Zone, undenkbar das hier ein Flugzeug geflogen ist. Hast du mal geschaut was du bei dir hast, vielleicht trägst du ja einen Ausweis mit dir oder etwas anders, das Aufschluss darüber gibt wer du bist Avem.“ Sie gibt die Brust des Mannes wieder frei und hängt den Pappmaché-Gegenstand in eine Schlaufe auf ihrem Rücken. „Einen Ausweis. Ja eine gute Idee, aber lass mich erstmal aus diesem Busch raus.“ Das Mädchen hilft dem Mann nach oben und Beide klettern aus dem Geäst. „Wie heißt du eigentlich und was machst du allein hier draußen im Nichts?“ Die Kleine schiebt die Brust nach vorne und macht sich so groß wie sie kann. „Ich heiße Nova, das hier ist nicht Nichts, sondern Pommerby und ich bin nicht allein, du bist doch da.“ Der Mann strauchelt ein wenig und versucht sich aus dem Geschirr zu befreien das ihn immer noch an den Rettungschirm fesselt. „Pommerby, das klingt Englisch, bin ich in England?“ Eine Weile beobachtet Nova wie der Mann an dem Geschirr herumfingert, anscheinend ahnungslos, wie man sich daraus befreit, bevor sie mit flinken Händen an die Gurte greift, ein paar der Karabiner schnalzen lässt und die Schlaufen öffnet. Verdattert blickt der Mann an sich herunter und nickt ihr dann danken zu. „Nein nicht in England, wie kommst du denn darauf? Wir sind in Deutschland.“ Ein Nicken. „Ah in Deutschland klar. Wieso bist du eigentlich so nass, es regnet doch gar nicht?“ Nova legt den Kopf schief. „Weil es bis vor zehn Minuten noch ziemlich heftig geregnet hat. Im Übrigen fängt es auch in circa vier Minuten wieder an. Du siehst nicht gerade wetterfest aus, wir können zu mir nach Hause gehen, bis dir wieder einfällt wo deins ist.“ Der Mann nickt ein drittes Mal, wenn auch unsicher. „Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist Nova, deine Eltern finden es bestimmt nicht so gut, wenn ich einfach so bei euch reinplatze. Außerdem weißt du doch gar nicht wer ich bin, ich könnte gefährlich sein. Besser ich rufe die Polizei, ich kann nicht mit dir mitkommen.“ Nova zuckt mit den Schultern, zieht sich den Regenhut tiefer ins Gesicht und dreht sich um. „Gut dann nicht. Ich glaube zwar nicht, dass ein Mann, der anscheinend nicht mal mehr weiß wie man ein Geschirr öffnet, gefährlich ist, aber das ist deine Endscheidung. War schön dich kennen zu lernen Avem.“ Ein Tropfen fällt dem Mann auf die Schulter, verloren steht er neben der Eiche, das Nylon des Rettungschirm knistert im stärker werdenden Wind, der Roggen biegt sich immer mehr und das kleine Mädchen ist schnell nur noch ein Punkt in der Ferne. Drei Minuten später beginnt es wieder zu regnen.
Dem Mädchen nachzulaufen soll schwerer sein, als der Fall aus dem Himmel. Ihre kurzen Beine gleiten mühelos über den morastigen Boden und trotz des abgebrochenen Astes, als improvisierte Krücke, fällt der Mann immer wieder auf den Boden zurück, fast so als würde er ihn immer noch magnetisch anziehen. Nova dreht sich nicht zu ihm um, immer schneller fliegen ihre Füße und obwohl der Regen in kleinen Bächen von ihr heruntertropft, scheint sie sich durch die nassen Gaben mehr geschmeichelt zu fühlen, als belästigt. Immer wieder peitscht der Wind an den Beiden und drückt sie stetig weiter auseinander. Die Sicht ist gut, gerade so gut, um immer wieder den gelben Regenhut aufleuchten zu lassen, wenn das flinke Mädchen hinter einem Hügel oder einer Böschung verschwindet. Der Weg scheint ewig zu sein, Kilometer lang hätte man den Mann nach der Entfernung gefragt. „Hey warte Mal. Hey Kleine! Nova halt doch mal an!“ Das Mädchen läuft weiter, brüllt aber vor sich in den Wind und lässt den Schall, durch ihn nach hinten tragen. „In zwei Minuten hört der Regen auf, dann warte ich!“ Ungläubig rollt der Mann die Augen, zieht den stützenden Ast aus dem Schlamm und schleppt sich weiter. Eine Minute vergeht, immer größer wird der Abstand, bis er das Mädchen dann doch aus den Augen verliert. Erschöpft lässt er sich in einen nassen Blätterhaufen fallen und massiert die erschöpften Muskeln. Verloren blickt er in den Himmel und lässt die Tropfen auf sein Gesicht schlagen. Eine Minute später reißt der Himmel auf und der Regen wird durch eine schwache Sonne vertrieben. –Seltsames Wetter– denkt er und schüttelt den Kopf. Ein paar Tropfen fliegen aus seinen Haaren und flüchten sich in die aufgequollene Erde. „Wo bleibst du denn Avem?“ Das Mädchen stapft einen Abhang herauf, der dem Mann jetzt erst auffällt. „Wo bleibe…? Hey, ich gebe hier mein Bestes dir hinterherzulaufen! Avem? Was bedeutet das?“ Nova legt den Kopf schief, puhlt das Pappmasché unter ihrem Wachsmantel hervor und hängt es zurück an die Schlaufe auf ihrem Rücken. „Wenn du mir folgst, dann tust du es zu langsam. Wir sind aber auch bald da.“ Das Mädchen wendet sich ab und deutet auf etwas im Horizont, das der Mann im Sitzen nicht sehen kann. Unter Schmerzen richtet er sich auf und sieht den kleinen Abhang herunter.
In der Ferne, eingebettet zwischen dutzenden bunten Feldern, liegen eine Hand voll Häuser und dahinter, groß und grau, wie ein blinder Spiegel, das Meer. Ehrfürchtig hält der Mann die Luft an und starrt auf die Weiten des Wassers. „Das ist unser Ziel?“ Nova nickt, auch sie betrachtet das Grau. „Jap. Das ist Nieby, da wollen wir hin.“ Verwundert über den seltsamen Namen wendet der Mann den Blick von Horizont ab und betrachtet das Mädchen prüfend von der Seite. „Ok. Pommerby? Nieby? Nova? Avem? Du flunkerst mich doch an?“ Nova wirkt empört. Der Mann folgt dem Drang wieder aufs Meer zu blicken. „Ach, so meine ich das nicht, aber das klingt eben alles sehr fantastisch. Avem zum Beispiel du nennst mich so, seit ich auf dem Boden aufgeprallt bin, was bedeutet das? Wie schwer kann es schon sein mir das zu beantworten?“ Nova schiebt den Mund feist zur Seite. „Wie schwer kann es sein seinen eigenen Namen zu nennen?“ Mit diesen Worten springt das Mädchen geübt den Abhang herunter und landet leichtfüßig an seinem Ende auf einem alten Baumstumpf. „Chapeau! Gut gekontert.“ nuschelt der Mann in sich hinein, überrascht sich von einem Kind überlisten zu lassen, dann lässt er sich auf den Boden herunter und rutscht dem Mädchen hinterher.
2. 35 Jahre vor dem Fall
Die Nacht ist kühl, immer wieder rieseln kleine, runde Schneeflocken nach unten, landen auf dem kalten Boden und vermischen sich mit dem Dreck der Straße. Die Frau, die an eine Häuserwand gelehnt den Himmel beobachtet, sieht jung aus. Ihre Kleidung ist dreckig, ihre Finger sind gelblich verfärbt und ihre Haare sind verfilzt aus dem Gesicht gebunden. Immer wieder kratzen ihre zu langen, zu brüchigen Fingernägel über ihre mit Wunden und Einstichen übersäten Arme. Sie jucken, kribbeln, warten auf den nächsten Schuss, den nächsten Zug durch die Nase oder den nächsten Rauch, der in die Lungen dringt. Teilnahmslos sind ihre Augen auf den dunklen Nachthimmel gerichtet, ihr Mund ist leicht geöffnet, so als könnte der Schnee, der hier und da auf ihre Zunge fällt, das Zittern, Jucken, Stechen und Schwitzen verringern. Obwohl sie schwitzt, ist ihr kalt, auch die vielen langen Hosen, Röcke, Jacken, Pullover und Kleider können die Kälte nicht von ihr fernhalten. Sie hustet, ihr Magen krampft sich zusammen und sie spuckt dicken Speichel auf den Boden der kleinen Häusernische, in der sie wartet. Bald muss er kommen, er ist nie pünktlich, so viel steht fest, aber heute lässt er sich mit der Lieferung sehr viel Zeit. Die Straße ist leer, kein Auto rollt über den glatten Boden und die wenigen kleinen Fenster in den Gebäuden um sie herum sind mit Vorhängen verhangen, so als wollten die Bewohner dieser Straße nicht sehen, wer sich unten auf dem kalten Asphalt herumtreibt. Wie beiläufig tastet sich die Frau über den Bauch, befühlt die Ausbuchtung, die sich von Woche zu Woche mehr hervorschiebt. –Zähes kleines Ding– denkt sie, als endlich der silberne Cadillac über die Straße rollt. Kleine Steine knirschen unter den langsamer werdenden Reifen und springen bedrohlich zur Seite, wie kleine Geschosse. Die Frau taumelt aus der Nische auf den Gehweg und beugt sich fröstelnd in das nun heruntergelassene Fenster. „Wie viel brauchst du?“ raunt der erstaunlich junge Mann, dessen Züge eher einem Jungen ähneln, im Inneren der Frau entgegen und versucht nicht allzu genau in das dreckige Gesicht zu sehen. Die Frau versteht den jungen Mann nicht, sie spricht die Sprache nicht, die über seine Lippen dringt, aber sie weiß genau, was er wissen will. Zittrig hält sie acht Finger in die Luft. Der junge Mann zieht die Augenbrauen nach oben, versucht aber weiter seine blauen Augen aus dem Gesicht der Frau zu halten. „Acht Milligramm, mann, mann, mann, du ziehst den Konsum ja schnell nach oben. Ist wohl das Kind, das mehr verlangt. Ja, ja die fangen früh an einem die Haare vom Kopf zu fressen.“ Kopfschüttelnd reicht er ihr ein kleines Päckchen mit einem hellbraunen Pulver und nimmt im Gegenzug die drei grünen Scheine aus ihrer Hand. Die Frau nickt dankend und will sich schon aus dem Staub machen, als der junge Mann sie am Arm packt und sie zurück ins Fenster zieht. „Hey, damit eins klar ist, 300 € ist ein Freundschaftspreis, den ich jeder Zeit nach oben ziehen kann, also wehe du verkaufst das Smack weiter. Klar? Mir sind deine Probleme egal, hättest dir eben keinen Braten in die Röhre schieben lassen dürfen.“ Dir Frau wimmert ein wenig und nickt, unwissend was der Mann im Cadillac ihr entgegen ranzt. Der Mann fixiert die junge Frau noch einmal scharf, stößt sie dann zurück und lässt den Wagen mit quietschenden Reifen aus der Straße heraus beschleunigen.
Nachdem sie sich vom Boden erhoben hat, auf den der Dealer sie schupste, läuft sie zurück in die Baracke, die man ihr Zuhause nennen kann. Die mit Planen und Mülltüten überzogenen Europaletten stehen weiter hinten in der Häusernische und schützen das wacklige Gestell so vor den Blicken der Passanten oder dem eisigen Wind, der in dieser Nacht aufkommt. Müde kriecht sie unter einer blauen Plane hindurch und schiebt von innen eine schimmlige Sperrholzplatte vor den Eingang. Sie greift nach einer braunen Decke, die sie sich um die Hüften wickelt und danach unter ein Stück Schaumstoff, das sie als Matratze nutzt. Zum Vorschein kommt ein altes Stofftaschentuch, dessen Inhalt aus einem Feuerzeug, einem Löffel, einer Spritze, kleinen Stoffresten und einem kleinen Fläschchen mit dem nötigen Lösungsmittel bestehen. Zittrig schüttelt sie einen Teil des Pulvers auf den Löffel, mischt es mit dem Lösungsmittel und hält mit schwitzenden Fingern das Feuerzeug unter den Stahl. Kleine Bläschen bilden sich auf der braunen, karamellähnlichen Oberfläche und tanzen wie Blubberblasen in einer Badewanne auf dem Löffel umher. Zufrieden mit dem Ergebnis wirft sie ein kleines Stoffstückchen in die Lösung und lässt sie, während sie die Spritze säubert, abkühlen. Anschließend zieht sie das Heroin durch das Stoffstück in die Spritze und setzt sich endlich den Schuss, auf den ihr Körper so sehnlichst gewartet hat. Erleichtert lehnt sie sich zurück und genießt das Gefühl, wie die Droge ihr die Sorgen nimmt. Die Sorge um ein Land, das nicht ihres ist, um eine Zukunft, die sie nicht erreichen wird, um Geld, das sie nicht hat und um einen kleinen Säugling, der in eine Welt geplatzt ist, in der es keinen Platz für ihn gibt.
3. Gegenwart
Nieby als Dorf zu bezeichnen wäre großzügig, die wenigen Häuser, die sich um die Straße herumschlängeln, wirken eher als würden sie alle zu einer Familie gehören. Sehr zum Leitwesen des Mannes, der nun immer langsamer hinter dem Mädchen herhinkt, scheint Nova nicht zu dieser Familie zu gehören, denn ihre Füße laufen immer schneller an den Häusern vorbei, bis die beiden wieder von riesigen Feldern und kleinen Dünen umgeben sind. „Meintest du nicht du wohnst in Nieby? Wenn das da Nieby war, sind wir dran vorbeigelaufen.“ Der Mann deutet auf die Häuseransammlung hinter sich und versucht die schwere Atmung zu beruhigen. Nova nickt. „Ja, ich wohne ja auch in Nieby, die ganze Landzunge hier ist Nieby. Die paar Häuser sind nur das Dorf. Komm! Mein Haus liegt hinter dem Feld da.“ Nova läuft weiter. Genervt und erschöpft schleppt sich der Mann durch ein Weizenfeld, das zu seinem Erstaunen bereits braun und bereit zum Ernten ist. Nova rennt das letzte Stück über das Feld und bleibt dann an seinem Ende stehen, um, zum ersten Mal freiwillig, auf den Mann zu warten. Schnaufend erreicht er sie und sieht die Böschung herunter. Erstaunt wird sein Blick von dem Haus angezogen, das geschützt hinter einer Düne, eingebettet zwischen Raps und Rogen, liegt. Dutzende Geräte sind auf dem Dach befestigt. Manche von ihnen folgen dem Wind, andere scheinen auf die Sonne gerichtet zu sein und wieder andere drehen sich ununterbrochen im Kreis und geben ein leises Quietschen von sich. Das Haus selbst ist mit graublauen Holzlatten getäfelt, die nur hier und da durch ein großes mit weißem Holz umarmtes Fenster unterbrochen werden. Um das Haus herum liegt ein weitläufiger Garten, der ebenfalls seltsame, surrende Instrumente, einen Gemüsegarten, eine Schaukel und ein Gewächshaus beherbergt. „Hier wohnst du?“ stellt der Mann, ungläubig, nach dem langen Weg angekommen zu sein, die überflüssige Frage. Das Mädchen nickt. „Jap! Komm mit, wir gehen schnell rein, bevor es wieder zu regnen anfängt.“ Der Mann folgt dem Mädchen über das weiche Gras und beobachtet, wie sie einen Schlüssel aus ihrem Regenhut hervorholt. Sie sperrt die rot lackierte Holztür auf, streift sich die Gummistiefel ab und verschwindet im Inneren. Unsicher, ob er ihr nachlaufen soll, bleibt der Mann neben dem kleinen Windspiel stehen, das an einem Holzwinkel an der Hauswand befestigt ist und die reinsten Töne in seine Ohren spielt, die er je gehört hat. „Kommst du auch rein?“ brüllt Nova ihm aus dem Inneren zu. Nervös streift auch er den Schuh ab und schlüpft durch die mit Fenstern versetzte Eingangstür.
Im Haus ist es warm, helle Holzdielen verzieren den Boden und die Möbel, die im Flur an den Wänden stehen, sehen alt und gemütlich aus. Vorsichtig stemmt sich der Mann durch den Flur und bleibt an einem großen Spiegel hängen, der neben dem Kleiderschrank an der Wand befestigt ist. Ein Mann mit asiatischen Zügen sieht ihm entgegen. Sein Gesicht ist von der alten Eiche zerkratzt und über seinem linken Auge klafft eine unangenehm aussehende Platzwunde. Seine Haare sind dunkel und kurz, sein Gesicht ist glattrasiert und zeigt nur ein paar Stoppeln unterm Kinn, die auf einen geringen Bartwuchs schließen lassen. Neugierig sieht er an sich herunter. Er trägt einen mit Schlamm und Blut verdreckten dunkelgrauen Overall, der an seinem rechten Bein leer herunterhängt. Der Mann im Spiegelbild kommt ihm seltsam unbekannt vor. Obwohl er sich selbst in die dunkelbraunen Augen sieht, scheint er den Mann im Spiegel nicht zu kennen. Neben ihm erscheint Nova, sie hat sich der Wachsjacke und dem Regenhut entledigt und hängt gekonnt flink den Pappmaché-Gegenstand an einen anscheinend dafür extra angebrachten Harken neben dem Spiegel. „Was ist das eigentlich?“ versucht der sich selbst fremde Mann die Stille zu brechen. „Du bist ziemlich neugierig Avem.“ Der Mann nickt unsicher. „Ja anscheinend. Ehrlich gesagt weiß ich ja sonst nichts über mich, das ich dir sagen könnte, also Stelle ich doch lieber Fragen.“ Ein versuchtes Grinsen auf dem Gesicht bringt Nova zum Lachen. „Du weißt wirklich Garnichts über dich? Nicht einmal was deine Lieblings-Lollisorte ist? Das ist nämlich erstaunlich wichtig.“ Ein resigniertes Kopfschütteln. „Na gut, wie wäre es, wenn du duschen gehst und ich ein paar Lollis heraussuche, damit du immerhin etwas über dich weißt.“ Der Mann lächelt, versucht ein zuversichtliches „Hey Nova, ich will deine Gastfreundlichkeit wirklich nicht verprellen, aber vielleicht solltest du deine Eltern anrufen und ihnen sagen was passiert ist.“ Nova kneift die Augen zusammen. „Ich weiß nicht, was das an deiner Situation ändern würde?“ Ein Nicken. „Es wäre einfach besser, wenn sie wüssten, dass ich hier bin.“ Nova zuckt mit den Schultern. „Meine Mutter wohnt nicht hier, sie ist mit irgendeinem Platzhalter, wie Papa immer sagt, auf Fidschi und erforscht Korallen und mein Vater ist unterwegs, keine Ahnung wann er wieder kommt, vielleicht heute Abend oder Morgen oder nächste Woche.“ Die Augen des Mannes werden größer. „Du bist hier draußen also ganz alleine?“ Das Mädchen runzelt die Stirn. „Das hast du mich schon einmal gefragt, ich werde mich also wiederholen und dir sagen, dass du ja hier bist.“ Dem Mann gehen die Worte aus, verwirrt nickt er erneut. „Gehe erstmal duschen. Das Bad ist, wenn du die Treppe hier nimmst, rechts und die Tür gegenüber ist der Kleiderschrank meines Vaters. Nimm dir einfach irgendwas. Ich suche die Lollis und dann überlegen wir, was wir als Nächstes machen.“ Wieder ein Nicken. Zu erschöpft dem Mädchen zu widersprechen kraxelt er die steile Treppe nach oben, die unter seinem Fuß knarzt.
Das Bad ist klein, aber nicht weniger gemütlich, als der Flur, trübes Licht fällt durch ein großes Schrägfenster hinein an dessen Griff eine kleine Glocke hängt. Vorsichtig streift sich der Mann den nassen Overall vom Körper und kippt bei dem Versuch das Bein aus der Hose zu ziehen, beinahe in die Badewanne hinter ihm. Erschrocken über das schlechte Gleichgewicht setzt sich der Mann auf den Wannenrand und überprüft die Taschen des Overalls auf Gegenstände. Die erste Tasche beinhaltet zu seiner Enttäuschung nur eine kleine, leere Plastiktüte. Die zweite Tasche enthüllt einen klaren Bergkristall, der schwer und kühl in seiner Hand liegt und einen Schlüssel, der nichts Besonderes an sich hat, er könnte ein Schlüssel für allesmögliche sein. Die anderen Taschen sind ebenfalls alle leer. Wie einen geborgenen Schatz legt er die Gegenstände auf ein winziges hölzernes Brett über der Toilette. Als er sich zu dem Brett herüber beugt, schlägt etwas gegen das Waschbecken, das ein klackendes Geräusch von sich gibt. Verwundert sieht er an sich herunter und entdeckt einen kleinen Kunststoffgegenstand, der am Ende einer silbernen Kette befestigt ist. Prüfend zieht er das Ding vor seine Augen und betrachtet es. Ein kleines halbdurchsichtiges rundes Plättchen mit drei graden Erhebungen auf der einen und einem kleinen, über die gesamte Fläche gehendem Kreuz auf der anderen Seite. Vorsichtig streift er sich die Kette vom Kopf und legt sie zu den anderen Fundtücken auf das Brett.
Komplett unbekleidet steigt er in die neben der Badewanne liegende Dusche, die so klein ist, dass er kaum hineinpasst. Durch die enge Umgebung fällt ihm das Stehen jedoch sehr viel leichter und so kann er, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, den Duschkopf aus der Halterung nehmen. Das Wasser ist heiß und brennt in den Wunden, reinigt sie aber auch, was kopfmäßig ein gutes Gefühl hinterlässt. Beim Einschäumen versucht er nicht allzu genau auf den nackten Körper zu sehen, der nicht seiner sein will und so hätte er das kleine Tattoo auf seiner Hüfte, unterhalb der heftigen Prellungen und den Hämatomen über den Rippen, beinahe übersehen. Es zeigt einen Kreis, in dessen Mitte ein Punkt liegt. Aus dem Kreis ragt ein Pfeil, der gerade nach oben gerichtet ist. Seltsames Symbol, an einer seltsamen Stelle. Jetzt tastet er doch den ganzen Körper mit seinen Augen ab, er will sichergehen, dass er nichts übersieht, nichts verpasst, das ihm Aufschluss darüber geben könnte, wer er ist, wer er war, bevor er ein Namenloser wurde. Da ist aber nicht mehr, keine weiteren, mit Nadeln unter die Haut gejagten Abbildungen, keine Narben, keine Hinweise, Nichts. Enttäuscht über die wenigen Erkenntnisse steigt er aus der Dusche und trocknet sich mit einem der Handtücher ab, die hinter der Tür an Harken hängen. Das Handtuch ist weich und riecht nach zu teurem Waschmittel. Flink reibt er es sich über Haare und Körper und schlüpft, das Handtuch um die Hüfte, aus der Tür zurück in den Flur des Obergeschosses. Da der Flur nicht viel größer als das Bad selbst ist, steht er nun, ohne sich weiter bewegen zu müssen, unmittelbar vor der Tür, hinter der sich, laut Novas Angaben, die Kleider ihres Vaters befinden sollen. Zögerlich, in die Privatsphäre eines Fremden einzudringen, öffnet er die knarzende Tür und betrachtet die wenigen, zusammengefalteten Kleidungsstücke vor ihm. In der Hoffnung mit den unten liegenden Stücken die unbeliebteren Teile zu greifen, zieht er an einem schwarzen Pullover und einer hellen blauen Jeans ohne Label und schließt die Tür leise wieder. „Socken sind in der Schublade neben der Tür!“ schreit Nova die Stufen hinauf, als hätte sie gewusst, was ihm noch fehlt. Flink greift er zu einem gelben Paar Socken und verschwindet erneut im Bad um sich, ungeübt wankend, die trockene, saubere Kleidung anzuziehen. Sanft, um nichts kaputt zu machen, lässt er den seltsamen klaren Kristall und den Schlüssel in der Hosentasche verschwinden und die Kette über seinen Kopf gleiten. Bevor er wieder nach unten geht, lässt er sie unter dem Pullover verschwinden. Das eigenartige Stück Kunststoff kratzt dabei leicht auf seiner Haut, was ihm Gänsehaut über den Körper jagt.
Nova sitzt mit einer Hand voll Lollis vor einem bodentiefen Fenster im erstaunlich großen Wohnzimmer. Sie hat ihre Haare geöffnet und ihre Füße unter eine alt aussehende Heizung geschoben, die hier und da leise gluckert. Zögerlich betritt der Mann das Wohnzimmer und versucht dabei nicht die viel zu weite Hose zu verlieren. Nova dreht ihren Kopf in seine Richtung und kichert. „Oh Avem, du siehst etwas verloren in den Sachen aus.“ Sie springt auf, rennt an dem Mann vorbei in den Flur und kommt mit einem dicken Ledergürtel mit dunkler Patina wieder. „Hier probiere den mal.“ Der Mann nimmt dem Mädchen den Gürtel aus der Hand, wickelt ihn sich um die Hüften und lächelt dankend. „Das hier solltest du so hochstecken.“ Nova beugt sich herunter und faltet die an seinem Stumpf viel zu lange Hose so weit nach oben, dass sie nicht leer herunterbaumelt. „Danke dir.“ Nova lacht ihr freundliches Lachen und legt den Kopf schief. „Wollen wir die Polizei rufen? Vielleicht vermisst dich ja jemand?“ Der Mann zuckt ehrlich ahnungslos mit den Schultern. „Und was sagen wir denen? Einbeiniger Mann ist aus dem Himmel gefallen und weiß nicht, wo er herkam oder wer er ist? Die halten uns doch für verrückt.“ Nova nickt ernst. „Nein, das können wir wirklich nicht machen. Ich weiß auch nicht. Willst du einen Lolli?“ Der Mann wirkt verloren. „Ja, ich nehme einen Lolli.“ Das Mädchen wirkt zufrieden und reicht dem Mann einen in gelbes Papier eingewickeltes Exemplar. „Das ist Zitrone.“ Der Mann streift das Papier ab und schiebt sich den Zucker in den Mund. „Und?“ fragt Nova erwartungsfroh. „Ist sehr lecker. Ich hoffe nur ich bin kein Diabetiker.“ Nova winkt ab. „Ach nein, dann wäre es dir vor dem Lolli schon sehr viel schlechter gegangen. Hast du eigentlich irgendetwas gefunden, das du bei dir hattest?“ Einen Moment zögert der Mann seinen Fund preiszugeben, er kann sich nicht erklären warum, aber irgendetwas hält ihn zurück. Er versucht das Thema zu wechseln. „Wie alt bist du eigentlich?“ Novas Augen verengen sich. „9.“ Der Mann rückt näher an sie heran. „Wirklich?“ Nova rollt die Augen. „Na gut, fast neun. In einem Monat und drei Tagen.“ Der Mann nimmt einen zweiten Lolli vom Tisch. „Ist das dein Vater?“ Er deutet auf die Fotographie eines Mannes, die auf einer kleinen Anrichte neben einem Schleich Affen steht. „Mhhhm. Das ist Papa, da ist er in Uruguay und sammelt Proben.“ Der Mann steht auf und betrachtet das Foto genauer. „Was für Proben?“ Nova nimm einen roten Lolli und lässt ihn in ihrem Mund verschwinden. „Regenwasser glaube ich, er ist Meteorologe. Soll ich dir ein Geheimnis verraten?“ Nova klettert von dem Stuhl herunter, der neben dem Esszimmertisch steht und läuft zu dem Mann herüber. Sie formt ihre Handflächen zu Schaufeln und hält sie sich an den Mund. Der Mann beugt sich vorsichtig herunter, um die geheime Nachricht zu empfangen. „Er kann das Wetter kontrollieren. Das darfst du aber nicht weitersagen.“ flüstert sie. Der Mann nickt gespielt beindruckt, glaubt dem Mädchen aber kein Wort.
4. 35 Jahre vor dem Fall
Waren es wirklich schon neun Monate? Konnte schon so viel Zeit vergangen sein? Sie weiß es nicht. Schwach versucht sie die Monate Revue laufen zu lassen, versucht sich daran zu erinnern, wo sie gewesen ist, aber die Schmerzen lassen schon bald keinen klaren Gedanken mehr zu. Ein Krampf folgt dem nächsten, sie krümmt sich, schreit in die Kälte der Nacht. Dicker Schnee hat sich auf ihrem Unterschlupf gebildet und rutscht hier und da durch die Löcher in den Planen ins Innere. Ihr Atem wabert in Schwaden um sie herum, so kalt ist es. Wie lange können diese Schmerzen noch dauern? Bald wird sie den nächsten Schuss brauchen, bald werden sich die Schmerzen mit dem des Entzugs vermischen, werden untergehen in dem Drang sich die Droge in die Venen jagen zu wollen. Muss sie pressen? Ist es denn schon so weit? Was soll sie bloß machen? Immer mehr Panik drückt sich in ihren Verstand, lähmt ihr handeln, lässt sie ihre Instinkte vergessen. Unruhig wälzt sie sich auf dem dünnen Schaumstoff hin und her, immer kraftloser versucht sie sich die Drogen aus dem Kopf zu schlagen, doch schon bald ist es das Einzige an das sie denken kann. „Nein!“ schreit sie in ihrer Sprache in die Nacht. „Nein! Heute nicht! Das hier werde ich schaffen! Du hast es so weit geschafft!“ Ihre Atmung wird schwerer. Sie bringt kaum noch einen Ton hervor. Nur ein leises, aber tapferes Wispern, dringt über die blauen Lippen. „Ich habe nichts für dich getan, aber alles, um dich loszuwerden, du lebst trotz meiner Selbstsucht. Nun ist es an mir dein Leben zu beginnen und wenn ich meins dafür beenden muss.“ Sie presst. Sie bündelt all ihre Kraft, um ihrem Worten Handlungen folgen zu lassen. Ihr Gesicht ist weiß wie der Schnee und ihre Lippen blau wie der Schaumstoff unter ihr und trotzdem presst sie weiter. Wieder und wieder, immer weniger Luft dringt in ihre Lungen, immer mehr Kraft in ihr Becken und dann, als sie es kaum noch schafft, als ihre Atmung kaum noch mehr als ein leichtes Röcheln ist, hört sie es. Es ist laut und schrill, es schießt durch die Nacht und vertreibt die Kälte aus ihrem Körper, die Angst aus ihren Augen, die Schwäche aus ihren Muskeln und schenkt ihr den Blick einer Mutter. Sie zieht den Säugling an ihre Brust, drückt ihn lachend an sich. Tränen rennen über ihr Gesicht. Ihre zitternden Hände streichen über den winzigen Kopf, ertasten die klebrigen, dunkeln Haare, greifen nach den winzigen Händen. Doch so schnell das Glück durch ihren Körper dringt, um so schneller tropft es wieder aus ihm hinaus. Sie starrt schockiert und angsterfüllt auf die kleinen Beine. Das linke Bein, zieht der Säugling kraftvoll an sich heran, stößt es von sich weg, aber das rechte Bein, ist als solches kaum zu erkennen. Die Wade ist eigenartig verdreht, der Fuß mehr ein Klumpen. Bis zum Knie ziehen sich eigenartige Beulen, fast so als wäre der Knochen unter der Haut rund wie eine Kugel. Ein Schrei entgleitet ihr. Sie legt das Baby auf den kalten Boden, springt auf und rauft sich durch die Haarmatte auf ihrem Kopf. Wie hässlich es doch ist, kaputt und krank wie ihr Leben. Der Säugling schreit, tritt kontrolllos um sich, unwissend der Dinge, die um ihn passieren. So kann es nicht leben, so nicht! Eine Missgeburt in einer fehlerhaften Welt. Schnee rutscht von einer der Planen und rieselt sanft über das Kind, das nackt auf dem kalten Boden liegt. Erneut jagen Krämpfe durch die Frau, Krämpfe, die nach Linderung verlangen. Mit schwitzender Stirn kramt sie das Heroinhervor und bereitet es vor. Stetig bläst der Wind, der in die Baracke zieht, ihr Feuerzeug aus. Es dauert lange bis sie es endlich in ihre Spritze ziehen kann. Sie legt ihren juckenden Arm frei, lehnt sich zurück und setzt die Spritze auf ihre Venen. Ihr Daumen ruht auf dem Kolbenkopf der Spritze, ihre Augen auf dem immer leiser werdenden Säugling. Ihre Atmung wird ruhiger, sie fühlt sich von den großen Augen beobachtet, die sie anstarren. Sie springt auf, legt die Spritze zurück in das Taschentuch und reißt ein langes, dünnes Stück Plastik aus einer der Planen. So flink, wie es ihre zitternden Hände zulassen, reißt sie es in zwei und wickelt eine Hälfe immer enger um die Nabelschnur. Mit etwas Abstand wiederholt sie den Zug und schneidet dann mit einem stumpfen Messer die Schnur zwischen den Stücken durch. Vorsichtig stopft sie das Taschentuch mit ihrem wertvollsten Besitz unter den Rock, in ihre Hose, fingert das Kind mit vor Kälte tauben Fingern auf und stolpert aus der Baracke auf die Straße. Schnell stapft sie durch den hohen Schnee. Es ist anstrengend, aber ihr Ziel ist nicht weit von hier, sie würde nicht lange laufen müssen.
Die Container mit ihren großen schwarzen Deckeln stehen hinter einem Mehrfamilienhaus. Sie sind kaum von Schnee bedeckt, da sie durch ein hohes Haus mit dem überstehenden Dach geschützt werden. Schwach stemmt sie den Deckel auf und lehnt ihn an die Hauswand. Dann zieht sie sich den Rock über die Hose und wickelt das mittlerweile stille Kind fest hinein. Vorsichtig legt sie das Bündel in den Container neben einen großen Sack. Sie will den Deckel schon schließen und zurück in die Nacht fliehen, als sie wieder diese großen Augen anstarren. Dunkel und braun blicken sie durch sie hindurch, direkt in ihre kaputte Seele. Weinend bricht sie den Kolbenkopf ihrer Spritze ab und legt ihn auf das Bündel, das immer müder zu ihr heraufsieht. Einen Moment betrachtet sie den Kolbenkopf, der nun, getrennt von seinem Körper, wie ein Amulett auf dem Kind liegt, ein Kreuz auf der einen, drei Erhebungen auf der anderen Seite. Bevor sie den Deckel leise schließt und sich in die durch Schnee bedeckte Nacht davon stielt, hat das Kind seine Augen bereits geschlossen.
5. Gegenwart
Nova ist für ihr Alter erstaunlich erwachsen, als die Sonne, immer noch versteckt durch die immer dunkler werdenden Wolken, hinter der Erdkrümmung verschwindet und nur noch einen leichten Schimmer am Himmel liegt, beginnt das kleine Mädchen zu kochen. Gekonnt hackt sie Zwiebeln in Würfel, wirft sie in die vor Öl knisternde Pfanne und beginnt Nudeln ins kochende Wasser zu schieben. Der Mann beobachtet sie dabei. „Hey Avem, kannst du die Tomaten schneiden?“ Der Mann nickt, greift sich irgendein Messer und beginnt, im Sitzen, auf den Tomaten herumzudrücken. Eine Weile beobachtet ihn das Mädchen dabei, mehr amüsiert als neugierig und als er die dritte Tomate unter der Klinge zerquetscht hat, hält sie das Lachen nicht mehr zurück. „Oh Mann, ich wollte eigentlich gestückelte und nicht passierte Tomaten. Hier ich zeig es dir.“ Der Mann, verwundert über seine Unfähigkeit überhaupt ein Messer halten zu können, reicht Nova das scharfe Stück Stahl. Nova legt es in die Spüle greift ein Messer mit Zähnen und schneidet die einzige noch ganze Tomate gekonnt in Stücke. „Hier, siehst du? Die Zähne bleiben in der Haut hängen und so braucht man quasi keine Kraft aufwenden.“ Der Mann stöhnt und stemmt den Kopf auf die Arme. „Es scheint, als hätte ich mehr als meine Identität vergessen.“ Nova lächelt aufmunternd, steigt auf einen kleinen Hocker und schüttet die Tomaten zusammen mit den anderen Zutaten in die Pfanne. „Ach, ist doch nicht schlimm Avem, vielleicht wusstest du es einfach noch nie.“ Der Mann wirkt frustriert. „Avem? Warum nennst du mich die ganze Zeit so? Bitte, ich möchte es wirklich wissen.“ Nova rührt gedankenverloren die Sauce, sie überhört seine Frage, ob wegen der Ablenkung oder aus Absicht kann er nicht sagen.
Die Pasta schmeckt, dafür das sie von den Händen einer achtjährigen kreiert wurde, erstaunlich gut. Der Mann wischt sich das letzte bisschen Sauce mit einer grünen Serviette vom Mund und betrachtet das Mädchen, wie sie die Nudeln gekonnt auf dem Löffel dreht und sie in ihrem Mund verschwinden lässt. „Du Nova, wir sollten doch die Polizei rufen, egal wie verrückt die Geschichte auch ist, vielleicht ist das der einzige Weg Antworten zu bekommen.“ Nova schluckt die Nudeln herunter, legt das Besteck ordentlich auf vier Uhr und sieht dem Mann in die Augen. „Mein Vater sagt immer, es gibt niemals nur einen Weg über eine Schnellstraße, es gibt meistens auch einen drunter durch.“ Der Mann verzieht verwirrt das Gesicht. „Ok?“ Nova rollt mit den Augen. „Avem, Niemand mag Klugscheißer, aber du machst mich mit deiner Unwissenheit zu einem. Es bedeutet, dass die Polizei zu rufen vielleicht der logische Weg ist, aber vermutlich nicht der einfachste. Ich glaube es gib bessere Wege herauszufinden wer du bist.“ Der Mann nickt, mehr verwirrt als verständnisvoll. „Und was fällt dir ein?“ Nova öffnet den Mund, selbst ihre Zunge bewegt sich bereits im Takt zu den Worten, die sie sagen will, doch noch bevor ein Ton ihre Lippen verlassen kann, poltert es im Flur. Beide sehen sich an, dann auf die geschlossene Flurtür. Keiner spricht. Wieder ein Poltern, gefolgt von lauten schweren Schritten und einem Geräusch, das wie das Öffnen eines Reißverschlusses klingt. Nova rutscht leise vom Stuhl herunter, tippelt zu der Tür, die ihr einbeiniger Gast immer noch beobachtet und zieht sie vorsichtig auf.
Im Türrahmen steht ein Mann. Durch die niedrige Tür wirkt er groß, sein Gesicht ist von dutzenden roten Äderchen durchzogen, die seine Wangen rötlich leuchten lassen. Seine eher kurzen Haare liegen wüst und durch einzelne graue Stellen leicht drahtig, wirr auf seinem Kopf und verlieren sich in dem zottligen Vollbart, der sein Gesicht einrahmt. Die Jacke, die geöffnet über seinen Schultern hängt, ist groß und schwer und durch die vielen Reflektoren eher für eine Arbeit in rauen Umgebungen geeignet,
als für eine Spaziergang ins Dorf. Um seinen Hals liegt eine schlauchartige Rettungsweste, die hinter dem Rücken durch einen Karabiner verschlossen ist. Seine Hose ist gepolstert und mit Schlamm und Schlick bedeckt und die ebenfalls dicken Socken, die leicht darunter hervorlugen, sehen warm und wetterfest aus. In seinem Gesicht, leicht verdeckt durch die graubraunen Haare, liegen die wachsamsten blauen Augen, die der mittlerweile aufgestandene Asiate, je gesehen hat. „Papa!“ ruft Nova freudig und springt dem groben Mann in die starken Arme. Der anscheint durch raues Wetter gegerbte Mann, fängt das kleine Mädchen auf und drückt es an den, durch die Jacke gepolsterten, Körper. Sprechen tut er dabei nicht. Nachdem er das Mädchen wieder zurück auf den Boden gestellt hat, schlüpft er aus der feuchten Jacke, wirft sie über einen der Garderobenhaken unter der Treppe im Flur und läuft von Nova gefolgt ins Wohnzimmer. „Warum bist du denn schon so früh wieder da Papa? Ist etwas Spannendes passiert?“ Novas Vater lächelt und antwortet mit rauer warmer Stimme auf Novas Fragen. „Wir mussten abrechen, das Wetter wurde zu schlecht und der Anker des Boots war für solche Strömungen nicht schwer genug, nächste Woche fahren wir wieder raus und dann nehmen wir…“ Der derbe Mann verstummt schlagartig. Verunsichert starrt er den Asiaten an, der auf eine Stuhllehne gestützt, in seinem Wohnzimmer steht. Er schluckt kaum merklich und mustert ihn eindringlich. Dem Einbeinigen fällt es schwer aus dem Gesicht des Mannes zu lesen. Ein wenig sieht er schockiert aus, für einen kurzen Moment fast ängstlich, dann sauer und schließlich einfach nur verwundert. Nova springt zwischen die beiden Männer und sprudelt los, es klingt wie ein einziger langer Satz, der aufgeregt aus dem Kind hervorsprudelt. „Ich habe ihn gefunden, er ist aus dem Himmel gefallen, kannst du dir das vorstellen? Einfach aus dem Himmel Papa, wie Regen oder wie Blätter im Herbst, er weiß nicht wer er ist, also nicht mal, wie er heißt, eigentlich weiß er gar nichts, nicht mal wie man Tomaten schneidet, ich meine, das weiß doch jeder, oder? Ich habe ihm Sachen von dir gegeben, weil seine ja nass waren, außerdem hat er nur ein Bein, selbst das wusste er nicht, dann wollten wir die Polizei rufen, aber…“ Ihr Vater hebt die rissige verhornte Hand und lässt Nova mit einem Wink im Wort verstummen. Für einen Moment ist es ruhig, beide Männer starren sich an, der eine eher zerstörend, der andere verunsichert und unbehaglich. Novas Vater öffnet den Mund, alles was in seiner ohnehin schon harten Stimme zuvor weich geklungen hat, ist gewichen. „Sie wissen also nicht, wie Sie heißen?“ Eingeschüchtert nickt der Mann, nun noch mehr auf den Stuhl gestützt. „So. So. So.“ Novas Vater redet langsam und tragend, als wolle er den Mann mit seinen Worten fesseln. Dann lässt er von ihm ab, beugt sich vorsichtig herunter, um auf Augenhöhe mit der, für ihr Alter eher kleinen, Nova zu sein und nimmt sie sanft an den Schultern. „Hör mal Nova, ich weiß, dass du schon groß bist und auch, dass du mit allem klarkommst, auch wenn ich ein paar Tage weg bin. Du kannst aber nicht einfach irgendwelche Menschen in unser Haus lassen, die du nicht kennst, das ist gefährlich. Niemand kann sagen was ein Mensch für Absichten hat.“ Nova laufen Tränen übers Gesicht. „Aber Avem ist nicht gefährlich. Er ist aus dem Himmel gefallen, einfach so. Ich hätte ihn doch nicht in dem Baum lassen können.“ Nova schnieft, presst die Worte aber über die Lippen. Der bärtige Mann nickt, schließt Nova in seine erstaunlich muskelbepackten Arme und streicht ihr über den Kopf. „Es ist ja nichts passiert. Ruf mich bei sowas aber bitte das nächste Mal an, oder die Polizei, ja?“ Nova nickt. Ihr Vater erhebt sich wieder und läuft auf den asiatischen Mann zu. Er glättet sein besorgtes Gesicht und reicht ihm die schroffe Hand, ohne ihn dabei aus den Augen zu lassen. „Thies.“ Der Einbeinige lässt den Stuhl los und reicht dem Mann seine Hand, die in dem engen Griff auch so gleich zerquetscht wird. „Ich würde Ihnen jetzt wirklich gerne meine Namen nennen, aber…“ der Mann zuckt symbolisch mit den Schultern. „Es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten, die ich Ihnen bereite. Ihre Tochter war sehr freundlich, wenn sie mich zur nächsten Polizeiwache fahren, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Die Kleidung gebe ich ihnen natürlich wieder.“ Thies gibt die Hand des Mannes frei und deutet auf sein Gesicht, ohne auf seine Worte einzugehen. „Die Wunde da hätte vor Stunden genäht werden müssen, ich hole Ihnen ein Wundpflaster und Desinfektionsmittel, damit sie sich nicht entzündet. Setzen sie sich Herr Unbekannt, die Polizei hier im Dorf macht erst wieder am Montag auf, mit so einem Anliegen könnten die ohnehin nicht umgehen und die Deichstraße in die Stadt ist durch den schweren Regen geflutet. Die ist wohl erst wieder Donnerstag frei und wie Sie vermutlich mitbekommen haben, ist es für Boote da draußen momentan zu rau. Ich schätze Sie sind hier erstmal gestrandet, also machen sie es sich bequem.“ Der asiatische Mann fällt zurück auf den Stuhl und lässt den Mund ein wenig offenstehen. Thies lacht und flötet seiner Tochter entgegen, bevor er ins obere Stockwerk entschwindet. „Könntest du mir die Nudeln nochmal ein wenig warm machen Nova, die riechen zu gut, um sie kalt zu essen.“
6. 35 Jahre vor dem Fall
Wieso lebt dieses winzige Wesen noch? Wie konnte es noch leben, wenn andere Menschen mit so viel besseren Prognosen so viel schneller sterben? Unaufhaltsam geistern dem jungen Arzt dieselben Fragen durch den Kopf, als er mit dem winzigen Bündel unterm Arm durch die Notaufnahme rennt. Kleine Augen blicken ihm dabei entgegen, nur einen Spalt geöffnet, gerade genug, um ihm in die Seele zu starren. Er versucht den eindringlichen Augen auszuweichen. Es gelingt ihm nicht, auch nicht, als ein paar seiner Kollegen vom Rettungsdienst eine Trage mit einer über und über mit Blut überströmten Frau an ihm vorbeischieben, ihn unsanft beiseite drücken und in einen der Schockräume einscheren. Er kann noch hören wie sie rufen: „Circa ein Dutzend Messerstiche! Hypovolämie, daraus resultierender Schock, rufen sie die Blutbank an!“ bevor die Tür hinter Schockraum 2 ins Schloss fällt. Die Augen starren ihn weiter an, selbst als er das Bündel auf die Liege in Schockraum 4 legt, weichen die Augen nicht von ihm ab. Fünf Leute stürmen mit wehenden Kitteln in den Raum, sie reden kontrolliert hektisch durcheinander. „Was haben wir?“ Der junge Arzt antwortet. „Ein Neugeborenes, circa drei Stunden alt. Ein Obdachloser hat es…“ Er wird von einer Frau unterbrochen. „Nicht relevant Dr. Beck. Vitalzeichen?“ spricht sie zu dem mit der Situation überforderten Assistenzarzt, dreht sich dann um und ruft einem anderen Arzt hinter ihr zu „Piepen Sie die Pädiatrie an!“ während sie das Neugeborene aus der Decke wickelt. Als sie die Decke entfernt, fällt ein kleines Stück Kunststoff zu Boden, der junge Arzt bückt sich geistesgegenwertig und steckt es schneller ein, als die Ärztin ihn anbrüllen kann. „Beck! Vitalzeichen, was haben wir? Bericht! Jetzt!“ Der junge Arzt bewegt sich nicht, wie festgefroren steht er da. Die Frau rollt die Augen und beginnt die Untersuchung bei dem sich kaum bewegenden Baby. Die dunklen, braunen Augen sind immer noch auf den jungen Arzt gerichtet. „Dr. Beck, Sie sind hier um zu lernen, also was wissen wir?“ Der Assistenzarzt wird aus seiner Erstarrung gerissen, als weitere Ärzte in den Raum stürmen. „Ja… natürlich. Neugeborenes. Nicht älter als drei Stunden. Hypothermie. Körpertemperatur liegt bei 34,1. Vermutlich entstanden durch leitenden und konvektiven Wärmeverlust. Missbildung der rechten unteren Extremität. Es wurde in einer Mülltonne gefunden, Verdacht auf Drogen, wir sollten ein Tox- Screen machen, außerdem…“ Die Augen des Babys bohren sich während er spricht in ihn hinein. Er stockt. Die Frau lässt von dem Neugeborenem ab, um die Kollegen der Pädiatrie weiter machen zu lassen. Sie packt den jungen Mann am Arm und zerrt ihn aus dem Schockraum. Drohend fliegt ein Zeigefinger in sein Blickfeld. „Konzentrieren Sie sich! Das letzte was der kleine Kerl braucht, ist ein Assistenzarzt, der im Weg steht. Dieser kleine Mensch da drinnen,“ der Zeigefinger lässt für einen Moment von ihm ab und zeigt auf die immer noch wankende Schwingtür. „ist ein Wunder, er sollte nicht da liegen, er sollte eigentlich schon ganz woanders sein und trotz alldem lebt er, er ist schwach, aber er lebt. Sie haben gerade versagt, das wird das letzte Mal sein, dass Sie bei diesem kleinen Menschen versagen. Ab jetzt weichen Sie ihm nicht mehr von der Seite, sie bleiben bei ihm, kontrollieren die Vitalzeichen und geben ihm jede Sekunde das Gefühl, dass er auf dieser Welt willkommen ist, dass da Jemand ist, der für ihn da ist. Nur für ihn!“ Der junge Arzt schluckt. „Was meinen Sie mit nur für ihn?“ Die Ärztin holt Luft. „Ich meine damit, dass ich Sie, solange Sie sich so unbrauchbar verhalten, in der Notaufnahme nicht mehr sehen will. Sie helfen jetzt der Pädiatrie und das so lange, bis ihr winziger Patient mit einer neuen liebenden Familie nach Hause geht. Klar?“ Der junge Mann nickt und schluckt. „Gut. Enttäuschen Sie ihn nicht.“
Der junge Arzt tut von da an auch nichts anders mehr. Tag und Nacht sitzt er neben dem Inkubator. Anfangs tut er es für seine Chefin, dann für sich selbst und dann irgendwann nur noch für den kleinen Menschen in seiner Obhut. Er steht den Entzug mit ihm durch, an dem der kleine Kerl beinahe gestorben wäre, die Erkältung, die der Hypothermie folgt, bei dem das Leben des Kleinen erneut am seidenen Faden hängt und dann Wochen später, die Operation, bei der dem kleinen Kerl das entstellte Bein abgenommen wird, das immer nutzloser an ihm herunterhängt. Er liest ihm vor, aus allem, was er in die Hände bekommt, meistens Patientenakten, manchmal auch aus den dicken Wälzern, die er für die nächste Prüfung durchkauen muss. Der Säugling beobachtet ihn dabei mit diesem seelenvollen Blick, den er ihm von Anfang an geschenkt hat. Einen Namen gibt der junge Arzt ihm dabei nicht, aus Angst sich zu sehr an ihn zu binden.