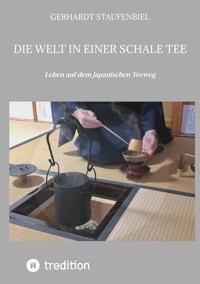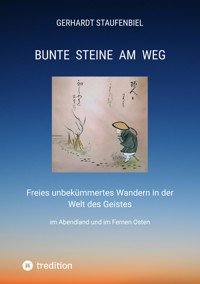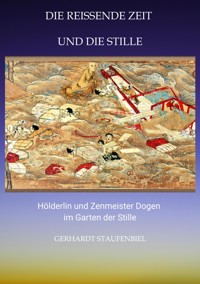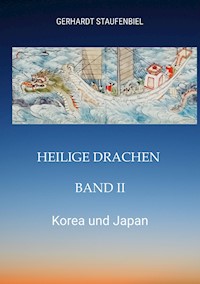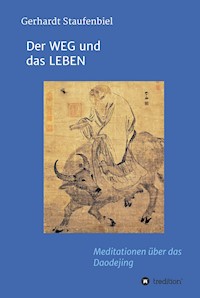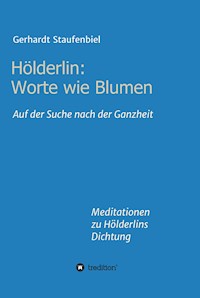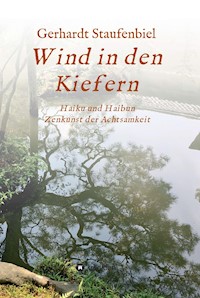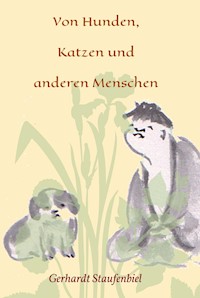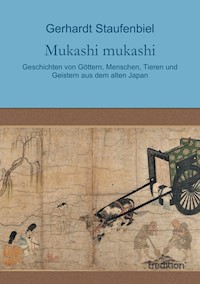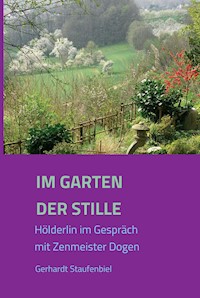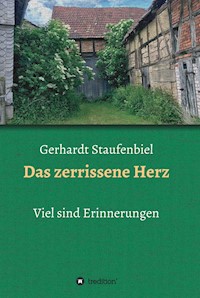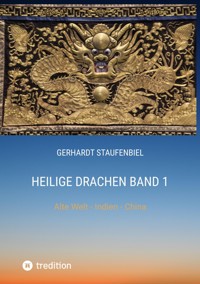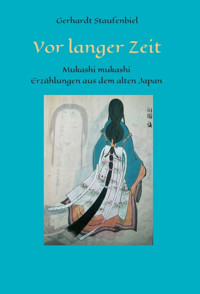
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichte, Legenden und Mythen aus dem alten Japan. Zusammengestellt, übersetzt und erläutert geben einen lebendigen Einblick in die alte Kultur Japans. Mit einer Einführung in die Geschichte der Begegnung Japans mit dem Abendland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Vor langer Zeit -
Mukashi - Mukashi
Umschlagbild:
Handzeichnung eines Fujiwara Nachkommen
www.tredition.de
Das Werk, einschließlich aller Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2017 Autor: Gerhardt Staufenbiel
Verlag: tredition GmbH
www.tredition.de
978-3-7439-5133-4 (Paperback)
978-3-7439-5134-1 (Hardcover)
978-3-7439-5135-8 (e-Book)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Lachen der Götter
Als die Sonnengöttin Amaterasu in der Höhle Unterwelt verschwunden war, und ewige Dunkelheit herrschte, versammelten sich die Götter vor dem Eingang und warteten.
Schließlich holten sie die junge Uzume herbei. Sie schmückte sich mit einer Krone aus Blättern. In die Hand nahm sie einen Strauß aus Bambusgras.
Auf den Boden vor der Höhle legte sie ein umgedrehtes, leeres Fass. Sie trat dröhnend auf das Fass und tanzte, bis sie in eine göttliche Besessenheit geriet.
Sie ließ ihre Brüste heraushängen und zog das Saumband ihres Gewandes so hoch, dass sie ihren Schoß entblößte.
Da geriet das hohe Himmelsgefild in Aufruhr und die acht Myriaden Gottheiten brachen alle vereint in ein lautes Lachen aus.
Neugierig kam die Sonne Amaterasu hervor und es wurde hell.
Das Lachen der Götter
brachte die Sonne und das Licht zurück in diese Welt.
Kojiki - Aufzeichnungen aus der alten Zeit
Vor langer Zeit
Mukashi - Mukashi
Legenden und Mythen aus dem alten Japan
von Göttern, Menschen, Tieren und Geistern
Zusammengestellt, übersetzt, nacherzählt
und mit Erläuterungen versehen
von
Gerhardt Staufenbiel
WIDMUNG
Gewidmet dem Andenken meines Großvaters, der ein wunderbarer Märchenerzähler war.
An den langen Winterabenden versammelten sich die Familie, die Kinder und alle Nachbarn in der Stube rund um den Kachelofen. Das Feuers knisterte und erhellte aus der offenen Ofenklappe geisterhaft den Raum.
Auf den Knien meines Großvaters saßen meine Cousine und ich. Die Erwachsenen drängen sich dicht in der Stube, als würden sie gegenseitig Schutz suchen. Wenn es in den Erzählungen besonders dramatisch wurde, hielt Großvater uns Kinder ganz fest im Arm. Die Erwachsenen schrien dann oft vor Schreck und Spannung.
Jeden Abend beendete er die Erzählungen:
»Und wie die Geschichte weitergeht, das erzähle ich Euch morgen!«
Er war in Notzeiten als Waisenkind in einer Mühle aufgewachsen. Mit 14 Jahren schnürte ihm sein Onkel und Pflegevater das Bündel und schickte ihn hinaus in die Welt. Als Bursche eines Offiziers lernte er die Welt kennen bis er als armer Bauer in seine Heimat zurückkehrte.
Oft erzählte er vom jüngsten Sohn des Müllers, der hinausging, um sein Glück zu machen. Nachdem der viele Gefahren gemeistert hatte, erhielt er als Lohn die Königstochter zur Frau und das halbe Königreich dazu.
Das Königreich meines Großvaters lag für jedermann sichtbar tief in seinem Herzen.
Zu seinem Andenken habe ich das Buch: ‚Das zerrissene Herz - Viele sind Erinnerungen’ geschrieben.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Warum dieses Buch geschrieben wurde
Japan - eine kleine Landeskunde
Religion in Japan
Shintō - Weg der Götter
* Matsuri - Schreinfeste
Feuerfest in Kurama
Yasurai Matsuri im Imamiya Schrein
Buddhismus in Japan
Buddhismus und Zen
Japan und Europa
• Das Goldland Zipangu
• Wie Amerika entdeckt wurde
• Christen in Japan
• Namban - Südliche Barbaren
• Oda Nobunaga
• Kriegerischer Buddhismus
• Christenverfolgung in Japan
Geschichten vom Anfang
• Das Kōjiki
• Der Anfang
• Das Land der Finsternis
• Trennung der Welten
• Wie Sonne und Mond entstanden
• Wie die Sonne verschwand.
* Takachiho - die Höhle der Amaterasu
Berggeister und Dämonen
• Die Yama-Uba
• Anmerkung zum Nō Theater.
• Yuki Onna - Die Schneefrau
• Die Kranichfrau
Geschichten vom Donnergott
• Der Donnergott im Sanjusangendo
• Michizane wird zum Donnergott
• Wie einmal der Donnergott in den Brunnen fiel
• Wie durch den Donnergott ein Kind geboren wurde
• Wie der Donner zweimal gefangen wurde.
Tiere und Tiergeister
• Krähen und Hunde
• Warum die Affen kurze Schwänze haben
• Frösche auf Reisen
• Der Frosch im Brunnen
Bashō’s Frosch
Tengu - Himmelshunde
• Der Tengu von Kurama
• Der Krähen-Tengu und der Geierberg
• Der alte Mann und die Tengu
Der Tengu und sein magischer Fächer
Inari und die Fuchsgeister
* Ein Besuch im Inarischrein
Das Schwert des Inari
* Inari und der Reis
• Die Fuchs Gattin Kitsune
Die Füchsin Kuzu no Ha
Wie ein Samurai Sutra für einen Fuchs kopierte
* Sutra-Schreiben als religiöse Übung
• Die Fuchsfrau Tamamonomae
• Der Yamabushi und der Fuchs
• Der Fuchs und der Fisch
• Die Fuchshochzeit
* Das Fuchsfeuer
• Der Kitsune Sōtan
• Der Tanuki
• Bunbuku chagama
Geschichten vom Kappa Taro
* Der Kappa Taro
• Der Kappa und das Shirikodama
• Wie man einen Kappa fängt
• Der Kappa von Mikawa
Von Karpfen und Drachen
* Das Drachentor
• Die Geschichte vom Goldknaben Kintaro
• Der Knabe auf dem Drachenkarpfen
* Drachen im leeren Himmel
• Geschichten aus dem Lande Fusō
• Der Priester als Drachenkönig
* Die Perle der Wunscherfüllung
• Die Tochter des Drachenkönigs Sagara
• Die Perle des Drachenkönigs
Die Geschichte vom Bambussammler.
Prinz Ishitsukuri und die Steinschale Buddhas
Kuromoji und der Zweig vom Hōrai-Berg
Der Tennō
Geschichten von tapferen Kriegern
Musashibō Benkei
• Benkei auf der Gojo Brücke
• Benkei in Ataka
• Benkei auf dem Boot
Kindkaiser Antoku
Totengeist des Tomomori
• Benkeis Tod - Benkei no Tachi Ōjō
* Der Genpei Krieg
• Der Miminashi Hōichi
Geschichten vom Buddha
• Wie einmal der Kannon Bōsatsu geholfen hat
• Wie Kriegsmänner Kannon nach Japan brachten
• Das Maus Sutra
• Der Mönch im Baum
• Einsiedler von einem Wildschwein getäuscht.
• Zen - Dialog
Daruma: Königssohn aus Indien
• Die Daruma Puppe
Zengeschichten um Daruma
• Ankunft in China
• Daruma und der König Wu Di
• Der Klang der einen Hand
• Daruma bei den Shaolin
Men piki: Wandanstarren
Daruma und der Tee
Daruma und Hui-ke
• Prinz Shōtoku und der Bettler
Vorwort
Dieses Buch enthält Nacherzählungen japanischer Volkslegenden, Mythen und Märchen, die sonst oft nur für Spezialisten zugänglich sind. Enthalten sind aber auch Episoden aus den »heiligen« Schriften des japanischen Shintō, dem Kojiki und dem Nihonshoki vom Anfang der Welt und Geschichten aus dem Umkreis des Buddhismus und aus dem klassischen Nō Theater. Manche Geschichten sind von derbem, volkstümlichen Humor, manche voll subtiler und stiller Poesie.
Manche Stücke, wie etwa die Erzählung vom Kintaro, dem Goldknaben, sind Kindergeschichten. Die Geschichte vom Bambussammler ist eine der berühmtesten Erzählungen der alten japanischen Literatur, die hier stark gekürzt wiedergegeben wird. Sie ist zugleich der älteste schriftlich erhaltene Erzähltext Japans. Die Mythen vom Anfang der Welt sind den beiden Schriften Kojiki und Nihonshoki entnommen, die zu den ältesten Aufzeichnungen in japanischer Sprache überhaupt gehören.
Es gibt Erzählungen voller Trauer und Schmerz, wie etwa die Lebensgeschichte des Kriegermönches Benkei. Aber den meisten Geschichten ist der Witz und Humor eigen, die man oft in den alten japanischen Texten findet. Der Humor ist in allen Völkern ein Ventil mit einem schweren Leben fertig zu werden. Japan ist ein Land mit vielen Naturkatastrophen wie Erdbeben, Tsunami und Taifunen und es hat furchtbare Kriege erlebt. So blieb den Menschen oft nur der Humor zum Überleben. Einschübe sollen einen kleinen Einblick in das Brauchtum und die Religionen Japans geben. Sie erheben keinen Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit, sollen aber den Hintergrund der Geschichten lebendig werden lassen. Sie sind in einer anderen Schriftart gesetzt als die Erzählungen. Der Erzählstil richtet sich jeweils nach der Herkunft der Geschichten etwa aus der Volksüberlieferung oder der hohen poetischen Kunst des Nō.
So soll dieses Buch eine möglichst farbige Sammlung von lustigen und traurigen Geschichten des japanischen Volkes bieten. Viele der japanischen Geschichten sind sehr respektlos. Auch die Göttergestalten werden nicht immer respektvoll dargestellt. Sogar der ehrwürdige Daruma, der den Zen nach China und letztlich nach Japan gebracht hat, ist Gegenstand vieler respektloser Geschichten. Ich denke, es ist schön, wenn man auch über seine Götter lachen kann. Das haben auch die antiken Griechen getan. Ich hoffe, dass die auswahlein farbiges Bild aus dem alten Japan vermittelt und die Texte vergnüglich und leicht zu lesen sind.
Warum dieses Buch geschrieben wurde
Der weiße Raureif
Leuchtet hell im Morgenlicht.
Kalter Wintertag
Ich sitze an meinem Schreibtisch und schaue aus dem Fenster. Die helle Morgensonne lässt den winterlich weißen Raureif auf den Wiesen feurig rot aufleuchten. Der Himmel strahlt wolkenlos in einem kalten klaren Blau. Nur am Horizont malt die Wintersonne einen hellen, rosaroten Streifen. Die Wälder, Hügel und Wiesen liegen da in winterlich gedämpften Farben wie eine Tuschezeichnung hingeworfen von der Hand eines japanischen Tuschemalers hingeworfen.
Es ist Sonntagmorgen. Die uralte Dorfkirche ist von meinem Schreibtisch aus nicht zu sehen, aber ich weiß, dass sie dort unten in dem kleinen Dorf auf die Besucher wartet. Es ist eine Jakobuskirche. Vor langer Zeit lag sie wohl am Jakobsweg, dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela. So war diese abgeschiedene Gegend schon früh mit der weiten Welt und den Sehnsüchten der Pilger nach den fernen heiligen Orten verbunden.
Drinnen im Teeraum singt der Teekessel und eine Kerze erhellt spärlich den Raum. Der Duft des Weihrauchs im Feuer verbreitet sich im Raum und kündet vom reinen Land Buddhas. Bashō, der Haiku - Dichter schrieb einst über die viereinhalb Matten des Teeraumes:
Aki chikaki
Der Herbst kommt heran.
kokoro no yoru ya
das Herz erfüllt von Sehnsucht:
yo jo han
Viereinhalb Matten
Hier in der geborgenen Stille sitzen wir oft, meditieren den Tee und spielen die Zen-Flöte, die Shakuhachi. Vor ein paar Wochen erst waren wir in Japan und haben zusammen mit Ōsho, dem Zenmeister des Zentempels Icchōken vor dem Buddhaaltar die Flöte gespielt. Ehrfurchtsvoll hatten wir auch den Daizafu Tenmangu besucht, den Schrein, in dem der gelehrte Michizane bestattet sein soll und in dem er als Gott verehrt wird.1 Hier hat er sich vom zornvollen Donnergott zum Schutzgott der Schüler und Studierenden verwandelt.
Warum schreibt jemand, der sich seit vielen Jahrzehnten mit Zen und den Zenkünsten befasst hat, ein Buch mit Geschichten über Geister, Gespenster und merkwürdigen Menschen aus dem alten Japan? Geht es im Zen nicht um die Überwindung allen Aberglaubens und der Angst vor Geistern, Dämonen oder was auch immer? Dämonen entspringen unseren eigenen unverarbeiteten Ängsten. Aber es gibt auch dämonische Kräfte in der Natur oder im Politischen Geschehen, die nicht unserem eigenen Inneren entspringen. Denken wir nur an die gewaltigen Tsunami, die Erdbeben und die Taifune in Japan oder die schrecklichen Kriege. All das kann Angst machen und das gesamte Leben bestimmen. Viele Gestalten in den japanischen Erzählungen spiegeln die Angst vor den unbekannten Naturgewalten. Die Yuki Onna, die Schneefrau, die den Tod im winterlichen Schnee bringen kann, die Yama Uba, die sogar Menschen frisst oder der Kappa Taro, der aus Schabernack die Schwimmer in die Tiefen des Wassers zieht, sind Beispiele solcher Gestalten.
Manchmal ist es sehr heilvoll, die dämonischen Gestalten liebvoll einzuladen zu einem Gespräch unter Freunden, anstatt die Angst in unser Herz zu lassen. Dann verlieren sie ihren Schrecken und werden zu friedvollen Gästen, mit denen man leben kann und mit denen wir uns in stillen Stunden unterhalten und sogar gemeinsam lachen können.
Der Steingarten im Ryōanji, dem ‚Tempel des Drachen des Friedens‘ gilt als Quintessenz des Zengartens schlechthin. Aber dieser Garten ist nur noch ein Fragment der ursprünglichen Gartenanlage. Nur noch das Kiesfeld vor der Haupthalle mit einigen Steinen darin ist erhalten. Ursprünglich einmal bestand der Garten wohl aus mehreren Teilen um die Haupthalle herum und bildete nach der Philosophie des Daoismus den gesamten Kosmos ab. Einen solchen Garten kann man noch im Daisen-In im Norden Kyōtos sehen. Über die Steinsetzungen im Ryōanji sind ganze Bücher geschrieben worden. Fragt man den Abt nach deren Bedeutung, so antwortet er höchstens: »Das sind Steine!« Auffällig aber ist es, dass man von den 15 Steinen höchsten 14 zur gleichen Zeit sehen kann. Will man auch den letzten Stein sehen, so muss man seinen Standpunkt ändern. Aber dann verschwinden andere Steine aus dem Blickfeld. So lehrt uns der Garten, dass wir die Wirklichkeit niemals vollständig erkennen können. Es hängt immer von dem Standpunkt ab, den wir einnehmen.
Der Steingarten ist durch eine niedrige Lehmmauer von der umliegenden Gartenlandschaft abgetrennt. Diese Mauer schließt die Welt außerhalb nicht ab, sie macht vielmehr deutlich, dass es außer dem Ort hier auch noch ein draußen gibt, das freundlich herüberschaut. Besonders zur Zeit der Kirschblüte ist draußen die üppige Fülle der vergänglichen Schönheit, zu bewundern und drinnen ist gesammelte Stille der Steinsetzungen. Man muss sich fast Mühe geben, die üppig blühenden Kirschbäume draußen außerhalb der Mauer nicht zu sehen - aber dennoch stören sie das klare Bild des reinen, abstrakten Zengartens keineswegs. Beide Bereiche, die der Fülle und Vergänglichkeit und die der Stille und Beschaulichkeit ergänzen sich zu einem Ganzen.
Der Garten außerhalb des Ryōanji ist der Überrest eines riesigen imperialen Gartens mit Kirschbäumen, einem großen See und vielen verschlungenen Wegen. Und dieser Garten gehört zu dem Gesamtbild hinzu. Die Wirklichkeit ist mehr als dieser kleine, abgegrenzte Raum, in dem ich mich gerade aufhalte. Und genau das ist Zen! Es ist ein Ausschnitt aus einer gesamten Wirklichkeit, die oft sehr bunt daher kommt.
Zen ist der zeitweilige Rückzug aus der bunten und lärmenden Welt draußen, an einen Ort der Stille und Sammlung. Aber es ist keine Flucht vor der bunten Welt, um für immer an diesem abgeschiedenen Ort weitab von der geschäftigen Welt zu leben. Der indische Kaufmann Vimalakirti, ein Zeitgenosse Buddhas hatte sich einst in eine kleine Hütte zurückgezogen und meditiert. Nachdem er vollkommen erwacht war, kehrte er in sein Kaufmannsleben zurück und lebte hinfort als tätiger und fürsorglicher Mensch sein Erwachtsein. Als er erkrankte, wollte Buddha einen seiner Schüler mit Genesungswünschen zu Vimalakirti schicken. Aber alle lehnten ab, denn sie seien nicht würdig, ihm gegenüber zu treten, denn sie konnten ihr Erwachen nur in der abgeschiedenen Hauslosigkeit leben, Vimalakirti dagegen mitten im tätigen Leben. Er ist das Vorbild für die Zenkünste. Leben mitten in der bunten Welt ohne sich von ihren Schrecken oder Verführungen aus der Stille herausreißen zu lassen.
Das Leben ist bunt und vielfältig. Ich möchte meine Liebe zu Japan und seinen Menschen, denen ich vieles zu verdanken habe, mit diesem kleinen Buch voller bunter Geschichten feiern.
Langsam wird es Abend und ich sitze in Meditation geborgen unter dem Blauregen -Fuji1.
Der Nachbar fährt den Traktor heim, die Kirchenglocken läuten zum Abendgebet. Im Dorf wird es langsam still.
Die Vögel haben es ganz wichtig und machen gewaltigen Lärm.
Die Amsel, die oben im Grün ihr Nest hat, sammelt letztes Futter für die Jungen.
Sie stutzt vor meinem Sitz und schaut: „Da ist ... - Nichts!“
Dann sammelt sie eifrig weiter Futter im Gras.
Allmählich verstummt das Geschrei der Vögel und der Bach murmelt: ‚Seseragi - Sesaragi‘.
Stille!
Da – ein leichtes Geräusch: Die scheue Katze des Nachbarn schaut, ob da irgendwo Futter ist.
Vor meinem Sitz erstarrt sie: Aber - da ist ... – Nichts!
Gegenüber steht ein kleines Orangenbäumchen mit Früchten.
Die Katze macht sich darüber her.
Noch einen Blick! ... Nein, da ist – Nichts.
Gut sind die Orangen!
Dann trollt sie sich davon.
Langsam beginnt es zu regnen – die Tropfen fallen.
Nacht und Dunkel.
Nur noch die Sterne singen ihr ewiges Lied!
Stille!
1Geschichten über Michizane als Donnergott oben, ab Seite 83
1Fuji: japanischer Blauregen, Wisteria. Das Geschlecht der Fujiwara hat diesen Ehrennamen bekommen, weil ihre Vorfahren einst unter dem Fuji gesessen und Gedichte im chinesischen Stil gelesen und geschrieben haben.
Japan - eine kleine Landeskunde
Japan ist ein Inselland weit im Osten. Nach der Mythologie ist das Inselreich entstanden, als das Götterpaar Izanami und Izanagi auf der himmlischen Brücke, der Ama no hashidate standen und in den dichten Nebel unter ihnen schauten. Da nahm Izanagi seinen Juwelenspeer und rührte den Nebel damit um, bis der sich verdickte. Dabei fielen große Tropfen von dem verdichteten Nebel in das Meer und bildeten die ersten Inseln. Izanami und Izanagi stiegen auf der Himmelsbrücke herunter und zeugten nun alle die anderen Inseln, Berge, Götter und Lebwesen, die das Land Japan bevölkern. In den alten Mythen heißt Japan ‚Toyo-ashi-hara no chi-aki no naga-i-ho-aki no mizu-ho no kuni‘ - ‚Land der üppigen Schilfgefilde, 1000 Herbste, langen 500 Herbste und der fruchtbaren Reisähren‘.
Der Name Japan oder Nihon oder Nippon ist keine ursprünglich japanische Bezeichnung. Er stammt von den chinesischen Kaisern, die das Land weit im Osten, an der ‚Wurzel der Sonne‘ als Ni-hon oder Nippon bezeichnet haben. Die japanische Bezeichnung war ihnen vermutlich viel zu kompliziert und zu japanisch. 日 Ni ist die Sonne, 本 hon oder pon die Wurzel, der Ursprung. Der ganz alte, japanische Name in Urkunden ist Wakoku, das Land der Wa. Die Wa waren vermutlich ein einzelner Volksstamm, der keineswegs das ganze Inselreich besiedelt hatte. Vielleicht lebten sie weit im Süden, in der Gegend, die nahe bei Korea liegt. Wer in Rest des Landes lebte, wissen wir nicht so genau. Heute jedenfalls trägt Japan den chinesischen Namen ‚Wurzel der Sonne‘ Ni-hon. Das ist für Japan keine so fremde Erscheinung. Die einheimische japanische Religion heißt mit der chinesischen Bezeichnung Shin-tō - Weg der Götter. Japanisch gesprochen würde es heißen ‚Kami no Michi‘. Der japanische Kimono als traditionelles Kleidungsstück kommt aus China, die japanische Schrift ist chinesisch und die Religion des Buddhismus hat ihren Weg über China nach Japan gefunden. Der Bonsai kommt aus China, der grüne Tee, der Reisanbau, die Sojasauce, die politische Ordnung, ja sogar das System der Herrschaft des Tennō stammen aus China. Man könnte sich ganz besorgt fragen, was denn überhaupt das Japanische an der japanischen Kultur ist, wo doch alles aus China zu stammen scheint. Aber die Japaner haben die fremden Einflüsse aufgesaugt und eine ganz eigene Kultur geschaffen.
Die meisten Ausländer kennen von Japan nur die große Stadt Tokio oder Tōkyō. Eigentlich ist Tōkyō gar keine Stadt, sondern eine Ansammlung von verschiedenen Städten. Heute besteht Tōkyō aus 23 Bezirken, die alle eine eigene Stadtverwaltung haben. Sie bilden zusammen die Region Tōkyō. Dort leben heute mehr als 8 Millionen Menschen. Aber damit noch nicht genug. Die Region Tōkyō ist umgeben von anderen Großstädten wie Kawasaki, Saitama, Chiba und Yokohama, die alle so dicht beieinanderliegen, dass eine einzige riesige Großstadt entstand. Dort leben fast 36 Millionen Menschen. Das ist fast ein Viertel der gesamten Bevölkerung Japans. So ist es kein Wunder, dass die meisten Japaner, die wir in Deutschland kennen lernen, aus Tōkyō stammen.
Früher einmal war Tōkyō die ‚Hauptstadt im Osten‘, das bedeutet nämlich der Name: Tō - Osten und kyō Hauptstadt. Kyōto war die ‚Hauptstadt‘ (Kyō - Hauptstadt; to -Hauptstadt), also die ‚eigentliche oder wirkliche Hauptstadt.‘ Früher einmal hieß Tōkyō einfach nur Edo und Kyōto hieß Heian-kyō 1, die Hauptstadt des ewigen Friedens.
Kyōto war über tausend Jahre lang der Regierungssitz des japanischen Kaisers, des Tennō, des Himmelssohnes, der erst 1868 nach Tōkyō umgesiedelt ist. Erst seit jener Zeit führen die beiden Städte die neuen Namen.
Tōkyō ist erst relativ spät zum Machtzentrum Japans ausgebaut worden. Die Stadt ist um eine Burg herum entstanden, die in den Kriegszeiten des 15. Jahrhunderts zum Schutz vor den Reitereien der Angreifer mitten in einem Sumpfgebiet erbaut wurde. Die Gebäude konnten auf keine wirklich festen Fundamente errichtet werden. Man versenkte Reisstrohmatten im Sumpf trieb Holzpfähle hinterher und errichtete darauf die Häuser und Paläste. Später wählte dann der Kriegsherr Tokugawa Ieyasu2 diese Stadt im Sumpf als Hauptsitz für seine Regierung, weitab vom Einfluss des Tennō, der nun fast isoliert und machtlos in der alten Kaiserstadt Kyōto residierte. Ieyasu ließ in der alten Hauptstadt eine Burg erbauen, in der er wohnte, wenn er einmal in Kyōto weilte. Ganz provozierend nannte er diese Burg Ni-Jō - Zweitwohnsitz.
Die Menschen von Kyōto sind heute noch davon überzeugt, dass die eigentliche japanische Kultur nur in der alten Kaiserstadt zu finden ist. Und tatsächlich liegen im Gebiet der Kaiserstadt 17 Orte, die als Weltkulturerbe gelten. In Tōkyō dagegen findet sich kein einziges Weltkulturerbe. Darum sind die Menschen in Kyōto heute noch besonders stolz auf ihre Kultur und ihre Geschichte.
Unser Bild von Japan ist zwar von dem riesigen Ballungsgebiet um Tōkyō geprägt, in dem ein Großteil der gesamten Bevölkerung lebt. Aber das Bild täuscht. Japan besteht aus einer Kette von Inseln mit den drei großen Hauptinseln Honshū (Hauptinsel), Shikoku (vier Länder) und Kyūshū (neun Provinzen). Erst im 19. Jahrhundert kam auch noch die große nördliche Insel Hōkkaidō (Hō - kai - dō - Bezirk des nördlichen Meeres) zum japanischen Kaiserreich hinzu. Vorher hatten dort im Wesentlichen nur die Ainu gelebt, ein Volksstamm, der nicht mit den Japanern verwandt ist. Zu diesen vier Hauptinseln kommen noch fast siebentausend kleine und kleinste Inseln hinzu, viele davon haben nur wenige oder überhaupt keine Einwohner.
Die großen Inseln sind von einem mächtigen Gebirge durchzogen, das sich ganz vom Norden bis in den tiefen Süden erstreckt. Die größte Fläche des Landes ist wilder, fast unzugänglicher Bergwald. Nur an den Küstenstreifen, dort wo das Marschland und die Sümpfe sind, kann man siedeln. Das Gebirge trennt den Osten und den Westen in zwei völlig verschiedene klimatische Bereiche. Im Osten herrscht mildes und feuchtes Klima, das vom weiten Ozean bestimmt ist. Hier gibt es kaum Schnee und die Temperaturen sinken fast nie unter den Gefrierpunkt. Der Westen wird von den kalten Winden, die von Sibirien kommen geprägt. Hier fällt so viel Schnee, dass die vielen Geschichten über die Yuki-onna, die Schneefrau nicht verwundern.
Die Berge mit ihren undurchdringlichen Wäldern sind auch deshalb nicht zu besiedeln, weil die Gebirge immer noch im Entstehen sind. Das macht sich in stetigen Erdbeben bemerkbar, die in manchen Zeiten nahezu täglich das Land erschüttern. Dann werden die Berge wieder ein ganz winziges Stück höher. Die Flüsse haben keine Zeit, um große, besiedelbare Flusstäler auszuwaschen. Die Auffaltung der Gebirge ist da fast schneller als das Wasser, das die Berge wieder abträgt. So kann man in den abgelegenen Gegenden stundenlang mit dem Auto unterwegs sein und stößt nur ganz selten auf winzige Ansiedlungen in einem kleinen Bergtal. Früher haben dort die Menschen in großen Familienverbänden gelebt, denn nur so konnten sie der Natur die lebensnotwendige Nahrung abringen. Es ist deshalb kein Wunder, dass viele Märchen und Volkslegenden von Naturwesen in den Bergen oder Wäldern erzählen. Heute werden diese abgelegenen Bergtäler von immer weniger Menschen bewohnt. In manchen Gegenden leben fast nur noch alte Menschen. Die jungen Leute sind abgewandert in Gegenden, in denen es angenehmer ist zu leben und zu arbeiten. So liegt in manchen Gebirgsgegenden das Durchschnittsalter nahe bei 80 Jahren oder sogar noch darüber.
Die modernen Städte liegen fast alle an der Ostküste in ursprünglich sumpfigen Gegenden, die in kurzer Entfernung von der Küste von steilen Bergen eingegrenzt sind. Man kann fast - mit nur wenig Übertreibung -sagen, dass man das gesamte besiedelte Gebiet der Japaner gesehen hat, wenn man mit dem Superschnellzug Shinkansen von Tōkyō bis zur Insel Kyūshū gefahren ist. Die Shinkansen Züge fahren im viertelstündlichen Takt. Im ‚hinteren Japan‘‘ auf der Westseite der Gebirge dagegen fährt oft nur noch ein einziger Zug am Tag, wenn man nicht überhaupt nur noch mit dem Bus reisen kann.
Abb. 1 Hokusai: Die große Welle
Wenn wir von Hokkaidō nach Süden fahren, reisen wir durch ganz unterschiedliche Klimazonen. Die nördliche Insel Hokkaidō hat ein Klima ähnlich dem in den bayrischen Alpen. Aber es gibt dort viel mehr Schnee als in den Alpen. Das kommt daher, dass sich die Wolken von Sibirien her kommend über dem Meer mit Feuchtigkeit aufladen. Diese Feuchtigkeit staut sich an den hohen Bergen und fällt im Winter als Schnee. Im ‚hinteren Japan‘ - dem Ura-Nihon - an der Westküste, die nach Sibirien hin zeigt, z.B. im Lande Hida in den ‚japanischen Alpen‘, fällt so viel Schnee, dass die Bauernhäuser dort spezielle Wintereingänge oben auf dem Dach des Hauses haben. Durch die normalen Haustüren konnte man das Haus im Winter nicht betreten, dazu lag der Schnee viel zu hoch. Der Vorteil davon ist, dass man eingehüllt vom Schnee fast wie in einem Iglu lebt. Es ist dann zwar dunkel aber doch immerhin recht warm. Ich war einmal am 1. Mai in dem Tempel Eheiji, den der Zenmeister Dōgen im 13. Jahrhundert dort in diesem ‚hinteren Japan‘ gegründet hatte. Es war furchtbar kalt und es regnete die ganze Nacht. Am Morgen wurde es noch kälter, und dichter Schnee fiel. Einer der Mönche, der aus dem östlichen Gebiet von der Küste kam, fragte einmal verzweifelt den Zenmeister dieses Klosters: »Seit Monaten, seit ich hier im Kloster bin, liegt Schnee. Wann gibt es denn eine Zeit, in der kein Schnee liegt?« Ungerührt antwortete der Zenmeister nur: »Wenn Schnee liegt, liegt Schnee, wenn kein Schnee liegt, liegt kein Schnee!«
Dafür fällt in der alten Kaiserstadt Kyōto, die nach Osten hin zum Meer offen ist, kaum Schnee. Es gibt zwar viele Postkarten mit den Tempeln im Schnee. Aber es kommt nur sehr selten vor, dass Schnee überhaupt liegen bleibt. Und wenn, dann ist er spätestens am frühen Vormittag verschwunden.
Auf der südlichen Insel Kyūshū dagegen herrscht schon ein subtropisches Klima wie in Nordafrika. Dort gibt es riesige Plantagen von Mandarinen und anderen Südfrüchten. Schnee ist dort unbekannt. Dafür ‚schneit‘ es in der südlichen Stadt Kagoshima ständig Asche aus dem Vulkan Sakurajima, der auf einer kleinen, vorgelagerten Halbinsel - der Insel der Kirschblüten - liegt. In Kagoshima wachsen Palmen und dort gibt es einen großen Park mit Kakteen - nicht im Gewächshaus, sondern unter freiem Himmel.
Und dabei ist Kyūshū noch nicht die südlichste Insel Japans. Noch südlicher, und berühmt für die vielen sehr alten Menschen, liegt die Inselgruppe um Okinawa. Aber eigentlich kann man Okinawa kaum noch zu Japan zählen. Ihre Bewohner sind fast schon Südseeinsulaner mit einer eigenständigen Kultur.
Von den vielen Erdbeben in Japan haben wir gesprochen. Aber das sind nicht die einzigen Schwierigkeiten, mit denen die Bewohner dieses Inselreiches zu kämpfen haben. Die Küstenstreifen werden in jedem Herbst von gewaltigen Stürmen, den Taifunen heimgesucht. Dann sitzen die Menschen gebannt vor den Fernsehgeräten und verfolgen den Verlauf der Stürme und die Zerstörungen, die sie anrichten. In der Kaiserstadt Kyōto spürt man relativ wenig vom Taifun.
Aber das Wetter wird neblig und feucht und es regnet in Strömen, weil der Wind die feuchte Meeresluft an den Rand der Gebirge treibt, wo sie als heftige Regenfälle niederkommen. Die Regenzeit im Frühjahr dauert um die 45 Tage. Im Süden Japans, in Kagoshima fallen dann während dieser Zeit durchschnittlich 1730 mm Regen. Zum Vergleich: In Berlin sind es im ganzen Jahr etwa 600 mm Regen. Der Rekord der Niederschlagsmenge liegt bei 153 mm in der Stunde. Ab 80 mm fällt das Atmen im Freien schwer und man fühlt sich, als würde man ertrinken. Die Regenzeit heiß in Japan Tsuyu - , wörtlich ‚Pflaumenregen‘. Eigentlich müsste man die Schriftzeichen als ‚bai-yu‘ lesen und das kann auch ‚Schimmel-Regen‘ heißen. Ich bin einmal während der Regenzeit in Japan gewesen. Trotz Regenmantel und Schirm war ich in kürzester Zeit total durchnässt, weil der feine Regen einfach unter den Regenmantel stäubte. Meine Schuhe wurden nicht mehr trocken und begannen in der feuchten Wärme zu schimmeln. Dichte Nebel verhängen die Berge und es wird unheimlich und geisterhaft. Kein Wunder, dass es so viele Geistergeschichten in Japan gibt.
An den Küsten ereignen sich immer wieder in unberechenbaren Zeitabständen gewaltige Tsunami, Flutwellen, die alles mit sich wegreißen, was ihnen im Weg steht. Die letzte große Flutwelle in Nordjapan ist uns ja allen noch in Erinnerung.
In Japan gibt es außerdem eine ganze Reihe von tätigen Vulkanen. Aber die sind kein wirkliches Problem, weil sie regelmäßig Feuer speien und damit kein großer Ausbruch bevorsteht. Der größte Vulkan der Welt ist der Vulkan Aso auf der Insel Kyūshū. Der Krater hat einen Umfang von 120 km. Aber weit entfernt davon, dass die Japaner den Aso fürchten: Er ist ein beliebtes Ausflugsziel. In der Nähe des Kraters sind sogar Parkplätze für die Besucher angelegt. Nur wenn der Aso etwas zu stark Gestein oder giftige Schwaden ausstößt, wird die Zufahrt zum Krater gesperrt. In der Stadt Kagoshima spannt man einfach Regenschirme auf, wenn der dortige ‚Hausvulkan‘ Sakurajima wieder einmal zu viel Asche ausspuckt.
Der berühmteste Vulkan Japans aber ist der Fuji-San, den wir meistens unter dem Namen Fujiyama kennen. Früher wusste kein Japaner, was ein Fujiyama sein soll. Inzwischen haben sie sich daran gewöhnt, dass Ausländer den Berg als Fujiyama bezeichnen. Bei uns weiß man, dass die Japaner das R und das L nicht unterscheiden können. Aber sie können auch kein F aussprechen. Das F klingt bei ihnen eher wie ein H. Also müsste man Huji sprechen. Yama ist das Schriftzeichen für den Berg - wenn man es auf Japanisch ausspricht. Aber der Fuji ist ein derart ehrwürdiger und wichtiger Berg, dass man das Schriftzeichen in der chinesischen Form als San ausspricht. Also heißt der Berg Hujisan. Was der Name Fuji bedeutet, weiß niemand so genau. Möglicherweise stammt er sogar noch von den Ureinwohnern, den Ainu und bedeutet Feuerberg. Aber das bestreiten viele japanische Wissenschaftler. Ein so heiliger Berg kann keinen Namen aus der Ainusprache tragen! Heute schreibt man seinen Namen mit den Schriftzeichen für ‚reich‘ und ‚Krieger‘, die zusammen als Fuji ausgesprochen werden.
Der Fuji war schon immer ein heiliger Berg. Nach der Legende ist er erst bei einem gewaltigen Erdbeben entstanden. In der Nähe der Kaiserstadt Kyōto liegt der Biwasee, der zu den ältesten Seen der Erdgeschichte zählt. Früher einmal waren dort, wo heute der See ist, wunderschöne Berge und Hügel, so erzählt jedenfalls die Sage. Nach einem gewaltigen Erdbeben war diese liebliche Landschaft verschwunden und ein gewaltiges und tiefes Loch klaffte, das sich mit Wasser füllte. Ein großer See in der Form einer Biwa, einer Art Laute, hatte sich gebildet. Und zu ihrer Überraschung bemerkten die Menschen, dass sich plötzlich weit entfernt ein gewaltiger Berg auftürmte, der aus den verschwundenen Bergen und Hügeln entstanden war - der Fuji. Auf geheimnisvolle Weise hatten sich die Erdmassen verschoben und neue Landschaften geformt.
1Heian-Kyō sprich: Heean kyoo
2Tokugawa Ieyasu 1543 - 1616. Nach der großen Schlacht von Sekigahara hatte er nach langen Kriegswirren die Oberherrschaft gewonnen. Als neuen Sitz seiner Regierung wählte er 1603 das schwer zugängliche Edo (Tōkyō) als Hauptstadt.
Religion in Japan
In Japan gibt es viele Geschichten von Göttern, wie dem Donnergott oder dem Windgott und Geschichten von Tieren, die Menschengestalt annahmen und mit den Menschen zusammenlebten. Es gibt aber auch viele Geschichten von Buddha. Das ist sehr verwir rend, denn es gibt verschiedene Religionen in Japan, den Shintō und den Buddhismus und sogar auch das Christentum.
Shintō - Weg der Götter
Die einheimische Religion Japans ist der Shintō. Wörtlich bedeutet Shintō ‚Weg der Götter‘. Aber eigentlich ist der Shintō nicht wirklich alt. Erst im 18. Jahrhundert versuchten die Politiker, eine ‚einheimische‘ Religion gegen die fremden Religion des Buddhismus zu etablieren. Der Buddhismus kam eindeutig aus der Fremde. Der Ursprung ist im Land des Buddha, in Indien zu suchen. Aber er kam nicht direkt von dort nach Japan, sondern über den Umweg über China und Korea.
In der japanischen Politik wollte man keine Religion aus Korea in Japan haben, also propagierte man den Shintō als einheimische Religion. Für den Namen der Religion musste man sogar auf die chinesische Sprache zurückgreifen: Shin - Gott oder Geist, Dō (zusammen mit Shin als Tō gelesen) - der Weg. Shin-Tō meint den ‚Weg der Götter‘.
Aber im japanischen Shintō verehrt man keine ‚shin‘ oder Götter, sondern Kami. Kami ist ein einheimisches japanisches Wort. Es ist nicht so sicher, ob man das Wort wirklich mit Gott oder Geist übersetzen kann, denn niemand weiß so genau, was Kami sind, auch die Priester, die an den Shintō Schreinen ihren Dienst tun, wissen das nicht so genau. Der Priester kennt zwar den Kami, der in seinem Schrein verehrt wird, aber er weiß nicht, in welchem Zusammenhang dieser Kami mit dem eines anderen Schreines steht. Die Verehrung der Kami kennt man in Japan schon seit den Urzeiten. Aber es gab keine über ganz Japan einheitliche Religion der Kami.
Abb. 2 Izumo Schrein
Das Wort Kami heißt eigentlich: »Die da oben« und damit waren ursprünglich die Sonne, der Mond und die Sterne gemeint.
An einem der ältesten Schreine Japans, dem Schrein von Izumo ganz im Süden der Hauptinsel Honshū haben Ausgrabungen ergeben, dass der ursprüngliche Schrein hoch oben auf riesigen Baumstämmen stand und nur über eine steile Treppe zu erreichen war.
Das Gebäude hatte eine gesamte Höhe von 48 Metern.1 Die Priester, die man im Modell als winzige Gestalten auf der Treppe erkennen kann, gingen eben zum Gebet zu ‚Denendort-oben‘, den Kami.
Oft sieht man auch, wie Japaner an einem Wasserfall oder einem Felsen stehen bleiben, kurz in die Hände klatschen, um den Kami aufzuwecken, der dort wohnt und dann für einen Augenblick still zu beten. Man weiß nicht, ob der Wasserfall oder der Felsen der Kami ist oder nur sein Wohnsitz. Wie dem auch sei, der Ort jedenfalls ist heiliger Boden.
Manchmal ist auch ein Baum ein Kami. Wenn dann eine neue Straße dort gebaut werden soll, wo der Baum steht, dann macht eben einfach die Straße einen großen Bogen um den Baum, denn schließlich kann man einen Kami nicht einfach abholzen. Damit jeder, der vorbei kommt, auch weiß, dass ein Kami dort wohnt, bindet man ein Seil aus Reisstroh um den Baum. Niemand weiß genau, in welcher Weise der Kami in diesem Stein mit dem Kami in jenem Baum zusammenhängt. Vermutlich haben sie nicht viel oder überhaupt nichts miteinander zu tun.
Nahezu alles, was existiert, kann ein Kami sein: ein Grashalm, eine Blume, eine Maus oder eine Schlange, ein mächtiger Baum, eine felsige Insel im Meer, ein Wasserfall, ein verstorbener Vorfahre, Sonne Mond und Sterne, ein Taifun. Aber der Kami des Felsens an d i e s e m Ort muss überhaupt nichts zu tun haben mit dem Kami des Felsens eines anderen Ortes. Alles kann heilig sein, aber ein Felsen, ein Baum oder eine Quelle sind eben genau an diesen einen Ort gebunden. Es gibt keinen Kami der Quellen oder der Felsen allgemein. Und es ist auch die Frage, ob es überhaupt einen obersten Kami gibt, der die gesamte Gesellschaft der Kami beherrscht oder ordnet. In den Mythen wird von den yaorozu no Kami, den acht Millionen Kami gesprochen. Das heißt aber nicht, dass es genau diese Anzahl von Kami gibt. Acht Millionen meint ganz einfach unendlich viel.
Einmal wurde Japan vor dem Angriff der Mongolen gerettet, weil ein göttlicher Wind, ein Kami-Kaze, die Flotte der Angreifer zerstörte. Die Grunderfahrung im Shintō ist, dass alles Wirkliche auch heilig und Kami sein kann.
Als man dann versuchte, den Staats - Shintōismus einzuführen, schüttelten die Priester in den vielen Schreinen nur die Köpfe. »Nur an ‚unserem‘ Schrein verehren wir unseren Kami nach der Tradition mit ganz besonderen Tänzen, bei denen die Tänzer ein ganz eigenes Kostüm tragen. Und das tun nur wir allein. Alle anderen Schreine verehren ihren Kami auf ganz andere Weise. Was hat unser Kami, der vielleicht als eine Art Schirm oder in der Gestalt eines weißen Fuchses erscheint mit den anderen Kami vielleicht in der Gestalt eines Baumes oder eines Felsens gemeinsam? Wie könnte es da einen einheitlichen Shintō geben?«
Wir bezeichnen die religiösen Stätten des Shintō als Schrein und die buddhistischen Stätten als Tempel. In der japanischen Sprache ist der Schrein ein Jinja2 und der Tempel ein Ji oder Tera. Der Daitoku-ji ist der Tempel der großen Tugend - Dai Toku ji. Der Inari Jinja der Schrein des Fuchsgottes Inari, der berühmt ist für seine 10 000 Torii - oder einfach nur wieder ganz viele Torii.
Ein Schrein kann so klein sein wie ein bayerisches Marterl, er kann aber auch ein riesiges Gebiet mit vieln Gebäuden umfassen. Das Wichtigste ist die Haupthalle Honden. Sie enthält in einem unzugänglichen und verschlossenen Bereich den ‚ehrwürdigen Körper des Kami‘ den go-shintai oder shintai. Das kann ein einfacher Stein sein, ein Spiegel oder ein Schwert. Immer aber ‚wohnt‘ in dem Shintai die Seele des Kami, die Mi-tama. Wird ein neuer Schrein gebaut, so muss man erst den Kami einladen, in dem Shintai seinen Wohnsitz zu nehmen. Weil nun dieser Schrein mit dem Kami im Inneren so heilig ist, darf er nur selten geöffnet werden. Manche Schreine werden nur einmal im Jahr für wenige Stunden geöffnet, manche nur alle 30 oder 50 Jahre. In Kyōtō gibt es einen winzigen Schrein, den Dai-Shogun-hachi-Jinja, den Schrein der acht großen Herrscher, die alle Himmelswesen sind. Dieser Schrein wurde vermutlich über 900 Jahre niemals geöffnet. Erst, als er baufällig war, hat man ihn geöffnet und darin einen Schatz von uralten Holz Figuren gefunden, die heute ein japanischer Nationalschatz sind. Sie werden in einem klimatisierten Betongebäude aufbewahrt, dass der Priester, wenn man ihn nett bittet, auch schon einmal für Besucher öffnet. Manchmal aber werden die Shintai bei Shintō Festen, den Matsuri, in kleinen tragbaren Schreinen durch die Straßen getragen. Das erinnert ein wenig an die Bundeslade, die von den wandernden Israeliten bei ihrem Zug durch die Wüste vor dem Zug hergetragen wurde.
Ursprünglich brauchte es überhaupt kein Schreingebäude, denn der Shintai kann auch einfach ein Baum, eine Quelle oder ein Felsen sein. Damit jeder erkennen kann, dass es sich nicht um einen einfachen Felsen handelt, wird geflochtenes Reisstrohseil herumgewunden und schon ist der Schrein fertig. Jedes Kind, das in Japan geboren wird, bringt man zum Shintō-Schrein, und meldet es bei den Kami an. Jeder Japaner gehört zum Shintō, weil ja alle nach ihrer Geburt am Schrein beim Kami angemeldet worden sind. Deshalb sagen die Japaner auch, Shintō ist keine Religion, sondern eine Familienangelegenheit.
1Zum Vergleich: Das Kirchenschiff der Frauenkirche in München ist 37 m hoch, der Petersdom hat eine Höhe von 132 m. Links unten der heutige Schrein. Foto aus Wikipedia.
2Jinja sprich: dschindscha
* Matsuri - Schreinfeste
Wenn irgendetwas untrennbar zum Shintō gehört, dann ist es das Matsuri, das Schreinfest. Schreinfeste sind bunt und laut. Es gibt so viele verschiedene Matsuri, wie es Schreine gibt und das sind mehr als einhunderttausend registrierte Schreine, vermutlich aber noch viel mehr, die nichtorganisiert oder registriert sind.
Ursprünglich war der Schrein kein Ort der religiösen Verehrung, sondern nur ein Ort des Matsuri. Erst später besuchte man auch außerhalb der Feierlichkeiten den Schrein. Es gibt Matsuri, bei denen die gewaltigen Trommeln geschlagen werden, Matsuri, bei denen getanzt wird oder riesige Fackeln begleitet von lauten Trommeln durch den Ort getragen werden. Manchmal werden auch Festwagen durch den Ort gezogen. Auf den Wagen sitzen Musiker mit Trommeln und Flöten- oder Puppenspieler, die die Göttergeschichten mit Puppen darstellen. Ein Matsuri ist immer bunt und voller Leben, keinesfalls eine ernste oder gar meditative Angelegenheit.
Feuerfest in Kurama
Nördlich von der alten Kaiserstadt Kyōto gibt es in dem Bergdorf Kurama das Feuerfest. Das Fest beginnt mit Einbruch der Dunkelheit, aber es ist günstig, schon früher mit dem Zug anzureisen. Sonst wartet man einige Stunden, bis man den Zug überhaupt besteigen kann. Und wenn man dann oben im Dorf ankommt, kann man kaum noch den Bahnhof verlassen, weil sich die Menschen dicht zusammendrängen. Die jungen Burschen des Dorfes schleppen riesige Reisigfackeln durch den Ort, die Frauen schlagen die Trommeln und das Publikum schreit begeistert: »Unser Matsuri ist das Beste!« Wenn es dunkel wird, brennen die Fackeln lichterloh und es wird recht gefährlich, sie überhaupt noch zu tragen. Aber die Burschen schwenken und schleudern die Fackeln wild herum, dass die Funken stieben. Wenn dann mal wieder die Feuerwehrsirenen heulen, ruft das nur ein Gelächter hervor. Die Straßen sind von der Feuerwehr mit Seilen abgesperrt, damit niemand den gefährlichen Fackeln zu nahe kommt.
Abb. 3 Feuerfest in Kurama
Wir gingen bis zur Absperrung vor und der Feuerwehrmann hob das Seil freundlich hoch, damit wir direkt hinter den Fackeln hergehen konnten. Obwohl das ganze Dorf brodelte wie ein Hexenkessel, waren alle immer ausgesprochen freundlich. Ganz besonders die Burschen mit den Fackeln freuten sich, dass Ausländer zusammen mit ihnen hinter den Fackeln gehen mochten.
Wenn die Fackeln dann lichterloh brennen und die Schlingpflanzen, mit denen sie zusammengebunden sind, Feuer gefangen haben, rennt die Gruppe, so schnell sie kann zu einem Kieshaufen am Eingang zum Schrein, um die Fackel dort auf den Haufen von anderen Fackeln zu werfen. Die Flammen schlagen hoch in den Himmel und die umstehenden Baumwipfel brennen.
Wenn das nächtliche Fest sich langsam dem Höhepunkt zuneigt, dann wird von ganz oben vom Berg, wo der Schrein steht, in einem Mikoshi, einem tragbaren Schrein der Shintai, der Kami Leib herumgetragen, dicht gefolgt von Fackeln und den wild geschlagenen Trommeln. Das Fest endet weit nach Mitternacht, wenn die zahlreichen Besucher mit dem letzten Zug wieder gefahren sind. Erst in den frühen Morgenstunden wird das Dorf wieder ganz still.
Yasurai Matsuri im Imamiya Schrein
In der Kaiserstadt Kyōto sind die Matsuri nicht ganz so wild wie auf dem Land oder in den Bergen. Aber dennoch ist das Yasurai Matsuri berühmt für die wilden Tänze der Oni, der geplagten Geister. Ganz im Norden der Stadt liegt der Imamiya Schrein, der für dieses Matsuri berühmt ist. In der direkten Nachbarschaft des Schreines liegt die Tempelstadt des buddhistischen Daitokuji Tempels mit vielen kleinen Untertempeln. Wenn man in der Stille der Zengärten weilt, dann hört man oft eine merkwürdige Musik mit Trommeln, Gongs und hellen Glocken. Das ist die Musik zu dem berühmten Tanz des Imamiya Schreines, die schon lange vor dem Matsuri eingeübt werden muss. Bei dem Matsuri wird der Kami in Gestalt eines großen Schirmes durch die Straßen getragen. Junge Männer tanzen in roten Gewändern mit langen schwarzen und roten Perücken zu dem Klang von Glocken, die sie schlagen und zum schrillen Pfeifen der begleitenden Flöten.
Abb. 4 Tanz der Oni
Abb. 5 Yasurai Matsuri: Dämonen ziehen durch den Daitokuji Tempel
Sie stellen die Oni dar, hässliche und abschreckende Gestalten, die ursprünglich aber positive Helfergestalten waren. Sie vertreiben die bösen Geister, die sich im Frühjahr verbreiten und Krankheiten verursachen können. Mit ihrem Tanz ziehen sie durch das ganze Stadtviertel und auch durch das Tempelgelände des buddhistischen Daitokuji, bevor sie lange Tänze vor dem Schrein aufführen, bis sie in eine Art Trance geraten.
Shichi-Go-San: Sieben-Fünf-Drei
Weil Shintō eine Familienangelegenheit ist, besucht man bei allen Familienangelegenheiten den örtlichen Schrein. Dabei geht man nicht zu irgendeinem Schrein, sondern zum Schrein der Familie, der gewöhnlich ganz in der Nähe der Wohnung liegt. Man heiratet am Schrein, indem man den von der Miko, der Schamanin servierten Reiswein trinkt und man stellt die neu geborenen Kinder dem Kami vor. Im Alter von jeweils drei fünf und sieben Monaten oder Jahren besucht man den Schrein. Der Priester führt die Reinigungszeremonien durch und die Schamanin tanzt für die ganze Familie. Dabei werden die Kinder prächtig herausgeputzt.
Abb. 6 Die Miko tanzt
Die Knaben werden mit dem Hosenrock, der Hakama gekleidet, den früher die Samurai über ihrem Kimono trugen, wenn sie auf dem Pferd ritten. Weil dieses Kleidungsstück immer ziemlich streng nach Pferd roch, legte man den Hakama noch in den Vorräumen der Wohnung ab. Aber heute gilt es bei den Japanern als besonders festlich, wenn man einen Hakama trägt. War man beim Schrein und hatte das neue Lebewesen beim Kami ‚registriert‘, so kümmerte der sich fortan um das Schicksal dieses Schreinmitgliedes.
Abb. 7 Shichi-Go-San
Wenn man den Wohnort wechselte, suchte man einen Schrein, der mit dem heimischen Schrein in Verbindung stand, und meldete sich hier wie beim Einwohnermeldeamt an.
Buddhismus in Japan
Für die spirituelle Entwicklung der Menschen oder für Zeremonien zu ihren Tod ist der Buddhismus zuständig. In der japanischen Geschichte hat sich so im Laufe der Zeit eine Arbeitsteilung zwischen dem Shintō und dem Buddhismus entwickelt. Wer sich in Meditation üben will oder wer Trost bei Krankheit oder Tod sucht, geht in den buddhistischen Tempel. Wenn man in Japan stirbt, bekommt man als Buddhist einen neuen Namen. Und alle Japaner wollen nach dem Tod einen schöneren Namen haben, also verehren sie heute noch den Buddha.
Japaner werden also als Shintō geboren und sie sterben als Buddhisten. In den großen Kriegszeiten des 16. Jahrhunderts wollte das Shogunat gerne wissen, wie viele Japaner eigentlich in Kyōto leben. Aber es war nicht möglich, eine Volkszählung zu veranstalten, weil ja ohnehin jeder Japaner der Meinung war, dass man ja beim Kami im Schrein gemeldet war. Da musste man sich nicht auch noch bei einer staatlichen Stelle melden. So wurde der Brauch eingeführt, dass man nach seinem Tod einen neuen buddhistischen Namen bekommen kann, wenn man in dem lokalen Tempel registriert ist. Die Tempel führten nun genau Buch und so konnte das Shogunat abschätzen, wie viele Japaner in der Stadt lebten. Der posthume Name ist für manche Priester oder Künstler viel wichtiger als der Name, unter dem sie zu Lebzeiten bekannt waren.
Manchmal heiratet man auch nach christlichem Brauch, einfach, weil die westlichen Brautkleider so schön sind. So kommt es auch, dass bei Zählungen über die Religionszugehörigkeit regelmäßig weit über 100% der Gesamtbevölkerung gezählt wird.
Der Buddhismus kam um das Jahr 552 von Korea nach Japan. Damals gab es das Land Japan noch nicht, es hieß vielmehr das Land Yamato und das war nur die fruchtbare Ebene um die alte Kaiserstadt Nara, die es damals auch noch nicht gab. Der Kaiser des Landes war Kimmei, aber sein Titel war noch nicht Tennō - Himmelssohn - sondern nur ‚Amenoshita Shiroshimesu Ōkimi‘ was so viel bedeutet wie der ‚große König, der alles unter dem Himmel regelt‘. Tennō konnte er noch nicht heißen, weil der Titel aus China stammt und von China wusste man damals im Lande Yamato noch recht wenig. Aber immerhin hatte er sechs kaiserliche Gemahlinnen und 25 Kinder.
Korea bestand damals aus den drei Königreichen Silla und Baekje im Süden und Goguryeo1 im Norden. Der König von Baekje ließ eine Buddhafigur aus Bronze anfertigen, die fast 5 Meter hoch war. Die schickte er zusammen mit einem ganzen Packen von Schriftrollen, Mönchen und Gelehrten als Geschenk an den Kaiser Kimmei nach Yamato.2 Sein Geschenk erläuterte er dem Kaiserkollegen in einem Brief:
Die Lehre [des Buddha] ist die erhabenste unter allen Lehren. Doch sie ist schwer zu verstehen und kaum zugänglich. Selbst der Fürst von Zhou und Konfuzius wussten nichts davon. Diese Lehre belohnt uns mit Wohlstand und Tugend in unvorstellbarem, grenzenlosem Ausmaß, sie führt uns zur höchsten Erleuchtung. Wenn etwa jemand einen Schatz besäße, durch den sich alles, was er benötigt, nach dem Willen seines Herzens fügt, so wäre das gerade so wie der Schatz dieser wunderbaren Lehre. Alles, worum er betet und bittet, geht in Erfüllung, an nichts fehlt es ihm mehr.
Das war nun ein Versprechen so ganz nach dem Herzen des Kaisers. Wer wollte nicht einen solchen Schatz besitzen? Er tanzte vor Freude: »Noch niemals zuvor habe ich eine so wundervolle Botschaft vernommen! Aber ich kann das nicht allein entscheiden«, und so fragte er seine Myriaden von Ministern, einen nach dem anderen: »Alle Länder des Westens verehren den Buddha und man hat noch niemals zuvor solch eine wunderbare Botschaft vernommen. Sollen wir ihn nicht auch verehren und anbeten?«
Der Minister Soga no Iname no Sukune aus der mächtigen Familie der Soga antwortete: »Wenn alle westlichen Länder den Buddha verehren, wie könnten wir, das Land Yamato beiseitestehen?«
Aber sein einflussreicher Gegner aus der Familie der Monobe entgegnete: »Der König und Regent unseres Landes hat immer die einhundertachtzig Götter des Himmels und der Erde, des Landes und der Getreide in Frühling, Sommer, Herbst und Winter verehrt und ihnen Opfergaben dargebracht. Wenn er das künftig nicht mehr tun würde, und statt dessen einen fremdländischen Gott verehrt, so fürchte ich den Zorn der Götter unseres Landes!«
Also beschloss der Kaiser, dass der Minister aus der Familie der Soga einen Tempel für Buddha errichten sollte, damit man sehen konnte, was passieren würde. Er selbst aber und die Familie der Monobe wollten weiterhin den Göttern des Landes die Ehre erweisen.
Aber kaum war der Tempel für Buddha errichtet, als das Land von verheerenden Plagen gequält wurde, die immer schlimmer wurden. Da sagte der Minister der Monobe: »Früher, als wir den Buddha noch nicht verehrt haben, gab es diese Plagen nicht. Es ist deutlich, dass die Götter unseres Landes erzürnt sind!« Also ordnete der Kaiser an, dass man die Buddhastatue im See von Naniwa 1 versenken und den Tempel anzünden sollte. Aber kaum brannte der Tempel lichterloh, als sich ein fürchterlicher Sturm erhob und ein gewaltiger Regen fiel. Ganz plötzlich stand sogar der Kaiserpalast in hellen Flammen. Da war allen klar, dass sich der neue Gott, der aus Korea gekommen war, der aber von weit her aus Indien stammte, so mächtig war, dass man ihn besser auch verehren sollte.
Und so kommt es, dass seit alter Zeit in Japan zwei Religionen nebeneinander bestehen: Die Verehrung der einheimischen Kami und die des fremden Buddha, der damals noch als Gott mit indischer Herkunft verehrt wurde.
Das Jahr 552, in dem der Buddha aus Korea nach Japan gekommen sein soll, ist ein ganz besonderes Jahr. Damals dachte man, es sei das Jahr 1501 nach dem Eingang von Buddha in das Nirwana. Die Zeit aber war im Buddhismus in drei Abschnitte eingeteilt, die jeweils 500 Jahre dauern sollten. Jetzt, nach 1500 Jahren würde das letzte Zeitalter beginnen, das 500 Jahre dauern und vielleicht mit dem Untergang der Welt enden würde. Sicher l aber mit dem vollkommenen Verfall der Lehre Buddhas. So kam der Buddhismus gerade noch rechtzeitig nach Japan. Und um das Jahr 1000 herum war man in Japan fest davon überzeugt, dass man in dieser schrecklichen Endzeit lebte.
Am Beginn ihrer Geschichte konnten die Japaner nicht lesen und schreiben, weil sie einfache Bauern und Fischer waren. Später aber lernten die Japaner von den Chinesen das Lesen und Schreiben, weil sie keine andere Schrift kannten. Genau besehen waren es die Koreaner, von denen die Japaner das Lesen lernten. In Korea kleidete man sich damals wie in China, man sprach und schrieb Chinesisch, und verehrte den Buddha wie in China. Von Japan nach Korea ist es viel näher als nach China. Außerdem gab es viele verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Korea und Südjapan.
In Japan dachte man, dass Menschen, die lesen und schreiben konnten, auch die mächtigere Religion haben müssen. Und damals verehrten die Koreaner wie die Chinesen den Buddha. Die Verehrung des Buddha war aus Indien zu den Chinesen gekommen, aber das wusste damals in Japan niemand. Also bemühte man sich, von den Koreanern zu lernen, wie man in China den Buddha richtig verehrt.
Man könnte meinen, die Japaner nehmen es nicht so genau mit der Religion. Dass sie ihre Götter nicht immer ganz ernst nehmen, werden wir in den Geschichten vom Donnergott hören. Aber auch vom Buddha gibt es fromme und weniger fromme Geschichten. Der ehrwürdige Daruma gar, der den Zen nach China und Japan gebracht hat, ist sehr oft Gegenstand von ganz und gar respektlosen Geschichten. Aber ist es nicht schön, wenn man ganz tolerant überall das Schönste nimmt und aus Freude am Leben tüchtig feiert und auch einmal kräftig über seine Heiligen lachen kann?
1Gorguyeo, das größte der drei Reiche erstreckte sich südlich von Seoul bis an die chinesische Grenze im Norden. Es entsprach also in etwa dem heutigen Nordkorea. Der Süden war aufgeteilt in die beiden Reiche Silla im Osten und Beakje in Westen.
2Die Begebenheit wird ausführlich berichtet in der alten Chronik Nihon Shoki im Kapitel über Kimmei.
1Naniwa ist der alte Name von Ōsaka
Buddhismus und Zen
Als ich das erste Mal nach Japan gereist bin, war ich sehr aufgeregt, dass ich einen richtigen Zentempel besuchen konnte, wo ich doch schon viele Jahre Zenmeditation geübt hatte. Gleich neben unserer Unterkunft lag ein Zentempel - so glaubt ich damals jedenfalls. Aber die Mönche beteuerten, dass sie mit Zen nichts zu tun hatten, sie waren Anhänger der Nichiren Shū. Das hatte ich noch nie gehört. Langsam lernte ich, dass die wenigsten Tempel in Japan zum Zen gehören. Es gab da den Shingon Shū, den Tendai Shū, die Jōdo Shū und die Jōdo Shinshū, Hossō Shū und viele andere. Sogar beim Zen gibt es den Rinzai Shū, den Sōto Shū, den Obaku Shū oder den Fuke-Shū. Das Wort shū steht dabei für eine Schule. Im Westen übersetzt man das gern mit ‚Sekte‘. Aber die verschiedenen Schulen sind keine Sekten.
Die Vielfalt der unterschiedlichen ‚Schulen‘ des Buddhismus in Japan ist für uns verwirrend. Japan ist das Land mit den meisten ‚neuen Religionen‘ auf der Welt. Wenn heute ein Meister einer bestimmten Schule über seinen Lehrer hinauswächst, gründet er eine neue Schule. Es gibt aber auch ganz einfach sehr reiche Menschen, die einen Tempel bauen, eine neue Schule der Religion, meistens des Buddhismus gründen und Anhänger um sich versammeln.
Es gab einmal eine bebilderte Anweisung in der Art eines Manga für Japaner, die ins Ausland reisen. Dort stand in etwa: »Wenn du ins Ausland kommst, wird dir das Merkwürdige passieren, dass man dich nach deiner Religion fragt. Dann sag, du seist Zen-Buddhist, das kennen sie!«
Der Zen hat einmal in Japan eine wichtige Rolle gespielt. Viele Samurai wurden Zenmönche und das Shogunat förderte die Zentempel, die zu mächtigen Institutionen heranwuchsen. Zenmönche haben viele Kulturgüter Japans geschaffen. Aber heutzutage möchten nur noch wenige Japaner etwas mit Zen zutun haben. Zen ist für Ausländer! Den Japanern sind die strengen Zenübungen zu anstrengend.
Die Samurai haben den japanischen Zen geprägt. Es ging um das Durchhalten und um strenge Einhaltung von Regeln. In Korea und China war und ist der Zen nicht so streng wie in Japan. Ein Japaner hat mir einmal gesagt: «Wenn du Zen kennenlernen willst, geh nach Kalifornien!« Aber das ist heut nicht mehr so. Es gibt in Japan inzwischen eigene Zen Ausbildungstempel für Ausländer. Nicht etwa, weil sie die Strenge in den japanischen Tempeln nicht aushalten würden, sondern vielmehr umgekehrt. Die jungen japanischen Mönche, die einmal den Familientempel übernehmen möchten, wollen nicht so streng üben wie die Ausländer! Einer der strengsten Zen-Tempel in Japan, der Antaiji, wird von einem deutschen Abt geleitet!
Die Samurai haben den Zen geprägt. Zen war für sie keine Religion, in der man Götter anbetete und aufwendige Zeremonien gestaltete. Sie mussten Kriege gewinnen und brauchten einen klaren und wachen Geist. Der Glaube an Geister oder übernatürliche Mirakel würde sie nur von ihren Aufgaben ablenken und den Geist täuschen. Der nicht spekulative Geist der alten chinesischen Zenmeister passte zur nüchternen Klarheit der Samurai. Einmal wurde der alte chinesische Meister Chao-Chu, den die Japaner Jōshū nennen, von einem Mönche nach dem Wesen des Buddha gefragt. Meister Jōshū antwortete nur mit einer Frage: »Hast du deine Reisschale schon gewaschen?«. Einmal fragte Jōshū seinen Lehrer Nanzen: »Was ist der WEG?« Nanzen antwortete: »Der alltägliche Geist!«. Ein andermal sagte Jōshū:
Wenn ihr euer ganzes Leben im Kloster verbringt und fünf oder zehn Jahre lang kein Wort sprecht und euch die Leute noch immer nicht als Dummköpfe bezeichnen, dann kann euch nicht einmal Buddha retten.
Der japanische Zenmeister Mūso Soseki1 sagte in einem Gespräch mit dem Bruder des Shōgun Ashikaga Takauji (1305–1358), das er unter dem Titel »Gespräche im Traum« aufzeichnete:
Zenschüler sollten ihre alltäglichen Tätigkeiten inmitten der Meditation verrichten und die Meditation inmitten ihrer alltäglichen Verpflichtungen. Besondere Übungszeiten sind für diejenigen erfunden worden, die ihren Geist nicht in einer solchen Weise auf den Weg konzentrieren können.
Zen, wie ihn Mūso Soseki und mit ihm die Samurai verstanden, ist ganz und gar im Alltag zu verwirklichen. Mitten in den alltäglichen Tätigkeiten ist Zen. Mūso Soseki schreibt:
Ein Zenmeister sagt: »Wenn du gehst, achte aufs Gehen; wenn du sitzt, achte aufs Sitzen; wenn du dich hinlegst, achte aufs Liegen; wenn du siehst und hörst, achte aufs Sehen und Hören; wenn du wahrnimmst und erkennst, achte aufs Wahrnehmen und Erkennen; wenn du dich freust, achte auf die Freude, wenn du wütend bist, achte auf die Wut.« Diese Achtsamkeit (auf den Augenblick) wird zum Erwachen führen.1
Fast alle der großen Daimyō, der Fürsten und Kriegsherren lebten, wenn sie in der Hauptstadt Kyōto weilten, in einem eigenen Zentempel, der von einem Zenmeister geführt wurde. Dort übten sie sich in der Zen Meditation und in der Teezeremonie. Die Zentempel bildeten regelrechte kleine Städte mit vielen Untertempeln. Einer davon ist der Daitokuji im Norden von Kyōto mit heute noch 22 Untertempeln. In der Sengoku Zeit2, der Zeit der kämpfenden Länder war der Daitokuji eines der kulturellen Zentren des Landes.
1Mūso bezieht sich unmittelbar auf die Satipatthana Sutta (Sutra), einer Lehrrede des Buddha, der ältesten Anweisung zur Achtsamkeit: »..verweilt ein Mönch, den Körper betrachtend, unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit ... die Gefühle betrachtend unermüdlich ...Das Verlangen und die Betrübtheit betrachtend unermüdlich, wissensklar ....
Japan und Europa
- Eine fast vergessene Geschichte