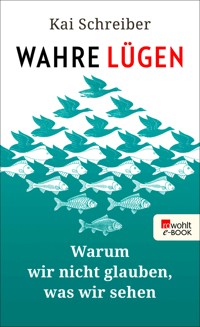
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ob es um Gesundheit, Politik oder Fake-News geht: Warum sehen wir nur das, was wir sehen wollen? Der Neurowissenschaftler Kai Schreiber hat eine überraschende Erklärung: Dass wir irrational denken und handeln, hat vor allem mit unserer Wahrnehmung zu tun. Ein Konzept wie "Wahrheit" ist evolutionär verzichtbar, da es zum Überleben einer Art wenig beiträgt. Dennoch können wir Wahrheiten erkennen – vorausgesetzt, wir wissen, wie die Erkenntnisfallen zu umgehen sind. Kai Schreiber überträgt neueste Forschungsergebnisse auf unseren Alltag und räumt dabei auf mit Fatalismus und engstirnigem Eigennutz. Ein fundierter wie unterhaltsamer Wegweiser durch den Irrgarten des Wahrnehmens und Denkens – für alle, die die Welt sehen wollen, wie sie wirklich ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kai Schreiber
Wahre Lügen
Warum wir nicht glauben, was wir sehen
Über dieses Buch
Warum halten wir Haie, Weißmehl und Terroristen für tödliche Bedrohungen, während wir die wirklichen Gefahren unseres Alltags – zum Beispiel im Straßenverkehr – schlicht ignorieren? Ob es um Gesundheit, Politik, Fake-News oder andere Formen der Manipulation geht: Wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Doch warum ist das so? Der Neurowissenschaftler Kai Schreiber hat eine überraschende Erklärung: Dass wir irrational denken und handeln, hat nicht nur mit Dummheit, sondern mit unserer Wahrnehmung und ihren Grundfunktionen selbst zu tun. Ein Konzept wie «Wahrheit» etwa ist evolutionär verzichtbar, da es zum Überleben einer Art wenig beiträgt; und es ist gerade unsere Fähigkeit zu sozialer Kooperation, die uns auch empfänglich macht für Suggestion und Fehlinformation. Dennoch können wir objektive Wahrheiten erkennen – vorausgesetzt, wir wissen, wo Erkenntnisfallen lauern und wie sie zu umgehen sind.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Frank Ortmann
Umschlagabbildungen: picture alliance/Photoshot
ISBN 978-3-644-10078-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Einleitung
«Zu den auffälligsten Merkmalen unserer Kultur gehört die Tatsache, dass es so viel Bullshit gibt.»
Der inspirierend direkte Anfangssatz des Essays «On Bullshit» des amerikanischen Philosophen Harry S. Frankfurt drückt eine einfache Wahrheit aus und spricht damit einen wichtigen Aspekt menschlicher Kommunikation an.[1] Bullshit, das ist Frankfurts Definition zufolge jede Mitteilung, die versucht, den Empfänger von etwas zu überzeugen, ohne Rücksicht darauf, ob es wahr oder falsch ist. Seine Beobachtung, dass solch wahrheitsfernes Gerede nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel ist, läuft der üblichen Darstellung öffentlicher Diskurse und Debatten zuwider, wonach im Aufeinandertreffen der Ideen stets jene gewinnt, die die besseren Argumente und überzeugenderen Belege für sich reklamieren kann. Diskurse des Vernunftwesens Mensch, sagt diese Erzählung, dienen der Suche nach der Wahrheit, und ihr Auffinden ist eine noble Gemeinschaftsleistung.
Kaum eine Darstellung kollektiver Wahrheitsfindung könnte falscher sein, oder jedenfalls irreführender. Die Gesetze, die Streitgespräche und Debatten leiten, sind nur in Ausnahmefällen die sogenannt rationalen, und oft spielen ganz andere Faktoren als die Suche nach der Wahrheit eine derart starke Rolle, dass man beinahe fassungslos zuhört: Wie kann man scheinbar aufrichtig unplausible Argumente für etwas herbeizerren, das doch offensichtlich falsch ist? Und der ermüdende Verlauf vieler privater und öffentlicher Debatten ist nur die Spitze eines titanischen Eisberges.
Denn auch die Wahrnehmung der Debattenteilnehmer ist ja nicht, was das Wort selbst uns zu versprechen scheint. Sie folgt ihren eigenen verborgenen Gesetzen. Und die sind weit entfernt vom idealisierten Bild, das der Aufruf an jeden Unwissenden malt, er möge doch bitte einfach seine Augen öffnen und hinschauen, dann werde er schon sehen. Dieses Bild von der Wahrnehmung als einem Mittel zur direkten Destillation der Wahrheit aus den unsortierten Wirrnissen der Welt, als dem aufrichtigen Versuch, die Puzzlestücke auf der Suche nach dem verborgenen Puzzlemotiv[2] richtig zusammenzusetzen, ist nicht einfach nur falsch. Nein, dieses Bild, das unser eigenes Gehirn uns über das Wesen unserer Wahrnehmung vorgaukelt, ist falsch mit Hintergedanken. Es versucht, uns von bestimmten Dingen zu überzeugen, ohne Rücksicht auf die tatsächliche, objektive Wahrheit. Es ist, mit anderen Worten, Bullshit.
Kluge Argumente oder Bullshit: Aus der Entfernung sieht alles aus wie heiße Luft.
Mit seiner Beobachtung der Allgegenwart des Bullshits traf Frankfurt jedenfalls punktgenau ins Herz der Dinge. Endlich sprach einer aus, was alle unterschwellig ahnten, endlich wurde das Unbehagen in Worte gefasst. Der zunächst in einer Literaturzeitschrift erschienene Aufsatz wurde 2005 vom Hausverlag der Princeton University als Büchlein veröffentlicht und trat einen weltweiten Siegeszug an. Aus der Beobachtung, dass Propagandalügen unsere Gegenwart und unsere Diskussionen durchziehen wie Schmelzrisse die antarktische Eisplatte, wurde ein internationaler Bestseller.
Eine schöne und plausible Geschichte, aber leider ist auch sie Bullshit, denn erstmals erschienen war der Aufsatz schon 1986, zwischen der Erstpublikation und dem Bestsellerstatus lagen also zwanzig lange Jahre.
Nun kann man sich eine andere Geschichte bauen, wonach eben für Frankfurts Idee die Zeit 1986 noch nicht reif war. Die amerikanische Öffentlichkeit brauchte erst die industriell organisierte Bullshitausbringungsmaschinerie des Clinton-Skandals und hatte erst die Verlogenheit der öffentlichen Propaganda für den dritten Irakkrieg erleben müssen, um Frankfurts Beobachtungen so recht schätzen zu können. Vielleicht war damals, in den letzten Sekunden vor dem weltweiten Siegeszug der Bullshitkrake[3] Internet, insgesamt noch gar nicht genug plausibel klingender Blödsinn in die Welt gestemmt, um den breiten Bedarf für seine Analyse zu wecken.
Diese Erklärungen fühlen sich beim Lesen vermutlich diffus einleuchtend an, denn sie besitzen als Narrativ eine gewisse innere Stringenz und behaupten vorstellbare kausale Zusammenhänge, von einer Art, wie wir sie zu kennen glauben, und das sind ja die besten kausalen Zusammenhänge von allen. Solchen inneren Stringenzen und Erzählungen von Ursache und Wirkung folgen wir jederzeit gern. Wir werden uns im Verlaufe dieses Buchs genauer ansehen, warum das eigentlich so ist, ja sogar so sein muss.
Aber, um es noch mal zu unterstreichen, dergleichen kausale Erzählungen und speziell die hier angebotenen Erklärungen für die zwanzigjährige Verzögerung der Bullshitanklage haben eine interessante Schwäche: Sie sind selber Bullshit. Sie kommen nämlich komplett ohne Belege aus, also ohne das, was Wissenschaftler etwas förmlich und steif Daten nennen.[4]
Diese Haltung wurde vom amerikanischen Journalisten und Humoristen Mark Twain ganz gut zusammengefasst, als er sarkastisch schrieb: «Lassen Sie die Wahrheit niemals einer guten Geschichte im Weg stehen.» Oder vielleicht wird sie noch besser dadurch zusammengefasst, dass das Zitat überhaupt nicht von Mark Twain stammt, obwohl man es online mehrfach findet und Sie mir vermutlich gerade geglaubt haben. So wie auch viele andere populäre Zitate nicht von ihren angeblichen Urhebern stammen.
Ernüchternd? Enttäuschend?
Thomas Henry Huxley ist für seine vehemente Verteidigung der Evolutionstheorie als Darwins Bulldogge in die Geschichte eingegangen. Der Biologe wurde der Stammvater eines ganzen Clans bedeutender Wissenschaftler und Autoren. Unter seinen Enkeln finden sich mit Aldous Huxley, dem Autor der «Schönen neuen Welt», mit Julian Huxley, dem Erstdirektor der Unesco, und mit dem Physiologen Andrew Huxley, der an einem kunstvoll zerlegten Riesenkalmar die Mechanismen der Signalleitung in Nerven demonstrierte und dafür mit seinen Kollegen John Eccles und Alan Hodgkins den Nobelpreis einfuhr, mindestens drei intellektuell schwergewichtige Nachfahren. Thomas Henry jedenfalls nannte den «Totschlag einer wunderschönen Theorie durch hässliche Fakten» in einem Vortrag vor der British Association die «große Tragödie der Wissenschaft». Und in dieser richtigen Beobachtung, dass nämlich das Widerlegen einer falschen Theorie durch Beobachtung uns nicht als Triumph der Erkenntnis, als Fortschritt, als Licht in der Dunkelheit, sondern eben als eine Tragödie erscheint, als Ermordung der Schönheit selbst, liegt eine übergeordnete und weitergehende Tragödie, die Tragödie nämlich der Wahrnehmung.
Dass sich oft nicht das Richtige für uns schön, gut und eben richtig anfühlt, sondern das Althergebrachte, das von mächtigen Autoritäten Gestützte und das überzeugend, will sagen: laut und mit mächtig Schmackes Vorgetragene, das führt dazu, dass Aberglaube und Irrlehre eine auf den ersten Blick erstaunliche Beharrlichkeit aufweisen. Dass diese Mechanismen der Wahrnehmung durchaus ihren Sinn haben, dass es sich aus einleuchtenden Gründen gut, aufregend und belebend anfühlt, ihnen nachzugeben und den Instinkten zu folgen, die uns die Evolution mitgegeben hat, dass aber aus den irrtümlichen Glaubenssätzen, die sich da so gut anfühlen, oft schädliche und mitunter katastrophale Folgen erwachsen, ist das Wesen dieser Tragödie. Es sollte uns insgesamt eine Lehre sein.
Ist es aber nicht.
Wie die amerikanische Journalistin Kathryn Schulz in ihrem Buch «Being Wrong» schreibt, fühlen sich Rechthaben und komplett Falschliegen leider exakt gleich an. Mit gutem Gefühl und fester Überzeugung glauben wir den größten Quark und staunen dann gar nicht schlecht, wenn uns die empirischen Fakten auf den Boden der Tatsachen zurückholen. «Das war falsch? Aber es fühlte sich doch so richtig an», rufen wir erstaunt, während aus dem Fesselballon unserer Irrtümer mit kläglichem Rauschen die heiße Luft entweicht und uns die Tatsachen wie Bleigewichte an den Füßen hängen.
Denn wie der amerikanische Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Neil DeGrasse Tyson schrieb, ist das Gute an der Wissenschaft, dass ihre Erkenntnisse wahr sind, egal ob man an sie glaubt oder nicht.[5] Weil Tyson diesen Satz twitterte, hatte er ein bisschen vereinfachen müssen: Natürlich sind wissenschaftliche Theorien nicht automatisch wahr. Ihre Wahrheit ist noch nicht einmal unabhängig von anderen Dingen, die wir für wahr halten. Ob ein Elektron Gras frisst oder nicht, hängt natürlich davon ab, ob wir ein Elektron für ein elektrisch geladenes Elementarteilchen halten oder für einen wiederkäuenden Paarhufer. Aber sobald wir uns dafür entschieden haben, dass die Kuh Elektron heißen soll, ist es eine empirische Frage, was die Elektronen auf der Weide zu sich nehmen. Wir ebenso wie die Elektronen selbst können uns einbilden, dass sie Kekse knabbern, aber die objektive Wahrheit wird ans Licht kommen: «Moment mal, das ist Gras. Wir haben die ganze Zeit Gras gefressen.» (Gary Larson)
Und diese Unterwerfung unter das Urteil objektiver Messergebnisse unterscheidet die Unternehmung Wissenschaft von Religionen, Aberglauben, esoterischen Moden und allen anderen Geschmacksrichtungen des allgegenwärtigen Bullshitcocktails. Und wenn man als Lebewesen ein praktisches Interesse daran hat, erfolgreich durch die Welt zu spazieren, ist das ein wichtiger Unterschied.
All den angenehmen und selbstzufriedenen Gefühlen zum Trotz, mit denen uns unsere fehlbaren Instinkte anfüllen, während sie in unserem Oberstübchen Irrtümer drechseln, haben eben diese Irrtümer ja in aller Regel durchaus negative Folgen. Und sobald die Gefühle kein angenehmes und selbstzufriedenes Glühen sind, sondern eher Wut, Empörung und Angst, dann dürfte die Bilanz noch eine ordentliche Rutsche schlechter ausfallen.
Die vom harmlos anmutenden Wahrnehmungsfehler verursachten Schäden können dabei von der an der Glastür eingeschlagenen Stirn bis hin zum kopflosen Ausstieg aus einer Wirtschaftsunion oder zur Wahl eines sonnenbankfrittierten verblendeten scheinbar Wahnsinnigen zum «mächtigsten Mann der Welt» (Eigenwerbung) reichen. Die perfidesten Wahrnehmungsirrtümer sind freilich die, die nicht sofort üble Folgen zeitigen, sondern erst auf lange Sicht. Dann lernen wir aus unseren Fehlern nämlich im schlimmsten Fall so wie der Hund, der lange, nachdem er die Schuhe zerfetzt hat, und weit von diesen entfernt bestraft wird: gar nicht.
Um den dräuenden Schaden abzuwenden, müssen wir unbedingt verstehen, wann unsere eigenen Wahrnehmungen uns freundlich an die Hand nehmen und auf direktem Weg und dabei fröhlich pfeifend in die Irre führen. Wir müssen Mittel dagegen entwickeln, immer wieder in dieselben Fallen zu tappen, die unsere eigene Entwicklungsgeschichte und die allgemeine Natur der Welterkenntnis vor uns aufbauen. Und wir müssen lernen, unseren Gefühlen zu misstrauen. Es ist freilich eine schwierige Sache mit diesem Misstrauen, denn zugleich sollten wir den Gefühlen im rechten Moment vertrauen. Aber wir haben eine etwas schiefe Vorstellung davon, was Gefühle sind und was sie tun, und ihnen einfach vertrauensvoll die Autoschlüssel zuzuwerfen, ist mit Sicherheit keine gute Idee.
Denn zu aller Fehlwahrnehmung kommt deutlich verschärfend hinzu, dass wir uns nicht nur einfach selbst damit schaden, nein, der erwähnte Bullshit kann auch, wir wissen es alle und sind dennoch ungebrochen anfällig dafür, von anderen gezielt eingesetzt werden, um uns über den sprichwörtlichen Tisch zu ziehen, an dem wir alle gemeinsam sitzen.
Die Anfälligkeit für Manipulation durch andere ist die dunkle Kehrseite der funkelnden Medaille einer faszinierenden Errungenschaft der Evolution. Diese Errungenschaft, die uns zu möglichen Opfern von Trickbetrügern und Populisten macht, ist die Kooperation. Sie hat einen zentralen Platz in unseren sozialen Instinkten und in unserem moralischen Universum und wurde gern und häufig als die offenbar dringend gesuchte Eigenschaft geführt, die uns von den Tieren des Feldes, den Fischen der Luft und den Vögeln des Meeres und allem anderen Wahrnehmenden und Denkenden unterscheide (Spoiler: tut sie nicht): Dass ihr Entstehen im Verlauf der Naturgeschichte aber alles andere als selbstverständlich ist, zeigen schon die zahlreichen Interpretationen des evolutionären Wettbewerbs, wonach dieser ein gnadenloser Kampf ums Überleben, ein erbarmungsloser Konflikt aller gegen alle sei. Wie und warum sollten in einem solchen Konflikt Fremde zu Freunden werden können?
Dabei handelt es sich allerdings um eine gründliche Fehlinterpretation evolutionärer Kräfte, die sich auch im etwas irregeleiteten Begriff des Sozialdarwinismus spiegelt. Wie der britische Biologe Richard Dawkins in «Das egoistische Gen» geistreich argumentiert, ist ja nicht das Individuum der Akteur des biologischen Wettbewerbs um die meisten Kinder, das längste Leben und die schönste Yacht, sondern es sind die einzelnen Gene, mitunter sogar im Wettbewerb gegen andere Gene im selben Tier. Und für diese Gene gelten überraschend etwas andere Gesetze, als sie uns, an der langen Darwin’schen Tradition geschult, für Tiere intuitiv einleuchten wollen.
Gene, die die Kooperation zwischen jenen Individuen fördern, die sie tragen, sind jedenfalls in der natürlichen Welt weit verbreitet. Menschen kooperieren, andere Tiere kooperieren, Pflanzen kooperieren, Bakterien kooperieren, Schleimpilze kooperieren. Letztere zum Beispiel rotten sich in ihrem täglichen Leben mit einzelligen Amöben zur Fortpflanzung zusammen und bilden dabei ein schneckenartiges Gebilde. Diese Pseudoschnecke besteht aber anders als richtige Schnecken nicht aus den Zellen eines einzelnen Organismus (eben der Schnecke), sondern aus dem Äquivalent einer Kleinstadt, nämlich Zehntausenden von Individuen. Diese kriechende Kleinstadt bildet einen Fruchtkörper aus, aus dem die Nachkommen der Individuen als hoffnungsvolle kleine Amöben in die Welt entlassen werden (das Äquivalent dieser Fruchtkörper sind in menschlichen Kleinstädten sicherlich die weiterführenden Schulen). Und mit den Schleimpilzen hört es noch nicht auf. Richtet man ein Elektronenmikroskop auf Viren, kann man sie einander die kleinen Virenhändchen reichen und gemeinsam an einer besseren Virenzukunft bauen sehen. Das ist besonders beeindruckend, weil den armen Viren ja mitunter sogar abgesprochen wird, dass sie überhaupt am Leben sind.
Aber unzweifelhaft hat der Mensch die Kunst der Kooperation auf ihren vorläufigen Höhepunkt getrieben. Auf Grundlage zweier mächtiger Säulen stellen unsere menschlichen Kooperationsleistungen alles, was Schleimpilze und Viren[6] zustande bringen, bei weitem in den Schatten. Die erste Säule ist die tatsächlich einmalig komplexe und flexible Kommunikationsfähigkeit des Menschen. Vom Austausch praktischer Informationen über Hund, Katze, Maus und vor allem natürlich über andere Menschen, den für viele interessantesten Gesprächsgegenstand, reichen die Möglichkeiten bis hin zum gemeinsamen Entwickeln abstrakter Ideen und Gedankenspielereien und zum Zwirbeln ganzer Weltbilder und Theoriegebäude. Löst man Gedankenexperimente aus dem wissenschaftlichen oder philosophischen Kontext heraus, kann man sie auch einfach Geschichten nennen und findet damit eine tiefe Parallele zwischen Wissenschaft und Literatur im Herzen der menschlichen Erfolgsgeschichte. Oder Misserfolgsgeschichte, je nachdem, wie es ausgeht mit dem Artensterben, dem Klimawandel und den Seuchengefahren. Es bleibt spannend, schalten Sie nicht um.
Die Idee von der Alleinstellung des Menschen in der Linguistik geht unter anderem auf den brillanten Wissenschaftler und politischen Denker Noam Chomsky zurück, der in den fünfziger Jahren die These formulierte, dass die sprachlichen Fähigkeiten des Menschen das Ergebnis besonderer kognitiver Fähigkeiten seien. Weil der verbreitete Impuls, den Menschen aus der sonstigen biologischen Welt herauszuheben, ungefähr so stark zu sein scheint wie der Gegenimpuls, nämlich den so herausgehobenen Menschen mit dem Gummihammer in die Reihe der anderen Tiere zurückzuklopfen, gab es in den sechziger Jahren einen groß angelegten Versuch, die These Chomskys zu widerlegen. Ein Schimpanse wurde dafür in einer menschlichen Familie in New York aufgezogen und von dieser genauso behandelt wie ein normales Kind. Das Tier wurde gekleidet wie ein Mensch und menschlichen Tagesabläufen unterworfen, aber es gelang trotzdem nicht, Nim Chimpsky, wie der Schimpanse in einem Anflug fragwürdigen Humors genannt wurde, eine Zeichensprache beizubringen, die in der Komplexität ihrer Grammatik der menschlichen auch nur nahe gekommen wäre.
Die ganze Episode endete tragisch. Der Schimpanse lernte zwar keine menschliche Sprache, aber dass er Mitglied einer menschlichen Familie war, begriff er durchaus. Nim Chimpsky fiel tief, als er erwachsen und wegen seiner enormen Körperkräfte zur Gefahr für seine Umwelt wurde. Stellen Sie sich einen zornigen Teenager mit Superkräften vor, und Sie wissen, warum das Experiment damals beendet werden musste. Nim Chimpsky wurde aus seinem luxuriösen Jugendzimmer in Manhattan in den Affenkäfig einer Pflegestation verlegt und verstand die Welt nicht mehr.[7]
Ob die Theoriegebäude und Weltbilder, die wir Edelschimpansen dank unserer Sprachsonderstellung basteln, immer von Vorteil sind, darf man aber getrost in Zweifel ziehen. Dass sie die Welt jedoch mehr verändern, als es noch der fleißigste Biber mit einem Staudamm könnte, ist unbestreitbar.
Die zweite Säule neben unserem Sprachtalent ist die entwicklungsbiologische Besonderheit, dass menschliche Kinder im Vergleich mit denen anderer Tierarten ausgesprochen unfertig zur Welt kommen und in den ersten Lebensjahren zu Ende geboren werden müssen. Das bringt große Nachteile mit sich, insbesondere die völlige Hilflosigkeit, mit der ein menschliches Kind auch Jahre nach der Geburt noch durch die Welt tappst. Haben Sie zum Beispiel schon mal eine Vierjährige bei der Mammutjagd beobachtet? Ein lächerliches Schauspiel. Denn Mammuts sind schließlich längst ausgestorben, aber Vierjährigen muss man eben alles erst mal erklären.
Dieser Nachteil der Ungeformtheit der neu geborenen Kinder wird allerdings mehr als aufgewogen durch einen dramatischen Vorteil und Zugewinn. Der Wahrnehmungs- und Denkapparat des erbärmlich erwerbsunfähigen Nachwuchses nämlich ist über Jahre hinweg durch materielle, vor allem aber soziale und kulturelle Einflüsse formbar wie Teig. Was wir Erziehung nennen, ist eine evolutionäre Errungenschaft, die uns Anpassung an rasanteste Veränderungen ermöglicht.
Auch viele Tierarten kennen, was wir Kultur nennen. Bienen zum Beispiel sprechen lokale Dialekte bei ihren Rund- und Schwänzeltänzen.[8] Beziehungsweise sie haben lokale Tanzstile, denn Bienen können ja nicht sprechen, egal, was Waldemar Bonsels und Karel Gott uns über Maja und Willi weismachen wollen. Oder denken wir an die berühmten hundert Affen in Japan, die einander das Waschen von Kartoffeln in Salzwasser beibrachten. Sie standen in den neunziger Jahren nicht nur als Beispiel für Kultur auch in unserer näheren Verwandtschaft, sondern sollten sogar Belege für eine Metaphysik der Kultur liefern, für die Existenz einer Art von Weltgeist. Die zugehörigen Theorien Rupert Sheldrakes waren esoterische Holzwege und sind reichlich aus der Mode gekommen. Trotzdem sind die Affen ein gutes Beispiel dafür, dass auch Tiere zu sozialem Lernen in der Lage sind.
Es ist wichtig, auf die Kontinuität kognitiver Eigenschaften im Tierreich hinzuweisen – auch weil die Skepsis gegenüber den menschlichen kognitiven Fähigkeiten und der Sonderrolle des Menschen eine zentrale Botschaft dieses Buches sein wird. Und nicht zuletzt, weil das Bewusstsein dafür, dass die Unterschiede zwischen Mensch und Tier stets graduell ausfallen, unsere Wahrnehmung eines der größten Probleme unserer Zeit bestimmen sollte, nämlich die der systematisch rohen Gewalt, die den sogenannten Nutztieren in unserem Namen angetan wird. Aber dieses monumentale Thema sprengt hier bei weitem den Rahmen und verdient sein eigenes Buch, zum Beispiel «Tiere Essen» von Jonathan Safran Foer.
Wir sind also Tiere, wir verhalten uns wie sie, und unser Denken und Wahrnehmen kann sich nur innerhalb derselben prinzipiellen Grenzen entwickeln wie das der Katzen und Maulwürfe. Aber es kann andererseits auch nicht geleugnet werden, dass der Mensch seine Kultur zu einem, wenn schon nicht ganz beispiellosen, so doch jedenfalls konkurrenzlos effektiven Antrieb für Innovation und Kooperation gemacht hat und damit alle anderen Tierchen weit überragt. Selbst die für sich genommen atemberaubenden Leistungen der staatenbildenden Tierweltmeister der Kooperation, Ameise, Biene, Termite und Nacktmull, müssen gegen kollektive Großprojekte wie die Pyramiden, die Mondlandung oder eine Aufführung von Verdis Requiem verblassen.
Nicht immer wirkt die Formbarkeit menschlicher Kultur freilich zum Guten. Man denke an die Möglichkeiten zur Indoktrination, für die das bekannte Zitat «Gib mir das Kind für die ersten sieben Jahre und ich gebe dir den Mann» beispielhaft stehen mag. Es wird oft dem Gründer des Jesuitenordens Ignatius von Loyola zugeschrieben, es ist aber eigentlich unklar, ob Loyola selbst der Urheber ist oder ob ein boshafter Voltaire ihm diesen Satz aus strategischen Gründen untergejubelt hat. Er drückt jedenfalls aus, dass die ersten Lebensjahre maßgeblich und unwiderruflich prägend für die gesamte restliche Existenz des Menschen sind, und das weit mehr als bei allen anderen Tieren, die in höherem Maße von angeborenen Instinkten durch ihr Leben geführt werden. Diese Formbarkeit der Kinder führt dazu, dass ältere Menschen sich fassungslos die Augen reiben, wenn sie der Jugend beim Jonglieren neuer Medien und Technologien zusehen. Was jedoch in diesen ersten Jahren schiefgeht, ist danach auch nur schwer wieder auszubügeln.
Man darf unter diesem Gesichtspunkt zum Beispiel gespannt sein, was für Menschen ans Tageslicht kommen werden, wenn die Mauern des groß angelegten sozialen Experiments Nordkorea eines Tages zu bröckeln beginnen. Der leider früh verstorbene brillante Autor Christopher Hitchens bemerkte nach einer Reise dorthin, ihm sei es vorgekommen, als bemühe sich das System Kim bewusst darum, alle skurrilen und beunruhigenden Ideen aus George Orwells literarischem Gedankenexperiment «1984» in der Realität auszuprobieren. Die Folgen des Experiments werden jedenfalls unerfreulich sein. Bienen wäre das vermutlich nicht passiert.
Als Krönung unserer kulturellen Leistungen kann man in vielerlei Hinsicht sicherlich das betrachten, was im weiteren Sinn unter den Begriff der Technologie fällt. Die Kombination aus den praktischen Methoden zum Beispiel der Ingenieurskunst und den abstrakten Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschung hat die Erfüllung des berühmten (und womöglich moralisch ein wenig zweifelhaften) Auftrags der Bibel in greifbare Nähe gerückt, der Mensch solle sich doch bitteschön den gesamten Planeten samt der ganzen Bewohnerskala vom Blauwal bis runter zum Pockenvirus untertan machen. Nebenbei steigern sich die Kosten für Fehlentscheidungen und kognitive Irrtümer ins geradezu Astronomische und Erbleichenmachende. Wer heute nicht an den Klimawandel glauben mag oder die Sinnhaftigkeit von Impfungen anzweifelt, riskiert Schäden an nicht nur der Menschheit, sondern gleich an der ganzen Biosphäre, und das in einer Größenordnung, die mindestens der luftigen Höhe des Turms menschlicher Errungenschaften entspricht. Wer sich infolge seiner Irrtümer von diesem Turm stürzt, dem steht jedenfalls ein weiter Weg nach unten bevor.
Und wir stürzen ja nicht nur durch eigenes Verschulden, etwa weil unser Gehirn uns Dinge plausibel erscheinen lässt, die oft nicht wahr sind und mitunter gar nicht wahr sein können. Sondern wir werden oft gestoßen. Und das ist nach der Tatsache, dass die Regeln unserer Wahrnehmung, die wir im Folgenden kennenlernen werden, uns anfällig für Irrtümer machen, die zweite große Tragödie: Die Erfindung der Kooperation und ihre zentrale Rolle in der menschlichen Kultur schließen wesentlich die Existenz jener Leute ein, die die Psychologie Psychopathen nennt, doch dazu später mehr, wenn es um das gemeinschaftliche Wahrnehmen geht.
Wie wir sehen werden, ist das Wesen der Kooperation ein Austausch von Leistungen. Die Beteiligten nehmen einen kleinen Nachteil in Kauf, damit andere einen größeren Vorteil genießen können. Aber wie wir auch sehen werden, kann es für Einzelne nützlich sein, die Vorteile solcher Kooperationen in Anspruch zu nehmen, ohne die Nachteile zu akzeptieren.
Und damit sind wir zurück bei Frankfurts Allgegenwärtigkeit des Bullshits. Weil unsere Wahrnehmung viel weniger rational und sattelfest ist, als unser Gehirn uns vormacht, und weil es Menschen gibt, die den sozialen Vertrag der Kooperation einseitig aufkündigen und stattdessen auf die Kooperation der anderen zum eigenen Vorteil setzen, wird die Quelle, aus der der Bullshit sich in stetem Strom ergießt, niemals versiegen.
Wir glauben instinktiv daran, dass ein gutes und richtiges Argument größere Überzeugungskraft habe als ein schlechtes und falsches, dass eine richtige Idee sich verbreiten müsse, dass im Großen der Weltgeschichte wie im Kleinen alltäglicher Entscheidungen der Pfeil der Entwicklung stets Richtung Fortschritt und Aufklärung zeige.
Aber was wäre, wenn das Durchsetzen einer Idee viel mehr mit Zufall und Willkür zu tun hätte als mit rationaler Abwägung? Ob im großen gesellschaftlichen Rahmen oder im allerprivatesten unserer persönlichen Wahrnehmung – was wäre, wenn schlecht begründete Meinungen und Irrtümer nicht die Ausnahme von der Regel wären, sondern die Regel selbst? Und wenn es dann noch Menschen gäbe, denen die Gesetze der Evolution und der Psychologie die Werkzeuge mitgegeben hätten, diese Schwäche unserer Wahrnehmung zu ihrem eigenen Vorteil und auf unsere Kosten auszunutzen? Dann müssten wir wohl unseren Umgang mit Ideen, mit Erkenntnis, mit Argumenten anpassen. Schon um uns selbst vor dem allgegenwärtigen Bullshitgeruch zu schützen. Ein geistiger Nasenfilter müsste her. Für den Anfang müssten wir begreifen, wie Wahrnehmung funktioniert und wie die Irrationalität in die Welt kommt.
Ihr Schlüssel steckt noch nicht im Schloss, da wird die Haustür von innen geöffnet, und lautes Stimmengewirr und rhythmisch dröhnender Bass empfangen Sie. Eine Gruppe Teenager im Flur guckt erschrocken und verschwindet Richtung Wohnzimmer. Die Koffer lassen Sie an der Tür stehen und eilen ins Haus, in dem die fröhliche Party Ihrer Kinder tobt. Sie kommen einen Tag früher zurück als geplant und hatten sich die freudige Überraschung ausgemalt – obenauf im Koffer liegen die Reisemitbringsel –, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Während gut gelaunte Jugendliche um Sie herumwirbeln und Ihnen scheue oder besorgte Seitenblicke zuwerfen, verschaffen Sie sich einen schnellen Schadensüberblick. Nichts ist bemalt, nichts brennt, alle Möbel stehen aufrecht an ihrem Ort, es gibt keine größeren Pfützen – es könnte weit schlimmer sein. Ihre größte Sorge gilt dem Alkohol, denn im Wirrwarr der Party sehen Sie Minderjährige und ältere Jugendliche und neben Cola und Saft in den Gläsern auch Cocktails und Bierflaschen. Manche Getränke und auch das Alter mancher Gäste können Sie nicht sofort einschätzen. Sie sehen vor sich also Minderjährige und Volljährige, bei denen Sie nicht wissen, was sie da Buntes trinken, und Sie sehen Alkohol trinkende Gäste im Gespräch mit Limo trinkenden, bei denen Sie jeweils das Alter nicht einschätzen können. Welche dieser vier Gruppen müssen Sie kontrollieren, um sicher zu sein, dass hier kein Minderjähriger Alkohol trinkt und den Gesetzen von Sitte und Anstand Genüge getan ist?
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, blenden den Partyrummel und den Text dieses Buches aus, und Sie finden vermutlich schnell aus eigener Kraft die Lösung, noch bevor Sie sie im nächsten Absatz zur Überprüfung nachlesen.
Als Alkoholpolizei müssen Sie zweierlei kontrollieren: die Getränke der Minderjährigen und das Alter der Alkohol Trinkenden. Die anderen beiden Gruppen können Sie ignorieren, denn bei Limo Trinkenden ist das Alter egal, und wer volljährig ist, darf in Ihrem Haus selbstverständlich zu sich nehmen, was er möchte. Mit diesen einfachen Einsichten haben Sie flugs ein wenig Ordnung ins wummernde Chaos gebracht. Gratulation!
Aber bevor auch nur daran zu denken ist, irgendwem Fragen zu stellen, zieht einer der Partygäste Ihre Aufmerksamkeit geschickt auf sich. Er trägt Frack und Zylinder und wedelt mit Spielkarten, ein Hobbyzauberer wohl, der ein bisschen Partyprogramm gemacht hat. Jetzt wurde er vermutlich von Ihren Kindern geschickt, um Sie abzulenken, während in den Hinterzimmern Beweise vernichtet werden. Er hält Ihnen vier Karten vor die Nase, auf die ein A, ein K, eine Vier und eine Sieben gedruckt sind. Die Rückseiten der Karten sehen Sie nicht.
«Ich bin der große Cathcart», sagt der Magier geheimnisvoll raunend. «Alle meine Spielkarten haben auf der einen Seite einen Buchstaben und auf der anderen Seite eine Zahl. Von welchen dieser vier Karten hier müssen Sie sich die Rückseite ansehen, um zu überprüfen, ob eine gerade Zahl immer einen Vokal auf der anderen Seite hat?»
Ein ziemlich lahmer Trick, finden Sie. Eigentlich ist es noch nicht mal ein Trick, sondern mehr eine Frage. Sie sind jetzt aber tatsächlich gründlich abgelenkt, denn diese Aufgabe fühlt sich seltsam glitschig und verwirrend an, und Sie sind doch sonst so stolz auf Ihren Durchblick. Sie haben doch wohl nicht versehentlich Alkohol getrunken im vorigen Absatz?
«Wenn Sie mir jetzt eine falsche Antwort geben», sagt der große Cathcart, der vielleicht Ihre Fahne wittert, «dürfen Sie wegen der Party nicht sauer sein.»
Das macht das Problem gewichtig, und sofort sind Sie noch mehr verunsichert. Es wird Sie vielleicht beruhigen, dass Sie mit dieser Verunsicherung nicht allein dastehen. Dieser Kartentrick wurde zuerst 1966 von Peter Cathcart Wason vorgestellt. Wason war kein Magier, sondern etwas ganz Ähnliches, wenn auch ganz anderes: Er war experimenteller Psychologe.
Weniger als zehn Prozent seines Publikums fanden damals die richtige Antwort.[9] Aber wir wollen jetzt nicht noch mehr Druck ausüben, sonst trüben sich Ihr Denkvermögen und ihre Wahrnehmung womöglich völlig ein. Können Sie diese Zeilen überhaupt noch entziffern? Gut.
Nehmen Sie sich alle Zeit der Welt, atmen Sie ruhig und gleichmäßig und finden Sie Ihre Antwort. Welche Karte oder Karten müssen Sie umdrehen? Der große Cathcart schaut Sie erwartungsvoll an, zwirbelt sich den angeklebten Schnurrbart und wartet ebenso geduldig auf Ihre Antwort wie diese Buchseite. Haben Sie eine Antwort? Wunderbar. Weiter also im Text.
Die meisten Teilnehmer des Experiments, denen diese Frage gestellt wurde, wollten die Rückseite der Karte mit der Vier sehen und hatten damit natürlich völlig recht. Denn wenn diese Karte auf der Rückseite keinen Vokal hätte, wäre die Regel verletzt. Sie müssen aber noch eine zweite Karte umdrehen, und zwar – für viele überraschend – das K. Wenn Sie das herausgefunden haben, gehören Sie zur winzigen Minderheit. Umdrehen müssen Sie es, weil die Regel auch verletzt wäre, wenn das K auf der anderen Seite eine gerade Zahl trüge, denn das K ist kein Vokal. Die Rückseite der Karte mit der Sieben ist egal, denn über Karten mit ungeraden Zahlen sagt die Regel überhaupt nichts aus. Und die Rückseite des A ist überraschenderweise aus demselben Grund egal. Denn wenn dort eine gerade Zahl steht, ist die Regel erfüllt. Steht dort aber eine ungerade Zahl, dann gilt dasselbe wie bei der Sieben: Über Karten mit ungeraden Zahlen sagt die Regel nichts aus.
Die größte Überraschung des Ganzen kommt aber jetzt. Stellen Sie sich vor, wir ersetzen auf den Karten die Vokale durch Wassergläser, die Konsonanten durch Schnapsgläser, die geraden Zahlen durch das Bild eines Kindes und ungerade Zahlen durch das Bild eines Erwachsenen. Aus der ursprünglichen Regel des großen Cathcart «Alle Karten mit einer geraden Zahl haben einen Vokal» wird unsere Partyregel «Alle Kinder trinken Alkoholfreies». Die beiden Logikprobleme, jeweils die Paare zu finden, die diese Regel verletzen, sind also im Aufbau völlig identisch.
1992 stellten die Psychologen Leda Cosmides und John Tooby die Spielkartenstudie ihres Kollegen Wason nach, fügten dem Ganzen aber die Fragenvariante mit dem Alkohol auf der Party hinzu.[10] Sie befragten Universitätsstudenten, die auf Wasons Originalversion der Frage mit den Buchstaben und Zahlen zu immerhin etwa 25 Prozent richtig geantwortet hatten. Ging es nun aber darum, minderjährige Trinker auf Partys aufzuspüren, stieg der Anteil der richtigen Antworten auf beeindruckende 75 Prozent. Und noch mal zur Unterstreichung, weil es gar so erstaunlich ist: Das zugrunde liegende logische Problem ist in beiden Fällen genau dasselbe.
Woher der große Unterschied in der Lösung zweier eigentlich identischer Probleme kommt, darüber herrscht in der Fachwelt auch mehr als fünfundzwanzig Jahre nach der Studie von Cosmides und Tooby keine Einigkeit. Aber ihre Beobachtung selbst, dass unsere Fähigkeit, ein logisches Problem zu lösen, von Umständen beeinflusst wird, die eigentlich gleichgültig sein sollten, ist unstrittig. Oder, kurz gesagt: Unser logisches Denken ist lange nicht so abstrakt, wie wir das gern glauben möchten.
Diese Erkenntnis ist ernüchternd (jedenfalls für die Erwachsenen, die zuvor von der enormen rationalen Kraft des menschlichen Geistes berauscht waren. Die Kinder waren ohnehin schon immer nüchtern) und fügt sich ein in eine lange Reihe ähnlicher Einsichten über die Beschränkungen der menschlichen Denkfähigkeit. Eine Reihe, die in den letzten Jahrzahnten so lang geworden ist, dass sie bis jenseits unseres geistigen Horizontes zu reichen scheint und dort in einem Nebel verschwindet.
Nehmen Sie nur die beiden unterhaltsamen Bestseller des Schweizer Autors Rolf Dobelli, «Die Kunst des klaren Denkens» und «Die Kunst des klugen Handelns», und Sie haben sogleich zweimal 52 dekorative Denkfehler und Irrtümer zur Hand. Wer der psychologischen Fachliteratur folgt, entdeckt kontinuierlich neue Arten und Weisen, wie unser Gehirn sich zu irren in der Lage ist. Seit 2005 gibt es einen jährlichen Wettbewerb, bei dem Wissenschaftler neue, noch nicht beschriebene Sinnestäuschungen einreichen können und das Publikum über die jeweils beste neue Täuschung abstimmt. Jedes Jahr finden sich beim Best-Illusion-of-the-Year-Wettbewerb immer wieder verblüffende Effekte. Die Arbeiten des japanischen Mathematikers und Künstlers Kokichi Sugihara etwa wurden seit Beginn des Wettbewerbs vier Mal prämiert. Eine seiner Skulpturen scheint aus vier abschüssigen Rinnen zu bestehen, die, so wirkt es, die Regeln der Schwerkraft aufheben: Egal wo in diesen Rinnen man eine Kugel ablegt, sie rollt vermeintlich nach oben, zur höchsten Stelle der Skulptur. Eine andere Arbeit Sugiharas besteht aus stehenden Röhren mit scheinbar kreisförmigen Querschnitten, die in einem dahinter stehenden Spiegel jedoch quadratisch aussehen. Dreht man die Zylinder um 180 Grad, sehen sie quadratisch aus, und ihr Spiegelbild wird rund. Wenn Sie das nicht glauben wollen, sehen Sie sich die Videos an.[11]
Und wenn Sie schon einmal die blau-gelb gestreifte Spirale gesehen haben, die sich immer dort zu bewegen scheint, wo man gerade nicht hinsieht, dann kennen Sie eine der vielen Designstudien von Akiyoshi Kitaoka, der Psychologieprofessor in Tokio ist und ganze Bücher mit fantastischen, wahrnehmungsverbiegenden Grafiken gefüllt hat. Der Vorrat noch unentdeckter Wahrnehmungsillusionen scheint offenkundig unerschöpflich zu sein, und alles Neue, das wir über unsere Wahrnehmung lernen, führt nur zu weiteren Möglichkeiten, wie sie sich aushebeln lässt.
Als Sigmund Freud einst postulierte, dass der Teil unseres Selbst, den er das «Ich» nannte, unser bewusstes Erleben, nur eines von vielen Elementen der Steuerung unseres Verhaltens ist und womöglich noch nicht einmal das wichtigste, bezeichnete er diese Einsicht bescheiden als die «dritte Kränkung der Menschheit». Er stellte seine These, dass das Unbewusste triebhaft unser Verhalten steuert – dass also «das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen Haus»[12] – in eine Reihe mit der Erkenntnis des Kopernikus, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums stehe, und mit der Darwins, dass der Mensch keineswegs Krone der Schöpfung sei, sondern nur ein Tier unter vielen, das Produkt derselben evolutionären Prozesse wie Molch und Lurch.
Aber selbst nach diesen drei Kränkungen blieb uns sprachbegabten Schimpansen noch eine Menge Selbstvertrauen. Die Vorstellung vom haarlosen nackten Affen Mensch als einer rationalen Denkmaschine drückt sich auch in seinem sich selbst verliehenen Gattungsnamen Homo sapiens aus, mit dem sich dieser «weise Mensch» seiner Denkfähigkeit und Weisheit wegen eine Medaille an die Brust heften möchte. Die eitle Gattungsbezeichnung ist übrigens nicht nur deshalb ein Irrtum, weil menschliche Rationalität ein flüchtiges, ätherisches Gebilde ist und der Mensch in der Praxis oft weit von dem entfernt, was wir unter Weisheit verstehen. Die Klassifizierung scheint auch biologisch recht fragwürdig zu sein, weil der Mensch gar nicht sinnvoll als eigene Gattung zu definieren ist. Genetisch gehört er gemeinsam mit seinen beiden nächsten Verwandten, den echten Schimpansen (Pan troglodytes) und den Bonobos (Pan paniscus), zur Gattung der Schimpansen. Eigentlich, so argumentiert jedenfalls der Evolutionsbiologe Jared Diamond in seinem Buch «Der dritte Schimpanse», müssten wir Menschen «Pan Homo» heißen und uns bescheiden unter unsere Geschwister einreihen. Es täte uns sicherlich gut.
Sich ein System auszudenken, in das alles Lebende einsortiert werden soll, um endlich Ordnung zu schaffen im Wirrwarr der Natur, und sich dann aus Eitelkeit selbst aus diesem System wieder herauszunehmen – ist nicht das alleine schon der beste Beleg dafür, dass mit dem kognitiven Apparat dieses Ausnahmeaffen nicht alles zum Besten steht? Sein Gehirn erlaubt ihm nicht, tatsächlich rational und objektiv zu sein. Zugleich aber sorgt es dafür, dass der Mensch sich trotzdem für rational und objektiv hält. Und diese grundlegende Irrationalität, bei gleichzeitig unerschütterlichem Glauben an die objektive Wahrheit und Beweisbarkeit der eigenen falschen Meinung, bildet den harten Kern vieler Probleme, denen der Mensch als Einzelner und die Menschheit insgesamt auf allen Ebenen, vom Partnerschafts- und Familienstreit bis hin zum internationalen Konflikt und zur Klimakontrolle, gegenübersteht.
In der Psychologie ist schon länger bekannt, dass Menschen, die sehr fest von etwas überzeugt sind, auf Beweise des Gegenteils selten so reagieren, wie wir das erwarten würden. Nehmen wir zum Beispiel einen Anhänger der unterhaltsamen Theorie, dass die Erde keine abgeflachte Kugel, sondern eine Scheibe sei. Schon im antiken Griechenland konnte man die ungefähre Kugelform der Erde ableiten, indem man sich die Daten der Landvermesser (griechisch: Geometer) genau ansah. Die Summe der Winkel in einem Dreieck, das wir mit einem Stock in flachen Sand zeichnen, beträgt immer 180 Grad. Auf einer gebogenen Oberfläche stimmt das aber nicht mehr, dort haben alle Dreiecke eine Winkelsumme über 180 Grad, und die Geometer Griechenlands stellten beim Vermessen der Olivenhaine nebenbei fest, dass die Winkel in größeren Dreiecken auf der Erdoberfläche sich immer zu über 180 Grad addierten, dass also die Erdoberfläche gebogen sein muss. Die Griechen waren sogar in der Lage, aus der Größe der Abweichung den Erddurchmesser zu berechnen, und kamen der richtigen Antwort mit dieser Methode recht nahe.
Wenn man das nun Menschen erklärt, die an die Scheibengestalt der Erde glauben möchten, dann kratzen sie sich nicht nachdenklich am Kinn, und nach einer kleinen Denkpause sagen sie nicht: «Das ist interessant; wenn die Innenwinkelsumme von Dreiecken auf der Erdoberfläche immer mehr als 180 Grad beträgt, dann leben wir ja auf einem Ball, da muss ich wohl meine Haltung noch einmal überdenken.» Stattdessen finden sie kreativ überzeugende Gründe dafür, warum das scheinbare Gegenargument in Wahrheit ein Beweis für die Richtigkeit ihrer Meinung ist: Der ganze Rest der Welt kann eben nicht richtig rechnen oder ist Teil einer Verschwörung, die die Wahrheit geheim halten möchte. Überzeugend ist das freilich nur für den, der es ohnehin glauben möchte, für alle anderen ist der Irrtum offensichtlich.
Der Prozess, sich für Dinge, die man glauben möchte, haltlose Gründe und Argumente zurechtzulegen, heißt Rationalisierung – und ist das Gegenteil von Rationalität. Er stellt eine Simulation echter Rationalität dar, und gleichzeitig liegen beiden Denkhaltungen eng beieinander.
Warum glauben so viele an ein breites Spektrum skurriler Theorien, das vom bloß Bizarren zum gründlich Gefährlichen reicht? Wieso ist es so einfach, uns von Dingen zu überzeugen, die dem sogenannten gesunden Menschenverstand zuwiderlaufen und die uns selbst und anderen schaden? Ein erster Hinweis liegt womöglich schon im Begriff des gesunden Menschenverstandes, denn bei näherem Hinsehen ist vieles von dem, was uns unsere Instinkte und unser Bauchgefühl über die Welt mitteilen, irreführend und falsch. Unsere Instinkte wurden naturgeschichtlich getrimmt auf eine überschaubare Welt, sowohl geographisch wie sozial. Eine kleine Gruppe von Menschen musste sich in einer feindlichen Umwelt miteinander arrangieren, und ein reibungsloses Sozialleben war oft wichtiger als zutreffende Welterkenntnis.
Und während der Mensch es um des lieben Friedens willen mit der Wahrheit nicht allzu genau nahm, musste er sich gleichzeitig seiner Entscheidungen und Überzeugungen sicher sein, denn schlimmer als eine falsche Entscheidung ist es in Krisensituationen oft, zu lange zu zögern. Auch wer vor dem Säbelzahntiger bergaufwärts flieht und dadurch langsamer vorankommt, hat eine größere Chance als der, der gelähmt im Dschungel steht, während er Argumente für die richtige Fluchtrichtung wägt. Das bedeutet, dass wir, obwohl viele unserer Urteile und Wahrnehmungen fehlerhaft oder irregeleitet sind, trotzdem dazu neigen, die Wahrnehmungen für zutreffend und die Urteile für rational zu halten. Wir überschätzen systematisch unsere eigene Zurechnungsfähigkeit.
Wirtschaftswissenschaftler dachten beispielsweise lange Zeit, der Mensch sei als rationaler Akteur gut zu beschreiben. Setzt man diesen fiktiven Modellmenschen in eine Modellsituation, dann tut er das, woraus er persönlich den größten Vorteil zieht. Aus dem Zusammentreffen vieler solcher rationaler Akteure in einem komplexen Modell entstehen dann Modelle ganzer Wirtschaftssysteme – so glaubte man.
Dem widersprechen allerdings die Ergebnisse des sogenannten Ultimatum-Spiels, das ein Team von Psychologen 1982 entwickelte.[13] Hier treten zwei Spieler zu einer interessanten Kombination aus Wettstreit und Zusammenarbeit an. Der eine Spieler, nennen wir ihn Gustav, kommt durch ausgesprochen glückliche Umstände in den Besitz von hundert Talern. Allerdings bekommt er das Geld nicht direkt zu seiner freien Verfügung, sondern muss zuerst dem zweiten Spieler, der Donald heißen mag, ein freundliches Angebot machen, wie diese hundert Taler zwischen ihnen beiden aufzuteilen seien. Akzeptiert Donald das Angebot Gustavs, ist es ausgemachte Sache. Lehnt Donald das Angebot aber ab, bekommen weder er noch Gustav etwas, und die hundert Taler fallen klimpernd zurück in den Geldspeicher des Experimentators Dagobert.
Die klassische Wirtschaftstheorie hätte nun argumentiert, dass Donald jedes Angebot annehmen muss, das von null verschieden ist. Denn auch wenn er nur einen einzelnen Taler bekäme, ist das immer noch besser als gar kein Taler. Die rationale Lösung für die beiden Spieler, so musste es nach dieser Logik erscheinen, ist also: Gustav behält 99 Taler für sich und bietet Donald einen Taler an. Donald freut sich über seinen Zugewinn und akzeptiert. Damit wäre das Spiel zwischen Gustav und Donald so beendet, wie man das aus Entenhausen kennt.
Diese Vorhersage rationalen Verhaltens hat aber interessanterweise nichts mit dem zu tun, was Menschen wirklich tun, wenn man statt der ausgedachten Enten sie in diese Situation bringt. Die erste Überraschung war, dass die Teilnehmer in der Rolle von Gustav Gans zwar tatsächlich mehr vom unverhofften Schatz für sich behielten, als sie dem anderen Mitspieler anboten. Sie lagen aber weit entfernt von der vorhergesagten Teilung von 99 zu 1. Die im Schnitt vorgeschlagene Teilung lag ungefähr bei 60 zu 40 und damit recht nahe bei einem fairen 50–50-Deal.
Der Grund für die unerwarteten Angebote war die zweite, womöglich noch größere Überraschung: Wurden dem menschlichen Donald vom menschlichen Gustav weniger als ungefähr dreißig Taler angeboten, lehnte Donald nämlich die Aufteilung in der Regel ab. Mit anderen Worten war Donald bereit, Gustav für die Ausnutzung seiner Machtposition zu bestrafen, obwohl er sich damit selbst empfindlich schadete. Bei einer vorgeschlagenen und dann abgelehnten Teilung von 75 zu 25 ist der Teilnehmer in der Rolle Donalds ja effektiv bereit, 25 Taler dafür zu opfern, dass der übertrieben gierige Gustav leer ausgeht. Der Mensch, so schien es, handelt in solchen sozialen Zusammenhängen wider Erwarten nicht wie ein rationaler Akteur oder eine Comicente, sondern schadet seinen eigenen Interessen.
Dieser Deutung liegt jedoch ein Missverständnis zugrunde. Bei näherer Betrachtung ist die Angelegenheit ein wenig komplizierter. Denn die Annahme, es sei rational und vernünftig, in jeder Situation den höchstmöglichen Gewinn anzustreben, erscheint uns vielleicht auf den ersten Blick einleuchtend, sie ist aber zumindest fraglich und ziemlich sicher sogar falsch. Denn es gibt einen wichtigen Aspekt des Ultimatum-Spiels, den wir aus den Augen lassen, wenn wir uns einfach nur die Gewinne in den jeweiligen Runden ansehen. Und zwar treffen sich Menschen im Alltag nicht nur einmal für eine einzelne Runde Ultimatum und sehen sich danach nie wieder. Stattdessen treffen sie immer wieder aufeinander, in immer neuen Situationen, in denen Geben und Nehmen sowie Verhandlungen eine Rolle spielen. Wie sich Gustav und Donald in der Vergangenheit zueinander verhalten haben, hat klaren Einfluss auf ihr Verhalten in Gegenwart und Zukunft. Unter solchen Umständen kann man den für die Bestrafung in Kauf genommenen Verlust als Investition in die Zukunft begreifen. Sie wird sich auf lange Sicht auszahlen, weil der andere Spieler in den kommenden Spielrunden fairere Teilungen vorschlägt. Es kann also durchaus rational sein, sich kurzfristig scheinbar irrational zu verhalten, um langfristig den Ertrag zu steigern.
Welches Teilungsverhältnis sich in den späteren Spielrunden einpendelt, hängt davon ab, was Donald seinem Gegenspieler Gustav gerade eben noch durchgehen lässt. Würde Donald beispielsweise alle Angebote strikt ablehnen, bei denen Gustav ihm weniger als 70 der 100 Taler zuteilt, hätte Gustav keine Wahl, als diese für ihn ungünstige Teilung tatsächlich vorzuschlagen, wenn er nicht seinerseits ständig leer ausgehen will. Die menschliche Psychologie ist in der Praxis allerdings auf eine weitgehend faire Teilung ausgerichtet, mit einer leichten Bevorzugung des Spielers, der die Kontrolle über die Höhe der Teilung hat. Dieser Umstand rechtfertigt das Verhalten von Donald und Gustav als langfristig rational und rettet den Grundgedanken, dass nämlich menschliche Entscheidungen eben rational organisiert sind.
Interessant an dieser ganzen Angelegenheit ist, dass hier zwar das reale Verhalten der Menschen vernünftig ist, aber ihr Gefühl dafür, wie vernünftiges Verhalten aussehen sollte, dem widerspricht. Was sagt es über unsere Wahrnehmung und unsere Entscheidungsprozesse aus, dass wir es als vernünftig empfinden, uns in wirtschaftlichen Interaktionen mit jedem Gewinn zufriedenzugeben, egal wie niedrig er auch sein mag. Dass wir uns dann aber in den entsprechenden Situationen anders – und kurioserweise im langfristigen Ergebnis vernünftiger – verhalten? Im Detail wird diese Frage komplex und kontrovers diskutiert. Fürs große Bild können wir aber an dieser Stelle festhalten, dass tatsächliches rationales Verhalten und das Gefühl dafür zwei recht unterschiedliche Dinge sein können.
Um zu begreifen, wie das möglich ist und welche Funktion diese Zweiteilung in unserem Seelenhaushalt erfüllt, müssen wir zunächst einen Ausflug in die Naturgeschichte, zu den Ursprüngen und Grundlagen der Wahrnehmung machen. Unsere Wahrnehmungsorgane sind, wie alle Teile lebender Organismen, seit Jahrmillionen den Prozessen und Regeln der Evolution unterworfen. Wer also die Gesetze der Wahrnehmung verstehen will, muss zuerst die Gesetze der Evolution verstehen. Woher kommt das Leben, und was ist es? Was sind und was sollen Wahrnehmung und Erkenntnis sein und leisten? Und was genau ist in diesem Zusammenhang eigentlich rationales Verhalten?
Und da stellen wir uns mal dumm und fangen ganz am Anfang an. Wir machen einen großen Schritt in die frühe Küche der Natur und werfen dort einen Blick auf die Vorgänge, die den damals noch lebensleeren Planeten mit Bärentierchen, Bilchen und Bartenwalen füllen sollten.
Spitzen Sie die Löffel und folgen Sie mir bitte auf den verschlungenen Weg vom Urknall zur Ursuppe.
Wahrnehmen für Anfänger: Augen auf in der Ursuppe
Im Anfang war ein Riesenknall, in dem das Nichts sich selbst wegsprengte und ein ganzes Universum in die frei gewordene Existenz hineinkrachen ließ. Dieser Urknall ereignete sich aus bis heute selbst für die größten Feuerwerksexperten in der Astrophysik unklaren Gründen. Vielleicht musste es so kommen, weil, wie François Rabelais sagte, die Natur die Leere verabscheut, vielleicht aber war die Entstehung des Universums auch einfach ein Zu- oder sogar ein kosmischer Unfall.





























