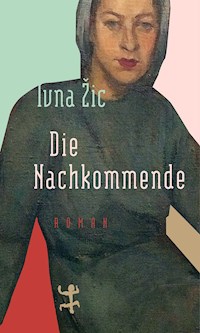Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie erzählen von einer Vergangenheit, die wir selbst nicht erlebt haben? Wie und in welcher Sprache erzählen von und über Geschichten, die wir nicht nachempfinden können? Denn wenn wir sprechen, sprechen wir Gegenwart, in der die Vergangenheit aber mitspricht: Wer also verstehen möchte, was er spricht, muss auch die Sprache der Toten verstehen. Ivna Žic öffnet in ihrer autofiktionalen Reflexion Zugänge zu den völlig unterschiedlichen Welten ihrer beiden Großmütter und des schweigsamen Großvaters, in deren Leben sich europäische Geschichte und eine untergegangene Welt spiegeln, die nach wie vor in uns weiterlebt und unser Handeln bestimmt. In zärtlicher Prosa und mit präzisen Beschreibungen geht Ivna Žic den Spuren ihrer Ahnen nach und eröffnet einen Ort des Wiedererkennens im anderen und des anderen. Diversität ist horizontal und vertikal, diachron und synchron. Žic' Text öffnet sich in einem Durchgang von der Vergangenheit in eine europäische Zukunft, in der sich eine neue, radikale Vielsprachigkeit längst Raum geschaffen hat, und lässt dadurch aus dem Privaten das Politische und aus den neuen Verhältnissen neue Erzählungen entstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ivna Žic
WAHRSCHEINLICHE HERKÜNFTE
INHALT
ICH FRAGE DICH NICHT, WER DU NICHT BIST
MIT DEM TOD WACHT DIE SPRACHE AUFEine Großmutter-Poetik
BLEI. LANDSCHAFTENEine Großvater-Poetik
WENN WIR SPRECHEN,SPRECHEN WIR GEGENWART
NACHWEISE
ICH FRAGE DICH NICHT, WER DU NICHT BIST
ERSTE SPRACHE
Die Sprache bezahlen wirmit nichts anderemals mit der Sprache.
Florjan Lipuš
Als meine Eltern im Sommer vor ein paar Jahren ihre Zürcher Wohnung, in der ich aufgewachsen, wo ich ausgezogen und in die ich immer wieder zurückgekehrt war –, als sie diese im Sommer vor ein paar Jahren räumten, um nach Zagreb zu ziehen, verbrachte ich mehrere Tage mit ihnen dort, um durch alle Sachen zu gehen und gemeinsam zu entscheiden: Brauchen wir das noch, brauchen wir es nicht, und wenn wir es brauchen, wo kommt es hin: Nach Zagreb? Zu mir nach Wien? Bleibt es bei meinem Bruder in Zürich? Oder brauchen wir es schlussendlich doch nicht mehr?
Im Zuge dieses großen Umzugs stand ich häufig für mehrere Stunden mit meiner Mutter im Keller, wo wir Kindheitskisten öffneten und Papier um Papier, Zeichnung um Zeichnung, Erinnerung um Erinnerung aus Kindergarten und Schulzeit, bis dahin akribisch aufbewahrt, in die Hand nahmen, anschauten, besprachen und schließlich vor der Entscheidung standen, ob es weiterhin aufbewahrt werden sollte oder ob die Erinnerung mittlerweile an Wert verloren hat.
Unter diesen Funden befand sich auch das erste »Buch«, das ich geschrieben hatte, oder eines der ersten, denn das Zeichnen und das Schreiben waren für das Kind, das ich war, eine ähnliche Bewegung. Eine, die ich gerne machte. Ich zeichnete mich damals an die gehörte Welt heran und an die Schriftzeichen in Buchstabenbüchern. Ich nahm sie als Vorlage, als Möglichkeit, die wandelbar war. Es fiel mir leicht, so zu erzählen, es war notwendig und scheinbar sehr klar, so dass ich »Bücher« schrieb in und mit allen Sprachen, die ich mit mir trug, und mit all ihren Klängen.
Das gefundene Buch besteht aus mehreren gefalteten A5-Seiten, die in der Mitte mit Heftklammern zusammengefasst sind. Auf allen Seiten ist zunächst in der oberen linken Ecke ein Punkt ersichtlich, ein feiner Punkt, den meine Mutter jeweils mit einem Bleistift gemacht hatte, um mir zu zeigen, auf welcher Seite des Blattes ich losschreiben sollte. Ich sage sollte, weil ich mich selten daran hielt und häufig doch von rechts nach links schrieb. Es war die einfachere Schreibart, denn ich schreibe mit der linken Hand, und wie es für Menschen, die mit der rechten schreiben, leicht von links nach rechts geht, so ist es für Linkshänder von rechts nach links zunächst zugänglicher als umgekehrt.
Das Nächste, was auffällt, sind die tanzenden Buchstaben, die, ohne Kontinuität oder innere Logik, mal links-, mal rechtsrum geschrieben sind. Immer in Großbuchstaben. Ich muss fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein, noch vor der Einschulung, denn dort wurde dann alles, was ich hier beschreibe, zurechtgerückt.
Das erste Wort im Buch ist mein Name.
Die Schreibweise meines Namens ist mehr Bild als Wort und die Buchstaben reihen sich so auf:
I als großer Strich, der eine klare Richtung hat, immer von oben nach unten gezogen. An zweiter Stelle V, danach gleich nochmal V mit einem Strich daran: das steht für N, spiegelverkehrt. Stellen Sie es sich so vor: VI.
Und dann das A. Ohne viel Spielraum, so wie wir es kennen.
Das Ganze sieht ungefähr so aus: I V VI A und ist ein Spiel aus horizontalen und waagrechten Linien.
Ich lese den Namen nochmal.
Ich betrachte ihn als Bild.
Vor allem die zwei Buchstaben in der Mitte, V und N. Zwei sich sehr ähnliche Buchstaben, wie es scheint. Da das V vor dem N steht, schien es logisch gewesen zu sein, das N dem V anzugleichen. Es daraus zu entwickeln. So liest es sich aus der Schreibbewegung heraus. Das V hat oben rechts schon einen kleinen Haken, der nach unten fahren will und dann abrupt stoppt, als hätte das Kind noch im letzten Moment bemerkt, dass es beim V und noch nicht beim N ist, welches aus dem V weitergeschrieben wurde.
Dann der Nachname:
Der Nachname sieht aus wie zwei sich zugewandte Klammern, mehr wie eine Umarmung als die Öffnung, die Ž I C eigentlich ist: das Ž am einen Ende nach links geöffnet und das C am anderen nach rechts. Das Kind I V VI A drehte die beiden Buchstaben, die sich den Rücken zukehren, zueinander, so dass sie sich anschauen, begegnen. Einklammern. Diese Schreibweise ist auf der Computertastatur ebenfalls nicht zu tippen: das Ž nach rechts gedreht, das I wieder unberührt gleich und das C nach links gedreht. Es scheint eine Möglichkeit zu sein, das Wort von beiden Seiten her zu lesen, beide Seiten könnten ein Anfang sein, bei dem man sich in der Mitte trifft, beim Strich, der vielleicht ein Spiegel ist.
Dieses Bild entsprach (für das Kind, das ich war) dem Klang meines Namens.
Ich schrieb und las und zeichnete und hörte mich selber so:
Dann folgt die Adresse.
Wir wohnten damals an einer Straße mit dem Namen Fleischbachstraße, Hausnummer 69 – und ich kann mir vorstellen, dass auch diese Spiegelung – 6 und 9 – dem Kind eine Freude bereitet hat.
Nach Straße und Hausnummer folgt noch das Land, in dem ich wohnte, und heißt:
S C H V I C E R L A VI D
S C H V I C E R L A VI D, das ist: Das Schweizerdeutsche – d’Schwiiz, das Kroatische – Švicarska und das Hochdeutsche – die Schweiz. Und irgendwo hatte sich das »Land« eingeschlichen, vielleicht durch meine amerikanische Nachbarin Jessica, die Englisch sprach – Switzerland. Also ein amerikanisches »Land«.
Die Buchstaben all dieser Sprachen sind in S C H V I C E R L A VI D vorhanden, in einem Wort, das als Bild vielleicht sogar vielschichtiger oder: viel-sprachiger erzählt als im Klang.
Diese wenigen Zeilen, eigentlich kein Text, sondern vielmehr eine Benennung, eine Bekundung: wer schreibt hier und woher – diese ersten Zeilen tragen in sich schon alle Sprachen, Dialekte und Möglichkeiten, in denen ich mich als Kind bewegte. Später begann ich über diese gleichzeitige Vielzahl zu schreiben, zu forschen, suchte und suche meinen Weg dahin zurück, im Theater, im Text – und fand an jenem Tag im Keller, in diesem kleinen Buch, in der Schreibweise eines Namens und einer Adresse, alles zusammen, gleichzeitig, wieder. Diese Art und Weise, mich zu schreiben, meinen Namen, meinen Ort und in all dem die Vielzahl, das Plurale der Sprachen, der Klänge, der Schriften stehen zu lassen: Das ist vielleicht die intimste, die ehrlichste, vielleicht: meine Sprache.
Poesie ist die Art, mit der wir
dem Unbenannten Namen geben,
so dass es gedacht werden kann.
Audre Lorde
(MACHT) LERNEN VERLERNEN STAUNEN
Oder mit Paul B. Preciado gesagt:
Ein Wort ist keine Repräsentation einer Sache. Es ist ein Stück Geschichte: eine unabschließbare Kette von Verwendungen und Zitaten. Ein Wort ist zunächst Ergebnis einer Feststellung oder eines Staunens, Resultat eines Kampfes oder Besiegelung eines Triumphs. Es war Niederschlag einer Praktik, die sich erst später in ein Zeichen verwandelte. Der Spracherwerb in der Kindheit setzt einen Prozess des Sicheinbürgerns der Sprache in Gang, der dazu führt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, den Nachhall der Geschichte in unserem eigenen Sprechen zu hören.
Dieses Zitat ist im Kapitel »Etymologien« des Buches »Ein Apartment auf dem Uranus – Chroniken eines Übergangs« zu finden. Ich höre zunächst und vor allem das »Sicheinbürgern« bei Preciado, es unterbricht den Lesefluss, es unterbricht und führt mich zurück zum schreibenden, zeichnenden Kind, das ich war und das später dann durch das Einbürgern auch unterbrochen wurde. Ich wiederhole: »Kindheit setzt einen Prozess des Sicheinbürgerns der Sprache in Gang, der dazu führt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, den Nachhall der Geschichte in unserem eigenen Sprechen zu hören.«
Die Schreibweise meines Namens, die ich eben hör- und sichtbar zu machen versucht habe, kommt aus einer Zeit vor dieser genannten Einbürgerung. Sie kommt vor der Schule, in der das Schreiben jeweils einer Sprache zugeordnet, ihr zugehörig gemacht wird. Die Schreibweise meines Namens kommt vor der einsprachigen Schule in Basel, die uns ein sogenanntes Hochdeutsch beibrachte und die damit eigentlich immer schon zweisprachig war: denn die Lehrerin sprach Mundart mit uns, konkret: den Basler Dialekt, und brachte uns zugleich lesend das Hochdeutsch bei. Sie teilte die Sprache in eine offizielle und eine inoffizielle Sprache. Es war wichtig, dass nur in der offiziellen Sprache geschrieben wurde. In der inoffiziellen wurde gesprochen. Den Dialekt nennen wir nicht ohne Grund Mundart.
Das Schreiben, das ich vorhin beschrieb, hatte noch keinen offiziellen Raum, fand in einer Zeit außerhalb des offiziellen Schreibens statt, denn ich hatte es offiziell noch nicht gelernt, war nicht verpflichtet, es zu können, es also: richtig zu können. Aber war das vielleicht das ehrlichste Schreiben? War es vielleicht das eigentliche Schreiben? War es das Schreiben, in dem noch ein »Nachhall der Geschichte«, der Nachhall meiner Geschichten zu hören ist? Nicht eingebürgert entsprach die Sprache noch der Welt, die mich umgab. Eingebürgert oder eingeschult wurde sie vereinfacht? Eindeutig? Einsprachig?
Das tatsächliche sogenannte Einbürgern in die Schweiz kam erst zehn Jahre später. Es fiel mir leicht, es war keine Hürde, denn die Sprache war da schon so klar, man hörte mir in dem Moment nichts an außer den Zürcher Dialekt, den ich damals sprach und den ich mir nach dem Umzug von Basel nach Zürich sehr schnell angeeignet hatte. Das reichte aus, um den Beamten, den ich verpflichtend treffen musste für ein Gespräch, von meiner Einbürgerung zu überzeugen. Es klangen keine anderen Geschichten und Länder in meiner Sprache mit, als ich mit ihm sprach, natürlich in der Mundart, denn die inoffizielle Sprache ist eigentlich jene, in der Entscheidungen getroffen werden. Wer die inoffizielle mündliche Sprache ohne Nachklang einer anderen spricht, aus sich heraus – denn je älter man wird, umso schwerer lernt man sie, man muss sie sprechen, ohne dass sie gelernt klingt, so wie jeden Dialekt –, wer diese Sprache spricht, als wäre sie immer schon Teil von ihm oder ihr gewesen, wer nicht mehr staunt oder suchend spricht, gehört dazu.
So hat mich also der Dialekt eingebürgert und die Schule auch.
Doppelt gehörte ich nun dazu, die Frage ist und bleibt aber: Wohin dazu? War daraus eine Richtung abzulesen? Was hatte das Einbürgern verändert? Ich hatte ja nichts zurückgelegt, zurückgelassen, es war ja nur etwas dazugekommen. So bürgerte ich mir das Schweizerdeutsche und einen Pass dazu, nicht ein. Dazubürgern wäre doch eigentlich das schönere Wort als Einbürgern oder wie bei Preciado: »Sicheinbürgern«.
Nicht ein- oder aus-. Nicht sich.
Sondern alles rundherum: dazu und dazu und dazu.
Es sprechen also gesamte Kinder-Generationen perfekten Dialekt, zum Beispiel den Zürcher Dialekt, ohne Nachklang, perfekt meinend: gelernt und dann das Gelernte versteckt, den Nachhall verloren. Und es sprechen gesamte andere Generationen, die der Eltern und Großeltern dieser Kinder, in diesem Land oft mit Nachklang. Mit Geschichten dahinter, mit Geschichte, und fallen auf. Fallen heraus, andauernd. Gehen und fallen anders als wir, ihre Kinder, es tun. Versuchen alles viel richtiger zu machen, als wir es tun, und klingen immer anders. Ist das schmerzvoll? Ist das Teil all dieser Geschichten? Gibt es viele Risse und einer davon geht direkt durch diese Familien? Ein Riss, der erstmal ein sprachlicher ist? Ja.
Und ich frage mich: Warum?
Warum müssen diese Klänge Risse verursachen?
Warum müssen die Eltern und die Großeltern diesem dauernden Bedürfnis nachgehen, ja nichts falsch zu sagen?
Warum müssen Klänge und Nachklänge unklingend gemacht werden?
Warum müssen die Sprachen unauffällig bleiben?
Warum ist Nachklang nicht Reichtum?
Es sprechen Familien also zwei unterschiedliche Sprachen. Mindestens. Nie habe ich im Deutschen gleich geklungen wie die Eltern. Immer habe ich aber genau wie sie geklungen im Kroatischen, identisch fast, denn sie waren die zwei Menschen, die mir diese Sprache beibrachten. Diese zwei Menschen sind größtenteils meine kroatische Sprache: Ihr Dialekt, ihre Sprichwörter und ihre Klänge waren für den Großteil der Zeit mein einziger Referenzraum. Alle anderen, die diese Sprache auch sprachen, waren immer weit weg. Ich sprach und ich spreche größtenteils die kroatische Sprache meiner Eltern. Und ich spreche das Zürich-Deutsch, das vor unserer Haustüre gesprochen wird.
»Diese zwei Menschen sind größtenteils meine kroatische Sprache.«
Ich lese den vorherigen Absatz nochmals und bleibe bei dem Satz hängen. Meine kroatische Sprache. Meine Küchentischsprache, sage ich auch oft. Meine Sommerferiensprache. Meine emotionale Sprache. Meine intime Sprache, vor allem. Und: meine Sprache, in der ich nur ungefähr schreiben kann. In der ich langsamer lese als im Deutschen. Wie eine gesamte Generation mit mir. In der ich zuhause alle Gefühle weinend und fließend am Küchentisch erzähle, jedoch nie ein Buch oder Theaterstück geschrieben habe. All das trägt diese Sprache in sich. Und noch mehr: Diese Sprache hat ebenfalls eine vielsprachige Geschichte, außerhalb dieser und vieler Küchen. Eine Vielsprachigkeit, die in mehreren Ländern verstanden wird. Für Menschen aus dem deutschsprachigen Raum eine bekannte Situation. Darin sollte eine Ähnlichkeit stecken, ein Verständnis füreinander. Sprache, die in jeder Ecke anders klingt. Es stecken viele ähnliche Sprachen und Namen in ihr, es sind viele Sprachen, die in ihr und mit ihr klingen. Die sich mühelos gegenseitig verstehen. Es sind nicht nur Dialekte, es sind vielfältige Hochsprachen und sogar unterschiedliche Schriften, in denen diese Sprachen sich begegnen und zusammen sprechen können.
Doch selten stößt die Sprache auf Verständnis außerhalb ihrer eigenen Ecke. Sie kommt aus einem Gebiet, in dem immer und immer wieder gekämpft wird. Auch um die Sprache. Auch um ihren Namen. Um Ähnlichkeiten. Und um Abgrenzungen. Sie kommt aus einem Gebiet, in dem oft überschrieben wird. Umbenannt wird. Und trotzdem kann man in einem Auto oder Bus, mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug in diesem Sprachengebiet weit reisen und wird immer noch und immer wieder verstanden. Im Gespräch. Bei einer Bestellung. In der Post. Anders, aber ähnlich.
Und weil ich in meiner Küchentischsprache nicht schreibe, bin ich ihr gegenüber häufig auch fremd. Ungenauer, vom Gefühl her, als in dieser Sprache, in der ich jetzt spreche und lese. Schneller habe ich das Gefühl, falsch zu liegen. Falsches zu sagen, in ihr und über sie. Weil mich erstmal, anscheinend, mehr mit dieser Sprache hier verbindet. Vielleicht ist diese Sprache hier freier. Vielleicht kann ich in ihr meine Geschichte anders entdecken, weil sie nicht in jedem Wort seit immer schon lauert. Und das kann unheimlich sein.
Wenn ich »kroatisch« sage, steckt in diesem Wort »ein Stück Geschichte. Ein Wort ist zunächst Ergebnis einer Feststellung oder eines Staunens, Resultat eines Kampfes oder Besiegelung eines Triumphs.«
Auch innerhalb einer Familie gibt es Unterschiede im Klang. Überall.
Zum Beispiel: Den Insel-Dialekt meiner Großmutter habe ich nie so sprechen können wie den Zürcher Dialekt. Habe ihn nie gelernt. Und irgendwann war es nicht mehr möglich, ihn zu lernen, weil der Dialekt, wie gesagt, irgendwo aus dem Kinderbauch kommen muss, aus den Kinderbeinen und den Kinderhänden, nicht aus dem erwachsenen Kopf. So war ich auf der Großmutterinsel in Kroatien immer fremder, sprachlich betrachtet, als in Zürich. Sprach den Zagreber Dialekt meiner Eltern und war auf der Insel immer die aus der Stadt, mit dem falschen, dem auffallenden Klang. Nie eingebürgert auf der Großmutterinsel, aber in der Schweiz. Nie der Großmutter sprachlich wirklich nahe gewesen, aber der Schweizer Lehrerin. Dem Beamten bei der Einbürgerung. Der Frau an der Kasse im Supermarkt. (Obwohl die noch am spannendsten ist, weil sie wahrscheinlich beide Sprachen spricht oder noch eine dritte.)
Immer der Großmutter nahe gewesen und nie der Schweizer Lehrerin.
Auf der Großmutterinsel bin ich wiederum in Stein gemeißelt, seit immer von dort, nicht eingebürgert, sondern eingeschrieben: durch den Namen, der von dieser Insel kommt und nur von der Insel. Dort heißen alle so. Jeder mit anderer Geschichte, mit anderen Sprachen, aber: mit dem gleichen Namen. Er ist in die Grabsteine der Insel gemeißelt. Einziger Ort, an dem keiner aufhorcht. An dem kein Buchstabieren notwendig ist.
GASTFREMD
Nicht selten werde ich gefragt – man könnte vielleicht sagen: darum, also, daher –, ob ich etwas über Entfremdung schreiben könnte. Und meistens stimme ich schnell zu, als wäre ich längst schon Expertin für solche Texte, als wäre es lange schon selbstverständlich, dass jemand fragt: Entfremdung, anybody? Und ich so: Ja ja, hier, klar! Dafür hat man mich hierhergebracht, dafür doch die ganze Mühe, Erziehung, Wanderung und Annahme des Status quo, damit ich dann so: Entfremdung?
Hier! Bei mir!
Bei uns.
Wir sind viele, Körper mit ähnlichen Bewegungen, Erfahrungen, Entfernungen, durch deren Fernen und diesen zum Trotz so etwas wie ein kollektiver biografischer Bogen gespannt werden kann. Mit Eltern, die alles dran- und draufgesetzt haben, Tag für Tag, jegliches Fremde auszublenden. Namen wurden neu klingend gemacht, so dass sie hier ausgesprochen werden können, ebenso Haarschnitte, Kleiderschnitte, Farben, wie man Bus fährt (leise), wie man im Bus die Elternsprache spricht (leise), wie man reagiert, wenn andere die gleiche Sprache sprechen (lächelnd, aber nicht weiter darauf eingehend), wie man sich grundsätzlich verhält: als wäre man schon immer hier gewesen, das heißt: Habtachtstellung, immer, denn hinter jeder Ecke lauert eine neue Gewohnheit, ein neues Sprichwort, eine neue Formulierung, eine weitere Geste, die falsch ausgeführt werden könnte, die aber sitzen muss. Sagten die Eltern. Sagen es immer noch.
Oder: Einbürgerung, du meine zweite katholische Erziehung. Weil du 1: mit Demut behaftet bist und Scham auslöst, 2: an eine Institution glaubst und 3: die Erlösung versprichst. Die Ankunft am besten aller möglichen Orte. In einer Zukunft, die du versicherst, die aber nie ganz eintreten wird: kein Ausruhen, kein Entspannen, da gibt es niemanden, der jemals sagen wird: »It’s ok now.« Und die Eltern beten jeden Tag zu ihr, ora et labora, es ist harte Arbeit und sie wird vollzogen. Man kommt nicht und ist einfach, ist nicht einfach die Person, der Mensch, der Körper, man wird: somebody, man wird: Teil vom Ganzen.
Oder: Einbürgerung, du unerfüllte monogame Liebe, du Wiederherstellung eines Ganzen, weg mit dem Fremden, der Fremden, das Fremde in dir soll aufgehen im Ganzen, verschwinden, aber dieser Körper bleibt und stellt sich quer, permanent, permeabel, will man rufen und streitet sich laut mit diesen gläubigen Eltern, es kann doch nicht sein, dass ihr immer noch und weiterhin an diese eine große Liebe glaubt, daran, dass wenn ihr alles richtig macht, dass wenn ihr diesen Glauben pflegt und hegt, wenn ihr tagtäglich leise und richtig und unauffällig –!
Und nun schauen die Kinder dieser Eltern, die längst keine Kinder mehr sind, die längst selber Eltern sein können, diese schauen ihre Eltern nun an und fragen sich: Wie viele Jahre werden wir brauchen, um diese letzten dreißig oder so Jahre der Eltern zu verstehen oder: erzählen zu können? Wir waren die gesamte Zeit über dabei, zuerst an ihrer Seite, zuerst ganz nah, dann immer weiter weg, es ging schnell, sehr schnell und schon standen wir ganz anders, sprachen wir ganz anders, bewegten wir uns ganz anders durch diese Straßen und Städte als diese Eltern, die weiterhin an unserer Seite waren, auch wenn wir weitergingen, bis wir an fast gegenüberliegenden Seiten standen. Und uns anschauten. Aus einer neuen Ferne. Und plötzlich scheint alles oder vieles, wegen dem sie gegangen sind oder das sie uns mitgegeben haben (Sprachen, Reisepässe, Reiserouten, die Familiengeschichte, das Mittagessen am Sonntagnachmittag, ein politischer Kontext, den es nicht mehr gibt, ein Land, das es nicht mehr gibt, das neue Land …), aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet zu werden. Gegenläufig gelebt zu werden. Wir stehen ihnen häufig wortlos gegenüber und wissen nicht mehr: Berühren wir uns noch?
Auf jeden Fall glauben wir nicht, sagen wir ihnen, auf jeden Fall lassen wir uns nicht zurechtschneiden, um dazuzugehören. Wir werden nicht weiter dieser unerfüllten Liebe hinterherrennen, wir werden alles ganz anders machen! Wir werden unsere Namen zurückändern, wir werden alle Sprachen gleich laut sprechen, uns kann keiner was, wir sind unverletzlich, von der Sehne bis zum Herzen, aber eure Integration, euren festen Glauben daran, den müssen wir ablegen, den werden wir so nicht mehr durchziehen, ziehen uns sowieso alles an, was wir wollen, oder aus, denn die Scham: pah! Wir lassen any Fremdes zu.
Und so gehen wir durch die Welt, bis etwas Unerwartetes passiert, bis es wieder schmerzt: zum Beispiel bei einer Premiere dieses Kindes von einem anderen Körper ihres Alters angesprochen zu werden. Einem Körper ihres Alters, der hier aber schon seit Generationen Wurzeln schlägt und darin träge und schlagfertig zugleich ist, sich vor allem in Sicherheit wiegt, all diese Generationen von Hiersein in sich tragend, dieser Körper also tritt an die Eltern heran, bei dieser, sagen wir mal, Premiere, bei der das Kind, das erwachsene Kind, Regie geführt hat; und bei der dieser Körper ebenfalls mitgewirkt hat. Er ist männlich, weißhaarig, gebildet, irgendwie beeindruckt und zugleich davon verängstigt, dass diese Eltern also dieses Kind hier haben, das potentiell ein Selbstverständnis im Hier-Leben haben könnte, das Regie führt an einem Stadttheater, das also sogar Führungspositionen übernimmt, dieses weibliche Kind, viel jünger als dieser ältere, weiße Körper, es ist das Jahr 2000-x, und er fragt, ganz simpel und direkt, so direkt, wie es sich die Eltern (und da könnte man wütend werden!) auch nach dreißig Jahren hier nie trauen würden, trotz aller Rhetorik und Gewitztheit, die sie doch irgendwo in sich tragen (aber wie gesagt: Scham, Demut …) – also dieser andere Körper, der sichere, der fragt: Wie geht es Ihnen als Gastarbeitern – damit, dass Ihr Kind nun als Künstler (natürlich nicht Künstlerin) einen ökonomisch unsicheren Weg bestreiten wird? Sie sind doch wegen des sicheren Geldes gekommen, nicht wahr?
Er überrumpelt sie. Die Eltern lächeln. Sie stottern leicht. Sie erklären sich, natürlich, denn das haben sie gelernt: Sie können immer erklären, dass sie ihre Kinder unterstützen, dass es ihnen nicht ums Geld geht, sondern wie allen Eltern um das Glück ihrer Kinder, und leise sagt der Vater auch noch: Ich bin nicht wegen des Geldes gekommen, sondern für das Abenteuer – wahrscheinlich sagt er es nicht einmal leise, doch der Mann mit dem Selbstbewusstsein mehrerer Generationen in sich freut sich so oder so: Da ist die Verunsicherung wieder und hier bleibt sein fester Stand. So muss es sein.
Und sie sagen nicht: Was fällt Ihnen ein, diese Frage zu stellen?
Und sie sagen nicht: Wir waren keine Gastarbeiter.
Und sie sagen nicht: Sie kennen unsere Geschichte nicht. Was fällt Ihnen ein, uns einen Namen zu geben, was fällt Ihnen ein, unser Leben zu kategorisieren, zu meinen, uns zu kennen, uns alle, nach dreißig Jahren hier –
Und niemand sagt: Dieses Kind, das verdient doch gar nicht so schlecht als Regisseurin. Im Gegenteil.
Nein, es wird gelächelt.
Danach kommt er zum erwachsenen Kind dieser Eltern, dieser Mann, gratuliert ihr, freundlich, lächelnd, wiederholt zum Schluss den Vornamen dieses Kindes und sagt dann zum Abschied: Was für ein ungewöhnlicher Name.
Abgang weißer, weißhaariger, gebildeter Mann.
Zurück bleibt: eine Familie, ein Schweigen, ein stolzer Blick unter Augenringen, die von einem Moment auf den nächsten wieder schwer im Gesicht liegen, ein weiterer Sekt, ein Stehen im Raum mit wackeligem Schatten. Müdigkeit.
Wo die Verletzung liegt? Wo sie beginnt? Nicht einmal nur in der bekannten Bedeutung von »Gastarbeiter:in« als jemandem, der oder die für eine begrenzte Zeit in einem fremden Land arbeitet, oder: einem ausländischen Arbeitnehmer. (So geschrieben, männlich, und so beschrieben erscheint das Wort 1967 zum ersten Mal im Duden.) Schon der kleinere Teil des Wortes oder eigentlich der große: »Gast« verliert in diesem Moment all seine Herzlichkeit: klingt scharf, klingt bitter. Gast, immer noch? Weiterhin? Oder gar: für immer? Und »Arbeiter«, so wahr: Sie haben dreißig Jahre lang gearbeitet, um keine Gäste mehr zu sein, sie wollen nur noch in den Ruhestand, stehen kurz vor ihm, doch dieser scheint nicht vorgesehen zu sein.
Dabei kamen sie als Akademiker und arbeiteten von Anfang an in ihrem Beruf.
Doch warum muss das betont werden?
Warum wird nicht das gefragt?