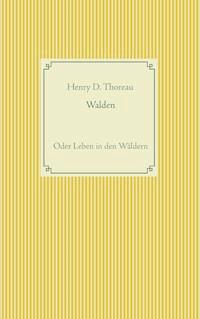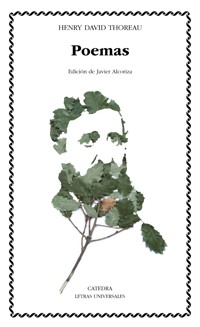15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Manesse Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Pflichtlektüre für alle Fortschrittsskeptiker, Sinnsucher, Weltflüchtige sowie Wald- und Naturliebhaber
Ein Klassiker von enormer Brisanz: ein leidenschaftliches Plädoyer für Verantwortung, Selbstbestimmung und ein naturnahes, ressourcenschonendes Leben. Nirgendwo finden sich die besseren Argumente für Achtsamkeit und Nachhaltigkeit, Minimalismus und Vegetarismus.
Was ist im Leben wirklich von Bedeutung? Um dies herauszufinden, kehrte Henry David Thoreau vor über hundertfünfzig Jahren der Zivilisation den Rücken und zog hinaus in die Stille der Wälder. Am Walden-See in Concord, Massachusetts, verbrachte er zwei Jahre in einer selbst gebauten Holzhütte, um «zu sehen, ob ich nicht lernen könne, was es zu lernen gibt, damit mir in der Stunde des Todes die Entdeckung erspart bleibe, nicht gelebt zu haben». Der grandiose Selbsterfahrungsbericht «Walden» legt Zeugnis von seiner Suche ab: mit sensiblen, poetischen Naturbeschreibungen und dem glaubhaften Plädoyer für echte Naturverbundenheit und ein selbstbestimmtes Dasein. Längst ist dieses Buch zu einer Art grüner Bibel geworden, in der man die besten Argumente für Nachhaltigkeit, Ökologie, Vegetarismus und Minimalismus findet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Einfachheit ist der neue Reichtum! Voller Enthusiasmus beschreibt Thoreau die Freuden von Mäßigung, Bedachtsamkeit und Nachhaltigkeit. Sein Plädoyer für ein freies, selbstbestimmtes Leben im Einklang mit der Natur ist das Buch der Stunde.
«Eine Lust- und Pflichtlektüre für alle, die die Naturschönheiten unserer Erde lieben.» Susanne Ostwald
Was ist im Leben wirklich von Bedeutung?Um dies herauszufinden, kehrte Henry David Thoreau (1817–1862) vor über hundertfünfzig Jahren der Zivilisation den Rücken und zog hinaus in die Stille der unberührten Natur. Am Walden-See in Concord, Massachusetts, verbrachte er zwei Jahre in einer selbst gebauten Holzhütte, um «zu sehen, ob ich nicht lernen könne, was es zu lernen gibt, damit mir in der Stunde des Todes die Entdeckung erspart bleibe, nicht gelebt zu haben». Sein grandioser Selbsterfahrungsbericht legt Zeugnis von dieser Sinnsuche ab: mit sensiblen, poetischen Naturbeschreibungen und der gelebten Utopie eines freien, ungebundenen Daseins. Längst ist dieses Buch zu einer Art grüner Bibel geworden, die Antworten auf all die brennenden Fragen gibt, die unsere Welt heute mehr denn je bewegen.
«Die amerikanische Literatur, so kühn und großartig sie ist, hat kein schöneres und tieferes Buch aufzuweisen.» Hermann Hesse
HENRY DAVID THOREAU
WALDEN
oderVom Leben im Wald
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Fritz Güttinger
Überarbeitete Neuausgabe
Kommentiert und mit einem Nachwortvon Susanne Ostwald
MANESSE VERLAG
Hauswirtschaft
Als ich das Folgende – jedenfalls den größten Teil davon – niederschrieb, lebte ich allein im Wald, mehr als einen Kilometer vom nächsten Nachbarn entfernt, in einem selbst gezimmerten Haus am Ufer des Walden-Sees bei Concord, Massachusetts, und verdiente mir meinen Lebensunterhalt ausschließlich mit meiner Hände Arbeit. Zwei Jahre und zwei Monate habe ich dort zugebracht; gegenwärtig halte ich mich wieder in der Zivilisation auf.
Ich würde den Leser nicht mit meinen Angelegenheiten behelligen, hätte man mir nicht so eingehende Fragen zu meiner Lebensweise gestellt, Fragen, die manchen vielleicht ungehörig, mir in Anbetracht der Umstände aber durchaus natürlich und zur Sache gehörig vorkommen. Man hat mich gefragt, was ich zu essen gehabt habe, ob ich mich nicht einsam fühlte, mich nicht fürchtete und dergleichen. Manche wollten wissen, wie viel von meinem Einkommen ich für wohltätige Zwecke ausgebe, und andere, solche mit großer Familie, wie viele arme Kinder ich unterstütze. Diejenigen, denen an mir persönlich nicht viel gelegen ist, möchte ich deshalb um Verzeihung bitten, wenn ich es unternehme, einige dieser Fragen in einem Buch zu beantworten. In den meisten Büchern wird die Ichform geflissentlich vermieden; in diesem wird sie nicht verhehlt. Geltungssüchtiger als andere bin ich deswegen nicht. Man vergisst allzu leicht, dass es im Grunde genommen immer die erste Person Einzahl ist, die spricht. Ich würde nicht so viel über mich selber reden, wenn es einen andern Menschen gäbe, über den ich ebenso gut Bescheid wüsste. Bedauerlicherweise bin ich durch mangelnde Erfahrung auf dieses Thema beschränkt. Ich meinerseits verlange übrigens von jedem Schriftsteller, als Erstes oder Letztes, einen einfachen und wahrhaftigen Bericht über sein eigenes Leben, und nicht bloß, was er vom Leben anderer gehört hat – einen Bericht, wie er ihn vielleicht aus fernen Landen seinen Angehörigen erstatten würde. Wenn er nämlich wahrhaft gelebt hat, muss das nach meinem Dafürhalten in fernen Landen gewesen sein. Vielleicht sind diese Seiten insbesondere für arme Studenten gedacht. Im Übrigen wird jeder Leser dem Buch entnehmen, was ihn betrifft. Ich hoffe, niemand wird sich dabei Zwang antun; wem der Schuh passt, dem wird er gute Dienste leisten.
Ich möchte etwas sagen, nicht über die Bewohner Chinas oder Hawaiis, vielmehr über meine Landsleute in Neuengland und ihre Lebensverhältnisse, wie diese sind, ob sie unbedingt so arg sein müssen oder ob sie sich nicht ebenso gut verbessern ließen. Ich bin in Concord viel herumgekommen, und überall, in Läden und Büros und auf den Äckern, hatte ich den Eindruck, dass die Bewohner damit beschäftigt seien, auf tausenderlei bemerkenswerte Art Buße zu tun. Ich habe von Brahmanen gelesen, die inmitten von vier Feuern sitzen und in die Sonne schauen; von solchen, die sich mit dem Kopf nach unten über Flammen aufhängen lassen; von andern, die über die Schulter zurück zum Himmel emporblicken, bis sie die natürliche Haltung überhaupt nicht mehr einnehmen können und des verdrehten Halses wegen auf flüssige Nahrung angewiesen sind; auch gibt es welche, die sich lebenslänglich an den Fuß eines Baumes anketten lassen; andere wiederum messen, Raupen gleich, mit ihrem Körper riesige Reiche aus oder stehen auf einem Bein hoch oben auf einer Säule. Doch alle diese Formen der Buße sind kaum erstaunlicher als das, was ich täglich erlebe. Die zwölf Aufgaben des Herkules1 waren eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, worauf meine Landsleute sich eingelassen haben; schließlich waren es nur deren zwölf, und sie fanden ein Ende; doch dass meine Zeitgenossen ein Monster erschlagen oder gefangen oder irgendeine Arbeit zu Ende gebracht hätten, davon habe ich nie etwas gesehen. Sie haben keinen Freund Jolaos2, der mit einem glühenden Eisen den Halsstumpf der Hydra versengt; sobald ein Kopf zermalmt ist, kommen gleich zwei neue nach.
Was ich sehe, sind junge Landsleute, deren Unglück es ist, Bauernhöfe, Häuser, Scheunen, Vieh und landwirtschaftliche Geräte geerbt zu haben; zu dergleichen kommt man leichter, als man es wieder loswird. Sie wären besser draußen auf freiem Felde geboren und von einer Wölfin gesäugt worden; dann hätten sie klarer erkannt, welches Feld zu beackern ihnen aufgetragen ist. Wer hat sie zu Sklaven der Scholle gemacht? Warum sollen sie sich für ihre sechzig Morgen Land abrackern, wenn sie doch nur dazu verdammt sind, ihr Häuflein Dreck zu fressen? Warum soll einer damit anfangen, sein Grab zu schaufeln, kaum dass er geboren ist? Sie sollen ein menschenwürdiges Dasein führen, sich dabei mit all diesen Dingen schinden und versuchen, so gut wie möglich zurechtzukommen. Wie oft bin ich schon einer armen Seele von Mensch begegnet, der unter seiner Last beinahe zusammenbrach, wenn er sich seinen Lebensweg entlangschleppte und dabei einen Stall, fünfundzwanzig mal zwölf Meter groß, vor sich herschob, einen wahren Augiasstall3, nie ausgemistet, und dazu noch hundert Morgen Land4, die beackert, gemäht und abgeholzt sein wollen! Die Besitzlosen, die sich nicht mit solch überflüssigem Erbgut abzurackern haben, finden es anstrengend genug, ihr menschliches Erbteil, das Fleisch, zu hegen und zu pflegen.
Aber der Mensch schuftet unter dem Eindruck eines Irrtums. Sein besserer Teil ist bald als Dünger unter den Boden gepflügt. Wegen eines scheinbaren Schicksals, gemeinhin Notwendigkeit genannt, müht er sich damit ab, Schätze zu sammeln, die die Motten und der Rost fressen und denen die Diebe nachgraben, um sie zu stehlen. Es ist eine Dummheit, so zu leben; das merkt jeder, wenn es ans Ende geht, wenn nicht schon vorher. Der Sage zufolge haben Deukalion und Pyrrha das Menschengeschlecht neu erschaffen,5 indem sie Steine hinter sich warfen:
«Inde genus durum sumus experiensque laborum,
Et documenta damus qua simus origine nati.»
Oder, wie Raleigh es in seiner klangvollen Art intoniert:
«Drum sind wir ein hartes Geschlecht,ausdauernd zur Arbeit;
Und wir geben Beweise, woher wir zogenden Ursprung.»6
So geht es, wenn man einem stümperhaften Orakel blindlings folgt und Steine hinter sich wirft, ohne zu schauen, wohin sie fallen.
Selbst in diesem verhältnismäßig freien Land sind die meisten Menschen aus bloßer Unwissenheit und Verblendung so von künstlichen Sorgen und von überflüssiger Schwerarbeit beansprucht, dass sie nicht dazu kommen, die feineren Früchte vom Baum des Lebens zu pflücken. Ihre Finger sind von der übermäßigen Plackerei zu unbeholfen und zittrig dafür. Das Erwerbsleben lässt dem Menschen nicht genug Zeit, um den Alltag menschenwürdig zu gestalten; er kann es sich nicht leisten, den andern Menschen gegenüber menschlich aufzutreten; es könnte ja den Marktwert seiner Arbeit beeinträchtigen. Er hat keine Zeit, etwas anderes als eine Maschine zu sein. Wie kann er wachsen, indem er sich seiner Unwissenheit entsinnt, wenn er dauernd seine Kenntnisse anwenden muss? Wir sollten ihn manchmal kostenlos ernähren und einkleiden und mit Stärkungsmitteln laben, ehe wir ein Urteil über ihn fällen. Mit den besten Eigenschaften des Menschen verhält es sich wie mit dem Flaum auf Früchten – man muss behutsam mit ihnen umgehen, wenn sie erhalten bleiben sollen. Doch weder uns selber noch den andern fassen wir so schonend an.
Gewiss, manche sind arm und haben Mühe, sich über Wasser zu halten. Ich habe keinen Zweifel, dass einige von Ihnen, die dieses Buch lesen, nicht imstande sind, jede Mahlzeit zu bezahlen, die Sie eingenommen haben, auch nicht die Kleider und Schuhe, die bald (oder bereits) abgetragen sind; die Zeit, die Sie an dieses Buch wenden, ist geborgt oder gestohlen und raubt Ihren Gläubigern eine Stunde. Es ist unverkennbar, was für ein armseliges und abgestumpftes Leben viele von Ihnen führen; ich habe da aus Erfahrung einen geschärften Blick. Immer am Limit, immer bemüht, ins Geschäft zu kommen und aus den Schulden heraus, aus diesem uralten Morast, von den Lateinern aes alienum7 genannt, eines andern Kupfer (manche ihrer Münzen waren nämlich aus Kupfer), immer am Leben und am Sterben und schließlich mit des andern Kupfer begraben; immerfort verspricht man zu zahlen; man verspricht zu zahlen, morgen, und stirbt heute, zahlungsunfähig; immer wirbt man um Gunst und Kundschaft, auf alle möglichen Arten, solange man nur innerhalb des Gesetzes bleibt; man lügt, schmeichelt, gibt seine Stimme, verkapselt sich in Höflichkeit oder verflüchtigt sich in einen Dunst von Leutseligkeit, um seinen Nächsten dazu zu bringen, dass man ihm die Schuhe machen darf, oder den Hut oder die Jacke oder seinen Wagen, oder dass man ihm die Lebensmittel liefern darf. Man schuftet sich krank, damit man etwas für Tage des Siechtums auf die Seite legen kann, etwas, das man in eine alte Truhe oder in einen Strumpf steckt oder, vorsichtiger, auf die Bank trägt, einerlei, wohin, einerlei, wie viel oder wie wenig.
Manchmal staune ich, dass wir so, fast möchte ich sagen, frivol sein können, uns mit der krassen, aber uns doch eher fernliegenden Form der Knechtschaft, Negersklaverei genannt, zu befassen, wo es doch im Norden wie auch im Süden so viel abgefeimte Herren und Gebieter gibt. Einem südstaatlichen Aufseher zu unterstehen ist hart; noch schlimmer, einen nordstaatlichen Aufseher zu haben; doch das Schlimmste ist, selber sein eigener Sklaventreiber zu sein. Da redet man vom göttlichen Funken im Menschen! Man betrachte den Fuhrmann auf der Landstraße, der bei Tag oder Nacht zu Markte fährt; regt sich vielleicht etwas Göttliches in ihm? Er kennt keine höhere Pflicht als die, seine Pferde zu füttern und zu tränken. Was ist er anderes als ein Rädchen im Getriebe des Transportwesens? Fährt er denn nicht für irgendeinen betriebsamen Krautjunker? Wie göttergleich, wie unsterblich ist denn so ein Fuhrmann? Man sehe nur, wie er sich duckt und herumschleicht, wie er dauernd in unbestimmten Ängsten schwebt, keineswegs unsterblich oder göttergleich, vielmehr der Sklave und Gefangene der Meinung, die er von sich selber hat, des Rufes, den er sich selbst geschaffen. Die öffentliche Meinung ist ein müder Tyrann verglichen mit unserer eigenen, privaten Meinung. Was einer von sich selber hält, gibt seinem Schicksal die Richtung. Selbstbefreiung auch in den entlegenen Provinzen der Fantasie – wo ist der Wilberforce8, der sich dafür einsetzt? Man denke auch an die Damen hierzulande, die endlos Kinkerlitzchen verfertigen, um nicht darüber nachsinnen zu müssen, wie es um sie steht. Als ob man die Zeit totschlagen könnte, ohne dabei der Ewigkeit zu schaden.
Die meisten Menschen führen ein Leben stiller Verzweiflung. Was man Schicksalsergebenheit nennt, ist eingefleischte Verzweiflung. Aus der verzweifelten Stadt fährt man aufs verzweifelte Land und tröstet sich mit einem Gepränge von Nerz und Bisam darüber hinweg. Eine landläufige, wenn auch unbewusste Verzweiflung verbirgt sich auch in dem, was man Spiel und Vergnügen nennt. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen – so heißt es. Ein Merkmal der Weisheit ist jedoch, dass man nichts Verzweifeltes tue.
Wenn man erwägt, was des Menschen Daseinsgrund sei, was seine wahren Notwendigkeiten und Lebenswege, so scheint es, als habe der Mensch sich seine gewöhnliche Existenzform mit Bedacht ausgesucht, weil er sie jeder andern vorziehe. In Wirklichkeit aber ist er überzeugt, dass ihm gar keine andere Wahl bleibt. Nur wer wachen und gesunden Sinnes ist, weiß noch, dass die Sonne strahlend aufging. Es ist nie zu spät, sich von Vorurteilen zu lösen. Kein Denken oder Tun, und sei es noch so althergebracht, kann ohne Weiteres übernommen werden. Was heute jedermann nachspricht oder als selbstverständlich auf sich beruhen lässt, kann sich morgen als falsch herausstellen, als bloßer Schall und Rauch, den man für eine regenspendende Wolke hielt.
Wenn man etwas versucht, was die alten Leute für unmöglich hielten, wird man feststellen, dass man es tun kann. Altes Tun und Treiben für alte Leute; neues Tun und Treiben für neue. Früher verstand man sich vielleicht nicht einmal darauf, ein Feuer im Gang zu erhalten; heute legt man etwas dürres Holz unter einen Kessel und saust flugs um den Erdball, mit einer Geschwindigkeit, die einen umbringen könnte, wie alte Leute sagen. Das Alter taugt nicht zum Lehrmeister der Jugend, hat es doch weniger gewonnen als eingebüßt. Man möchte fast bezweifeln, dass selbst der Weiseste dadurch, dass er gelebt hat, etwas von unbedingtem Wert erfuhr. Als Wegleitung fürs Leben haben die Alten den Jungen nichts von Belang zu geben; ihre Erfahrungen waren eigennützig, ihr Leben war ein kläglicher Misserfolg, aus besonderen Gründen, wie sie annehmen müssen. Und möglicherweise haben sie sich aller Erfahrung zum Trotz noch etwas Lebensmut bewahrt und sind bloß nicht mehr so beweglich. Ich habe gut dreißig Jahre auf diesem Planeten gelebt und warte noch immer auf den ersten brauchbaren oder auch nur erwägenswerten Rat eines älteren Menschen. Man hat mir nichts beigebracht, kann mir wahrscheinlich gar nichts Brauchbares beibringen. Da ist das Leben, ein von mir großenteils noch unerprobtes Wagnis, aber es nützt mir nichts, dass andere es erprobt haben. Wenn ich zu irgendeiner wertvollen Einsicht gekommen bin, dann ist es bestimmt eine, von der meine Erzieher mir nichts verraten haben.
«Man kann nicht ausschließlich von Pflanzenkost leben», erklärt mir ein Bauer, «diese liefert nämlich nichts zum Aufbau der Knochen.» Und so führt er sich denn Tag für Tag andächtig den Aufbaustoff für seine Knochen zu; dabei geht er, während er seinen Spruch zum Besten gibt, hinter den Ochsen her, die ihn und den schweren Pflug mit ihren aus Pflanzenkost aufgebauten Knochen über Stock und Stein schleppen. Manches mag für Kranke und Gebrechliche lebensnotwendig sein, was für andere überflüssig und noch andern völlig unbekannt ist.
Manche finden, der ganze Boden des Menschenlebens sei schon längst mitsamt allen seinen Höhen und Tiefen durchmessen und in jeder Beziehung geregelt worden. «Der weise Salomo hat sogar für den Abstand der Bäume voneinander Vorschriften erlassen», liest man bei John Evelyn, «und die römischen Prätoren haben verfügt, wie oft einer rechtmäßig das Grundstück seines Nachbarn betreten darf, um dort Eicheln aufzulesen, und wie viel davon dem Nachbarn zusteht.»9 Hippokrates hat sogar Anweisungen hinterlassen, wie man sich die Nägel schneiden soll – nämlich genau bis zu den Fingerspitzen, weder kürzer noch länger.10 Zweifellos ist sogar die Langeweile, das Gefühl, die Freuden des Lebens bereits ausgekostet zu haben, so alt wie Adam. Wessen der Mensch fähig ist, wurde aber noch nie ermessen; das lässt sich nicht nach dem beurteilen, was bisher geleistet wurde; es ist ja so wenig geleistet worden. Wo auch immer du bisher erfolglos geblieben bist: «Lass dir nicht zusetzen, mein Kind, denn wer soll dir zuweisen, was du nicht erledigt hast?»11 Wir könnten unser Leben tausenderlei einfachen Tests unterziehen, zum Beispiel erkennen, dass dieselbe Sonne, die meine Bohnen reifen lässt, gleichzeitig ein ganzes System von Welten wie die unsere erhellt. Hätte ich mich dessen erinnert, wären mir einige Fehler erspart geblieben. Ich habe meine Bohnen nicht im Lichte dieser Erkenntnis angebaut. Von welch wundervollen Dreiecken sind doch die Sterne der Scheitelpunkt! Welche ganz andersgearteten Wesen in den verschiedenen Behausungen des Weltalls betrachten im selben Augenblick aus der Ferne dasselbe Dreieck! Natur und Menschenleben sind so verschiedenartig wie unsere Konstitution. Wer kann sagen, welche Aussichten die Welt einem andern darbietet? Ließe sich ein größeres Wunder denken, als sie vorübergehend mit den Augen eines andern sehen zu können? In einer Stunde würden wir alle Zeitalter der Welt durchleben, ja, alle Welten vom Anbeginn der Zeit. Geschichte, Dichtung, Sage – ich kann mir keinen Erfahrungsaustausch denken, so verblüffend und lehrreich wie diesen.
Das meiste von dem, was meinen Nachbarn als gut gilt, halte ich zutiefst für schlecht, und wenn ich irgendetwas bereue, dann höchstens mein gutes Benehmen. Was war eigentlich in mich gefahren, dass ich mich so gut benahm? Da kann einer, der siebzig Jahre – nicht unehrenhaft – hinter sich gebracht hat, noch so weise Sprüche von sich geben, mich lockt eine innere Stimme unwiderstehlich von alldem weg. Eine neue Generation lässt das Tun und Treiben der vorhergehenden im Stich wie ein auf Grund gelaufenes Schiff.
Ich glaube, wir könnten bedenkenlos mehr Vertrauen haben. Wir könnten uns ohne Weiteres in dem Maße der Sorge um uns selbst entäußern, wie wir sie etwas anderem zuwenden. Die Natur passt sich ebenso sehr unseren schwachen wie unseren starken Seiten an. Sich ständig zu sorgen und zu überanstrengen ist eine nahezu unheilbare Krankheit. Wir machen uns eine übertriebene Vorstellung von der Wichtigkeit der Arbeit, die wir verrichten, und wie viel bleibt dabei ungetan! Oder wie steht es, wenn wir krank würden? Wie sind wir doch ständig auf der Hut, fest entschlossen, nichts dem Zufall zu überlassen, wenn es sich anders einrichten lässt; nur des Nachts vertrauen wir uns wohl oder übel dem Ungewissen an. Notgedrungen halten wir unsere Lebensweise hoch und bestreiten, dass es auch anders ginge. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, wie sich von einem Mittelpunkt aus Radien ziehen lassen. Jede Veränderung, in Erwägung gezogen, ist ein Wunder, doch das Wunder findet dauernd statt. «Zu wissen, dass wir wissen, was wir wissen», sagt Konfuzius, «und dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen, das ist wahres Wissen.»12 Wenn einer das, was ihm vorschwebt, einmal verstandesmäßig gefasst hat, dann werden wohl die Menschen zu guter Letzt ihr Leben darauf aufbauen.
Bedenken wir doch kurz, worum sich die Sorgen und Ängste, von denen die Rede war, meistenteils drehen und inwieweit es notwendig ist, dass wir uns sorgen oder zum Mindesten vorsehen. Es wäre von Vorteil, ein anspruchsloses Grenzerleben zu führen, wenn auch inmitten einer zivilisierten Welt; dann würde man merken, was zum unentbehrlichen Lebensbedarf gehört und wie man es anstellt, ihn zu beschaffen. Vielleicht würde es schon genügen, die Geschäftsbücher der Kaufleute von ehedem zu durchblättern, um zu erfahren, was denn gemeinhin am meisten gekauft wurde, was jeweils auf Lager war, mit andern Worten, was eigentlich die unmittelbaren Lebensmittel sind. Die Errungenschaften von Jahrhunderten haben nämlich nur wenig an den Grundgesetzen des Menschendaseins geändert, wie sich wohl auch unser Skelett von dem unserer Urahnen nur wenig unterscheidet.
Unter dem «Lebensbedarf» verstehe ich, was immer von den Dingen, die der Mensch sich selber beschaffen muss, von Anbeginn an oder aus alter Gewohnheit als so wichtig gilt, dass nur die wenigsten, falls überhaupt jemand, je versuchte, ohne diese Dinge auszukommen, sei es aus Kulturlosigkeit, Armut oder Überzeugung. Für viele Lebewesen gibt es in diesem Sinn nur eines, das unbedingt nötig ist – Nahrung. Dem Büffel der Prärie genügt etwas genießbares Gras und Trinkwasser, außer wenn er den Schutz des Waldes oder die Schattenseite eines Berges aufsucht. Etwas anderes als Nahrung und Obdach braucht kein Tier. Den Lebensbedarf des Menschen in unseren Breitengraden kann man einteilen in Nahrung, Obdach, Bekleidung und Brennstoff; erst wenn wir uns das gesichert haben, sind wir in der Lage, ungehindert und mit Aussicht auf Erfolg an die eigentlichen Lebensfragen heranzutreten. Häuser und Bekleidung sowie das Kochen der Nahrung sind eine Erfindung des Menschen, und aus der zufälligen Entdeckung, dass Feuer Wärme spendet, ergab sich mit der Zeit das Bedürfnis, am Feuer zu sitzen. Auch Katzen und Hunden wird das ja zur zweiten Natur. Obdach und Bekleidung, im richtigen Maß, dienen dazu, uns die Körperwärme zu erhalten; im Übermaß verwendet, grenzen sie, wie auch übertriebene Heizung, gewissermaßen bereits ans Kochen. Der Naturforscher Darwin13 schildert sein Erstaunen über die Eingeborenen von Feuerland, denen, während seine eigenen Leute sich in warmer Kleidung dicht ums Feuer scharten, bei dieser Röstung der Schweiß in Strömen herunterrann, obwohl sie nackt und viel weiter entfernt waren. So laufen auch die Neuholländer nackt herum, während der Europäer in seinen Kleidern schlottert. Ist es denn ausgeschlossen, die körperliche Widerstandskraft dieser Naturvölker mit dem Geist des Kulturmenschen zu vereinen? Nach Liebig14 ist der menschliche Körper ein Ofen, und Nahrung der Brennstoff, der die innere Verbrennung aufrechterhält. An kalten Tagen essen wir mehr, an warmen weniger. Die natürliche Körperwärme ist das Ergebnis eines langsamen Verbrennungsvorgangs; Krankheit und Tod treten ein, wenn der Vorgang sich zu rasch abspielt oder wenn die Heizung aus Mangel an Brennstoffzufuhr ausgeht, im Sinne dieser Analogie, denn selbstverständlich soll Körperwärme nicht mit Feuer verwechselt werden. So bedeutet Leben deshalb fast dasselbe wie Körperwärme; Nahrung kann als der Brennstoff betrachtet werden, der die innere Heizung im Gang erhält. Brennstoff braucht der Mensch also, um die Nahrung zuzubereiten oder die Körperwärme von außen her zu steigern, während Obdach und Bekleidung nur dazu dienen, die solchermaßen erzeugte Wärme zu bewahren.
Was uns körperlich vor allem nottut, ist deshalb, die Lebenswärme in uns zu erhalten. So mühen wir uns ab, nicht nur, was Nahrung, Kleidung und Obdach betrifft, sondern auch mit unseren Betten, die gewissermaßen unsere nächtliche Hülle darstellen; wir rauben den Vögeln Flaum und Federn, um diesen Unterschlupf innerhalb des Unterschlupfs auszustatten, dem Maulwurf gleich, der am Ende seines Gangs sein Lager aus Laub und Halmen hat. Der Arme pflegt sich zu beklagen, es sei eine kalte Welt; und der Kälte, körperlicher wie sozialer, schreiben wir großenteils unsere Übel zu. In gewissen Gegenden ermöglicht es der Sommer dem Menschen, gleichsam in elysischen Gefilden zu wohnen. Des Brennstoffs bedarf er dann höchstens, um sich sein Essen zu kochen; die Sonne ist sein Feuer, und mancherlei Früchte sind von ihren Strahlen genügend gekocht, während die Nahrung ganz allgemein abwechslungsreicher und verfügbarer ist und Kleidung sowie Obdach überhaupt oder teilweise überflüssig werden.
Zum unentbehrlichen Lebensbedarf kommen bei uns heutzutage erfahrungsgemäß ein paar Werkzeuge hinzu – Messer, Axt, Spaten, Schubkarren und so weiter –, und für den Geistesarbeiter noch Lampenlicht, Schreibzeug sowie der Zugang zu ein paar Büchern. All das lässt sich für wenig Geld beschaffen. Dennoch ziehen manche – nicht die Weisesten – um den halben Globus, in wilde und ungesunde Gegenden, und treiben dort zehn oder zwanzig Jahre lang Handel, um dann letzten Endes in der Heimat leben – das heißt sich behaglich warm halten – und sterben zu können. Die üppig Reichen halten sich nicht nur behaglich warm, sondern unnatürlich heiß; wie bereits angedeutet, lassen sie sich regelrecht kochen, selbstverständlich àla mode15.
Die meisten der sogenannten Annehmlichkeiten des Daseins sind nicht nur entbehrlich, sie sind geradezu ein Hemmnis für die Höherentwicklung der Menschheit. Was diese Annehmlichkeiten betrifft, haben die Weisen stets einfacher und anspruchsloser gelebt als die Armen. Die Philosophen des Altertums – Chinesen, Inder, Perser und Griechen – waren an äußerem Besitz so arm, wie einer nur sein kann, dafür aber innerlich umso reicher. Viel wissen wir ja nicht von ihnen. Es ist bemerkenswert, dass wir überhaupt etwas von ihnen wissen. Dasselbe gilt für die modernen Reformer und Wohltäter der Menschheit. Nur vom Standpunkt der freiwilligen Armut aus kommt einer heutzutage zu uneigennütziger Menschenkenntnis. Der Ertrag eines üppigen Lebens ist immer nur Üppigkeit, sei es auf dem Gebiet der Landwirtschaft, des Handels, der Literatur oder der Kunst. Wir haben heute Philosophieprofessoren, aber keine Philosophen mehr. Dabei gelten die Professoren nur deshalb so viel, weil die Philosophen einst lebten, was sie lehrten. Um Philosoph zu sein, genügt es nicht, ausgeklügelte Gedanken zu haben oder eine Schule zu gründen; man muss die Weisheit so sehr lieben, dass man ihren Geboten nachlebt. Einfachheit, Unabhängigkeit, Großmut und Zuversicht heißen diese Gebote. Es gilt einige der Lebensfragen zu lösen, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Das Ansehen der großen Gelehrten gleicht dem von Höflingen; es hat nichts Königliches, nichts Mannhaftes. Es genügt ihnen, sich nach außen hin anzupassen und nach alter Väter Sitte zu leben; Erzeuger eines edleren Menschengeschlechts sind sie keineswegs. Woher kommt es eigentlich, dass der Mensch degeneriert, Geschlechter aussterben, ganze Völker am üppigen Wohlleben zugrunde gehen? Sind wir sicher, dass wir uns nicht auf demselben Weg befinden? Der Philosoph ist seiner Zeit voraus, auch was die Lebensweise betrifft. Er nährt, kleidet, behaust und wärmt sich nicht wie seine Zeitgenossen. Wie kann einer Philosoph heißen, der, um seine Lebenswärme zu erhalten, kein besseres Verfahren kennt als andere?
Wenn einer auf die beschriebene Art für Wärme gesorgt hat, was braucht er als Nächstes? Doch nicht etwa noch mehr Wärme derselben Art, also mehr und reichere Nahrung, ein größeres und prächtigeres Haus, schönere und mannigfachere Kleidung, zahlreichere, länger brennende und heißere Feuer und dergleichen. Wenn sich einer das zum Leben unbedingt Notwendige einmal beschafft hat, steht ihm noch eine andere Möglichkeit offen, als sich Überflüssiges zu beschaffen; nachdem er nun von der niedrigen Arbeit beurlaubt ist, kann er sich nämlich ans Leben wagen. Der Boden ist offenbar für das Samenkorn geeignet, hat dieses doch seine Wurzelfasern nach unten ausgestreckt, jetzt kann es sich getrost emporrecken. Wozu hat der Mensch so fest in der Erde Wurzeln geschlagen, wenn nicht, um im selben Maße in die Höhe zu streben? Die edleren Gewächse werden bekanntlich um der Früchte willen geschätzt, die sie zuletzt an der lichten Luft tragen, weitab vom Boden; sie werden nicht wie die bescheideneren Knollengewächse behandelt, die, obwohl zweijährig, doch nur gepflegt werden, bis die Knollen ausgewachsen sind, und deshalb über dem Boden oft weggeschnitten werden, sodass viele sie in ihrer Blütezeit gar nicht erkennen würden.
Ich habe nicht im Sinn, Lebensregeln aufzustellen für Kraftnaturen, die sich allen Umständen zum Trotz durchsetzen und vielleicht großartiger bauen und mit dem Geld verschwenderischer umgehen als die Reichsten, ohne deswegen innerlich zu verarmen, weil sie sich keine Gedanken darüber machen, wie sie leben – falls es solche Kraftnaturen, von denen man liest, überhaupt gibt. Auch schreibe ich nicht für diejenigen, die ihren Lebensmut aus den bestehenden Verhältnissen beziehen und mit der Inbrunst von Liebenden daran hängen – in gewissem Sinne zähle ich mich selber zu ihnen. Ebenso wenig wende ich mich an solche, die in einer nützlichen Beschäftigung aufgehen, was die Betreffenden selber am besten beurteilen können. Ich schreibe vornehmlich für die vielen, die unzufrieden sind und untätig mit ihrem harten Schicksal oder den schweren Zeiten hadern, obschon sie beides verbessern könnten. Am entschiedensten und untröstlichsten beklagen sich jene, die behaupten, nur ihrer Pflicht zu genügen. Auch denke ich an die vermeintlich reiche, tatsächlich aber furchtbar armselige Klasse von Menschen, die massenhaft Plunder angehäuft haben, mit dem sie nichts anzufangen wissen, sodass sie sich selber an goldene oder silberne Ketten gelegt haben.
Wollte ich erzählen, wie ich früher meine Zeit zu verbringen wünschte, wären diejenigen unter meinen Lesern, die einigermaßen Bescheid wissen, wahrscheinlich überrascht; erstaunt wären jedenfalls diejenigen, die gar nichts davon wissen. Ich will nur andeutungsweise von ein paar Dingen sprechen, die mich beschäftigt haben.
Bei jeder Witterung, zu jeder Stunde, ob tags oder nachts, war ich bestrebt, die Zeit zu nutzen und an meinem Wanderstab einzukerben, immer genau da zu stehen und zu gehen, wo zwei Ewigkeiten – Vergangenheit und Zukunft – zusammenkommen, also im gegenwärtigen Augenblick zu leben. Man wird mir eine gelegentliche Unklarheit nachsehen; in meinem Beruf gibt es nämlich mehr Geheimnisse als in jedem andern – das liegt in der Natur der Sache. Gerne würde ich alles mitteilen, was ich davon weiß, ohne jemals «Kein Zutritt» an meine Tür zu pinseln.
Vor langer Zeit sind mir ein Jagdhund, ein braunes Pferd und eine Turteltaube abhandengekommen, und hinter diesen bin ich immer noch her. Schon viele Wanderer habe ich derentwegen befragt, habe ihnen die Spuren beschrieben und den Ruf, auf den sie hören. Einen oder zwei habe ich getroffen, die den Hund und das Getrappel des Pferdes vernommen hatten und sogar die Taube hinter Gewölk verschwinden sahen; es lag ihnen so sehr daran, ihrer habhaft zu werden, als hätten sie sie selber verloren.
Es gilt, in Erwartung zu sein, nicht nur des Sonnenaufgangs und der Morgendämmerung, sondern wenn möglich der Natur selber! Wie oft bin ich doch in der Frühe, sommers oder winters, ehe noch ein Nachbar seiner Arbeit nachging, der meinen nachgegangen! Sicher haben viele Dorfbewohner mich von meiner Beschäftigung zurückkehren sehen – Bauern, die sich frühmorgens nach Boston aufmachten, oder Holzfäller auf dem Weg zur Arbeit. Zwar habe ich der Sonne nie wesentlich beim Aufgehen geholfen – aber auch nur dabei zugegen zu sein war von äußerster Wichtigkeit.
Viele Herbst- und Wintertage habe ich im Freien verbracht, um zu erfahren, was in der Luft lag, und es schleunigst zu befördern. Fast mein ganzes Vermögen habe ich in dieses Unternehmen gesteckt, und obendrein hat es mir noch den Atem verschlagen, wenn ich Gegenwind hatte. Hätte es sich um parteipolitische Belange gehandelt, wäre es garantiert sogleich in die Zeitung gekommen. Manchmal hielt ich von einem Felsen oder Baum herab Ausschau, um jede Ankunft sogleich übermitteln zu können, oder dann wartete ich abends auf das Einstürzen des Himmels, um womöglich etwas davon zu erhaschen. Aber viel habe ich nie erhascht, und das wenige löste sich dann wie Manna an der Sonne wieder auf.
Lange Zeit war ich als Berichterstatter für ein Journal von beschränkter Auflage tätig,16 dessen Schriftleiter es noch nie für gut befunden hat, meine ganzen Beiträge abzudrucken. Wie das bei Schriftstellern nur allzu oft vorkommt, war die Mühe auch der einzige Ertrag, den meine Tätigkeit abwarf.
Jahrelang war ich selbst bestellter Inspektor von Schneegestöbern und Gewittern (ein Posten, den ich gewissenhaft versah) wie auch Vermesser, allerdings nicht von Landstraßen, aber doch von Waldwegen und Querfeldeinpfaden, die ich jederzeit begehbar erhielt, und Schluchten, die zu queren ein öffentliches Bedürfnis durch Stiefelabdrücke ausgewiesen war.
Ich habe den Wildbestand des Ortes gehütet, der dem getreuen Hirten die Arbeit sehr erschwert, weil er über Umzäunungen hinwegsetzt. Auch behielt ich oft die entlegenen Ecken und Winkel eines Bauerngutes im Auge, wenn ich auch nicht immer wusste, ob Jonas oder Solomon17 auf einem bestimmten Feld jeweils an der Arbeit war; das ging mich schließlich nichts an. Ich habe die roten Heidelbeeren bewässert, die Sandkirsche und den Nesselbaum, die Rotkiefer und die Schwarzesche, die weißen Trauben und gelben Veilchen, die in trockenen Zeiten sonst vielleicht verdorrt wären.
So habe ich es lange getrieben, wobei ich mich, das darf ich sagen, meiner Aufgabe gewissenhaft entledigte, bis ich einsehen musste, dass meine Mitbürger nicht gewillt waren, meine Tätigkeit in eine amtliche Anstellung zu verwandeln oder mit einer bescheidenen Pfründe für meinen Unterhalt aufzukommen. Meine Rechenschaftsberichte, gewissenhaft nachgeführt, habe ich allerdings nie prüfen lassen, auch sind sie nie entgegengenommen geschweige denn honoriert worden. Doch daran habe ich nicht mein Herz gehängt.
Vor Kurzem wollte ein indianischer Wanderkrämer an der Haustür eines bekannten Rechtsanwalts im Ort Korbwaren verkaufen.
«Möchten Sie einen Korb kaufen?», fragte er.
«Nein, wir wollen keinen», lautete die Antwort.
«Wie!», rief der Indianer im Weggehen, «wollen Sie uns denn verhungern lassen?»
Er hatte wahrgenommen, wie gut es den fleißigen Weißen in der Gegend ging – der Rechtsanwalt brauchte nur eine Beweisführung zusammenzuflechten, und schon stellten sich, wie durch Magie, Wohlstand und Ansehen ein. Da hatte er sich gesagt: «Ich will mich auch selbstständig machen, ich werde Körbe flechten, darauf verstehe ich mich.» Er glaubte, mit der Herstellung der Körbe seinen Teil getan zu haben; dem Weißen obliege es dann, ihm seine Arbeit abzukaufen. Dass auch der andere seinen Vorteil dabei finden muss oder dass er ihm das wenigstens glaubhaft zu machen hatte, sofern er sich nicht lieber auf etwas anderes verlegte, das sich verkaufen ließ, das alles hatte er nicht bedacht. Auch ich hatte eine Art Flechtwerk fein säuberlich zusammengebastelt, doch niemand sah einen Vorteil für sich darin, es mir abzukaufen. Immerhin, mir schien es lohnend, dergleichen zu verfertigen, und statt mir zu überlegen, wie ich es anstellen solle, dass es sich auch für andere lohnte, meine Arbeiten zu kaufen, überlegte ich mir lieber, was zu tun sei, damit ich es nicht nötig hätte, sie zu verkaufen. Die Lebensweise, die gemeinhin als erfolgreich gilt, ist nicht die einzige, die es gibt. Warum die eine auf Kosten aller andern überbewerten?
Nachdem sich herausgestellt hatte, dass meine Mitbürger mir vermutlich keine Bestallung noch sonst irgendeine Pfründe antragen würden, sodass ich mir wohl oder übel selbst weiterhelfen musste, wandte ich mich ausschließlicher denn je dem Walde zu, wo man mich besser kannte. Ich beschloss, mich sogleich selbständig zu machen, ohne erst das übliche Startkapital aufzuhäufen, vielmehr mit den knappen Mitteln, die ich bereits besaß. Als ich an den Walden-See zog, geschah es nicht, um dort billig oder teuer zu leben, sondern um möglichst ungehindert ein persönliches Geschäft abzuschließen. Darauf zu verzichten, bloß weil ich nicht genügend Weltläufigkeit und kaufmännisches Talent besitze, schien mir nicht nur betrüblich, sondern regelrecht dumm.
Ich habe stets danach getrachtet, mir ein streng geschäftliches Gebaren anzugewöhnen; ohne das geht es nun einmal nicht. Wenn man mit dem Reich der Mitte Handel treibt, genügt ein kleines Kontor in einer Hafenstadt. Man führt dann aus, was das Land hervorbringt; heimische Produkte, viel Eis und Tannenholz und etwas Granit, alles in heimischen Fahrzeugen. Das kann nicht fehlgehen. Es gilt, alles im Einzelnen persönlich zu beaufsichtigen; gleichzeitig Lotse und Schiffer, Eigner und Versicherer zu sein; zu kaufen und zu verkaufen und darüber Buch zu führen; jeden eingehenden Brief zu lesen, jeden abgehenden Brief zu schreiben oder durchzusehen; Tag und Nacht das Löschen der Ladung zu überwachen; fast gleichzeitig an verschiedenen Orten zu sein – die reichste Fracht wird oft an entfernter Küste gelöscht; sein eigener Fernmelder zu sein, der unermüdlich den Horizont absucht und alle einlaufenden Schiffe anruft; einen ständigen Warenversand aufrechtzuerhalten, um einen so fernen und grenzenlosen Markt zu beliefern; sich über die Markt- und Weltlage auf dem Laufenden zu halten und der Entwicklung von Handel und Gewerbe zuvorzukommen, indem man sich die Ergebnisse von Forschungsreisen zunutze macht, sich neuer Seewege und verbesserter Navigationsmethoden bedient; Seekarten sind zu studieren, das Vorhandensein von Klippen und der Standort von neuen Leuchttonnen sind festzustellen, Logarithmentafeln sind fortwährend zu berichtigen, haben doch falsche Berechnungen schon oft ein Schiff scheitern lassen – man denke an das ungeklärte Schicksal von La Pérouse;18 man muss mit der Wissenschaft aller Länder und Zeiten Schritt halten, sich mit den Lebensläufen der großen Entdecker und Seefahrer, der Abenteurer und Kaufleute vertraut machen, von Hanno und den Phöniziern bis auf den heutigen Tag; und schließlich sind von Zeit zu Zeit die Lagerbestände aufzunehmen, damit man weiß, wie es steht. Es ist eine Arbeit, die alle Fähigkeiten eines Menschen beansprucht – all die Fragen von Gewinn und Verlust, von Ertrag, von Tara und Gutgewicht und was alles an Berechnungen dazugehört; dergleichen erfordert ein umfassendes Wissen.
Ich fand, der Walden-See eigne sich gut für meine Zwecke, nicht nur der Bahnlinie und des Eishandels wegen; er bietet auch Vorteile, die preiszugeben unklug wäre; jedenfalls eignet er sich vorzüglich als Ankerplatz und Baugrund. Zwar sind keine Newa-Sümpfe trockenzulegen, aber dennoch kann man nur auf Pfählen bauen, die man selber in den Boden hämmert.19 Von St. Petersburg heißt es, eine Überschwemmung bei Westwind und Vereisung der Newa könne die Stadt vom Erdboden hinwegfegen.20 Da ich mich auf dieses Unternehmen ohne das übliche Startkapital einzulassen gedachte, wird man fragen, woher ich denn die Mittel nehmen wollte, die jedes Unternehmen erfordert.
Um gleich zum Praktischen zu kommen: Was die Bekleidung betrifft, lassen wir uns bei deren Anschaffung allzu oft vom Hang nach dem Neuen und von der Rücksicht auf die Meinung anderer statt vom Aspekt der Zweckmäßigkeit leiten. Wer eine Arbeit zu verrichten hat, möge bedenken, dass Sinn und Zweck der Bekleidung darin besteht, erstens die Körperwärme beisammenzuhalten, und zweitens, in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen, die Blöße zu bedecken; dann mag einer beurteilen, wie viel notwendige oder wichtige Arbeit er zu verrichten vermag, ohne seine Garderobe zu vermehren. Könige, die einen Anzug nur einmal tragen, obwohl er eigens für sie geschneidert wurde, haben keine Ahnung, wie bequem ein Anzug sein kann, der passt. Sie sind nichts als Kleiderständer. Von Tag zu Tag passen sich die Kleidungsstücke dem Träger immer mehr an und erhalten sein Gepräge, bis wir sie ebenso ungern ablegen wie das, was wir etwas feierlich «unser Staubgewand» nennen. Von keinem habe ich je geringer gedacht, bloß weil sein Zeug geflickt war; dabei sind die meisten ängstlicher darauf bedacht, modisch oder wenigstens sauber und ungeflickt daherzukommen, als ein reines Gewissen zu haben. Selbst wenn der Riss nicht geflickt ist, verrät das nichts Schlimmeres als Unbekümmertheit. Manchmal stelle ich meine Bekannten auf die Probe, indem ich frage, wer von ihnen einen Flicken oder auch nur eine doppelte Naht über dem Knie tragen könnte. Die meisten gebärden sich, als sei ihr Fortkommen in dieser Welt ruiniert, wenn sie es täten. Lieber würden sie mit einem Knochenriss unter die Leute gehen als mit zerrissenen Hosen. Bricht ein feiner Herr sich das Bein, lässt sich der Schaden meist beheben; widerfährt aber seinem Hosenbein ein ähnliches Missgeschick, ist ihm nicht mehr zu helfen; er schaut nämlich nicht darauf, was wahrhaft achtenswert ist, sondern darauf, was gemeinhin geachtet wird. Wir kennen nur wenige Menschen, aber massenhaft Jacken und Hosen. Man kleide eine Vogelscheuche in sein letztes Hemd und stelle sich selber hemdlos daneben auf, wer würde da nicht eher die Vogelscheuche grüßen? Als ich kürzlich an einem Maisfeld vorüberkam, wo auf einer Stange ein Hut und ein Kittel hingen, erkannte ich darin den Besitzer des Bauernhofs, etwas mitgenommen von Wind und Wetter, aber sonst fast genauso, wie ich ihn zuletzt gesehen hatte. Ich habe von einem Hund gehört, der jeden Unbekannten anbellte, sofern dieser Kleider trug, sich aber von einem nackten Einbrecher leicht beschwichtigen ließ. Es fragt sich, wie viel von den Rangunterschieden übrig bliebe, wenn man die Kleider abschaffte. Könnte man dann an einer unserer Abendgesellschaften noch mit Sicherheit feststellen, wer von den Anwesenden zur Oberschicht gehört? Als Madame Pfeiffer21 sich auf ihren abenteuerlichen Weltreisen von Ost nach West wieder der Heimat näherte und schon im asiatischen Teil von Russland weilte, fand sie es ratsam, ihr Reisekleid mit einem andern zu vertauschen, wenn sie mit Amtsstellen verkehrte, da sie sich jetzt, wie sie schrieb, «wieder in der Kulturwelt befand, wo man die Leute nach ihrer Kleidung beurteilt». Selbst in unseren demokratischen Neuenglandstaaten trägt der zufällige Besitz von Reichtum und dessen äußere Bekundung durch Kleider und Kutsche dem Besitzer fast allgemein Hochachtung ein. Doch diejenigen, die ihm diese Hochachtung zollen, mögen sie noch so zahlreich sein, sind in dieser Hinsicht Heiden und sollten sich bekehren lassen. Außerdem hat das Kleidertragen zur Näharbeit geführt, die bekanntlich kein Ende nimmt; das Kleid einer Frau jedenfalls ist nie endgültig fertig.
Wer glücklich eine Beschäftigung gefunden hat, der bedarf keines neuen Anzugs dazu; der alte, der seit unvordenklichen Zeiten verstaubt auf dem Dachboden gelegen hat, genügt vollauf. Alte Schuhe sind für einen Helden länger brauchbar als für seinen Kammerdiener, falls ein Held je einen Kammerdiener hat, und bloße Füße gibt es schon länger als Schuhe; nötigenfalls kann der Mensch barfuß gehen. Nur wer an Abendgesellschaften und Ratsversammlungen teilnimmt, braucht immer wieder einen neuen Mantel (damit er ihn nach dem Winde hängen kann). Wenn mir aber Jacke und Hose, Hut und Schuhe noch gut genug sind, um darin Gott zu verehren, was brauche ich dann neue? Wer hat je seinen alten Mantel wirklich abgetragen und in seine Bestandteile aufgelöst gesehen, sodass es nicht mehr als Wohltätigkeit gelten könnte, ihn einem armen Knaben zu schenken, der ihn vielleicht später an einen noch ärmeren weitergibt? Oder soll ich lieber sagen, an einen reicheren, weil genügsameren? Man hüte sich vor allen Unternehmungen, die neue Kleider erfordern, nicht aber einen neuen Menschen. Ist der Mensch nicht neu, wie kann ihm der neue Anzug passen? Wer eine Arbeit vorhat, soll sie erst einmal in den alten Kleidern versuchen. Was der Mensch will, ist nicht, es mit etwas zu tun haben, sondern etwas tun, oder besser, etwas sein. Vielleicht sollten wir uns nie einen neuen Anzug zulegen, mag der alte noch so ausgefranst und schmuddelig sein, bis wir etwas geleistet haben und uns auch im alten Zeug wie neugeboren vorkommen, sodass wir gewissermaßen neuen Wein in alten Schläuchen lagern würden, falls wir das alte Zeug weiter verwendeten. Wenn wir uns schon mausern, dann muss es wie bei den Vögeln einen entscheidenden Wendepunkt in unserem Leben bedeuten. Der Eistaucher zieht sich an einen einsamen Waldweiher zurück, um sein Gefieder zu wechseln. Auch die Schlange und die Raupe häuten sich dank einer inneren Betriebsamkeit und Erweiterung; Kleider stellen nämlich nur unsere äußerste Haut dar. Sonst erweist sich am Ende, dass wir unter falscher Flagge segeln, und dann werden wir nach eigenem Dafürhalten wie auch nach dem der Allgemeinheit unfehlbar unseres Ranges entkleidet.
Wir ziehen ein Kleidungsstück über das andere an, als ob wir uns wie exogene Pflanzen durch Zuwachs an der Außenfläche entwickelten. Unsere äußeren, oft dünnen und wunderlichen Kleider sind die Epidermis oder falsche Haut, die sich da und dort ohne fatale Folgen abstreifen lässt; das festere Zeug, ständig getragen, entspricht dem Cortex, der Rinde; das Hemd jedoch stellt den Bast dar, das Zellgewebe, das sich nicht entfernen lässt, es sei denn, man wolle den Baum ringeln, um ihn absterben zu lassen. Alle Völkerschaften tragen wohl zu gewissen Zeiten etwas dem Hemd Entsprechendes. Wünschenswert ist, dass der Mensch so einfach gekleidet sei, dass er auch im Dunkeln zurechtkommt; am besten, man lebt in jeder Hinsicht so gesammelt und gefasst, dass man jederzeit wie jener Philosoph des klassischen Altertums unbesorgt mit leeren Händen flüchten kann, wenn der Feind anrückt. Ein festes Kleidungsstück taugt so viel wie drei dünne, und wohlfeiles Zeug ist zu einem Preis erhältlich, der für jedermann erschwinglich ist. Ein fester Kittel ist für fünf Dollar zu haben und hält ebenso viele Jahre; feste Hosen kosten zwei Dollar, rindslederne Stiefel anderthalb Dollar das Paar, einen Strohhut bekommt man für fünfundzwanzig Cent und eine Wintermütze für zweiundsechzigeinhalb Cent, sofern man sich nicht lieber selbst eine anfertigt, die besser ist und so gut wie nichts kostet. Wo ist der Mensch, der so arm wäre, dass er, solchermaßen ausgestattet, und zwar aus eigener Tasche, nicht weise Freunde fände, die ihn achten?
Wenn ich ein Kleidungsstück von bestimmtem Zuschnitt bestelle, erklärt mir meine Schneiderin, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne das «man» besonders zu betonen: «Das trägt man heute nicht mehr», als berufe sie sich auf eine Autorität, unerbittlicher als das Schicksal. Ich habe jeweils die größte Mühe, meine Wünsche durchzusetzen, weil sie einfach nicht glauben kann, dass es mir damit ernst ist. Höre ich diesen Orakelspruch, werde ich jeweils nachdenklich und fange an, jedes Wort sorgfältig abzuwägen, um hinter seine Bedeutung zu kommen und herauszufinden, in welchem Verwandtschaftsverhältnis «man» zu «mir» steht und inwiefern «man» maßgebend ist in einer Angelegenheit, die «mich» so persönlich angeht. Schließlich verspüre ich jeweils die größte Lust, ihr ebenso geheimnisvoll zu antworten, und ebenfalls ohne das «man» zu betonen: «Sie haben recht, man hat das bis vor Kurzem nicht mehr getragen, aber heute trägt man es wieder.» Was nützt es, mir das Maß zu nehmen, wenn nicht auch mein Charakter gemessen wird, sondern nur die Breite meiner Schultern, als wären diese ein Kleiderbügel? Nicht die Grazien verehren wir, noch die Parzen22, lediglich die Mode. Diese allein ist heute befugt, zu spinnen und zu weben und den Faden abzuzwacken. Der Oberaffe in Paris setzt sich eine Reisemütze auf, und sämtliche Affen in Amerika tun es ihm nach. Manchmal verzweifle ich daran, irgendetwas Einfaches und Rechtschaffenes in dieser Welt mit Hilfe anderer machen zu lassen. Man müsste die Leute zuerst durch eine gewaltige Mange drehen, um die vorgefassten Meinungen aus ihnen herauszuquetschen, damit diese nicht so bald wieder auf die Beine kämen; und auch so bliebe noch jemand mit einer Grille im Kopf übrig, ausgebrütet aus einem Ei, das wann auch immer dort abgelegt wurde. Nicht einmal das Feuer vermag derlei abzutöten, und so wäre alle Mühe vergeblich gewesen. Immerhin, wir wollen nicht vergessen, dass durch eine Mumie ägyptische Weizenkörner auf uns gekommen sind.23 Im großen Ganzen kann man wohl nicht behaupten, dass sich die Bekleidung in diesem oder irgendeinem anderen Land zu einer Kunst emporgeschwungen hat. Man behilft sich mit dem, was erhältlich ist. Wie Schiffbrüchige kleiden wir uns in das, was sich am Strande findet, und schon auf geringe Entfernung, örtlich oder zeitlich, macht man sich gegenseitig über die Maskerade der andern lustig. Jede Generation findet die frühere Mode komisch, folgt aber ehrfürchtig der neuen. Das Kostüm Heinrichs VIII. oder das der Königin Elisabeth wirkt auf uns so belustigend wie das von Kanaken. Jedes Kostüm, in dem gerade niemand steckt, wirkt kläglich oder grotesk. Erst der ernsthafte Blick, der daraus hervorguckt, und das Leben ohne Falsch, das sich darin abspielt, hindern uns am Lachen und geben der Tracht die Weihe. Man stelle sich einen Harlekin vor, der sich in Krämpfen windet, und seine Ausstattung muss auch diesem Umstand dienen. Wird der Soldat von einer Kanonenkugel getroffen, stehen ihm Lumpen so gut wie ein Purpurmantel.
Der kindische und drastische Hang der Menschen zu neuen Mustern erhält wer weiß wie viele damit beschäftigt, ein Kaleidoskop zu schütteln und hineinzugucken, um genau die Zusammenwürfelung zu finden, die dem heutigen Geschmack entspricht. Dass dieser Geschmack launenhaft ist, haben die Fabrikanten längst gemerkt. Von zwei Mustern, die sich voneinander nur durch ein paar farbige Fäden mehr oder weniger unterscheiden, verkauft sich das eine gut, während das andere liegen bleibt, obwohl es oft vorkommt, dass nach Ablauf einer gewissen Zeit das zweite Muster auf einmal Mode wird. Im Vergleich damit ist die Tätowierung nicht der verabscheuungswürdige Brauch, als der sie gilt; sie ist nicht etwas Barbarisches, bloß weil das Farbmuster in die Haut geht und unveränderlich ist.
Dass unsere Kleiderfabriken das beste System sind, die Menschheit zu kleiden, kann ich nicht glauben. Die Arbeitsverhältnisse werden denen in England immer ähnlicher, und das ist weiter nicht verwunderlich, ist doch der Hauptzweck dabei nicht etwa, gute und brauchbare Kleidung zu liefern; der Fabrikant will bloß reich werden. Auf die Dauer erreicht der Mensch nur, was er sich als Ziel vornimmt. Er täte deshalb gut daran, das Ziel, auch wenn es vorläufig unerreichbar ist, möglichst hoch zu stecken.
Was nun das Obdach betrifft, will ich nicht bestreiten, dass ein solches heutzutage eine Lebensnotwendigkeit darstellt, obwohl Fälle bekannt sind von Menschen, die sich in kälteren Gegenden als der unseren längere Zeit ohne beholfen haben. «Der Lappländer», schreibt Samuel Laing, «schläft in seinem aus Pelzen genähten Anzug und mit einem Sack aus Fellen, den er sich über Kopf und Schultern zieht, Nacht für Nacht auf dem Schnee … bei Kältegraden, die einer in wollenem Zeug nicht überleben würde.» Er hatte sie so schlafen sehen, setzt jedoch hinzu: «Sie sind nicht widerstandsfähiger als andere.»24 Wahrscheinlich dauerte es aber nicht lange, bis der Mensch dahinterkam, wie bequem ein Haus ist. Unter dem «häuslichen Behagen» hat man ursprünglich wohl eher die Vorteile der Behausung als die des Familienlebens verstanden. In Breitengraden, wo ein Haus sich hauptsächlich im Winter oder in der Regenzeit aufdrängt, sind seine Vorteile allerdings beschränkt; zwei Drittel des Jahres ist es höchstens als Sonnenschirm zu brauchen. Bei uns diente es früher, vorab im Sommer, fast ausschließlich als nächtlicher Unterschlupf. Im Nachrichtenwesen der Indianer war ein Wigwam das Zeichen für einen Tagesmarsch, und eine Reihe solcher, in Baumrinde geritzt oder draufgemalt, bedeutete die Zahl der Nachtlager, die sie hinter sich hatten. So großmächtig und stark war der Mensch nun auch wieder nicht, dass er seine Welt nicht gerne eingeengt und einen seiner Größe entsprechenden Raum mit vier Wänden umschlossen hätte. Ursprünglich war er nackt und lebte im Freien; bei schönem und warmem Wetter war das tagsüber ja recht angenehm, doch die Regenzeit und der Winter, von der sengenden Sonne ganz zu schweigen, hätten dem Menschengeschlecht bald den Garaus gemacht, wenn er sich nicht beizeiten in eine Behausung gehüllt hätte. Adam und Eva hüllten sich, der Fabel zufolge, in eine Laube, bevor sie an andere Bekleidung dachten. Der Mensch wollte ein Heim, eine Stätte traulicher Wärme, zuerst im körperlichen, dann auch im übertragenen Sinn.
Man kann sich vorstellen, wie in den Anfängen des Menschengeschlechts einst einer darauf verfiel, in einer Felsenhöhle Unterschlupf zu suchen. Jedes Kind fängt gewissermaßen die Welt wieder von vorne an und hält sich am liebsten im Freien auf, auch an nassen und kalten Tagen. Instinktiv spielt es «Haus» und «Pferd». Wer entsinnt sich nicht, welchen Reiz ein überhängender Fels und alles, was einer Höhle ähnlich sah, einst für ihn hatten, als er noch klein war? Was sich da regte, war das Stück Urmensch, das in jedem von uns steckt. Von der Höhle ist der Mensch dann weitergekommen zum Dach aus Palmblättern, aus Rinde und Geäst, aus gespannter Leinwand, aus Gras und Stroh, Brettern und Schindeln, Steinplatten und Ziegeln. Inzwischen wissen wir gar nicht mehr, was es heißt, unter freiem Himmel zu wohnen, und unser Leben ist in mehr als einem Betracht domestiziert. Vom häuslichen Herd ist es weit bis aufs Feld. Vielleicht wäre es gut, wenn wir unsere Tage und Nächte häufiger ohne Abschirmung zwischen uns und den Himmelskörpern verbrächten, wenn der Dichter nicht so oft unter einem Dach hervorspräche oder der Heilige sich so lange dort aufhielte. In den Höhlen singen keine Vögel, auch hegen Tauben ihre Unschuld nicht im Taubenschlag.
Hat einer vor, ein Wohnhaus zu bauen, muss er sich allerdings vorsehen, damit er am Ende nicht in ein Arbeitshaus gerät, in ein Labyrinth ohne Wegweiser, ein Museum, ein Armenhaus, ein Gefängnis oder gar ein prunkvolles Mausoleum. Man bedenke zunächst, wie wenig es zu einem Dach über dem Kopf eigentlich braucht. In unserem Ort habe ich Penobscot-Indianer25 gesehen, die in Zelten aus dünnem Baumwollstoff wohnten, während der Schnee sich dreißig Zentimeter hoch häufte – für sie nicht hoch genug, dachte ich, um den Wind abzuhalten. Als mir die Frage, wie ich mich anständig durchbringen und doch genügend Spielraum für meine eigentlichen Anliegen haben könne, noch mehr zu schaffen machte als heute, wo ich leider etwas verhärtet bin, da sah ich einst am Bahndamm eine große Kiste stehen, zwei Meter lang und einen Meter breit, in der die Arbeiter nachts ihr Werkzeug verschlossen. Mir kam dabei der Gedanke, nötigenfalls könnte einer sich eine solche Kiste für einen Dollar verschaffen und ein paar Luftlöcher hineinbohren, um dann nachts oder bei Regenwetter hineinzuschlüpfen, den Deckel festzuhaken und damit selbständig und seelisch frei zu sein. Das schien mir durchaus nicht die schlechteste oder verachtenswerteste Alternative zu sein. Es durfte einer nachts aufbleiben, so lange er wollte, und wenn er aufstand, konnte er jederzeit ausgehen, ohne dass sich ihm ein Hauswirt wegen der Miete an die Fersen heftete. Manch einem wird das Leben sauer gemacht, der die Miete für eine großartigere Kiste aufbringen muss, wo er doch auch in meiner Eisenbahnerkiste nicht erfroren wäre. Das soll beileibe kein Witz sein. Hauswirtschaftliche Fragen kann man auf die leichte Schulter nehmen, wenn man will; abtun lassen sie sich damit nicht.
Einst wurde hierzulande ein bequemes Haus für einen rauen und zähen Menschenschlag ausschließlich aus den von der Natur fertig gelieferten Baustoffen errichtet. Gookin, Aufseher über die Indianer im Gebiet von Massachusetts, schrieb 1674: «Die besten ihrer Behausungen sind mit Baumrinde sehr säuberlich, dicht und warm gedeckt. Die Rinde wird zu einer Zeit vom Baum geschält, wo dieser im Saft steht, und mittels schwerer Holzklötze zu großen Platten gepresst, solange sie noch grün ist … Die bescheideneren Hütten werden mit Matten gedeckt, die aus einer Art Schilfrohr verfertigt werden und ebenfalls leidlich dicht und warm sind, wenn auch nicht so gut wie die andern … Einige habe ich gesehen, die waren zwanzig bis dreißig Meter lang und zehn Meter breit … Ich habe oft in ihren Wigwams gewohnt und sie so warm gefunden wie die besten Häuser in England.»26 Im Weiteren vermerkt er, dass sie meist mit kunstvoll bestickten Teppichen und allerlei Haushaltsgerät ausgestattet waren. Die Indianer waren schon so fortgeschritten, dass sie die Einwirkung des Windes durch eine Matte regulieren konnten, die über der Dachluke hing und sich mittels einer Leine verstellen ließ. Eine Behausung wie die erstgenannte wurde in höchstens zwei Tagen errichtet; sie ließ sich in ein paar Stunden abbauen und wieder aufstellen. Jede Familie besaß einen solchen Wigwam oder hatte Anteil an einem.
Bei den Naturvölkern besitzt jede Familie ein Obdach, das so gut wie irgendeines ist; ich glaube aber nicht zu übertreiben, wenn ich behaupte, dass bei uns zwar jeder Vogel sein Nest, jeder Fuchs seinen Bau und jeder Indianer seinen Wigwam hat, während kaum jede zweite Familie das Haus, in dem sie wohnt, ihr Eigen nennt. In den größeren Ortschaften und Städten, den Sammelpunkten der Kultur, bilden die Hausbesitzer nur einen geringen Bruchteil der Bevölkerung. Die Übrigen entrichten einen jährlichen Betrag für diese äußerste Körperhülle, die sommers und winters unentbehrlich geworden ist, einen Betrag, für den man ein ganzes Dorf von Indianerwigwams kaufen könnte, der nun aber dazu beiträgt, dass die Leute ihr Leben lang arm bleiben. Auf den Nachteil der Miete gegenüber dem Besitz will ich hier nicht eingehen, aber so viel ist klar, dass der Naturmensch Besitzer seines Obdachs ist, weil dieses so wenig kostet, während der Kulturmensch das seine mietet, weil er es sich in der Regel nicht leisten kann, eines in seinen Besitz zu bringen; auf die Dauer kann er sich allerdings auch die Miete nicht leisten. Man mag dagegen einwenden, dass der arme Kulturmensch sich durch regelmäßige Entrichtung dieses Betrags eine Behausung sichert, die verglichen mit der des Naturmenschen ein Palast ist. Eine Jahresmiete von fünfundzwanzig bis hundert Dollar, wie sie auf dem Lande gilt, lässt ihn an den Errungenschaften der Jahrhunderte teilhaben – reichlich Wohnraum, sauber gestrichen und tapeziert, Kaminfeuer, Gipsverputz, Rollläden, rostfreie Wasserpumpe, Schnappschloss, Kellerräume und vieles andere mehr. Doch wie erklärt es sich, dass derjenige, der in den Genuss all dieser Dinge kommt, meistens ein armer Schlucker ist, während der Naturmensch, der dergleichen nicht hat, verhältnismäßig reich ist? Wenn behauptet wird, der Kulturfortschritt habe die Lebensverhältnisse entscheidend verbessert – und das ist wohl der Fall, wenn auch nur der Weise die gebotenen Vorteile wahrnimmt –, dann muss nachgewiesen werden, dass er bessere Wohnverhältnisse geschaffen hat, ohne die Kosten zu steigern, und unter den Kosten einer Sache verstehe ich, wie viel einer dafür von seinem Leben drangeben muss, entweder gleich oder auf Dauer. Ein Haus hier in der Gegend kommt durchschnittlich auf etwa achthundert Dollar zu stehen. Um diese Summe zusammenzusparen, braucht ein Arbeiter zehn bis fünfzehn Jahre, auch wenn er keine Familie zu ernähren hat. Dabei veranschlage ich den Gegenwert der Arbeit eines Menschen auf einen Dollar täglich – die einen erhalten mehr, andere aber weniger. Im Allgemeinen muss er also mehr als die Hälfte seines Lebens daran verwenden, sich seinen Wigwam zu verdienen. Natürlich kann er stattdessen Miete bezahlen, aber es fragt sich, welches von beiden Übeln das geringere ist. Hätte der Naturmensch klug daran getan, unter diesen Bedingungen seinen Wigwam gegen einen Palast einzutauschen?
Alldem mag man entnehmen, dass sich nach meinem Dafürhalten der Nutzen eines so überflüssigen Besitzes darauf beschränkt, als vorsorgliche Anlage zu dienen, namentlich zur Bestreitung der Bestattungskosten. Es ist zwar nicht gesagt, dass einer verpflichtet ist, für sein Begräbnis selbst aufzukommen. Immerhin weist dies auf einen bedeutsamen Unterschied zwischen dem Kulturmenschen und den Naturvölkern hin; man will zweifellos nur unser Bestes, wenn man bei uns das Leben zu einer Institution macht, in welcher der Einzelne großenteils aufgeht, um das der Gattung zu erhalten und zu vervollkommnen. Ich möchte nur aufzeigen, mit welchen Opfern dieser Vorteil gegenwärtig erkauft wird, und auf die Möglichkeit einer Lebensgestaltung hinweisen, bei der wir der Vorteile habhaft werden, ohne die Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Damit es endlich nicht mehr heiße: Es werden allezeit Arme sein im Land, und: Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden.
«So wahr als ich lebe, spricht Gott der Herr: Dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel.
Denn siehe, alle Menschen gehören mir; die Väter gehören mir so gut wie die Söhne; jeder, der sündigt, soll sterben.»27
Wenn ich an meine Nachbarn, die Bauern von Concord, denke, die mindestens so wohlhabend sind wie andere Bevölkerungsschichten, dann stelle ich fest, dass sie sich meistens zwanzig, dreißig oder vierzig Jahre lang abgerackert haben, auf dass ihr Bauernhof wirklich ihnen gehöre. Zumeist war er schon verschuldet, als sie ihn erbten, oder sie haben ihn mit geborgtem Geld gekauft – und ein Drittel ihrer Plackerei dient zur Abzahlung der Hypotheken, aber die meisten werden nie fertig damit. Manchmal übersteigt die Schuldenlast den Wert des Bauernhofs, sodass dieser selbst nichts als eine schwere Belastung darstellt, und doch findet sich immer einer, der das Erbe antritt, da er, wie er sich ausdrückt, mit dem Hof nun einmal vertraut ist. Wendet man sich an die Gebäudeschätzer, erfährt man zu seiner Überraschung, dass sie einem kaum ein Dutzend Bauern in der Gegend nennen können, die schuldenfrei auf ihrem Hof wohnen. Will man die Geschichte dieser Anwesen kennenlernen, muss man sich bei den Banken erkundigen, bei denen sie verschuldet sind. Es kommt so selten vor, dass einer den Hof mit seiner Hände Arbeit tatsächlich erworben hat, dass der Betreffende in der ganzen Gegend dafür bekannt ist. In Concord gibt es wohl keine drei Bauern, von denen sich das sagen lässt. Was von den Kaufleuten behauptet wird, dass nämlich die große Mehrheit, vielleicht siebenundneunzig von hundert, zum Scheitern verurteilt sind, das gilt auch für die Bauern. Was die Kaufleute betrifft, hat einer von ihnen mir allerdings versichert, ihr Misserfolg sei zum großen Teil nur scheinbar und bestehe lediglich darin, dass sie ihre Verpflichtungen nicht gerne erfüllen, das heißt, es handelt sich in Wirklichkeit um einen Zusammenbruch der Zahlungsmoral. Das macht die Sache aber keineswegs besser und legt die Vermutung nahe, dass auch die andern drei seelisch nicht unbeschadet davonkommen, sondern vielleicht in einem noch schlimmeren Sinn Bankrott machen als diejenigen, die nur geschäftlich versagen. Bankrott und Nichtanerkennung von Schulden sind das Sprungbrett, von dem aus unsere Kulturwelt ihre Saltos macht, während der Naturmensch auf der unnachgiebigen Planke des Hungerleidens steht. Und doch findet hier jedes Jahr mit éclat28 unsere landwirtschaftliche Ausstellung statt, als wickle sich der ganze Betrieb reibungslos ab.
Der Bauer sucht das Problem des Lebensunterhalts durch ein Verfahren zu lösen, das verzwickter ist als das Problem selbst. Um zu seinen Schnürsenkeln zu kommen, spekuliert er mit ganzen Viehherden. Er hat eine ausgeklügelte Falle aufgestellt, um Unabhängigkeit und ein bequemes Leben zu ergattern, und dann verfängt er sich im Weggehen selber mit dem Fuß darin. So ist und bleibt er arm, und aus einem ähnlichen Grund sind wir alle arm, im Hinblick auf tausend naturgegebene Annehmlichkeiten, wenn auch von Überfluss umgeben. Wie Chapman sagte:
«Der gesellige Mensch lebt falsch –
Um irdischer Größe willen schlägt
Er jede himmlische Tröstung aus.»29
Und wenn dem Bauern einmal sein Haus gehört, ist er vielleicht nicht einmal reicher, sondern desto ärmer, und er ist es, der dem Haus gehört. Es war meines Erachtens ein berechtigter Einwand, als Momos30 an dem Haus, das Minerva31 erbaut hatte, auszusetzen fand, dass sie es nicht transportabel gemacht habe, damit man unerwünschter Nachbarschaft entgehen könne. Der Einwand lässt sich auch heute noch gegen ein Haus erheben; es ist ein so schwerfälliger Besitz, dass wir darin oft eher eingesperrt als wohnlich untergebracht sind, und die unerwünschte Nachbarschaft, der es zu entgehen gilt, ist unser eigenes schäbiges Selbst. Mir sind mindestens zwei Familien in der Gegend bekannt, die seit Ewigkeiten ihr Haus draußen auf dem Land verkaufen wollen, um ins Dorf zu ziehen, ohne dass es ihnen gelungen wäre; erst der Tod wird sie davon befreien.
Zugegeben, die meisten sind schließlich imstande, das moderne Haus mit all seinen Errungenschaften zu erwerben oder die Miete dafür aufzubringen. Während aber die Häuser im Laufe der Zeit verbessert worden sind, ist der Mensch, der sie bewohnen soll, nicht im selben Maße besser geworden. Paläste hat die Kultur hervorgebracht; edle Menschen hervorzubringen war offenbar nicht so leicht. Und wenn das Tun und Treiben des Kulturmenschen nicht verdienstvoller ist als das des Kanaken, wenn er ebenfalls den größten Teil seines Lebens bloß damit verbringt, sich den elementarsten Daseinsunterhalt zu sichern, wozu sollte er dann bequemer wohnen?
Wie steht es aber mit der unbehausten Minderheit? Vielleicht verhält es sich so: Je mehr Menschen den äußeren Umständen nach über den Naturmenschen gestellt sind, umso mehr bleiben hinter diesem zurück. Der üppigen Lebensweise der einen Klasse hält die Mittellosigkeit der andern die Waage. Auf der einen Seite der Palast, auf der andern das Armenhaus und der «stille Arme»32