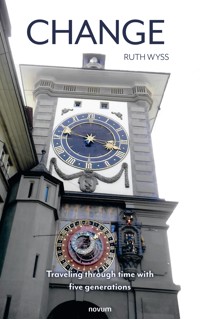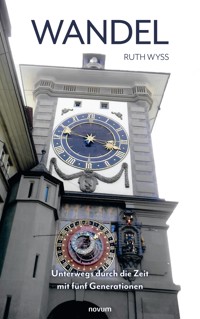
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Schweiz gut behütet aufgewachsen und mit "Kopf, Herz und Hand" zur Lehrerin ausgebildet, erlebt Ruth Wyss, wie ihr Traumberuf durch eine willkürlich-autoritäre Mentorin zum Qualberuf wird. Als sie aufgeben will, um Musik, Theologie, Literatur zu studieren, ermutigt sie ihr pragmatischer Vater, sich eine Stelle zu suchen; die Freude komme bei der selbständigen Arbeit. Eine selbstbewusste, tatkräftige Frau entwickelt sich, die ihre musische Begabung zum Beruf macht. Sie ist Mitgründerin einer Musikschule, Ensembleleiterin, zieht zwei Kinder groß und bereist an der Seite ihres Ehemanns geschäftsbedingt die weite Welt. Die Klippen des Lebens meistert sie in tiefem Glauben, hilfsbereit und empathisch. "Der Wind beugt die Gräser, aber er bricht sie nicht", gilt für diese starke Frau besonders.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0473-6
ISBN e-book: 978-3-7116-0474-3
Lektorat: Christiane Lober
Umschlagfoto: Christiane Lober
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: aus dem Privatbesitz von Ruth Wyss
Autorenfoto: Familie Wyss
www.novumverlag.com
Einführung
Panta rhei.
Heraklit
Vorwort
Im Ruhewagen
Über viele Jahre pendelte ich mit dem Zug von Norden nach Süden, freute mich über das liebliche Seetal, wo vertraute Menschen wohnen, setzte mich in Luzern in den Ruhewagen, blickte über Vierwaldstätter-, Zuger-, Lauerzersee, umkreiste auf der Gotthardstrecke die Kirche von Wassen, bemühte mich, nach dem Tunnel die erste Palme nicht zu verpassen, die Gotteshäuser von Giornico nicht achtlos vorbeiziehen zu lassen und die Erhabenheit der Tre Castelli in Bellinzona zu erfassen. Es war stets eine ereignisreiche Fahrt, gewürzt mit Begegnungen mancher Art. Es durchmischten sich Passanten aus aller Welt, Personen mit Stil und Geld, Backpackers, Wandervögel, Businessleute, Medien- und Politikprominenz von heute, sportliche und musizierende Gruppen, fasnächtliche und militärische Truppen. Der Leutnant wurde in Arth-Goldau von Kindern und Ehefrau, in Locarno von der Geliebten umarmt. Am Lago Maggiore umarmte mich mein Galerist im Tessiner Licht, sichtlich beglückt, nach einer ehefreien Frist. Auch ich freute mich über das wiedergefundene Miteinander.
Unter blühendem Oleander erzählte ich von meinem Bahnvergnügen Richtung Süden und verblüffte die frohe Tafelrunde mit der Kunde, dass ich, trotz höherem Preise, wegen der kultivierten Männer in der ersten Klasse reise. Schlagfertig konterte mein Gemahl, mit Vorliebe würde er sich in der zweiten Klasse umschauen wegen der schönen, jungen Frauen.
In Wahrheit wählte ich den Ruhewagen, um meinem betriebsamen Alltag Stille zu geben und mich inspirieren zu lassen, die gelebte Zeit zu verdichten und in Worte zu fassen.
Die Fäden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ergeben unverwechselbare Gewebe, die verbunden sind mit einem Band. Es sind chronologisch persönliche Erlebnisse, globale Ereignisse, Reflexionen, Philosophien, Rückblenden, Ausblicke, die sich verflechten zum einmaligen Muster – einmalig wie bei jedem einzelnen Menschenleben auf dieser Welt, ob bewegt, still oder schrill.
Mein Buch widme ich in Dankbarkeit allen Lesenden, all meinen Lieben von damals, von heute und von morgen. Sie sind Teil des tragenden Netzes in meinem Sein. Zu ihrem Schutze sind nur wenige Namen der fünf Generationen oder von allgemein bekannten Personen im Zeitgeschehen erwähnt.
Abschied
Ein leises Ahnen, ein Wahrnehmen und Befürchten begleiteten mich während Monaten, bis ich erfasste, dass mein Ehemann sich ernsthaft mit dem Verkauf unseres lichtdurchfluteten nördlichen Wohnidylls befasste. Stets war er Stratege im Berufs- und Privatleben und zog seine Pläne durch, in unserem Fall aus Fürsorge für ein bequemeres Älterwerden. Ihm schwebte ein Dasein vor ohne Gartenarbeit, ohne Schneeschaufel, ohne Treppenunsicherheit – ein vereinfachtes Wohnen in Freiheit und Unabhängigkeit. In mir aber wehrte sich alles dagegen. An diesem traulichen Ort, im wohligen Familienhort, gingen unzählige Menschen ein und aus. Nachbarn, Verwandte, Befreundete, Bekannte, Mitarbeitende, Spielende, Musizierende beseelten das weiträumige, hoch über dem See gelegene Haus. Hier verankerte sich meine Pfahlwurzel im Laufe der langen Zeit. Die globalen Luftwurzeln meines angetrauten Internationalen waren aber flexibel und umzugsbereit.
Nach und nach wurde mir bewusst, dass ich loslassen musste aus Vernunft – für eine komfortable Zukunft. Das konnte nur gelingen, wenn ich festhielt, was mir lieb war. Loslassen – festhalten. Ein Wortspiel – ein Gegensatz. Mit der Fotokamera erfasste ich das Anwesen von allen Seiten im schönsten Licht: den Rasen im gepflegtesten Zustand, den blumengeschmückten Apéropavillon, die Terrasse mit dem erdfarbenen Granittisch samt acht Gedecken, den Jurakalkbrunnen mit Tonschnecken, die Keramikfroschskulptur und die einzigartige Sonnenuhr, ebenso die Rosen, Sträucher, Bäume in ihrer prächtigsten Blütezeit, die Pergola mit weißer oder blauer Traubenherrlichkeit, wetteifernd mit dem Feuerdorn in herbstlicher Buntheit, und die drei mächtigen Pappeln kurz vor ihrem Kahlschlag an einem frostigen Wintertag. Während meines bedachten fotografischen Abschiednehmens wuchs die Beige von Immobiliendokumenten auf dem Schreibtisch des Interessenten. Doch kein noch so verlockendes Angebot konnte mich berühren. Erst fürs Bauvorhaben zu Füßen unserer Panoramaliegenschaft, mitten in lieblicher Seelandschaft, konnte ich Sympathie verspüren. Bei der geplanten Terrassensiedlung in natürlicher Umgebung wurde auch meine sich sträubende Seele erfüllt von positiven Gefühlen. Noch vor dem Spatenstich fanden die acht Häuser ihre auswärtigen Käufer. Das Nachsehen hatten wir, die zu spät gekommenen, einheimischen Mitläufer.
Der Stern
Die Wochen flossen dahin. Wir wurden emotional überwältigt von der Geburt des zweiten Großbübleins in Südostasien, in Petaling Jaya, Malaysia.
Voller Vorfreude buchten wir eine weihnächtliche Tour nach Kuala Lumpur mit der schwülheißen Temperatur, um das Bébéwunder zu erleben.
Seine Urgroßmutter im Pflegeheim bemühte sich, ein Glückwunschbrieflein mitzugeben, bevor sie starb, am Geburtstag ihrer tieftraurigen Enkelin, ihrer treuen Besucherin. Geburt und Tod, Freud und Leid, eine bewegende Zeit!
Unter diesen Umständen mussten wir das Wohnprojekt ausblenden.
Auf einmal leuchtete ein großer, goldener Stern hinein in den dunklen November, ein Komet auf dem Kran, mitten im Bauareal in unserem Blickfeld hinunter zum See. Dieses Lichtereignis im ersten Schnee ergriff mich und begleitete mich ans feierliche barocke Konzert mit Flöten, Viola da Gamba, Cembalo und Gesang. Die Partituren auf meinem Dirigierpult verwandelten sich in einen wunderbar adventlichen Klang.
Asien
Schon am darauffolgenden Morgen brachte uns eine Limousine der „Emirates“ nach Kloten. Zu zweit flogen wir Richtung Fernosten. Wir kreisten im Sandsturm über Dubai, bevor wir zwischenlandeten im gigantischen Wüstenterminal. Wir labten uns an frischen Datteln im muslimischen Scheichtum mit dem märchenhaften Reichtum. Wir tauschten die weihnächtlichen Lichter gegen den überdimensionierten Christmasglitzer inmitten aufgepfropfter Wolkenkratzer. Im Hotelgarten am Persischen Golf, mit Blick auf die künstliche Insel Palm Jumeirah und den Burj al Arab, genossen wir das Tête-à-Tête mit feinstem Menu Arab. Mein neckisches Gegenüber fabulierte vom Kauf eines Appartements in einer der schwindelerregenden Wohnarchitekturen. So wären wir zwischen Zürich und Kuala Lumpur, wo unsere Kinder sesshaft waren. Da konnte ich nur erklären, dass nach fast vierzig bewegten Ehejahren ich ihm dahin nicht folgen würde – für mich eine zu utopische Hürde!
Wir erlebten eine unvergesslich schöne Festtagszeit bei tropischem Klima bis 95 Grad Fahrenheit. Es war ein frohes familiäres Zusammensein mit dem neugeborenen Büblein, seinem dreijährigen Brüderlein und der zugereisten Tochter. Auch Expatfreunde bereicherten das Fest der funkelnden Lichter.
Wir erlebten eine Christmasparty in der Millionenstadt und schmausten uns an den immensen Buffetkreationen satt. Wir genossen Barbecues am Piscine, umrankt von Hibiskus und Vanille, entdeckten Kulinarik, Kultur, Natur und religiöse Aktionen in vielen asiatischen Variationen. Wir bereisten an zwei Tagen das Highland mit den Teeplantagen, fuhren vorbei an bedrängtem Regenwald und an Palmölmonokulturen, wunderten uns auch über verspritzte Toiletten mit Wasserschlauch, womit ich mich versehentlich ganzheitlich duschte. Es blieb mir ein Rätsel, wie die einheimische Bevölkerung die Vorrichtung nutzte. Ich werde mich nie mehr beklagen, wenn ich allüberall per Zufall die WC-Rollen wechseln muss. Die papierlose Variante war für mich ein pudelnasser Verdruss.
Wir erreichten Pangkor Laut Island, wo die Makakenäffchen Kokosnüsse pflückten am Palmenstrand, das Frechste unsere Süßigkeiten fand im Pavarotti-Wellnessland.
Der Tenor ging oftmals ein und aus im gegen das Denguefieber desinfizierten, paradiesischen Haus. Er genoss Sonne, Wasser und asiatischen Gourmetschmaus.
Wir staunten, wie die Hornbillvögel mit höchstem Geräuschepegel nach Nahrung schrien auf der Futterstation – eine vergnügliche Aktion!
Stabil beschuht und gut behütet, machten wir uns auf zum Urwaldtrekking, wo eine schauerliche Fledermauskolonie in einem Gingkobaumgeäste hing. Auch nach dem mächtigen Termitenbau, umgeben von riesigen Farnen und schlängelnden Lianen, hielt der Guide Ausschau. Wir waren umschlungen vom bunt blühenden, saftig grünen Dschungel.
Nach der beglückenden, abenteuerlichen Urlaubszeit verließen wir die malaysische Familie und die exotische Inselwelt und kehrten zurück in die kalte Schweizer Düsterkeit.
Es war Dreikönigstag 2010, das Ende der festtäglichen Zeit. Die geschnitzte Krippe stand noch auf dem Cembalo – ein biblisches Szenario! Beim traditionellen Kuchenritual – mein Ehekönig trug die goldne Kron’ – kam das Telefon, dass ein verkauftes Seeblickhaus wieder frei geworden sei. Wir studierten die aufbewahrten Pläne vom Mai. Der Weihnachtsstern auf dem Kran leuchtete hinauf, ein letztes Mal, und wies uns mit seinem Schweif den Weg hinab zum „Stall“.
Tags darauf wurde der Kaufvertrag beglaubigt – notariell, würdevoll, formell.
So begann ich, auch das Interieur im Familiendomizil hoch oben im Zihl digital einzufangen, ebenso die Schneelandschaft mit Fernsicht im strahlend kühlen Licht.
Es war Ironie des Schicksals, dass eine ehemalige Musikschülerin als Sachbearbeiterin aus der Fülle des Fotowerks ein eindrückliches Verkaufsdossier der „Villa mit Seesicht“ gestaltete und es ins Internet stellte. Bald danach, an einem sonnigen Frühlingstag, als die sprießende Natur das Haus umkränzte, übergaben wir es einem Elternpaar im Hinblick auf den kommenden Winter. Im Garten hüpften drei Kinder.
Loslassen
Auf dem geräumigen Estrich unter dem Dach stapelten sich unzählige Kisten, Schachteln, Koffern, Truhen. Sie konnten jahrelang verstauben und ruhen. Ein alter Schrank barg eine Kleiderwelt in großer Vielfalt: Hochzeitsgarderoben, Ballroben, hohe Stöckelschuhe, Smoking, Offiziersuniformen, Fasnachtskostüme, Skianzüge, Langlaufdresses, Knickerbocker, rote Wandersocken, selbst gestrickte Zopfmusterpullis aus der Vergangenheit. Manches war unnötig geworden im Laufe der Zeit. Es wurde entsorgt, sinnvoll verteilt oder der Brockenstube zugeteilt. Nur das Brautkleid aus Seidensatin mit Sankt Galler Spitzen und das edelste Abendkleid faltete ich zusammen und legte die beiden Stücke mit sentimentalem Wert in einen Karton für den neuen Ort.
Der braune Lederkoffer
Da lag noch etwas, zuunterst im sonst leer geräumten Schrank: Der braune Lederkoffer, der mich mit meiner Kindheit verband. Es war dieser Koffer und auch der in braunes Leder gehüllte Fotoapparat, welche unsere Familie in den Fünfziger- und Sechzigerjahren auf Reisen begleitet hatten. Es war noch nicht die Zeit, wo Menschenscharen sich bewegten auf den teils noch unasphaltierten Wegen.
Der Vater war motorisiert, unternehmungslustig, und er beschloss ganz spontan – je nach Wetter, Schulferien, Geschäftslage –, Urlaub zu machen für einige Tage. Die Mutter packte den Koffer, und man fuhr los, zu dritt mit Seitenwagen, bald mit Vierpersonenwagen, über Pässe mit Alpenrosen, vorbei an glitzernden Seelandschaften, an mit Sgraffiti verzierten Engadiner Häusern, an Tessiner Rustici oder an dunkelholzigen Walliserstadeln. Wir genossen Picknick bei den Narzissen, an sprudelnden Wasserquellen, auf blühenden Magerwiesen oder unter schattenspendenden Baumriesen. Nur einmal war die Enttäuschung groß, als Mutter die Cervelats im erstmals erworbenen Kühlschrank vergaß und die missmutige Familie den gemischten „Fourgon“-Salat aus der Gamelle fleischlos aß.
Am Comer See schauten wir den Waschfrauen zu, die ihre Kleider in den Wellen schwenkten und sich mit fröhlichem Schwatzen von der mühevollen Arbeit ablenkten. Die Fischer flickten die Netze in der Sommerhitze. Wir übernachteten in Pensionen, genossen die abendlichen Menus der Regionen und schwärmten vom Radio auf dem Nachttisch des Hotels in Lugano, mit Sicht aufs Funicolare und auf die Leuchtreklame. Schwermütiger Glockenklang lullte uns ein wie Nachtgesang.
Ein andermal staunten wir über die hochgewachsenen Palmen an der Riviera, die mit ihren Wedeln himmelwärts streben am Ufer des Meeres, das tiefblau glänzte bis zum Horizont. Nizza, der Sehnsuchtsort, von da aus mein Patenehepaar zur Adventszeit die Postpakete sandte, Jahr für Jahr. So wurde ich einst überrascht mit einem wunderschönen „Schildkröt“-Puppenkind. Geschwind traktierte es mein Brüderchen mit dem Weihnachtshämmerchen. Ich weinte, Mutter tadelte, und der Kleine schluchzte: „Der Hammer hat gehauen!“ Es war traurig, die Havarie anzuschauen. Der Puppendoktor in der Stadt montierte Bébé Rita einen neuen Kopf, und ich bettete es mit Wohlbehagen in den hellgrünen „Wisa Gloria“-Bäbiwagen. Meine Paten waren als Hausdame und Privatchauffeur zu Diensten im Hause Ringier. Den Winter verbrachten sie an der Côte d’Azur. Jetzt kam ich den alljährlichen Geschenken auf die französische Spur. Beigelegt waren jeweils „Ringgi und Zofi“-Bücher, später auch Pestalozzikalender für den lesefreudigen Bruder.
Mit unserem tatendurstigen älteren Cousin saßen wir, schon fast erwachsen geworden, hinten im Auto. Wir degustierten die ersten Melonen im Leben, lauschten den ungewohnt rockigen Songs von Johnny Hallyday im Strandrestaurant und amüsierten uns über den hungrigen Jüngsten, der Tintenfische fasste wie der Blitz, im Glauben, es wären Pommes frites. Mich würgte es beim Anblick der Platte mit den Fruits de Mer, kannte ich doch den widerlichen Geruch vom Comestiblesgeschäft beim Zytglogge in Bern.
In Saint-Tropez waren wir neugierig auf den Jetset der Sechzigerjahre, wo sich Brigitte Bardot im gehäkelten Bikini räkelte, fotografiert von Gunter Sachs fürs Modeblatt. Leider fand keine Begegnung mit der Leinwanddiva statt.
Stattdessen bestaunten wir in der lavendelblauen Provence die Amphitheater von Arles, Nîmes, Orange. Wir schritten über den Pont du Gard und waren beeindruckt vom Aquädukt, dem mächtigen römischen Konstrukt. Danach besichtigten wir den Palais des Papes, wo die Mutter einem bettelnden Kinderschwarm Sugusbonbons verteilte, Vater dazueilte und meinte, die Älteste sei Mireille Mathieu, der Spatz von Avignon, mit ihrer Geschwisterschar. Er mochte die Chansons der mädchenhaften Sängerin mit dem Pagenhaar.
Und nun, fünfzig Jahre danach, lag er da, der braune Koffer mit der Kodak-Kistchenkamera für die Reportagen unserer Familienära. Die Reiseberichte mit den eingeklebten Fotos, Billetten, Servietten, Rechnungen, Zeichnungen weckten Erinnerungen an viele vergangene Stimmungen. Unbenutzt seit langer Zeit, bot der Koffer Schutz dem Sammelsurium der Stammvergangenheit.
Eltern
Meiner Mutter Frühlingsliebe war längst entschwunden. Viel Schmerz und Kummer nagten an der jungen Seele, da sie, zu schüchtern noch, sich nicht getraute und sich selbst das Glück verbaute. Es war die Sommerliebe, die sie über Jahre pflegte, bis der Mann des Herzens reif für die Heirat war.
Nach fünf Monaten schon erlebten sie das Wunder der Geburt. Mit einem Lächeln kam ich auf die Welt, hat meine Mutter mir erzählt. Sie war verzaubert – zugleich irritiert. Früher schon, im Traum, sah sie ihre Kinderlein. Das Brüderlein war größer, kleiner das Schwesterlein. Nun lag es da, das Sonntagskind, nicht ein Büblein, wie erwartet, ein Mädchen war’s, geboren im trauten Daheim.
Später gab die Fünf-Monate-Konstellation der jugendlichen, achtsamen Tochter zu rechnen und zu denken. Neun Monate sollten es sein, las sie in einem kargen Aufklärungsbüchlein.
Großeltern
Großvater machte mir Angst mit seinem Schnurrbart und der Korpulenz. Er aber freute sich über die winzige Enkelin, die schon mit neun Monaten selbständig auf den Beinchen ging.
Im Frühling 1948 starb der 1872 geborene Johann. Er war ein geachteter Mann mit bäuerlicher Würde, der von seinen sechs Kindern mit Respekt gesiezt wurde.
Zu seiner Zeit wurde man konfrontiert mit gesellschaftlichen, politischen, technischen Veränderungen. Prägend waren die beiden Weltkriege, die Inbetriebnahme der lokalen Dampfeisenbahn, die die tiefe Schlucht überwand und die Stadt mit dem Land verband. Um der Armut zu begegnen, organisierten sich die Landwirte im Schweizerischen Bauernverband. Das neu gegründete Nationalgestüt berührte des Pferdezüchters Gemüt. Die Freiberger Rasse mit der strotzenden Kraft war geeignet für Militär, Transport und Landwirtschaft. Auch die angesagte Alters- und Hinterlassenen-Versicherung wurde endlich wahr, 1948, in seinem letzten Lebensjahr. Kurz nach Großvaters Tod kam mein Brüderlein zur Welt. Das frohe Ereignis hatte die Familientrübnis aufgehellt. Zu Ehren des Verstorbenen wurde das Büblein Jürg Johann genannt.
Auch Großmutter hatte ich kaum gekannt, ist sie doch bald darauf verschieden. Sie ist als vornehme Frau in Erinnerung geblieben, obschon sie nicht Königin im Schloss, sondern Bäuerin im Schlössli war. „Vornehm kann man auch im Herzen sein“, sagte meine Mutter, die Großmutters Liebreiz und Güte auch als Schwiegertochter spürte. Und man spricht von ihrem guten Geist, der immer noch nachwirke im weit verzweigten Verwandtenkreis. Eine selbst gewobene, flachsblaue Bettwäsche aus Gartenlein ist mein Andenken an ihr Wirken in Hof und Heim.
Doppelnamen
In der Hochhitze des Juni 1947 wurde ich in der Kirche biblisch, kurz und bündig auf den Namen Ruth getauft, zeitgleich mit Fredy, dem Zirkuskind, dem späteren Pferdewirbelwind.
Jahre danach empfand ich es als kleine Ungerechtigkeit, dass die Eltern mein Brüderlein mit zwei Namen bedachten in der damaligen Trauerzeit.
Im Lesealter vertiefte ich mich in Kreidolfs „Blumen-Märchen“, aber auch in die witzigen „Eulenspiegel“-Bildgeschichten, über die wir alle herzhaft lachten. In diesem Kalender entdeckte ich Franziskas Namenstag – an meinem Geburtstag. Das inspirierte mich, den Vornamen Ruth mit Franziska zu erweitern und damit mein Umfeld zu erheitern. Mit dem Doppelnamen beschriftete ich Zeichnungen und Sammlungen für den Hausgebrauch. Ich spürte auch, dass ich meinem Vater Franz verbunden und ganz ähnlich war: flink, geduldig und mit dunklem Haar.
Brüderlein und Schwesterlein
Mein Brüderlein wuchs heran, entzückte die Leute mit seinem Charme, seinem goldlockigen Haar, seinem Schalk in den braunen Augen, seiner Fabulierlust, von der Mutter geerbt, und mit seinem Wortspiel, das allen gefiel.
Bald schon wurde offenbar: Der mütterliche Traum wurde wahr! Größer war das Büblein, kleiner das Schwesterlein.
Vaterland
Das Schlössli war Vaters Daheim und das seiner fünf Geschwister. Zugleich war es das Ferienheim für Stadtkinder, die staunten über ländliche Naturwunder. Kleine und große Tiere belebten das Gehöft. Auf den Weiden graste das Vieh für die Milchwirtschaft. Die Pferde mit den Freiberger Traditionen waren der Stolz der Bauerngenerationen. Für die Beackerung der hügeligen Felder waren die Arbeitstiere von großem Nutzen und konnten Wind und Wetter trutzen. In den Sechzigerjahren wurde aus der Berner Sennenhundezucht der erste Welpe zur Übersiedlung nach Amerika ausgesucht.
Der Hof war im Sommerhalbjahr prächtig blumengeschmückt. Der fruchtbare Garten wurde gehegt und gepflegt. Spielplatz und Regenveranda boten Bewegungsfreiheit, und die Feuerweiher luden zum Bade in der warmen Jahreszeit.
Bei den Bienen vorbei führte der Weg zur Weiermatt, einer einfachen, buschig umrankten Behausung mit plätscherndem Brunnen, Holzfeuerung und Petrolbeleuchtung.
Die Angehörigen aus Bern weilten gern im Refugium in der Waldlichtung mit der urtümlichen Einrichtung. Sie suchten Holz, trugen Wasser in die Küche, pflanzten Gemüse, wägten Jahr für Jahr die Bohnenernte, kannten geheime Baumstrünke – Paradiese für Pilze –, kochten, fischten, fingen Mäuse, stiegen an heißen Tagen hinunter zum mäandernden Fluss, der die trutzige Burgruine umspült, und plantschten in dessen Glunggen, die Mutigste schon im ersten Bikini wie am Strand von Rimini.
Mein Bruder und ich waren die Jüngsten der Sippe. An Festtagen vereinte sich die große Verwandtschaft am Familienhort, einem wohligen Ort!
Eine Schokolade gab es am ersten Januar fürs aufgesagte Verslein zum Neujahr. An Ostern suchten die Kinder versteckte, mit Gräsern verzierte, mit Zwiebelschalen gebräunte und mit Speck geglänzte Eier.
Bowle aus Waldmeister servierte man zur Pfingstfeier.
Am Bettag aß man Zwetschgenkuchen, sammelte Haselnüsse in unendlich langen Hecken und schnitzte Stecken zum Skifahren, das wir entdeckten, wenn im Winter die Schneeflocken die Hügel bedeckten.
Man jasste zu heimeligem Schwyzerörgeliklang, begleitet von Volkslied- und Jodelgesang. Auch bereicherte die jüngste Tante, die mit ihrem Hosen-Kurzhaar-Zigarettenspitzenstil erfrischend chic auffiel, die Feste mit Gedichten und Geschichten. Sie sorgte im Stammbaum mit dem Wappenapfelbaum für die Mutationen mit den Familienemotionen: Hochzeit, Geburt, Taufe, Tod, bevor der Hoffotograf die neuesten Bilder darbot. Auch der jung verstorbene Onkel kam in Aktion – eine herzerfrischende Illusion! Er stand auf dem Kopf, weil das Dia absichtlich verkehrt eingeordnet war. So konnte man schmunzeln über den turnenden Leinwandstar.
Der älteste Onkel war selten dabei, da er mit seiner Familie angebunden war auf dem eigenen stattlichen Bauernhof, wo man sich auch immer wieder traf. Manchmal überraschte uns ein Verwandter aus Basel mit seiner Aufwartung. Als „Ölsoldat“ musste er seit 1940 zurechtkommen mit einer Behinderung. Die Vergiftung durch Maschinenöl in Käseschnitten war für ihn und für siebzig Aktivdienstler eine fatale Verwechslung, eine gesundheitliche und finanzielle Einschränkung. Er überwand sie dank gutem, familiärem Umfeld und dem neu aufgegleisten „Glückskette“-Spendengeld.
Es war eine Seltenheit, aber eine große Freud, wenn der Onkel aus Ohio anreiste zu einer Familienfestlichkeit. Er war fasziniert von der Technik, wie unser Vater, in einer Zeit der rasanten Entwicklung der Mechanik. Er wanderte aus über den Atlantik. He married a lovely American teacher. Technik und Pädagogik vereinten sich.
Vater kaufte ein Geschäft für Automobile, Motor- und Fahrräder nach einem beruflichen Aufenthalt am Genfersee. Bald darauf entstand das Hochzeitsbild unserer Eltern am Bielersee.
Mutterland
Wilhelmina Lina hieß das Kind und war darüber nie ganz glücklich. Wilhelm aber freute sich. Die Tochter wurde genannt wie die Königin von Holland, und sein Name blieb in weiblicher Form Familienbestand. Zudem versteckte sich die Lina in ihrer Mutter Karolina. Die Rufnamen variierten: Minggeli, Wilma, Mina! Sie wuchs zusammen mit sechs Geschwistern auf, nicht im Wohlstand, aber in Anstand. Karolina besserte den bäuerlichen Haushalt als Arbeitsschullehrerin auf, sorgte für Nahrung, Kleidung, Erziehung und übernahm Verantwortung, wenn der Vater unterwegs war mit den Tieren zur Sömmerung, hoch oben im Diemtigtal oder zum Straßenbau im Simmental.
In der Schlussphase des Ersten Weltkriegs und während des Generalstreiks 1918 brach eine heftige Pandemie aus. Sie verbreitete sich von Haus zu Haus. Millionen Menschen starben weltweit. Auch Karolina litt an der heimtückischen Krankheit. Die medizinische Kunst war oftmals machtlos. Man berichtete von einer frommen Frau im Moos. Karolina erholte sich nach der Fürbitte von der Spanischen Grippe und blieb nicht mehr lange sterbenskrank. Sie erlebte Heilung – Gott sei Dank!
Viele Kindheitsgeschichten wurden festgehalten von Mina, damit das bescheidene und doch frohe Leben ihrer Kindheit im Berner Oberland nicht vergessen gehe.
Schulreise 1922
„Mit einem Korb voll Kuchen, auf Kreuzbeige gelegt, schickte uns die Mutter auf die Schulreise. Dass wir spät waren, wussten wir. Marta, die Älteste, trug den Korb.
Als wir beim Schützenhaus hinunterkamen, sahen wir unsere Schulreisler schon unterwegs. Gut ein Kilometer Entfernung lag zwischen uns.
Ich raste los – aber nicht, ohne im Vorbeigehen der Schwester den Korb aus den Händen zu reißen. Ohne Korb kein Kuchen! So kam es, wie es kommen musste. Mir wurden nie alle Steine aus dem Weg geräumt, und so stolperte ich über einen. Der Korb flog weit vor mir her. Auf einmal schienen es fast doppelt so viele Geschwister zu sein, die mir mit Schmähworten halfen, den Kuchen wieder in den Korb zu legen. Ich musste ihn den ganzen Tag nicht mehr tragen!
Unsere Reise ging zu Fuß nach Thun. Auf dem Schiff konnten wir uns ausruh’n, und wir sahen schöne, unbekannte Ufer vorbeizieh’n.
In Spiez hatte ich schon wieder den Anschluss verträumt und den Ausstieg versäumt. Ich sah die Lehrerin mit ihrer Schar auf dem Vorplatz stehen. In Panik drängte ich, direkt hinauszugehen. Aber andere Leute auf dem Landungssteg versperrten mir den Weg. Um vorwärtszukommen, kletterte ich auf den Zaun, der mich an unser Kalbergatter mahnte. Da eilte der Dampfschiffanbinder herbei, der Schlimmes ahnte. Er konnte mich noch fassen vor dem tiefen Sturz ins Wasser. Ich übersah in meinem Angstzustand, dass dieses Gatter über dem See und nicht, wie das zuhause, auf dem Trockenen stand.
Von der Schifflände bis hinauf ins Hotel Lötschberg ist’s ein langer Marsch für schon etwas müde, kleine Kinderbeine – und der Bauch knurrte auch. Im Speisesaal bekamen wir Erbsensuppe mit Wurst und Tee gegen den Durst.
Nach diesem stärkenden Mahl besuchten wir das neue Soldatendenkmal. Endlich konnten wir den Kuchen essen. Danach hatte Alfred seine schöne, braune Kutte vergessen!
Abends wurden wir abgeholt von Bauern mit bekränzten Pferdewagen. Wir holperten heimzu auf steinigen Pfaden, schwatzten, lachten und sangen. Fast alles war gut gegangen. Dennoch musste ich bangen: Ich hatte das Geldsäcklein verloren. Mein Pech war wohl angeboren! Durch ehrliche Finder bekamen wir zum Glück Kutte und Portemonnaie zurück.“
Mina1
Welschland
Die Geschwisterschar wuchs heran. An Geburtstagen gab es fürs jeweilige Glückskind ein Spiegelei, eine heimliche Leckerei.
Nach der Konfirmation machten die vier Buben eine Ausbildung. Für die drei Mädchen suchte man eine Anstellung.
So reiste Wilhelmina mit der Eisenbahn, beschützt von „Freundinnen junger Mädchen“, ins Welschland, wo sie Unterschlupf in einem Pfarrhaus fand. Sie lernte gepflegtes Französisch am Neuenburgersee, wurde vertraut mit der Cuisine française, kochte Fisch mit Mayonnaise, Entrecôte mit Béarnaise, verzweifelte am Käsesoufflé, zerlegte ein Reh, mühte sich ab mit Safrankutteln und Kartoffelschnee, ebenso mit Kalbskopf an Vinaigrette und mit Hühner-Wachtel-Gänseeier-Omelette. Sie lernte, mit Seeländer Spargeln umzugehen, und musste manche gerechte und ungerechte Kritik überstehen. So war für Madame immer „trop de muscat dans la purée de pommes de terre“, bis Wilma, wie sie damals hieß, schlauerweise das Muskatraspeln unterließ. Sie bekam trotzdem die Rüge, dass sie dem Kartoffelstock zu viel davon zufüge.
Zu ihrer Freude zeigte sich das Städtchen geschäftig und lebhaft, geprägt von der École de Commerce mit einer fidelen Schülerschaft. Dieses Umfeld gab ihr so viel Kraft, dass sie zwei Jahre durchhielt, dank ihrem heiteren Gemüt, trotz Heimweh und Karolinas Klage: „Mein Kanarienvogel fehlt mir an jedem Tage.“ Denn die fröhliche Sängerin hatte einen glockenreinen Sopran. Doch in der Mitte des Lebens wurde ihr Gesang brüchig und lahm. Diese helle Stimme hatte ich von der Mutter geerbt. Aber auch meine Lieder wurden welk und verblühten, worüber wir beide große Trauer verspürten.
Frühlingsliebe am Thunersee 1935
Wilhelmina kehrte wieder zu den Wurzeln zurück. Sie erlebte ihre Frühlingsliebe, ein scheues Glück, das endete in quälender Magersucht. Die verlassene junge Frau war zutiefst bedrückt, die Essstörung eine einsame, trostlose Flucht.
„Meine verirrte Seele
sucht ihr Heim bei Nacht
und wird vom langen Suchen
oft so sterbensmatt.
Sie kniet vor verschlossner Türe.
Sie bittet, weint und fleht.
Da sagt eine fremde Stimme:
‚Was willst? Es ist zu spät!‘
Gejaget von wilden Schmerzen,
flieht sie dann von diesem Ort
und findet nirgends Ruhe.
Es ist spät, so viel zu spät.
Da wieget ein gütiger Himmel
sie sanft in tiefen Schlaf
und schenket Kraft ihr wieder
zu leben am kommenden Tag.“
Mina2
Kriegszeit – Abschiedszeit
Trübe, belastende Jahre folgten 1939 der Mobilmachung zur Landesverteidigung. Die Wehrmänner wurden eingezogen in den Aktivdienst. Die Lage war ernst. Die Frauen sorgten für Familie, Hof, Verdienst und mussten zurechtkommen mit Rationierungen und vielerlei Erschwerungen.
So kam es, dass die Großeltern ihre erste Enkelin zu sich nahmen. Mina wurde Gotte und enge Bezugsperson zum geliebten Patenkind, das mit seinem sonnigen Wesen hineinstrahlte in die verdunkelte Zeit, in der man sich still zum neu erworbenen Radio setzte und sich über die Kriegsnachrichten entsetzte. Nur Caruso mit seinem unsterblichen Tenor hatte Großmutters Rundfunkwelt erhellt!
Mit Naschen von Beeren im nahen Wald, mit Lecken an Schwefelholzköpfchen und mit Aussaugen von schmutzig-nassen Bodenlappen glich Margritli den Vitaminmangel aus, wohl nicht ganz im Sinne der Erwachsenen im Generationenhaus. Grosätti nagelte ihm ein Wedeleböckli und ein Sägeli, auch ein Leiterli, um Stangenbohnen abzunehmen. Auf dem warmen Ofenbänkli gvätterleten sie mit dem Chnopftruckli. Großmutter nähte aus Hudeln ein Bäbitoggeli und schickte das unbeschwerte Mädchen mit einem Krättli über die Wiesen, um Maikäfer aufzulesen für die Hühner der Nachbarin. Zwei Eier bekam die fleißige Sammlerin!
Nach Kriegsende spürten drei Brüder Abenteuerlust und wanderten aus nach Amerika, ins Land der Träume, der erhofften Freiheiten und der unbegrenzten Möglichkeiten, aber auch in eine Zukunft mit vielen Ungewissheiten.
Der für sie endgültige Abschied belastete die hadernden Großeltern schwer. Die Söhne und ihre mitreisenden, abhängigen Ehefrauen mit Kleinkindern entschwanden übers Meer. Großmutter schrieb ins „Vergissmeinnicht“ der entgleitenden Lieben:
„Über euch wacht
ein Engel für und für.
In des Lebens Stürmen
wird er euch beschirmen
und zu eurem Glück
das Steuer lenken,
für und für.“3
Es gab kein spontanes Zurück, auch kein sicheres Glück, kaum Telefonkontakt. Nur zur Festtagszeit wurden Briefe und Fotos verpackt in Kuverts mit blau-weiß-rotem Schrägdruckrand und geschickt „by Airmail“, dem teuren Weltpost-Überseeversand.
Nun pflegten die Großeltern die Beziehungen zu den nahgebliebenen Familien im Heimatland.
Mit viel Geduld brachte mir Großmutter das Stricken bei, belohnte mich mit Zitronenzuckerwasser und streichelte mir immer wieder übers Haar. Das war 1953, in ihrem Todesjahr. Der Darmverschluss war die schmerzvoll-tödliche Gefahr.
Sie starb im sechsundsiebzigsten Lebensjahr.
Man bettete sie in einen Sarg, worin sie still und schneeweiß lag. Mutter trug einen schwarzen Hut mit Schleier an der Trauerfeier. Pferde mit geflochtenen Schwänzen zogen den Leichenwagen mit den Blumenkränzen. Wir schritten hintendrein in einem langen Umzug. Die Leute redeten, was ich kaum ertrug. Ich weinte bis in die Kirche hinein und sorgte mich: „Jetzt ist Großvater ganz allein.“
Viele Jahre später bekam ich das Peddigrohr-Nähkörblein mit Karolinas Namen – nach dem bestandenen Handarbeitsexamen.
Großvater lebte nicht lange allein, zog ins Chalet des Sohnes ein, bis er kurz darauf im „Asyl Gottesgnad“ verstarb. Auch er glitt ganz leise im rosenbekränzten Sarg in das mit Tannenzweigen begrünte Grab. „Jetzt ist er bei Großmutter und beim lieben Gott“, hat man mir gesagt.
Zum Gedenken an ihren Vater Wilhelm hatte Wilhelmina seinen Albumspruch im Herzen aufbewahrt, zur Ermutigung auf ihrem weiteren Lebenspfad:
„Froh erwache jeden Morgen
und erfülle deine Pflicht.
Wo du bist, fliehn Gram und Sorgen,
und es blühn Vergissmeinnicht.“
Dies von Deinem Vater,
geboren 18774
Im Chalet
Im Chalet von Onkel und Tante verbrachte ich naturnahe Ferienzeiten mit allerlei Besonderheiten. Am Anfang und am Ende musste ich auf die Waage stehen und während des Aufenthaltes möglichst viel zunehmen. Sie sagten, ich sei ein Finöggeli. Ich war mager, aß unfreudig und verweigerte das Fleisch. Als Kleinkind saß ich oft ewig lang am Tisch, bis ich die drei mir zugemuteten Stücklein Braten, Wurst, Poulet, Speck, Leber, Kotelette hinuntergewürgt hatte. Ich war aber sportlich, sprang hoch über die Latte, weit über die Matte, turnte und rannte mit meinem Cousin um die Wette. Wir pressten Saft von den blauen Trauben im Hühnergeschirr und löschten den Durst im geheimnisvollen Sträuchergewirr. Wir saugten Nektar aus Rotklee und badeten im Thunersee. Wir vergnügten uns auf dem Jahrmarkt beim Billigen Jakob, der mit Klamauk und viel Lob seine Ware ausschrie – eine lautstarke Strategie! Wir schnappten beim Karussell nach dem goldenen Ring, dem kostbaren Freikartending.
Meine Cousine, auch Mutters Patenkind, war fünf Jahre älter. Sie lernte Coiffeuse, wusch mir die Haare, putzte den Nacken mit der Domdöse, rollte Bigoudis ein, steckte das Gewickel in die Trockenhaube hinein und strählte mir eine schöne, lockige Frisur, eine haargenaue Prozedur.
Amerika
Im braunen Lederkoffer lag, inmitten einheimischer Erinnerung, eine amerikanische Dokumentensammlung. Dank mütterlich-sorgfältiger Aufbewahrung fand ich Tagebücher von der beschwerlichen Überfahrt der Abenteurer mit dem Dampfschiff nach New York ins „Gelobte Land“, wo sie 1948 behördlich registriert wurden auf Ellis Island. Der Anblick der Freiheitsstatue nach dreiwöchiger Reiseübelkeit war eine erlösende Seligkeit.
Es folgten Briefe aus Ohio und California. Wir staunten über Familienfotos vor Bungalows und Cabriolets. Mit Fleiß und Tatendrang ging’s aufwärts, nach dem Vorbild Louis Chevrolets, des Schweizer Ingenieurs und Autokonstrukteurs. Die Pioniere schätzten die republikanische Gesinnung der Eigenverantwortung. Wir lasen die Zeitungsreportagen vom Schweizerklub – Jodel, Alphorn, Sennenkutte, Tracht –, ließen uns berühren von jeder Geburts-, Hochzeits-, Todesnachricht und von den Segenswünschen zu Weihnacht. Ein Dossier voller Eindrücke über viele Jahre der Assimilation in der Fremde, bis die Fremde zur zweiten Heimat wurde.
Das damals sechsjährige Margritli war beim Abschied ebenso untröstlich wie die Großeltern. Es war ihm aber später vergönnt, Kontakte zu pflegen, hinzufliegen oder die geliebten Onkelfamilien bei sich zu beherbergen. Es war auch für mich erstaunlich, wenn der jüngste Cousin, der in Amerika geboren und Vaters Patenkind war, versicherte, er sei Doppelbürger – auch seine Berner Seele sei stets fühlbar. Als Familienrichter kam er immer wieder in die alte Heimat und hielt an europäischen Kongressen sein juristisches Referat. Privat machte die Verwandtenchronik die Runde. Ebenso die Urkunde, die sein Götti nach Kriegsende, am 8. Mai 1945, von General Guisan bekam, betrachtete er aufmerksam. Er mochte die Kleinheit und die Vielseitigkeit der hiesigen Umgebung. Auch freute er sich über jede Begegnung mit einheimischer Bevölkerung. Zu unserer Erheiterung sprach er im ursprünglichen, unverfälschten Dialekt der Großelterngeneration – ein echter Enkelsohn!
Onkel, Tanten, Cousins starben – auch an Drogen –, ebenso die Verwandten väterlicherseits, die Freundschaft pflegten in Übersee mit den Familien mütterlicherseits. Sie ruhen in Frieden auf amerikanischem Boden.
„In Loving Memory:
Don’t grieve for me
for now I’m free.
I’m following the path
God laid for me.
I took his hand
when I heard Him call.
I turned my back
and left it all.“5
Es war beeindruckend, als zu Ehren der entschlafenen jüngsten Tante die Nachkommenschaft aus Ohio anreiste, um auch in der von Bergen beschützten Taufkirche ihrer zu gedenken mit Worten des eingeflogenen Pastors, mit Bildprojektionen, mit englisch-deutschen Reflexionen, umrahmt vom Orgelspiel des Sohnes und von Liedern aus dem Musical „The Sound of Music“. Beim letzten Sound des Akkordeons, beim „Edelweiß“, flossen die Tränen der Heimatverbundenheit. Es war eine eindrückliche Reise zurück in die Vergangenheit!
Nicht nur in Amerika war die verwandte Altersgruppe der Eltern verschieden. Wir mussten uns über die Jahre von dieser Generation, früh schon von unserem erst vierundsechzigjährigen Vater, verabschieden. Doch in all der verflossenen Zeit spürte ich unvergängliche Vertraulichkeit.
Vater
Er war der etwas in sich gekehrte ruhende Pol. Er war der Geduldige als Lehrmeister, auch mit Tochter und Sohn. In elterlicher Übereinstimmung überließ er seiner frohmütig-offenherzigen Frau die liebevoll-konsequente Erziehung.
Er war der seriöse Geschäftsmann, ebenso der elegante Tänzer mit den glänzend-lochverzierten Gigoloschuhen, womit er auch an beruflichen und politischen Versammlungen teilnahm und jährlich den Autosalon besuchte am Lac Léman. Wir alle fuhren sonntagsbekleidet nach Genf, bestaunten den Jet d’eau und die Trends im Salon de l’Auto. Zuhause ergötzten wir uns an Eusebius’ Vierradkarikaturen in der „Automobil Revue“, an den Witzen über Motoren. Vater handelte mit Autos im Umfeld, interessierte sich für die Welt, studierte Globus, Landkarte, Lexikon, war der Reiselustige, der keine Sehenswürdigkeit unbeachtet passierte. Auch den US-Bomber, der 1944 im Zugersee verschwand, besichtigten wir, als die Bergung stattfand. Beim Fliegenpilzkiosk unterwegs gab’s eine kurze Rast fürs überhitzte Getriebe und für die hungrigen Familienmitglieder im Reisefieber.
Vater war der Belesene, wenn es um Technik ging. Es gab Bücher in seiner Sammlung über Oskar Biders Alpenüberflug, über die „Hindenburg“ von Graf Zeppelin, die bei New Jersey in Flammen aufging, und über den „Titanic“-Untergang nach dem dramatischen Eisbergalarm.
Gleichermaßen fasziniert war er von der Entwicklung des Fahrrads, vom hölzernen Laufrad bis zum metallenen Velo. Für die amerikanischen Ferienkinder aus Ohio war es ein Gaudi, den Onkel radeln zu sehen. Das würde in ihrem Autoland nie geschehen!
Vater selber schmunzelte über „Don Camillo und Peppone beim Straßenradsport“ mit Fernandel als Filmikone. Besonderes Interesse jedoch hatte er am Automobil- und Motorradsport. Als Jugendliche war es für mich eine Wonne, bei ihm oder bei meinen Cousins auf dem „Gilera“-Sozius zu sitzen und durch die Gegend zu flitzen.
So war es fünfzig Jahre später auch ein Gaudi, nach der offiziellen Motorrad-Weltmeisterschaft in Katalonien über die Piste zu blitzen in Formation mit Ehemann und Firmendelegation. Das spanische Renngefühl wurde entschleunigt bei der Besichtigung von Antoni Gaudís „Sagrada Família“, der rätselhaft unvollendeten Basilika in der Kulturstadt Barcelona – ebenso im Kloster Montserrat, wo mehrstimmiger Renaissancegesang im Chor erklang.
Rückblickend in die Vergangenheit der Fünfzigerjahre, war der Vater begeisterter Bergrennfahrer. Er ratterte mit dem „Motosacoche“ über Pässe, wobei ihn die karierte Schirmmütze bei allen Wetterlagen schützte. Er besuchte mit dem „Topolino“ die Autorennen am Klausen und die „Formel 1“ in der Lombardei. Dabei tröstete er sein besorgtes kleines Mädchen, der Götti sei ja auch dabei. Sie fanden stets den Weg zurück über den Ceneri, die Leventina und die gepflästerte Tremola hoch – ein pures Männerglück! Auf der Gotthardpasshöhe gönnten sie sich Ruhe, dem Motor mit dem siedenden Wasser eine Abkühlung und sich selbst eine Nussgipfelverwöhnung. Danach kosteten sie die Schöllenenschlucht aus und kamen über den Susten durchs Oberland wieder nach Haus. Für uns alle gab’s Souvenirs: Chiantiwein in Korbflaschen, Salami aus Eselsfleisch, einen kleinen, grauen Stoffesel für meinen tierliebenden Bruder und eine Kuckucksflöte für mich, die den Grundstein legte für mein Flötenspiel, das mir zu Herzen ging.
Vaters Rennspiele wurden mir nach und nach vertraut. Als der adelige, gut aussehende Wolfgang Graf Berghe von Trips im königlichen Park von Monza im Kampf um den Gran Premio d’Italia ums Leben kam, hatte es auch mir zutiefst leidgetan.
Ein halbes Jahrhundert danach, Vater und Götti waren längstens tot, erblickte ich in der Sonntagszeitung eine großformatige Archivabbildung vom Bremgarten-Rundstreckenrennen. Ich war wie vom Blitz getroffen. Unter den Zaungästen, nah bei einem verunglückten Boliden, standen die beiden in der Mitte, fotografiert mit Gabardinemantel, Bogarthut und Zigarette.
Nach dem katastrophalen Horrorunfall 1955 in Le Mans wurde das gefährliche Spektakel bei Bern nach politischen Debatten verboten.
Mutter
Es war Liebe, prägende Liebe, die uns umgab. Die Mutter sorgte fürs Wohlsein der Familie, schaute zum prächtig blühenden Blumengarten vor dem Panorama der Stockhornkette und der Schneeberge mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Vor allem für ausländische Durchreisende war es eine fantastische Schau. Sie bestaunten und fotografierten das imposante Gebirge, besonders, wenn im Abendglühen das Schattenkreuz sich über die Jungfrau legte, bis die Sonne sanft entschwand. „Die Bärge luege chalt!“, sagte die amerikanische Cousine mit Blick aufs erloschene Alpenland.
Hinter dem Haus bepflanzte die Mutter mit Herzblut den großen Blätz mit Gemüse und Salat. Mit den Naturprodukten Kompost, Mist und Gülle reicherte sie die Erde an. Niemals begoss sie mit dem Flüssigdünger die wachsenden Pflanzen wie die etwas verhutzelte Nachbarin nebenan. Das Dorforiginal hatte den größten Spinat und überlebte munter bis ins hohe Alter.
Die Fülle der Gartenprodukte aus Mutters Plantagen in frisch geernteter, sterilisierter oder gedörrter Form ernährte uns an dreihundertfünfundsechzig Tagen, Jahr für Jahr. Das Erdbeerfestival war legendär, eine Wonne für Gaumen und Magen!