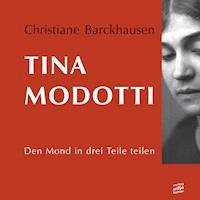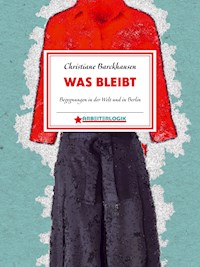
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arbeiterlogik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was bleibt von einem Schriftstellerinnenleben: Texte – Texte, die Wegmarken sind. Was bleibt in der momentanen dunkelgrauen Zeit: Die Erinnerung an Menschen, die gegen Unterdrückung und Ausbeutung kämpften – mit der Waffe, mit Worten, mit Liebe. Was bleibt, ist der Nachhall einer Zeit, in der der Weg zur Befreiung der Menschen vom Terror des Kapitals klar und das Ziel in nächster Nähe erschien. In 12 bewegenden Erzählungen erinnert Christiane Barckhausen an Begegnungen mit Menschen dieser Zeit – in Berlin, Mexiko, Madrid, Kuba, Chile, El Salvador, Nikaragua. In ihnen steckt die Glut, die wieder zu entfachen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Christiane Barckhausen-Canale
Geboren 1942 in Berlin. 1962-1979 Arbeit als Dolmetscherin für Spanisch und Französisch sowie als Übersetzerin spanischer Bücher. Seit 1980 Veröffentlichung eigener Bücher. 1987 Literaturpreis des FDGB für »Schwestern«. Seit 1982 Recherchen zu Tina Modotti. 1987 erscheint ihre Modotti-Biografie »Auf den Spuren von Tina Modotti« in der BRD, 1989 dann unter dem Titel »Wahrheit und Legende einer umstrittenen Frau« in der DDR. Im gleichen Jahr erhält Christiane Barckhausen-Canale den Literaturpreis des Frauenverbandes DFD. 1988 wird ihr für die von ihr selbst übersetzte spanische Fassung als erster Europäerin der Literaturpreis der Casa de las Americas in Kuba verliehen.
1992 ist sie Mitbegründerin des noch heute in Berlin existierenden Interkulturellen Frauenzentrums S.U.S.I und beginnt mit dem Aufbau des Tina-Modotti-Archivs, das 2010 nach Bonefro, Italien, übersiedelt.
Im Verlag Wiljo Heinen erschien ihre biografische Skizze »Tina Modotti. Den Mond in drei Teile teilen« (2012).
Christiane Barckhausen
WAS BLEIBT
Begegnungen in der Welt und in Berlin
Arbeiterlogik • 2022
Diese Seite ist absichtlich fast leer.
© Dieses elektronische Buch ist urheberrechtlich geschützt!
Autoren und Verlag haben jedoch auf einen digitalen Kopierschutz verzichtet, das heißt, dass – nach dem deutschen Urheberrecht – Ihr Recht auf Privatkopie(n) durch uns nicht eingeschränkt wird!
Selbstverständlich sollen Sie das Buch auf allen Geräten lesen können, die Ihnen gehören.
Als Privatkopie gelten Sicherungskopien und Kopien in geringer Stückzahl für gute Freunde und Bekannte.
Keine Privatkopie ist z.B. die Bereitstellung zum Download im Internet oder die sonstige »Einspeisung« ins Internet (z.B. in News), die dieses Buch »jedermann« zur Verfügung stellt.
Autor und Verlag achten Ihr faires Recht auf Privatkopie – bitte helfen Sie uns dabei, indem Sie das Urheberrecht von Autor und Verlag achten.
Nur dann sind wir in der Lage, unsere elektronischen Bücher zu kleinem Preis und ohne digitalen Kopierschutz anzubieten.
Wenn Sie noch Fragen haben, was denn »faire Kopien« sind, schreiben Sie einfach eine Mail an
Diese Seite ist absichtlich fast leer.
Mir war eigentlich schon immer klar, dass ich niemals eine Autobiografie schreiben würde, schon deshalb, weil mein Langzeitgedächtnis äußerst lückenhaft ist. Vielleicht ist dies ein »Kollateralschaden«, eine Folge der Tatsache, dass ich jahrzehntelang als Simultandolmetscherin das, was ich hörte, sofort in meine Muttersprache übersetzen musste und keinerlei Übung darin hatte, Dinge im Gedächtnis zu verankern. Mein Entschluss, mein privates und berufliches Leben nicht an die Öffentlichkeit zu tragen, festigte sich immer mehr, seit der Buchmarkt mit Autobiografien von Verfassern überschwemmt wird, die noch nicht einmal dreißig oder auch nur fünfundzwanzig Jahre jung sind.
Es ist ja nicht so, dass es nichts zu erzählen gäbe. So zum Beispiel meine größte Blamage als Dolmetscherin, als ich bei einem Gespräch zwischen Egon Krenz und Fidel Castro den Comandante dreimal bitten musste, ein Wort zu wiederholen, das ich nicht kannte: es war die Bezeichnung der Landessprache Eritreas: amharisch. Nie habe ich die hochgezogenen Brauen Fidel Castros vergessen, der sich wohl fragte, ob die DDR keine besseren Dolmetscher hatte.
Oder mein Gespräch, eher eine Diskussion, mit Fidel Castro im Jahre 1990, als ich ihm nicht mehr als Dolmetscherin, sondern als Autorin einer Biografie Tina Modottis gegenüberstand. Wir diskutierten über das, was sich seit dem Herbst 1989 in meinem Land abspielte, und ich erinnere mich dunkel, dass wir nicht in allen Punkten übereinstimmten.
Natürlich könnte ich von den Begegnungen mit Pablo Neruda, mit der Witwe Salvador Allendes, mit Sohn und Töchtern von Luis Corvalan, mit Gladys Marín, mit Künstlern, Sängern, Gewerkschaftern und Guerilleros verschiedener lateinamerikanischer Länder berichten, oder von den unvergesslichen Tagen mit dem spanischen Dichter Marcos Ana bei einem internationalen Schriftstellertreffen 1965 in Weimar, als ich 23 Jahre alt war und Marcos gerade eine 23-jährige Haft in Franco-Spanien hinter sich hatte.
Aber als Autorin haben mich immer vor allem die Menschen interessiert, die eher unbekannt waren, sowohl im eigenen Land als auch international. Ihre Lebensgeschichten habe ich in zwei Büchern (»Schwestern« und »Männer erzählen«) festgehalten, aber auch in Beiträgen, die in Zeitschriften wie »Für Dich« oder »Wochenpost« veröffentlicht wurden. Diese Geschichten brachten den in den Landesgrenzen eingeschlossenen BürgerInnen der DDR die Welt etwas näher, nicht die Welt der großen Politik, sondern die der Menschen, die versuchten, mit ihrem Wirken und ihren Opfern die gesellschaftlichen Zustände in ihren Ländern zu verändern.
Ich bin dem Verleger Wiljo Heinen sehr dankbar dafür, dass er mir jetzt, kurz vor meinem 80. Geburtstag, die Möglichkeit gibt, einige dieser Menschen einer jüngeren Generation von Lesern näher zu bringen. Aber all diesen Geschichten möchte ich heute eine Weitere hinzufügen, und dabei handelt es sich denn doch um eine Episode aus meinem Leben.
Es ist eine Begebenheit aus meiner Kindheit, die ich trotz des schlechten Langzeitgedächtnisses nie vergessen habe. Jetzt, im März 2022, drängt sie mit Gewalt an die Oberfläche, raubt mir in den Nächten den Schlaf und wirft viele Fragen auf.
Es war Januar 1946 und ich war noch keine vier Jahre alt. Meine Eltern waren ein Jahr zuvor aus Berlin in die Gegend um Magdeburg geflohen und wir lebten auf einem Gutshof, den meine Großeltern väterlicherseits bewirtschafteten. Nach Kriegsende waren zunächst amerikanische Truppen einmarschiert, die jedoch später von Militärs abgelöst wurden, die meine Großmutter als »Russen«, meine Mutter jedoch als »Sowjetsoldaten« bezeichneten. Offiziere und einige Soldaten waren im Gutshaus untergebracht, andere Soldaten kampierten in Zelten, und unsere Familie bewohnte einen der Pferdeställe.
Es war ein sehr strenger Winter, und an besonders eisigen Abenden sammelten die »Russen« in der näheren Umgebung alles, was als Heizmaterial genutzt werden konnte und entfachten in der Mitte des Gutshofes riesige Holzfeuer. Das war ein Schauspiel, das ich mir nie entgehen ließ. Und dann, an einem Abend im Februar, sah ich, wie einige Soldaten einen großen hölzernen Gegenstand herbeischleppten und ins Feuer warfen: meinen geliebten Schlitten! Ich rannte brüllend auf das Feuer zu, aber der Schlitten war direkt im Feuer gelandet und ich konnte nur stehen bleiben und weinen und immer wieder rufen: »Mein Schlitten, mein Schlitten!«
Und plötzlich sprang einer der Soldaten direkt in das Feuer und holte meinen Schlitten, der stellenweise schon Feuer gefangen hatte, heraus, legte ihn vor meine Füße und versuchte, meine Tränen zu trocknen. Als er mich einigermaßen beruhigt hatte, pochte er sich mit einem Finger auf die Brust und sagte: »Boris, Boris. Ja Boris.« Und dann kam schon meine Großmutter und zog mich mit sich in Richtung des Pferdestalles.
Wie gesagt, ich habe diesen Boris nie vergessen, aber ich wusste gar nichts von ihm außer seinem Namen. Als ich älter wurde, erfuhr ich, dass in der Sowjetarmee nicht nur Russen kämpften, sondern auch Angehörige vieler Völkerschaften: Kasachen, Usbeken, Armenier, Tataren, Ukrainer …
Dem Äußeren nach musste »mein Boris« Russe oder Ukrainer gewesen sein. Ein junger Mann, wohl nicht älter als 25 Jahre. Also etwa 20 Jahre älter als ich. Heute ist er sicher nicht mehr am Leben, und das bewahrt ihn davor, mitansehen zu müssen, wie Soldaten der einen ehemaligen Sowjetrepublik die Soldaten und Zivilisten einer anderen ehemaligen Sowjetrepublik überfallen.
In meinen schlaflosen Nächten male ich mir aus, wie das Leben von Boris nach der Rückkehr in seine Heimat verlaufen sein mag. Ich frage mich, ob ich ihm, ohne es zu wissen, während einer meiner Besuche in Moskau, Kiew oder Charkow begegnet bin. Hat er eine Familie gegründet? Hatte er Kinder? Enkel? Er könnte Urenkel haben, die heute bereits erwachsen wären. Lebten sie in Russland, und wären es junge Männer, wo würden sie heute stehen? Wären sie in das Kriegsgeschehen verwickelt? Wären sie Zivilisten, – würden sie Putin zujubeln oder gegen den Krieg demonstrieren? Und wenn Boris Ukrainer gewesen wäre, wo würde ich seine Urenkel heute finden? Unter den ukrainischen Soldaten? Unter den Zivilisten, die Molotowcocktails herstellen? Oder haben sie schon lange vor dem Krieg ihr Land verlassen und arbeiten heute vielleicht in Italien, wo ich diese Zeilen schreibe und wo seit Jahren viele junge Ukrainer und Ukrainerinnen als billige Arbeitskräfte das Geld für ihre in der Heimat zurückgebliebenen Familien verdienen?
Fragen über Fragen, die ich mir in diesen Februar- und Märznächten gestellt habe, und Familiengeschichten, die ich mir ausgemalt habe. Auf die Fragen werde ich nie eine Antwort bekommen, und was die Familiengeschichten angeht, – es gibt noch viele Varianten, die ich erfinden könnte, aber es gibt auch eine Konstante: ob Russe oder Ukrainer, ich gehe immer davon aus, dass Boris rechtzeitig gestorben ist und dass er diesen Krieg nicht mitansehen muss, er, der im Winter 1946 sicher davon überzeugt war, dass der Krieg, den er gerade überlebt hatte, der Letzte war und dass die Menschheit aus dieser Tragödie die richtigen Lehren ziehen würde.
Ich widme dieses Buch meiner Urenkelin Camila, die in Barcelona zur Welt kam, am 23. Februar 2022.
Christiane Barckhausen-Canale
Besuch bei Dora Alonso1984
»Nach Straße und Hausnummer habt ihr gefragt? Aber warum denn? Warum habt ihr nicht gesagt, dass ihr zu Dora wollt? Ihr hättet euch die lange Irrfahrt sparen können.«
Der Mann schüttelt den Kopf über so viel Dummheit, wendet sich vorwurfsvoll an meine kubanischen Freunde, die mich in diesen Teil von Havanna gebracht haben und große Schwierigkeiten hatten, die Straße und das Haus ausfindig zu machen.
»Ihr hättet doch wissen müssen, dass jeder hier in diesem Stadtteil Dora Alonso kennt!«
Dora, die in der Küche den Kaffee für uns zubereitet hat, setzt das Tablett auf dem niedrigen Tischchen ab, packt ihren Mann an der Schulter und schiebt ihn zur Wohnungstür. »Du übertreibst mal wieder«, sagt sie lächelnd, und in ihrer Stimme liegen Vorwurf und Zärtlichkeit zugleich. »Man könnte glauben, ich sei ein Filmstar … und nun geh schon, die Miliz wartet nicht.« Bevor sie die Tür hinter ihm schließen kann, zwinkert er mir noch einmal zu wie ein Verschwörer. »Wenn du etwas über Dora erfahren willst, compañera, musst du sehr hartnäckig sein. Sie fragt den Leuten Löcher in den Bauch, kann anderen stundenlang zuhören, aber über sich selbst spricht sie nicht gern.«
Doch kurze Zeit später – die winzigen Kaffeetassen sind längst geleert, die Freunde haben uns allein gelassen – sind Dora und ich bereits in ein angeregtes Gespräch vertieft. Der Erfahrungsaustausch über die Anforderungen unseres Berufes, über die Schwierigkeiten, den Drang zum Schreiben und die Erfordernisse eines geordneten Familienlebens miteinander zu vereinen, bringt uns beinahe automatisch auf das Anliegen, das mich zu ihr geführt hat. Ohne dass ich die Frage ausdrücklich formulieren muss, erfahre ich, wie diese Frau, die gerade ihren 73. Geburtstag gefeiert hat, zu der angesehenen Schriftstellerin wurde, deren Adresse heute fast jeder Einwohner von Havanna kennt.
Dora ist auf dem Lande aufgewachsen, in einer Familie wohlhabender Viehzüchter. Ihre Kindheit war geprägt von der wilden Schönheit der heimatlichen Landschaft, die in ihr einen so starken Willen nach Freiheit und Ungebundenheit wachsen ließ, dass die Eltern sie, halb bewundernd, halb vorwurfsvoll, als »Bengel« bezeichneten. Dora, ein eher kränkelndes Kind, setzte sich schon früh über die Vorurteile ihrer Klasse und über die Grenzen, die ihr Gesundheitszustand ihr setzte, hinweg, ritt stundenlang über Weiden und Koppeln des väterlichen Besitzes und hielt sich am liebsten in den Hütten der Landarbeiter auf, in denen sie erstmalig mit der harten Realität der Anderen, der Besitzlosen, konfrontiert wurde. Da sie ein Mädchen war, hielt es die Familie nicht für notwendig, sie auf eine höhere Schule zu schicken, und so musste sie aus eigener Kraft Wege finden, ihre Wissbegierde zu stillen. Jeden Tag, nach Anbruch der Dunkelheit, trieb sie heimlich in ihrem Zimmer Selbststudien, las alle Bücher, deren sie habhaft werden konnte. Mit 22 Jahren trat sie der Gruppe »Junges Kuba« bei, die sich den Sturz der Machado-Diktatur zum Ziel gesetzt hatte, und dies, so meinte die Familie, war schlimmer als ihre Angewohnheit, auf Bäume zu klettern und viele Stunden bei den Landarbeitern zu verbringen. »Das Mädchen wird noch Kommunistin werden!« rief ihre Mutter einmal aus, als wolle sie sagen: Sie hat sich mit dem Teufel eingelassen.
Mit 26 Jahren machte Dora erste Heiratspläne. Ihr Verlobter Constantino war Gewerkschaftsführer der Arbeiter einer Zigarrenfabrik, und von ihm erfuhr Dora, dass die Armut und das Elend der Landarbeiter gesetzmäßige Folgen eines bestimmten gesellschaftlichen Systems waren und dass es dieses System zu verändern galt. Aus ihrem ursprünglich rein humanistisch geprägten Mitgefühl für die Ärmsten der Armen wurde bewusstes Eintreten für eine Klasse, die nicht die ihre war.
Dann, eines Tages, wurde Doras neu gewonnene Überzeugung auf eine harte Probe gestellt. Constantino eröffnete ihr, er habe sich in einem Rekrutierungsbüro der Sozialistischen Volkspartei gemeldet; er werde als Freiwilliger nach Spanien gehen, um dort die Republik zu verteidigen. Dora, die von einer baldigen Heirat geträumt hatte, zeigte sich einsichtig. Sie verzichtete nicht nur auf jeden Versuch, den Verlobten umzustimmen, sondern bestärkte ihn in seinem Entschluss, indem sie sich bereiterklärte, während seiner Abwesenheit einen Teil seiner politischen Aufgaben zu übernehmen, Artikel zu schreiben, Texte für Flugblätter zu verfassen. Und natürlich würde sie auf ihn warten, so lange es notwendig sein würde. Aber er würde ja sicher bald zurückkehren. Die Verteidiger der spanischen Republik waren im Recht, und angesichts der weltweiten Solidarität mussten sie in nicht allzu ferner Zukunft siegen.
»Ich lief von einer politischen Versammlung zur anderen«, erzählt Dora. »Ich schrieb Artikel und ab und zu kleine Erzählungen; ich versuchte, meine Tage maximal mit Pflichten auszufüllen, um das Warten erträglicher zu machen. Und natürlich schrieb ich lange Briefe an Constantino. Erst Jahre später erfuhr ich, dass kein einziger meiner Briefe ihn je erreicht hatte. Constantino, einer von tausend kubanischen Freiwilligen, war bereits in der ersten Schlacht gefallen …«
Auf der Suche nach besseren Möglichkeiten für eine politische Betätigung, und sicher auch, um den Verlust des Verlobten leichter zu verwinden, zieht Dora nach Havanna, wo sie an verschiedenen literarischen Wettbewerben teilnimmt und ihre ersten Kurzgeschichten veröffentlicht. Das Havanna jener Jahre – Tummelplatz nordamerikanischer Millionäre, ein Paradies für alle, die auf der Suche sind nach Spielhöllen, exklusiven Show-Theatern und billigen Prostituierten – zeigt sich der jungen Frau vom Lande von seiner schlimmsten Seite. Dora sieht bei ihren Streifzügen durch die Elendsviertel Szenen, die sich ihr für immer einprägen sollen; das kleine Mädchen mit dem blutenden Auge beispielsweise, Opfer einer vererbten Syphilis, oder die auf einem Stück Sackleinen kauernde Frau, die ihre Zwillinge im Arm hält. Eines der beiden Kinder ist bereits tot, das andere saugt verzweifelt, aber erfolglos an der schlaffen Brust der Mutter. »Warum gehen Sie nicht mit dem Kind in ein Krankenhaus?« fragt Dora die Frau, und nie wird sie die Antwort, die geflüsterten, monotonen Worte, vergessen: »Was hätte das für einen Zweck? Lassen Sie mich, Señora, ich werde hier sitzen bleiben und warten, bis das Kleine stirbt. Denn sterben wird es, das ist der Wille Gottes …«
Dora, die jetzt regelmäßig Hörspiele für den Rundfunk schreibt, findet auch unter den Bedingungen der Batista-Diktatur Möglichkeiten, die Realität, in der ein überwiegender Teil ihrer Landsleute lebt oder auch nur so dahin vegetiert, in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Aber sie träumt bereits jetzt von dem Tag, da sie ihren lange gehegten Wunsch verwirklichen wird: einen Roman zu schreiben über das Leben der Landarbeiter und der armen Bauern ihrer Heimat. Einen Roman, der nichts beschönigt und der die Sprache derer wiedergibt, die in ihm beschrieben werden.
Und dann kommen eines Tages aus den Bergen der Sierra Maestra die Bärtigen in den olivgrünen Uniformen, und sie leiten in dieser Neujahrsnacht 1958/59 nicht nur ein neues Jahr, sondern ein neues Zeitalter für Kuba ein. Vom ersten Tag an stellt Dora ihr Können in den Dienst der Revolution und besonders derer, die das soeben begonnene Werk einmal fortsetzen und vollenden werden: Sie wird die Wegbereiterin einer eigenen kubanischen Kinderliteratur. Eines ihrer Bücher, »Der kleine blaue Kutscher«, gehört heute zur Pflichtlektüre in den kubanischen Schulen. Seit 1960 hat Dora Alonso 22 Titel herausgebracht. Sie haben eine Gesamtauflage von 1 300 000 Exemplaren und wurden in ein Dutzend Fremdsprachen übersetzt. Und im Jahre 1961 konnte sie auch den alten Traum vom Roman über die Bauern verwirklichen. »Tierra inerme« – »Regloses Land« – erhielt den Preis der Casa de las Americas.
»Mit diesem Buch habe ich mich freigeschrieben von all den bedrückenden Erinnerungen, von den Bildern, die mich seit meiner Kindheit verfolgt hatten. Das Buch war für mich eine Art Katharsis, und es blieb bis heute mein einziger Roman für Erwachsene. Alles, was ich sonst noch geschrieben habe, ist für Kinder und Jugendliche bestimmt.«
In ihrer Bescheidenheit verschweigt Dora, dass sie in all diesen Jahren auch eine äußerst produktive Mitarbeiterin mehrerer kubanischer Zeitschriften war, dass sie neben der Arbeit an ihren Büchern stets Zeit fand, mit Artikeln und Betrachtungen einzugreifen in die Geschehnisse des Tages, mit operativen Reportagen bei der Veränderung des Bewusstseins ihrer Leser mitzuhelfen. Es ist erstaunlich: Welchen Teil ihrer Arbeit sie auch immer erwähnt, kaum einmal erweckt sie den Eindruck, stolz zu sein auf das Getane. Immer spricht sie wie jemand, der nichts als seine Pflicht getan hat. Nur einmal liegt ein Anflug von Stolz in ihrer Stimme: Sie kann darauf verweisen, dass alle ihre Hörspiele aus der Zeit vor 1959 nach der Revolution erneut gesendet wurden, ohne dass sie auch nur ein Wort oder ein Komma im Text hätte ändern müssen.
Jetzt, da unser Gespräch den Punkt erreicht hat, da es um Doras eigene Arbeit geht, muss ich immer öfter beharrlich nachfragen, denn es ist wahr: Sie spricht nur ungern über sich selbst. Nur meine Hartnäckigkeit entlockt ihr schließlich auch die folgende Episode:
Im April 1961 macht Dora zusammen mit einem Fotoreporter einen Besuch in Santiago de Cuba, und wie jeder Besucher dieser »Wiege der Revolution« macht auch sie einen Abstecher zum Grab des Nationalhelden José Martí. Hier erfährt sie die ungeheuerliche Neuigkeit: In Playa Girón und Playa Larga sind kubanische Konterrevolutionäre, bezahlt, bewaffnet und ausgebildet von der CIA, gelandet und versuchen, als Auftakt für den Sturz der revolutionären Regierung, einen Brückenkopf zu bilden.
Sofort macht sich Dora auf die Reise nach Havanna. Der Weg führt in der Nähe des Küstenstreifens vorbei, an dem erbitterte Kämpfe zwischen den Konterrevolutionären und kubanischen Milizeinheiten toben. Je näher der Wagen dem umkämpften Gebiet kommt, umso heftiger wird in Doras Innern der Kampf zwischen dem Gefühl der Angst und dem Drang, an die vorderste Frontlinie zu eilen und ihre Pflicht als Reporterin zu erfüllen. Auf der Landstraße trifft sie Menschen, die aus dem umkämpften Gebiet kommen, Zivilisten, die ihr von schrecklichen Szenen berichten, und Doras Angst weicht immer mehr zurück vor dem Hass auf die Invasoren. Sie bittet den Fahrer, nach Playa Girón abzubiegen, wo sie sich beim Stab der Milizen meldet. Man will sie abweisen, schließlich, so heißt es, sei sie eine Frau, und noch dazu eine Frau von über fünfzig Jahren. »Warum wollen gerade Sie …?« »Sie haben es eben selbst gesagt, Genosse: Ich bin volljährig. Ich weiß, was ich zu tun habe.« Und ohne eine Antwort abzuwarten, läuft sie in die Richtung, aus der sie den Geschützdonner hört. Alle Angst ist verflogen, und inmitten der Gefechte interviewt sie die Jungen an den Flak-Geschützen. »Es waren halbe Kinder«, sagt sie heute. »Sie hätten meine Enkel sein können. Und das Erstaunlichste war, dass ich kein einziges Gesicht gesehen habe, auf dem sich Angst gespiegelt hätte. Es war ein einschneidendes Erlebnis, und ich hätte es mir nie verziehen, wäre ich seelenruhig weitergefahren nach Havanna, in meine sichere Wohnung …«