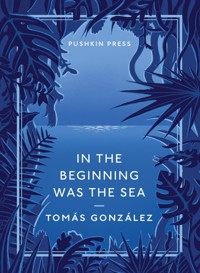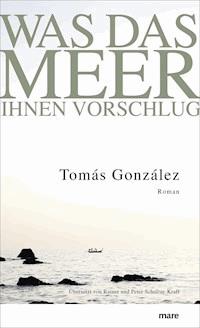
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mare Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als nichtsnutzige Versager betrachtet der jähzornige, misanthropische Hotelbesitzer seine fast erwachsenen Zwillingssöhne Mario und Javier. Und nachdem sie jahrelang unter ihm gelitten haben, bringen die beiden Brüder dem herrischen Vater ihrerseits lang gewachsene Ablehnung entgegen. Schließlich hat nicht zuletzt dessen schamloses Verhältnis mit einer anderen Frau, aus dem sogar ein weiteres Kind hervorgegangen ist, ihre Mutter krank gemacht – ein offenes Geheimnis in dem kleinen Küstenort. Eines Nachmittags begeben sich Vater und Söhne zum Fischen auf hohe See. Doch vor der karibischen Küste braut sich ein schweres Unwetter zusammen, die Hitze ist drückend, die Stimmung aufgeladen. Als ihr Motorboot in Seenot gerät und der Vater plötzlich über Bord geht, erkennen die Brüder eine Chance, die so verlockend wie grausam ist. In siebenundzwanzig vielstimmigen Kapiteln schildert Tomás González die schicksalsträchtigen Stunden, in denen ein fest verwurzelter Konflikt unaufhaltsam auf seinen Höhepunkt zusteuert und in denen zwei Brüder eine Entscheidung über Leben und Tod fällen müssen. Vordergründig still, erzählt González eine dramatische Geschichte von der Dimension einer griechischen Tragödie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tomás González
WAS DAS MEER IHNEN VORSCHLUG
Roman
Aus dem Spanischen von Rainer Schultze-Kraft und Peter Schultze-Kraft
mare
Die Übersetzung aus dem Spanischen wurde mit Mitteln des Auswärtigen Amtes unterstützt durch Litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e. V.
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abruf bar.
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Temporal bei Alfaguara, Bogotá. Copyright © by Tomás González 2013
© 2016 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung: Nadja Zobel / Petra Koßmann, mareverlag, HamburgAbbildung: plainpicture / clack
Typografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, HamburgDatenkonvertierung eBook bookwire
ISBN eBook: 978-3-86648-324-8 ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-231-9
www.mare.de
L’Éternité. C’est la mer allée Avec le soleil.
Arthur Rimbaud
Sturmwind ohne festen Weg, der du alles fortnimmst aus der Welt, nimm auch den Knoten mit, der meine Seele quält.
Aus einem Lied von Javier Solís
Samstag, 4 Uhr
Obwohl Mario eine Riesenwut im Bauch hatte, legte er die zwei Ruder sorgfältig ins Boot. Dann machte er sich auf den Weg zum Bungalow des Vaters, um die Benzinkanister zu holen. Javier hatte die Wasserflaschen und die zwei Kühlboxen, eine mit Eis, die andere ohne, schon gebracht und war jetzt wohl dabei, den Kaffee für die Thermosflaschen und die Eier für das Frühstück zu kochen. Mario war zwei Stunden nach Javier zur Welt gekommen und wünschte sich oft, nie geboren worden zu sein. Das Boot war himmelblau, zehn Meter lang und aus Glasfaser. Auf einer der Bänke brannte eine Coleman-Lampe. Trotz der nächtlichen Kälte trug Mario kein Hemd. Die Wut auf den Vater hielt ihn warm.
Wäre es ihm nicht gleichgültig gewesen, hätte er das Netz der Sterne am Himmel bewundert. Er schaute zwar nach oben, sah die Sterne aber nicht oder wollte sie nicht sehen. Javier kannte sich mit Großen und Kleinen Bären und Kreuzen des Südens aus; Mario konnte dafür mit verbundenen Augen einen Außenbordmotor auseinandernehmen und wieder zusammensetzen und fand sich auch ohne die Sterne sehr gut im Golf zurecht. Den Blitz, der seine Fangarme am Horizont ausstreckte, bemerkte er durchaus und auch, wie windstill es war, aber nicht weil ihn das als Naturschauspiel beeindruckte, sondern weil er alles, was mit Meer und Fischfang zusammenhing, instinktiv wahrnahm.
Der Gast, der im einzigen erleuchteten Bungalow die ganze Nacht getrunken hatte, stellte jetzt die Musik ab und löschte das Licht. Die Tangoklänge von Gardel und Olimpo Cárdenas und die in ihm kochende Wut hatten Mario kaum schlafen lassen. Der laute Bungalow war nicht weit von dem seinen entfernt, und auch wenn die Musik nicht mit voller Lautstärke lief, war sie unüberhörbar. Doch Marios Groll richtete sich nicht gegen diesen Mann; die Unsitten der Feriengäste zu ertragen, gehörte zu seinem Job: Sie zahlten dafür, sich am Meer zu betrinken, und davon lebte er, davon lebten sie alle.
Das Benzin stand im Hof hinter dem Bungalow des Vaters, der in diesem Moment zwei Kilometer weit weg, im seichten Wasser vor dem Flugplatz, mit dem Wurfnetz Köder zum Angeln fing. Mario nahm zwei rote Benzinkanister und verstaute sie im Heck. Dann ging er die beiden anderen Kanister holen. Die Insekten kreisten um die Coleman-Lampe, prallten gegen ihren Schirm. Die Wellen liefen fast lautlos im Sand aus. Um die Bungalows, zwischen den Kokospalmen und Seemandelbäumen, flogen Fledermäuse, die weder Mario noch sonst jemand sah. Vielleicht sah Gott sie, aber für Mario gab es keinen Gott.
Sie wollten zum Fischen rausfahren, in ein zwei Stunden entferntes Gebiet, in dem der Golf ins offene Meer übergeht. Sie hatten vor, einen Tag und eine Nacht auf See zu bleiben und drei- bis vierhundert Kilo Spitzmaulbrassen, Stachelmakrelen, Seebarsche, Stöcker, Sábalos, Schnapper und Grunzer zu angeln, die ihre von der Seeluft und vom Kater immer hungrigen Gäste mit gebratenen Bananen, Kokosreis und Tomatensalat essen wollten, wie jedes Jahr in der Hochsaison am Jahresende.
Mario verstaute das zweite Paar Kanister im Boot und holte die Mangrovenstange, mit der sie sich vom sandigen Grund abstoßen mussten. Neben seinem Bungalow stand die Cabaña Nummer 2, in der seine Mutter seit Jahren Selbstgespräche führte. Insgesamt waren es fünfzehn Cabañas, die Nummern über den Türen waren weiß auf rohe Holztafeln gepinselt. Seine Cabaña hatte die Nummer 3, Javiers die 9, die des Vaters hatte keine Nummer. Die Mutter redete in Wirklichkeit nicht mit sich selbst, sondern mit einer ganzen Schar von Leuten, mal leise, mal lauter, richtig laut wurde sie fast nie. Nora hatte zwar »eine Schraube locker« – wie die Zwillingsbrüder ihre Krankheit respektlos-liebevoll nannten –, aber sie hatte noch genug Verstand, um zu begreifen, dass ihr Mann jederzeit kommen und sie zum Schweigen bringen konnte.
Mario legte die Mangrovenstange behutsam im Boot ab und ging zur Hotelküche. Sie wollten einen Topf Bohnen mitnehmen, die der Vater eigenhändig zubereitet hatte, und einen mit Reis. »Die Leute hier an der Küste können keine Bohnen kochen«, sagte der Vater immer. »Wer einen anständigen Teller Bohnen haben will, muss ihn selber machen.« Während Mario die Töpfe an sich nahm, murmelte er: »Hält sich wirklich für das fetteste Schwein im Stall, der Alte. Jeder Trottel kann Bohnen kochen. Ist doch keine Kunst.« Die Wut wärmte ihn zwar an der Oberfläche, sein Herz aber blieb eiskalt.
Hotel Playamar hieß die Bungalowanlage.
Er packte die Töpfe in Plastiktüten, trug sie zum Boot und stellte sie in die Kühlbox ohne Eis, in die sie genau hineinpassten. »Die Arepas!«, dachte er und lief zurück. »Wenn ich die liegen lasse, bringt er mich um, der alte Sack.« Außer den Arepas und den Coca-Cola-Flaschen nahm er noch das große Messer mit, das die Köchin zum Tranchieren der Fische benutzte. Die Tüte mit den Arepas legte er in den Behälter mit den Bohnen und die Cola-Flaschen in die Kühlbox mit Eis, in die sie später die ausgenommenen Fische geben wollten. Da er nicht wusste, wohin mit dem Messer, steckte er es zu den Flaschen. Dort fand es später der Vater, als er auf See die Box aufmachte, um sich eine Cola zu nehmen.
»Und was soll das?«
»Für alle Fälle.«
»Für welche Fälle?«
Ihr seid einfach zu nichts zu gebrauchen – dieser Vorwurf schwang immer mit, wenn der Vater etwas zu den Söhnen sagte.
Mario wollte noch den Flaschenöffner und seine Angelruten von zu Hause holen, doch vorher schaute er bei der Mutter vorbei. Nora hatte das Klimagerät ausgeschaltet und schlief, jedenfalls sprach sie mit niemandem, obwohl die Leute spürbar da waren. Die Schar war immer da, einerlei, ob seine Mutter wach war oder schlief. Mario war leise. Er wollte sie nicht aufwecken, und sie sollte ihn auch nicht bemerken, falls sie wach war. Sie würde mit ihm reden wollen, und er musste doch gleich los. Er dachte nicht, »Die Arme!« oder »Was für ein trauriges Leben sie hat!«. Die Zwillingsbrüder dachten oder sprachen nie so über ihre Mutter. Sie waren einfach immer für sie da gewesen und hatten, so gut es ging, dafür gesorgt, dass sie nicht mehr Leid ertragen musste als das, was Gott, der nicht existierte, für sie vorgesehen hatte. Und wenn ein naiver Gast glaubte, sich einmischen oder teilnahmsvoll zeigen zu müssen, und zu ihnen sagte: »Eure Mutter hat es wirklich schwer getroffen«, dann antworteten sie: »Ach ja?«, und blieben von da an von weiteren Kommentaren verschont.
Der Vater tauchte aus der Dunkelheit auf, weiß behaarte Brust, muskulöse Beine mit hervortretenden Adern, das Wurfnetz über der Schulter und einen Beutel voller Sardinen und Garnelen in der Hand. Er ging zum Boot und verwahrte die Köder in der Kühlbox mit Eis. Für einen Außenstehenden, der weder den rot lodernden Hass im Herzen des Sohns noch die grünliche Flamme der Verachtung in dem des Vaters sehen konnte, wäre der Moment untergegangen im Fluss der Zeit.
Der Vater sah, dass alles in bester Ordnung war, und sagte nichts. Mario war erleichtert, dann stieg die Wut wieder hoch.
»Und Javier?«, fragte der Vater.
»Ich hole ihn.«
Wie erwartet lag sein Bruder, in gelben Shorts und mit roter Nylonregenjacke, im Wohnzimmer seines Bungalows in der Hängematte und las im Schein der nackten Glühbirne in einem Buch. Javier hatte die gleichen durchdringend schwarzen Augen wie der Vater. Er war etwas kurzsichtig und trug eine kleine, robuste Brille, die auf See beschlug und die er mit einem Handtuch putzte, das er sich immer um den Hals legte, wenn er mit dem Boot ausfuhr. Überall im Bungalow waren Bücher: im Wohnzimmer, in den anderen drei Räumen, selbst in der Küche und im Bad; sie standen nicht in Regalen, sondern stapelten sich auf dem Boden, wie in einer Abstellkammer oder einem Lagerraum.
Auf dem Fußboden neben der Hängematte lagen Javiers Angelruten, der Plastikeimer mit den Angelrollen und sein Arhuaco-Beutel, in dem immer ein Buch, Zigaretten, das Taschenmesser und kleinere Angelutensilien steckten: Haken, Blei und andere Dinge. Auch das Glas mit Marihuana und Pfeife war darin. Wenn er auf dem Boot kiffte, setzte er sich so hin, dass der Rauch nicht zum Vater zog, weil der sonst wieder sagte, er solle aufhören mit diesem Scheiß. Neben dem Beutel standen die vier großen Thermosflaschen, die sie immer mitnahmen, gefüllt mit starkem, süßem Kaffee, und eine Plastiktüte mit zehn ungeschälten hart gekochten Eiern.
»Seid ihr so weit?«, fragte Javier.
Mario steuerte das Boot. Obwohl der Vater in den Bergen aufgewachsen war, hielt er sich für einen besseren Seemann als seine Söhne; seit einiger Zeit gönnte er sich aber den Luxus, sich nur noch den Wind in sein braun gebranntes, glatt rasiertes, gut geschnittenes Gesicht pusten zu lassen. Er war einundsiebzig und sah aus wie sechzig. Am Horizont zuckte ein Blitz durch den Nachthimmel. Mario fasste die Ruderpinne des Evinrude mit der Linken. Das Meer war ein schwarzer Spiegel.
5 Uhr
Nora hatte gemerkt, dass ihr Sohn ins Zimmer getreten war, und hatte sich schlafend gestellt. Das Anlassen des Motors klang grausam in ihren Ohren, und sogleich ließ sich von der Zimmerdecke der Chor der Propheten vernehmen:
»Klänge im Hintergrund, auf die die Sterne scheinen. Riesenwelle, die die Zähne fletscht.«
»Stimmt«, sagte Nora. »So etwas kommt vor. So ist das Leben.«
29. Dezember. Am 23. hatte ihr Mann, der König, am Strand eigenhändig ein Schwein abgestochen, das so laut wie eine ganze Herde geschrien hatte, und genau so hörte sich jetzt das Aufheulen des Motors an, als das Boot in See stach. Bald würde es hell werden.
»Es wird hell, es wird hell. Wozu eigentlich?«, fragte sich Nora laut.
»Sonnenfieber, das den Strand versengt, Sonne, die alles niederstreckt«, prophezeite der Chor, obwohl es noch viele Stunden waren, bis die glühende Hitze auf dem Meer einsetzte, die der Vater nicht vertrug.
Die Zimmerdecke, aus Kiefernholz, war niedrig und erdrückend, doch im Bungalow war es kalt. Man hatte Nora den Ventilator weggenommen, nachdem sie ihre Finger in die Flügel gesteckt hatte, und danach hatte sie lange unter der Hitze leiden müssen, denn der Vater wollte ihr kein Klimagerät kaufen. Als die Zwillinge ihr schließlich von ihrem eigenen Geld eines besorgt hatten, hatte er sich wegen der Stromkosten zunächst geweigert, es anzuschließen, dann aber nachgegeben, und jetzt war es immer sehr kalt, wenn sie vergaß, das Gerät auszuschalten.
»Klopf, klopf«, sagte jemand vor der Tür.
Es war Doña Libe, die jeden Morgen mit ihrer jüngsten Tochter kam, um Nora zu einem Spaziergang am Strand einzuladen. Manchmal ging sie mit, manchmal nicht.
»Wer ist da?«
»Ich bin’s, Doña Nora, der Schneider«, sagte Doña Libe.
Heute wollte Nora mitgehen. Die Nachbarin und ihre Tochter kamen immer vor Sonnenaufgang, und die drei schauten zu, wie der Mangrovenwald im Morgenlicht langsam Gestalt annahm. Die Tochter war sechzehn und geistig zurückgeblieben. Die Nachbarin war weiß, etwa fünfzig Jahre alt und rundlich. Sie hatte immer einen Badeanzug an, und ihre Augen waren geschminkt. Sie sahen, wie die ersten Reiher von ihren Schlafbäumen aufflogen, in Richtung der Lagune, die südlich lag. Doña Libe fragte, ob die Jungen gut weggekommen seien – und schon meldeten sich die Stimmen, um zu singen und der Nachbarin, einfach unvorstellbar!, das Unglück anzukündigen, das sie vielleicht erwartete. Nora musste sie mit leiser Stimme und nachdrücklichem Gesichterschneiden (damit Doña Libe nichts mitbekam) zurechtweisen:
»Psst, wollt ihr wohl still sein! Doch nicht jetzt! Was fällt euch ein, ihr Schwachköpfe!«
»Mit wem sprechen Sie, Doña Nora?«, fragte Doña Libe und lächelte. Sie und ihr Mann führten ein kleines Hotel, ebenfalls mit Cabañas, ungefähr eine halbe Meile entfernt, in der Richtung, in die die Reiher davonflogen.
»Ich?«
»Ja, Doña Nora.«
»Mit niemand, warum?«
»Ach, nur so«, zwitscherte die Nachbarin und lächelte immer noch.
Auf dem Meer gab es keinerlei Anzeichen einer bevorstehenden Katastrophe. Weit draußen waren die Lichter der großen Kutter zu sehen und vorn die kleinen Lichter der Fischerboote, die auf dem Weg zu ihren Fanggründen in Küstennähe waren.
»Seht ihr, was ihr angerichtet habt!« Nora war aufgebracht, weil der Chor so unvorsichtig gewesen war, Doña Libe in ihre Angelegenheiten einzuweihen.
Sie gingen im seichten Wasser, das ihnen bis zu den Knöcheln reichte. Doña Libe leuchtete mit ihrer Taschenlampe auf den Schaum der auslaufenden Wellen. Linker Hand rannten die Strandkrebse aufgeschreckt über den weißen Sand, als sei der Tag des Jüngsten Gerichts gekommen und sie müssten sich vor Gott in ihren Löchern verstecken. Rechter Hand bewegte sich die Schar, jetzt schweigend, aber einige von ihnen standen Nora im Weg und versperrten ihr die Sicht, sodass sie sich auf die Zehenspitzen stellen musste, um die Lichter auf dem Meer sehen zu können.
»Geht gefälligst zur Seite, ihr! Ich kann doch nicht durch euch hindurchschauen!«, sagte sie mit einer Stimme, die durch ihre Krankheit merkwürdig piepsig geworden war.
Die Nachbarin schaute sie verwundert an, ganz im Gegensatz zu dem jungen Mädchen, das in seiner Entrücktheit kaum Notiz nahm von dem, was in seiner Umgebung vor sich ging.
Dort draußen musste das Boot sein.
Nora dachte an ihre beiden Söhne und wünschte sich, dass sie heil zurückkehrten. Der Chor verstand ihre Besorgnis als Aufforderung, wieder loszulegen:
»Mond, der wässrig leuchtet. Mond, der den Vers ans Kreuz schlägt …«
»Jetzt reicht’s aber! Auf der Stelle ist Ruhe, ja?«, fuhr Nora mit ihrer dünnen Stimme dazwischen.
»Die reden ganz schön viel, nicht wahr?«, bemerkte die Nachbarin, die in ihrer Gutherzigkeit immer bemüht war, sich in andere Menschen hineinzudenken.
Nora machte sich Sorgen um ihre Söhne auf dem Boot. Die Schar hatte sich offenbar vorgenommen, ihre Angst auszuplaudern, also musste sie den Chor zum Schweigen bringen. Die Nachbarin sollte nichts merken. Nora hielt es für möglich, dass Doña Libe Teil der Verschwörung war, die die Schwarze Hand mithilfe ihres Mannes gegen sie angezettelt hatte, und beobachtete sie argwöhnisch aus den Augenwinkeln, fast so, als gäbe es gar keinen Zweifel mehr daran, dass sie am Komplott beteiligt war.
Sie kamen an Doña Libes Hotel vorbei und grüßten ihren Mann, der im Licht der Straßenlaternen den Rasen sprengte. Der Wasserschlauch in seiner Hand kam Nora wie ein Phallus vor. Der Mann war dunkel und groß, etwa sechzig Jahre alt; er hatte einen Schnurrbart, und wenn er lächelte, strahlten seine hellen Augen. Sie gingen weiter in Richtung Lagune und kamen an den Ferienhäusern der Leute aus Medellín vorbei, die zu dieser Jahreszeit von ihren Besitzern bewohnt waren. Es war erst halb sechs, und die Hausherren und Angestellten schliefen noch. Nora blieb vor einem Haus stehen und betrachtete gebannt die Meerbilder mit Schiffen und Sonnenuntergängen, die auf den Kacheln am Eingang in die Mauer eingelassen waren. Doña Libe zog sie sanft am Ellbogen von den Bildern weg. Sie gingen zum Strand zurück und wateten weiter durch das seichte und noch dunkle Wasser.
»Don Alberto sieht aus wie der Teufel«, sagte Nora plötzlich, und die Nachbarin lächelte geschmeichelt.
»Schön wie der Teufel und ein Teufelskerl«, sagte sie. »Stimmt’s, Mädchen, dein Papá ist ein schöner Mann?«
»Ja.«
Die Nachbarin sagte immer, ihre Tochter habe Hirnhautentzündung gehabt, aber Nora war überzeugt, dass die Kleine von Geburt an zurückgeblieben war. Sie war groß gewachsen, was sie in Noras Augen noch hässlicher machte, und sah aus, als sei sie mit ungelenker Hand aus einem Stück Karton ausgeschnitten worden: Die Nase war zu groß und zu krumm geraten, die Augen standen zu nah beieinander, und der Hinterkopf fehlte.
»Dass ihr mir ja die Klappe haltet!«, rief Nora der Schar vorsichtshalber zu. Wo der Kapitän befiehlt, hat der Matrose nichts zu melden, dachte sie. Wenn nur einer der Zwillinge dem Kapitän das Messer in den Leib stoßen würde. Oder lieber doch nicht. Man könnte ihn auch ins Wasser werfen. Ertrinken soll ein süßer Tod sein. Ein süßer Tod im salzigen Wasser, wie findet ihr das?
Auf der glatten Wasserfläche waren jetzt die Kanus der Fischer zu sehen, kurze, dunkle Striche. Sie werden alles wegfischen und meinen Söhnen nichts übrig lassen, dachte Nora voller Groll.
»Ach, wenn ich nur schon Urlaub hätte!«, sagte sie dann mit einem müden Seufzer. Diesmal war die Nachbarin tatsächlich überrascht und beeindruckt.
»Wo arbeiten Sie denn, Doña Nora, wenn ich fragen darf?«
»Im Außenministerium, ein Sack voller Nieten.«
Sie waren fast bei den Buden angekommen, kurz vor der Einmündung der Lagune. Bald würden sich hier die Touristen drängen, die in Bussen aus Montería und Sincelejo angekarrt wurden, um zu essen, zu trinken, zu tanzen und zu baden. Jetzt war der Sand noch tadellos sauber und geharkt, und man konnte sich nicht vorstellen, dass er in wenigen Stunden voller Dreck und Abfall sein würde. An einem Sonntagnachmittag war Nora mit ihren Kindern dort gewesen und hatte ein Würstchen Menschenkot gesehen, das im Wellenspiel zwischen Strand und Meer hin und her schwappte, während sich direkt daneben die Badegäste im Wasser vergnügten. Seitdem wollte Nora immer umkehren, sobald sie die palmengedeckten Dächer der Buden sah. Es war, als sei das Würstchen immer noch dort und warte auf sie.
Sie kehrten um, und als sie Playamar erreichten, verabschiedete sich die Nachbarin und ging mit ihrer Tochter nach Hause. Die Tochter verabschiedete sich nie.
»Unwetter, das den Kompass kreuzt. Sextant, der den Horizont nicht sieht.«
»Ja, ich weiß, ihr braucht mir das nicht so oft zu sagen. Ihr geht mir auf die Nerven. Wisst ihr, was? Warum machen wir nicht eine Party?«
Sie vergewisserte sich, dass die Türen und Fenster gut geschlossen waren, stellte die Temperatur des Klimageräts etwas herunter, und die Party konnte beginnen.
6 Uhr
Wie eine Wand hatte Javier vor sich den unberührbaren Rücken des Vaters, der am Bug saß und den frischen Morgen empfing. Der Vater war kräftiger gebaut und kleiner als er und trug ein ausgeblichenes Polohemd, das einmal rot gewesen war. Javier war mittelgroß; von ihm sagte man, er sehe dem Vater ähnlich, im Gegensatz zu seinem Bruder. Mario war blond und hochgewachsen, so wie einst Nora, bevor die Krankheit ihren Körper veränderte und ihn schrumpfen ließ.
Dass er seinem Vater ähnlich sah, kümmerte Javier nicht.
Sein Verhältnis zu ihm war nicht einfach, aber anders als Mario hatte er gelernt, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Er war immer bemüht, einen kühlen Kopf zu bewahren, damit seine Mutter und sein Bruder es nicht noch schwerer hätten. Wie Mario nahm Javier gerne Drogen: Marihuana, Kokain und gelegentlich auch Amphetamine; das half ihm gegen die Monotonie des Lebens am Meer, aber er wusste fast immer, wann er aufhören musste. Wie sein Bruder schloss auch er sich manchmal in seinem Bungalow ein und ließ sich erst nach ein paar Tagen wieder blicken. Diese Anfälle von Melancholie und die Zuflucht zu Alkohol, Drogen und Büchern leistete er sich allerdings nur in der toten Zeit, wenn keine Touristen kamen, denn genau wie sein Vater und sein Bruder war Javier in erster Linie Geschäftsmann, und zwar ein guter, selbstdisziplinierter, dem es nie eingefallen wäre, sich das Geschäft zu vermasseln, indem er seinen Bedürfnissen nach Lesen, Trinken und Kiffen zur Unzeit nachgab.
Javier glaubte keineswegs, dass er und Mario Versager waren, wie sie der Vater nannte, wenn er getrunken hatte, und manchmal auch, wenn er nüchtern war. Ihm machte dieses Geschwätz nichts aus, aber Mario war empfindlicher und ließ sich verletzen. Javier bestritt nicht, dass sie beide Drogen nahmen, aber immerhin taten sie es nicht auf Kosten anderer. Sie führten erfolgreich das Restaurant des Hotels und hatten obendrein, ohne Zutun des Vaters, einen Lebensmittelladen an der Asphaltstraße gekauft, der gut lief.
Er zog eine Packung Pielroja aus seinem Beutel, wandte dem Wind den Rücken zu und zündete sich eine Zigarette an. Dann sah er, dass Marios Blick starr geradeaus gerichtet war und er das Steuer eine Spur zu krampfhaft festhielt. »Wer weiß, was in den Dummkopf gefahren ist«, dachte Javier. Der Evinrude-Motor war fast neu und hatte einen soliden, gleichmäßigen Klang. Es machte Spaß, zu erleben, wie sich der Bug aufrichtete, wenn Mario Gas gab. Billig war der Motor nicht gewesen, aber was teuer ist, macht sich mit der Zeit bezahlt, dachte Javier. Sie kamen jetzt an die nördliche Spitze des Golfbogens und nahmen Kurs auf die erste Insel des Archipels, in deren Nähe sie die Angeln auslegen wollten. Weit draußen, in nordwestlicher Richtung, hatten sich an einer Stelle dunkelgraue, fast schwarze Wolken zusammengeballt, eine steinfarbene Insel am Himmel, die sich jetzt unter unablässigem, heftigem Blitzen entlud. Es war, als würde sich an diesem fernen Punkt ein begrenztes Inferno abspielen. Der Rest des Meeres, der Rest des Universums war ruhig und blau.
Javier schenkte sich Kaffee aus der Thermosflasche ein und trank in kleinen Schlucken, während das Boot das türkisblaue Wasser durchpflügte. Auf hoher See wurde das Schauspiel des Gewitters immer großartiger. Keiner gab einen Kommentar dazu ab, keiner hatte das Verlangen zu sprechen, schon gar nicht über Meereslandschaften. Aber immer wieder wandten sie den Blick den Blitzen zu.
Steuerbord erschien jetzt die Insel, mit ihren Kokosbäumen und palmengedeckten Hütten, mit Zelten von Touristen und deren Badesachen, die, zum Trocknen auf Mangrovenzweige gehängt, wie Lumpen aussahen. Sie fuhren weiter, bis die Insel wieder verschwunden und überall nur Wasser war.
Der Vater sagte »Hier!«, und an dieser Stelle warfen sie den Anker aus.
Kaum tauchten die Angelhaken ins Wasser, bissen schon die Fische an: Spitzmaulbrassen, Rote Schnapper, große Seebarsche, die dann zappelnd auf dem Boden des Boots landeten. Manchmal betäubten sie sie mit einem kurzen Knüppel; oft kamen sie aber nicht dazu, weil sie sich um die Fische kümmern mussten, die an den anderen Haken angebissen hatten. Einen solchen Fischsegen gab es selten. Sie angelten Stachelmakrelen, Sierras, Stöcker. Javier musste eine Pause machen, um sich auszuruhen. Er rauchte eine Zigarette und holte dann das Glas mit dem Marihuana aus seinem Beutel. Als er die Pfeife anzündete, achtete er darauf, dass der Rauch nicht in die Richtung des Vaters zog.
7 Uhr
Ich bin der alte Mann aus der Cabaña 5. Einer der Feriengäste hier. Nummer 5 hat den schönsten Blick aufs Meer, obwohl die Klospülung nicht immer funktioniert und die Fliegengitter vor den Fenstern die Moskitos durchlassen. Meine älteste Enkeltochter und ihr Mann haben mich mitgenommen. Wenn man alt ist, wacht man immer früh auf, und so sah ich durch die Jalousien, wie der Vater mit seinem Wurfnetz aufbrach und der eine Sohn die Coleman-Lampe anzündete und anfing, das Boot fertig zu machen. Ich legte mich wieder hin, nicht um zu schlafen, sondern um auf den Tag zu warten. Ich hörte, wie sie losfuhren. Wenn man alt ist, kommen einem die Nächte ewig vor. Und das Geräusch der Wellen lässt sie noch länger werden. Man weiß nicht mehr, ob das Leben lang ist oder kurz, mit seinen Sekunden, die im Schneckentempo dahinkriechen, und seinen Wochen, die im Flug vorbeisausen. Ich schlief dann aber doch wieder ein. Als ich aufwachte, war es Tag, und ich hatte den Vater und seine Söhne vergessen.
Wir sind die Gäste, die Touristen.
Ich bin das sieben Jahre alte blonde Mädchen aus Medellín, das auf den Rückenstachel eines Seewolfs getreten ist und dem dann ein schwarzer Junge auf die Wunde gepinkelt hat, um sie zu entgiften. Es war schon fast dunkel, als wir gestern mit