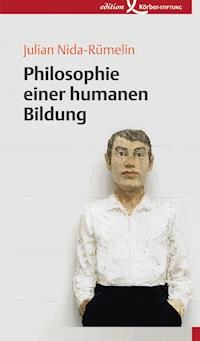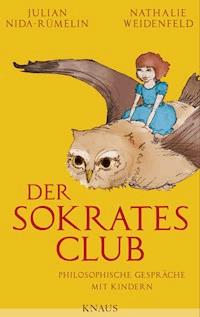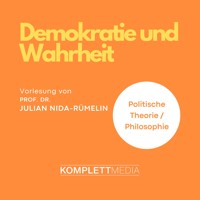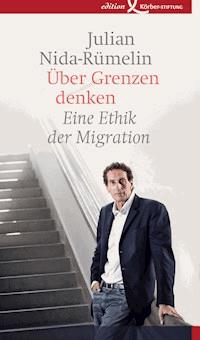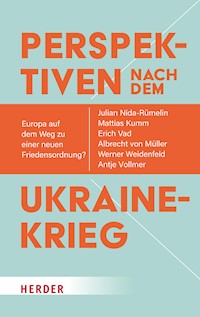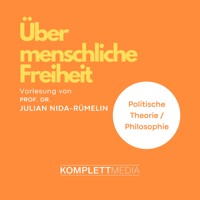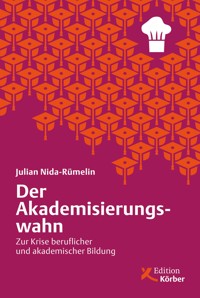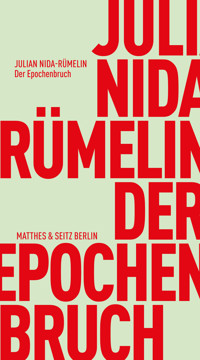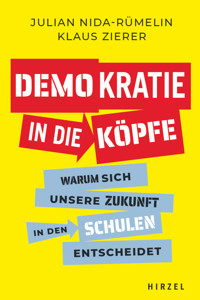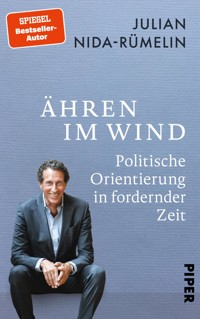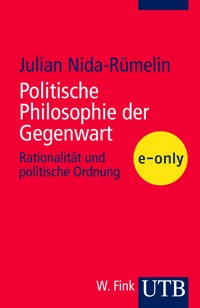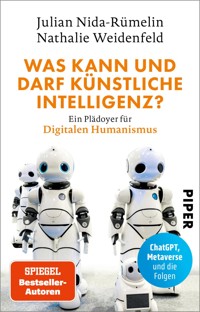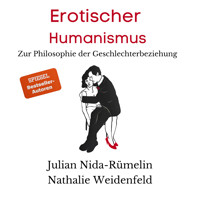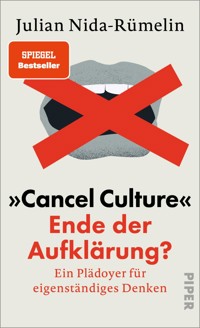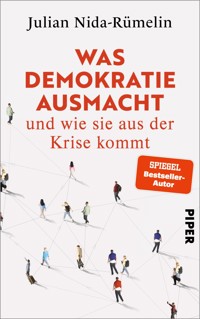
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In einer Zeit, in der die Demokratie als Staats- und Gesellschaftsform weltweit auf dem Rückzug ist, bietet Julian Nida-Rümelin in diesem Buch notwendige Orientierung. Gleichzeitig tritt er populären Missverständnissen von Demokratie entgegen – insbesondere verschiedenen Varianten des Populismus, überwiegend von rechts, aber auch von links. Demokratie gehört zu den höchsten Gütern unserer Kultur – doch sie muss verteidigt werden. Denn durch Nachgiebigkeit werden die Feinde der Demokratie in ihrer Verachtung gegenüber liberalem Gewährenlassen und kultureller Toleranz nur bestärkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorwort
Dank
Teil A Was Demokratie ausmacht
Einführung
1 Die Krise der liberalen Weltordnung
Sieg und Verfall
Die Erosion sozialer Marktwirtschaft
2 Eine kosmopolitische Perspektive
3 Die Essenz der Demokratie
Demokratie und kollektive Rationalität
Das Arrow-Theorem
Lehren aus dem Arrow-Theorem
Kollektive Autonomie
Individuelle Autonomie
Das Liberale Paradoxon
Konsens in der Demokratie
Dissens in der Demokratie
Politische Manipulation
4 Formen der Demokratiekritik
Eine Verteidigung von Gleichheit und Freiheit
Kritik des Verteilungsegalitarismus
5 Gerechtigkeit in der Demokratie
6 Deliberation in der Demokratie
7 Demokratischer Realismus
8 Kooperation in der Demokratie
9 Demokratie als Lebensform
10 Die gefährdete Ordnung der Demokratie
Teil B Drei Studien
Studie I: Demokratie in der Krise
Krise als Herausforderung des Verfassungskonsenses
Politische Strömungsbilder in der Krise
Gemeinwohl und Volkspartei in der Krise
Demokratisches Vertrauen in der Krise
Die Gefährdung demokratischer Zivilkultur in der Krise
Studie II: Demokratie in der digitalen Transformation
Das menschliche Selbstbild in der digitalen Transformation
Digitale Akteure
Radikale direkte digitale Demokratie als Lösung?
Die digitale Transformation der repräsentativen Demokratie
Die Ethik digitaler Kommunikation
Digitale Kommunikation in der Demokratie
Studie III: Die Rolle der Zivilkultur in der Demokratie
Multikulturalität, Individualismus, Humanismus
Öffentliche Räume in der Zivilkultur
Kulturelle Transzendenz in der Einwanderungsgesellschaft
Partizipative Demokratie in der Kommune
Anhang
Politische Theorie und demokratische Praxis
I Politische Philosophie als Grundlegung politischer – speziell demokratischer – Praxis
II Politische Philosophie als Interpretation (und Revision) demokratischer Praxis
III Politische Philosophie als Analyse demokratischer Praxis
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Vorwort
Mit diesem Buch verfolge ich eine doppelte Zielsetzung: Es soll in einer Phase, in der die Demokratie als Staats- und Gesellschaftsform weltweit auf dem Rückzug ist, Orientierung geben, populären Missverständnissen von Demokratie entgegentreten, insbesondere den unterschiedlichen Varianten des Populismus, überwiegend von rechts, aber teilweise auch von links, es will aber auch Selbst-Missverständnisse der liberalen Demokratie aufklären und dabei vor allem die Besonderheiten demokratischer Meinungsbildung und Entscheidungsfindung herausarbeiten.
Teil A klärt zentrale Fragestellungen der politischen Philosophie und präsentiert dabei eine eigenständige Demokratietheorie, deren unterschiedliche Aspekte ich in zahlreichen Einzelpublikationen über viele Jahre präsentiert habe.
Zudem werbe ich trotz der beunruhigenden Entwicklungen diesseits und jenseits des Atlantiks für einen demokratischen Optimismus: Es liegt an uns Bürgerinnen und Bürgern, die Bedingungen, unter denen wir leben wollen, selbstbestimmt zu gestalten. Daher werden auf der Grundlage der in Teil A erfolgten demokratietheoretischen Klärungen in Teil B wichtige Aspekte demokratischer Selbstbestimmung in drei Studien behandelt:
I
: Was kann eine Demokratie in einer Krise wie der
COVID
-19-Pandemie gefährden, und wie kann sie sich darin bewähren?
II
: Inwiefern ist die digitale Transformation eine Herausforderung der Demokratie, und wie kann sie zu ihrer Stärkung eingesetzt werden?
III
: Welche Rolle spielt in der Demokratie das, was ich als »Zivilkultur« bezeichne, und wie lässt sie sich stärken?
Frühere Fassungen dieser drei Studien wurden von mir in den Jahren 2021, 2022 und 2023 für die Körber-Stiftung (Hamburg) erarbeitet und auf Tagungen zur Diskussion gestellt. Sie werden hier mit Zustimmung der Körber-Stiftung und der Parmenides Foundation (Pöcking), an der sie angefertigt wurden, publiziert. Zu den ersten beiden Studien sind zusätzliche Detailinformationen online verfügbar,[1] die zwei Mitarbeiterinnen der Parmenides Foundation, Dr. Niina Zuber und Dr. Dorothea Winter, verfasst haben. Eine frühere Fassung des Teils A wurde 2020 von der unterdessen aufgelösten Edition der Körber-Stiftung publiziert, sie ist seitdem vergriffen.
Ich hatte bei der Abfassung dieses Buches eine breitere Leserschaft vor Augen, die Lehrkräfte an weiterführenden Schulen, Medientätige und Demokratieinteressierte umfasst. Entsprechend habe ich mich bemüht, jeweils die Essenz eines Argumentes möglichst allgemein verständlich darzustellen. Eine besondere Herausforderung war, zentrale Theoreme der Collective-Choice-Theorie für ein angemessenes Verständnis der Demokratie fruchtbar zu machen, ohne in die Details der formalen Analyse zu gehen.
München und Berlin im Februar 2025
Julian Nida-Rümelin
Dank
Dankbar bin ich zwei Stiftungen, die sich für die Demokratie engagieren: zunächst der Körber-Stiftung für die langjährige Kooperation im Rahmen des Deutschen Studienpreises, den ich als Kuratoriumsvorsitzender über acht Jahre mitgestalten konnte, dann im Rahmen des Programms »Demokratie stärken«, besonders Lothar Dittmer und Sven Tetzlaff, auch der unterdessen aufgelösten Edition der Körber-Stiftung, geleitet von Bernd Martin, die einige meiner Bücher veröffentlicht hat.
Dankbar bin ich auch der Parmenides Foundation, an der die drei Studien verfasst wurden, besonders dem Stifter Prof. Albrecht von Müller, dem Generalsekretär Carsten Freitäger, den Mitarbeiterinnen in den Demokratieprojekten Dr. Dorothea Winter und Dr. Niina Zuber, die den Online-Anhang erstellt haben, sowie für Transkription und Vor-Lektorierung Silke Deuringer.
Ebenfalls dankbar bin ich dem Piper Verlag, dass er dieses doch überwiegend akademische Buch in sein Programm aufgenommen hat. Tatsächlich spielt die bedeutende politische Theoretikerin Hannah Arendt im Programm des Piper Verlags von jeher eine wichtige Rolle. Insofern fühle ich mich in bester Gesellschaft und danke den Lektoren Martin Janik und Steffen Geier.
Dieses Buch ist aber auch eine Art allgemein verständliche Summa meiner wissenschaftlichen Arbeit im Bereich der politischen Theorie. Ich bin allen, die dazu am Lehrstuhl Philosophie und Politische Theorie der Ludwig-Maximilians-Universität München über die Jahre beigetragen haben, dankbar. Es ist nicht möglich, sie alle hier aufzuführen.
Anlässlich meines Siebzigsten veranstaltete die Ludwig-Maximilians-Universität zusammen mit dem Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation ein Symposion, zu dem ich einen Vortrag »Politische Theorie und demokratische Praxis« beisteuerte, den ich nachfolgend dokumentiere (in Auszügen wurde er am 7. Dezember 2024 unter dem Titel »Eine Verteidigung der liberalen Demokratie gegen ihre Verächter und ihre allzu naiven Freunde« im SZ-Feuilleton publiziert).
Teil A Was Demokratie ausmacht
Einführung
Demokratie ist eine spezifische Form der Selbstbestimmung, die auf den anthropologischen Prämissen der Freiheit und Gleichheit beruht. Diese Form kollektiver Selbstbestimmung wird durch Verfahren der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung realisiert, die auf Regeln beruhen, die allgemein zustimmungsfähig sind. Der rationale Konsens ist also nicht das Ideal kollektiver Selbstbestimmung, sondern die Zustimmung zu normativen Regeln höherer Ordnung, die das demokratische Institutionengefüge und die demokratische Praxis tragen. Nennen wir dies ein strukturelles Verständnis demokratischer Ordnung.
Die Praxis der Demokratie kann insgesamt als eine Form der Kooperation verstanden werden. Im Unterschied zu liberalistischen Demokratiekonzeptionen plädiere ich dafür, Demokratie auch als eine Lebensform zu begreifen, insofern hat diese Demokratiekonzeption nicht nur liberale und soziale, sondern auch republikanische Züge.
Individuelle Rechte und demokratische Entscheidungen stehen nicht, wie oft angenommen wird, in einem Spannungsverhältnis, sondern sind in den demokratischen Institutionen einer repräsentativen, rechtsstaatlichen und gewaltenteiligen Demokratie unauflöslich miteinander verbunden. Demokratie ist nicht lediglich ein Verfahren kollektiver Entscheidungsfindung, sondern beruht auf geteilten normativen Überzeugungen, in deren Zentrum die humanistische Idee der Freiheit, Gleichheit und Würde aller Menschen steht. Diese Normen lassen sich nicht auf die politische Sphäre begrenzen, während die ökonomische, die soziale und die kulturelle Praxis davon unberührt bleibt. Demokratie ist eben nicht nur eine institutionelle Struktur, sondern auch eine humane Lebensform, die wir erhalten und mit neuer Vitalität ausstatten müssen.
1 Die Krise der liberalen Weltordnung
In der gesamten westlichen Welt erstarken seit einigen Jahren die rechtspopulistischen Kräfte. Dies gilt unterdessen für fast alle demokratischen Staaten der Welt, in Europa, in den USA, in Südamerika, aber auch in Süd- und Ostasien. Mit der zweiten Wahl Donald Trumps Ende 2024 ist sogar zu erwarten, dass sich damit ein neues Muster der Politik im mächtigsten Staat der Welt dauerhaft etabliert, das die normativen Grundlagen der Demokratie zu großen Teilen infrage stellt, die Rechtsstaatlichkeit und die Pressefreiheit gefährdet und in den internationalen Beziehungen das Recht des Stärkeren anerkennt und damit hegemoniale Strukturen weltweit akzeptiert.
Manche dieser rechtspopulistischen Bewegungen können auf lange etablierte, organisationsstarke, rhetorisch geschulte Parteiformationen zurückgreifen, wie etwa der Front National in Frankreich, der sich heute Rassemblement National nennt, andere, wie die sogenannte »Alternative für Deutschland« (AfD), formierten sich aus Euroskepsis und Kritik an der Flüchtlingspolitik Angela Merkels erst später, wieder andere transformierten sich aus einer offen neofaschistischen Bewegung des italienischen Movimento Sociale Italiano zu einer europa- und ukrainefreundlichen rechtskonservativen Partei wie die Fratelli d’Italia der aktuellen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. In mehreren EU-Mitgliedsländern, nicht nur Italien und Ungarn, bestimmen unterdessen rechtspopulistische Parteien die Regierungspolitik. Das Erstarken rechtspopulistischer Kräfte geht teilweise zulasten konservativer, aber deutlicher noch zulasten sozialdemokratischer und sozialistischer Parteien.
Unterschiedliche Aspekte der Globalisierung und interne kulturelle Veränderungen sind ausschlaggebend für diese neue Formation der Politik in westlichen Ländern: Das gilt ganz besonders für die Migrationsthematik. In der ökonomischen Theorie und von Unternehmensverbänden wird die Öffnung der Grenzen nicht nur für Warenströme, sondern auch für Arbeitskräfte befürwortet. Zusammen mit der linksliberalen Befürwortung einer multikulturellen Gesellschaft haben sich in Reaktion darauf politische Bewegungen unterschiedlicher Schattierungen gebildet, die in Italien als sovranisti bezeichnet werden, sie wenden sich gegen den Souveränitätsverlust des Nationalstaates, aber auch gegen kulturelle »Überfremdung«. In ihren extremen Ausformungen bedienen sie sich rassistischer, antisemitischer und antimuslimischer Parolen, der Übergang zu völkischen und identitären Bewegungen ist fließend.
Unter »Populismus« sind politische Bewegungen zu fassen, die sich als Vertreter des (»einfachen«) Volkes gegenüber den (vermeintlichen) Eliten inszenieren, die das, was sie unter dem Volkswillen verstehen, gegen dessen Geringschätzung in der etablierten Politik, aber auch in Wissenschaft und Kultur zu verteidigen vorgeben. Populismus ist eher eine politische Methode als eine inhaltliche Festlegung. Es gibt populistische Strömungen und Parteien, die von ihren Zielsetzungen her rechts im politischen Spektrum stehen (in Europa beispielsweise noch die italienische Lega oder die britische UKIP), andere stehen eher links, wie Podemos in Spanien oder Syriza in Griechenland, manche gehören eher der linken Mitte an, wie etwa das Movimento 5 Stelle in Italien. Der populistische Politikmodus ist an Inhalte nicht gebunden.
In Europa wendet sich der Rechtspopulismus in besonderer Weise gegen die Politik der Europäischen Kommission, gegen Forderungen nach einer innereuropäischen Solidarität bei den Finanzen und bei der Aufnahme von Flüchtlingen, gegen die gemeinsame Währung des Euro und fordert ein Zurück zu nationalstaatlicher Souveränität mit allenfalls intergouvernementaler europäischer Kooperation. Der Rechtspopulismus der Gegenwart tritt dabei teils regionalistisch, teils nationalistisch auf. Durch seine oft gute lokale Verwurzelung schafft er eine enge Verbindung zu seiner Wählerschaft, die den christdemokratischen und sozialdemokratischen, erst recht den liberalen und grünen Parteien schon länger nicht mehr gelingt. Möglicherweise geht damit die politische Formation, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg in fast allen westlichen Ländern unabhängig von ihrem Wahlsystem etabliert hat, zu Ende. Und damit endet auch deren Prägung durch starke Volksparteien der linken und der rechten Mitte, gestützt auf einen liberalen und sozialstaatlichen Grundkonsens.
Besonders dramatisch ist die Gefährdung der demokratischen Ordnung ausgerechnet in den USA, der unumstrittenen Führungsmacht des »Westens«, neben Frankreich und England eine der ältesten modernen Demokratien. Die erneute Wahl des republikanischen Rechtspopulisten Donald Trump 2024 lässt erwarten, dass sich der Politkmodus nicht nur in den USA dauerhaft verändert und Ethosnormen der demokratischen Praxis, aber auch ihre institutionelle Absicherung in Gestalt eine unabhängigen Justiz gefährdet sind.
Die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten 2016 war ein politisches Phänomen, das von den professionellen Beobachtern der Politik und der Wahlforschung für undenkbar gehalten worden war. Seine erneute Wahl 2024 galt zwar auch nach dem Kandidatenwechsel der Demokraten von Joe Biden zu Kamala Harris noch als möglich, kein Institut hatte jedoch mit einem Sieg Trumps in allen Swing States gerechnet. Die politischen Fehleinschätzungen aus Wahlforschung, politischer Kommentierung und Politikwissenschaft hatten sich – trotz aller Bemühungen, Fehlerquellen auszumerzen – wiederholt.
Für uns ist jedoch etwas anderes relevant: die Erosion der liberalen Werte ausgerechnet in dem Land, das sich als Hort und Anführer dieser Werte versteht. Die erfolgreiche Wahlkampfrhetorik Donald Trumps, zu großen Teilen rechtspopulistisch ausgerichtet, deutet zweifellos auf einen tiefen Traditionsbruch: Denn sie bricht mit den zivilen Werten der amerikanischen Demokratie, mit der engen Beziehung zu Europa, mit der westlichen Verteidigungsgemeinschaft, mit der gleichen Anerkennung unterschiedlicher Kulturen, Ethnien und Religionen im Inneren, sie bricht mit der traditionellen Weltoffenheit dieses Landes, mit dem respektvollen Umgang mit Unterschieden, mit der guten Partnerschaft mit dem nördlichen (Kanada) und dem südlichen (Mexiko) Nachbarn. Keiner der früheren Präsidentschaftskandidaten hatte sich je einer solchen Rhetorik bedient.
Im Rückblick sind lange verdrängte Phänomene der US-amerikanischen politischen Kultur ins öffentliche Bewusstsein zurückgeholt worden, wie die McCarthy-Hysterie gegen alles, was links oder auch nur linksliberal war, die Aggressivität der Rednecks gegen die Beatniks und die aggressive Reaktion auf die Jugendbewegung der Sechziger- und frühen Siebzigerjahre, die immer wieder in Gewalt ausartete, vor allem aber die beschämend lange Frist, die verstrich, bis diese liberale Demokratie das Unrecht der Sklaverei erkannte. Ein Déjà-vu stellt sich ein im Blick auf die noch frühere Geschichte der USA, als sich der Republikanismus der Federalist Papers mit seinen Grandseigneurs wie James Madison oder Alexander Hamilton zur Politik Andrew Jacksons wandelte, eines Präsidenten anderen Typus, der sich als common man stilisierte und allen Verfeinerungen von Sprache, Auftreten und Intellekt mit Verachtung begegnete. Donald Trump und seine Entourage verkörpern auch im Habitus diese Tradition amerikanischer Elitenverachtung.
Der Brexit in Großbritannien, also die knappe Mehrheitsentscheidung beim Referendum im Juni 2016, die EU zu verlassen, kann ebenfalls als Menetekel der Erosion liberaler Werteorientierung im Inneren gelten. Der Erfolg der Brexit-Kampagne, der eine Vorgeschichte im Zuspruch der rechtspopulistischen UKIP-Bewegung mit Nigel Farage an der Spitze hatte, beruhte zweifellos auf einer antiliberalen und nationalistischen Rhetorik. Europa wurde als Moloch karikiert, der die britischen Bürger aussaugt, der den Verlust nationaler Identität durch erzwungene Zuwanderung herbeiführt und die nationale Souveränität bedroht. Diese Kampagne wurde mit einer Vielzahl offenkundig lügnerischer Behauptungen geführt, wie sie in alten, institutionell stabilen und mit einer freien Presse gesegneten Demokratien bislang nicht vorgekommen waren. Das Beunruhigende ist, dass alle Mechanismen, die ein gewisses Maß an öffentlicher Vernunft sichern sollten, in diesem Fall versagten. Selbst die Tatsache, dass schon bald nach dem Brexit-Votum auch öffentlich nicht mehr bestritten wurde, dass die Brexiteers ihren Erfolg irreführenden Argumenten zu verdanken hatten, änderte nichts daran, dass dieses Votum fortan, befeuert von einer geradezu hetzerischen Yellow Press, als unumstößlich galt. Nicht einmal die sich abzeichnenden massiven ökonomischen Verluste und die Tatsache, dass durch den Austritt finanzielle Nachteile für die meisten Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens eintreten werden, änderten die Stimmungslage. Eine Erklärung für dieses ungewöhnliche Phänomen ist, dass es sich nur in zweiter Linie um eine politische Sachfrage handelte, sondern vielmehr darum, dass sich zum ersten Mal seit Langem die Provinz gegen die Metropole, die einfachen Leute gegen die Eliten durchgesetzt hatten. Umfragen zeigen unterdessen, dass sich der Wind viele Jahre später gedreht hat. Eine Mehrheit meint nun, dass der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ein Fehler war, aber es besteht in der Politik keine Bereitschaft (auch nicht in der Labour-Regierung), den Brexit rückgängig zu machen. Vermutlich wird es jedoch in den kommenden Jahren zu einer Wiederannäherung Großbritanniens an die EU kommen, die dann möglicherweise in einen Status münden wird, der dem der Schweiz ähnlich ist.
Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, der Erfolg der Brexiteers, die Übernahme von Regierungsverantwortung durch rechte, demokratie- und EU-kritische Parteien in etlichen europäischen Ländern, die Rechtsverschiebung bei den Europawahlen 2024, die Erosion sozialdemokratischer, teilweise auch christdemokratischer Volksparteien in Europa und der Verfall der zivilkulturellen Grundlagen der Demokratie belegen eine tektonische Verschiebung: eine Demokratiekrise, die als die interne Dimension einer erodierenden liberalen Weltordnung verstanden werden kann.
Mit der internen Erosion der normativen Grundlagen der liberalen Ordnung korrespondiert eine externe Herausforderung neuen Typs. Während der Jahrzehnte der bipolaren Weltordnung standen sich mit den USA und der UdSSR zwei militärisch in etwa gleich starke Systeme gegenüber, die diese Parität in den SALT-Verträgen der Siebzigerjahre auch wechselseitig anerkannt hatten. Beide Akteure waren spätestens seit der Kubakrise darauf bedacht, Konflikte so zu kontrollieren, dass sie nicht zu einer direkten militärischen Konfrontation der beiden Weltmächte ausarten konnten, jeweils eingesponnen in ein Netz internationaler Beziehungen mit engen Verbündeten, Kooperationspartnern, Abhängigen und Einflusszonen. Kriege erschienen nur an der Peripherie dieser Systeme möglich. Zugleich allerdings tobte ein innergesellschaftlicher Kampf um die intellektuelle Hegemonie. Seit den ersten Jahren nach der Russischen Revolution etablierte sich im Westen ein intellektueller Diskurs, insbesondere in europäischen Ländern wie Frankreich und Italien, teilweise aber auch in Deutschland und England, der bei aller Kritik doch von einer Grundsympathie für die sozialistische Alternative bestimmt war. Ähnliche Entwicklungen in den USA stießen auf massiven Widerstand der politischen Elite, was die liberale Grundordnung dieses Landes im Kalten Krieg einer ernsten Bedrohung aussetzte. Die externe sozialistische Systemalternative korrespondierte mit einer internen Kritik des liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells.
An dieser Stelle muss die soziale Dimension der liberalen Ordnung in die Betrachtung einbezogen werden. Sozialstaatlichkeit gibt es in unterschiedlichen Formen, solchen, die sich in der Tradition des Armenrechts auf die Unterstützung der Bedürftigen beschränken (USA), solchen, die das Ausmaß der sozialen Absicherung in hohem Maße von erbrachten Leistungen abhängig machen (Frankreich und Deutschland), und solchen, die ein Bürgerrecht aller auf soziale Unterstützung, wie die skandinavischen Staaten, postulieren. Gemeinsam ist ihnen, dass die liberale Staatsordnung westlicher Gesellschaften, in Gestalt garantierter individueller bürgerlicher Rechte, ohne eine sozialstaatliche Komponente nicht (mehr) denkbar erscheint. In Deutschland war es der konservative Staatsmann Otto von Bismarck, der mit der Reichsversicherungsordnung das Fundament legte. Er reagierte damit auf das Erstarken der Sozialdemokratie, die als Repräsentanz des Dritten Standes dagegen aufbegehrte, dass die arbeitende Bevölkerung weithin rechtlos blieb und ihnen die gewünschte Anerkennung versagt wurde. Bismarck entwickelte eine Doppelstrategie aus Verfolgung (zwölf Jahre Sozialistengesetze) und Sozialstaatlichkeit und bewirkte damit etwas, das er wohl gar nicht beabsichtigt hatte: Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte entstand so etwas wie eine nationale Identität, spürbar über alle regionalen und landsmannschaftlichen, sprachlichen und kulturellen Identitäten hinweg. Erst der Aufbau eines gemeinsamen Rechts- und dann Sozialstaates etablierte das, was im Französischen als citoyenneté und im Englischen als citizenship bezeichnet wird und zu dem es interessanterweise im Deutschen keine Entsprechung gibt (»Bürgerschaft« hat andere Konnotationen).
Den zweiten Entwicklungsschub erfuhr die demokratische Sozialstaatlichkeit als Reaktion auf die Erfahrung der Weltwirtschaftskrise ab 1929 und ihrer Folgen in Gestalt von Nationalsozialismus und Krieg. Keynesianisch angeleitete wirtschaftliche Globalsteuerung sollte die Krisenanfälligkeit des Kapitalismus dämpfen und über gleiche soziale Anspruchsrechte die Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger am anwachsenden Wohlstand sichern.
Der dritte Entwicklungsschub reagierte auf die Kapitalismuskritik der 1960er- und 1970er-Jahre unter der kulturellen und politischen Hegemonie sozialdemokratischer Parteien, die erst in den Erdölpreiskrisen angesichts wachsender Massenarbeitslosigkeit und zunehmender Ineffektivität keynesianischer Globalsteuerung in den späten 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre zu Ende geht.
Die Verbindung eines dynamischen Kapitalismus mit sozialer Beteiligung nicht nur der Arbeitnehmerschaft, sondern der Bürgerschaft als Ganzer sicherte dem liberalen Ordnungsmodell eine hohe Attraktivität gegenüber dem wirtschaftlich zunehmend ineffizienten zentralstaatlichen Sozialismus der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten. Weniger eindeutig fällt der Vergleich in damaligen Entwicklungsländern aus: Der Radikal-Kommunismus chinesischer Prägung konnte sich auch ökonomisch gut gegenüber der Demokratie Indiens behaupten. Während die Systemkonkurrenz des industrialisierten Ostens mit dem industrialisierten Westen in der Nachkriegszeit immer einseitiger wurde, galt dies nicht in gleichem Maße für den Globalen Süden.
Unterdessen sind der Verbindung liberaler Freiheitsrechte mit Kapitalismus und Sozialstaatlichkeit im Westen, insbesondere in Nord- und Mitteleuropa, Konkurrenzmodelle erwachsen, etwa in Gestalt der gelenkten Demokratie Singapurs oder der aufstrebenden Weltmacht China. Singapur hat gezeigt, dass eine effiziente Staatlichkeit auch ohne individuelle Freiheitsrechte möglich ist und dass sich ein kleines Land ohne Rohstoffe mit hohen Bildungsstandards und funktionierender Sozialstaatlichkeit gegenüber allen Konkurrenten der Region hervorragend behaupten kann. Auch wenn das Bruttoinlandprodukt pro Kopf in China immer noch weit hinter dem Durchschnitt europäischer Länder oder der USA zurückliegt, sind doch viele aus dem Westen von der Effizienz staatlichen Handelns und der Dynamik der kapitalistischen Entwicklung in Shanghai oder Peking und anderen chinesischen Metropolen beeindruckt. Jedenfalls scheint der Siegeszug der demokratischen Staatsform zunächst in Europa, dann in Südamerika, schließlich in Teilen Afrikas gestoppt zu sein. Länder, die auf einem guten Weg zur Demokratie schienen, wie die Türkei, fallen in autokratische Muster zurück, andere, die als Transformationsgesellschaften galten, wie Russland oder Belarus und andere vormalige Sowjetrepubliken, versuchen, ökonomische Dynamik ohne liberale Freiheitsrechte zu realisieren, teilweise erfolgreich.
Auch in der islamischen Welt ist die Attraktivität, die das westliche Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell zumindest in den Metropolen über Jahrzehnte hinweg ausstrahlte, geschwunden. Im sogenannten Arabischen Frühling Anfang der 2010er-Jahre schien kurzzeitig die Option einer Liberalisierung von Staat und Gesellschaft auf, entpuppte sich dann aber als eine Art Fata Morgana, getragen nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung, überwiegend aus der jüngeren Generation und den gebildeten städtischen Mittelschichten. Die Alternative zur ägyptischen Militärdiktatur, über drei Jahrzehnte mit ruhiger und harter Hand von Husni Mubarak geführt, war dann nicht, wie vom Westen erwartet, eine liberale Demokratie, sondern die Muslimbruderschaft: durch einen überwältigenden Wahlerfolg im Jahr 2012 legitimiert und angeführt von Mohammed Mursi, der bereits ein Jahr später durch einen Militärputsch abgesetzt wurde und 2019 im Gefängnis starb. Als sich die ägyptische Militärdiktatur unter Abdel Fattah al-Sisi neu etablierte, ging ein Aufatmen durch westliche Hauptstädte, obwohl sich die Staatspraxis unter al-Sisi von der Mubaraks nur unwesentlich unterscheidet.
Während der Islamismus in der arabischen und generell in der muslimischen Welt zu einer starken kulturellen und sozialen, zunehmend auch zu einer politischen Kraft geworden ist, hat er in den westlichen Demokratien zum Wiedererstarken von Nationalismus, Antisemitismus und Antiislamismus einen wesentlichen Beitrag geleistet. Die Tatsache, dass ein Gutteil islamistisch motivierter terroristischer Akte als Homegrown Terrorism bezeichnet werden kann, erschwert die Lage, denn damit wird deutlich, dass sich die Integrationserwartungen, die an die Einwanderung geknüpft waren, zu einem wesentlichen Teil nicht erfüllt haben. Die späte Radikalisierung von Eingewanderten, manchmal auch erst in der zweiten oder gar dritten Generation, zeigt, dass die kulturellen Integrationskräfte der liberalen westlichen Gesellschaft erlahmt sind. Das Anpassungsbedürfnis und die Anpassungsbereitschaft der Eingewanderten waren in früheren Jahrzehnten sowohl in Nordamerika als auch in Westeuropa weit stärker ausgeprägt. Oft gibt es daher in den Familien mit Migrationshintergrund einen Generationenkonflikt, bei dem Eltern die Werte und Normen der liberalen Gesellschaft, in die sie einmal eingewandert sind, gegenüber ihren Kindern verteidigen müssen. Diese verschaffen sich ein neues Selbstbewusstsein, indem sie sich von der Umgebungskultur, von der sie sich unzureichend respektiert fühlen, absetzen und sich oft genug radikalisieren, in seltenen, dann aber umso erschreckenderen Fällen bis zu terroristischer Gewaltbereitschaft.
Die erschöpfte Integrationskraft der liberalen westlichen Gesellschaften hat vor allem eine soziale Dimension, aber auch eine kulturelle, und zwar insofern, als auch die liberalen Gesellschaften des Westens ohne einen zivilen Grundkonsens der alltagskulturellen Praktiken, entgegen einer liberalistischen Illusion, nicht auskommen. Um dies an einem konkreten Beispiel zu illustrieren: Die Gleichberechtigung von Mann und Frau hat heute Verfassungsrang in allen liberalen Gesellschaften. Diese Verfassungsnorm schlägt sich in Antidiskriminierungsgesetzen, im Familienrecht, in zahlreichen einzelgesetzlichen Normierungen nieder. Diese sind zweifellos wichtig, um die Gleichberechtigung von Mann und Frau staatlich abzusichern. Zugleich aber kann kein Zweifel bestehen, dass die Realisierung dieser Verfassungsnorm nur möglich ist, wenn sie von einer geteilten kulturellen Praxis und einem normativen Grundkonsens getragen ist. Wenn Mädchen dazu angehalten werden, ihren Brüdern gegenüber unbedingten Gehorsam zu leisten, ihre Haare schamhaft zu verhüllen und in Anwesenheit von Männern nicht zu sprechen, dann erfolgt dies in der Regel ohne Gesetzesbruch und ohne strafrechtliche Sanktion. Ja, eine liberale Grundordnung muss sehr zurückhaltend darin sein, Gesetzesnormen zu schaffen, die in solchen Fällen die Intervention des Strafrechts vorsehen. Das Erziehungsrecht der Eltern, die Wahrung der Privatsphäre, die kulturelle Neutralität des Staates und andere Grundnormen der liberalen Ordnung stünden hier im Feuer. Zugleich aber kann kein Zweifel bestehen, dass eine derartige Erziehungspraxis mit der Realisierung der Gleichberechtigung von Mann und Frau unverträglich ist.
Wenn sich die Hoffnung zerschlägt, dass die Anpassung an die kulturellen Praktiken der aufnehmenden Gesellschaft ausreicht, um eine geteilte Alltagskultur und den normativen Grundkonsens der Gleichberechtigung zu realisieren, dann erodiert die liberale Ordnung von innen heraus. Wenn die Zahlen groß genug sind, handelt es sich nicht mehr um marginale Phänomene, sondern um eine Veränderung der kulturellen Verfasstheit der Gesellschaft als Ganzer. Wenn es die Mädchen in den Schulen vermeiden, sich selbstbewusst und körperbetont zu kleiden, weil sie dann von präpotenten Machos als »Schlampen« herabgewürdigt werden, dann ist die liberale Ordnung im Inneren gefährdet, auch wenn die Rechtsnormen selbst und ihre Durchsetzung unangetastet bleiben.
Sieg und Verfall
Francis Fukuyama, der konservative US-Intellektuelle, hatte nach dem Ende des Kommunismus in Gestalt von Perestroika und Glasnost sowie der Auflösung der Sowjetunion ein Ende der Geschichte ganz in Hegel’schem Stile angekündigt. Die Menschheitsgeschichte sei nach seiner Auffassung nun in Form der liberalen Weltordnung, einer liberalen Demokratie und eines westlich geprägten Wirtschafts- und Konsumstils an ihr Ende gekommen und habe ihr historisches Telos erreicht: In Zukunft werde es zwar nach wie vor Veränderungen geben, aber keine fundamentalen mehr. Alle Gesellschaften weltweit würden sich früher oder später eine liberale Ordnung geben, sich ihr fügen oder sie sich aneignen. Als ich dieses Buch damals las, hatte ich für diese Einschätzung nur Spott übrig, erschrak aber zugleich über die immense Wirkung in der Öffentlichkeit. Es schien, als sei hier die Selbstüberschätzung des Westens auf den Begriff gebracht worden, als fänden sich die politischen, ökonomischen und kulturellen Eliten in dieser Einschätzung wieder. Und es folgte tatsächlich eine Phase des westlichen Triumphalismus, wie sie noch wenige Jahre zuvor völlig undenkbar geschienen hatte.
Es genügt, hier einige wenige Schlaglichter zu werfen: Die ausgestreckte Hand Michail Gorbatschows, nachdem er mit intellektueller Brillanz, aber wohl auch oft genug ohne langfristigen Plan, den weitgehend friedlichen Übergang von einer zentralstaatlichen, sozialistischen Einparteiendiktatur mit totalitären Zügen zu einer liberalen Demokratie mit freien Wahlen organisiert hatte, wurde nur so lange ergriffen, als dies geopolitisch und strategisch als hilfreich erachtet wurde. Da Gorbatschow an seinen sozialistischen Idealen festhielt und sich der Auflösung aller Staatlichkeit in der vormaligen Sowjetunion entgegenstemmte, schien der robustere, allem Intellektuellen abholde, dem Alkohol dagegen zugetane Boris Jelzin der willkommenere Erfüllungsgehilfe auf dem Wege zur globalen westlichen liberalen Ordnung zu sein. Das Ergebnis war eine Phase des entfesselten Manchester-Kapitalismus, allerdings unter Beteiligung vormaliger, nun zu Milliardären mutierter Mitglieder der Nomenklatura und durchsetzt mit mafiösen und nepotistischen Strukturen. Diese Form der Transformation zerschlug nicht nur die Reste der aus den Zeiten der Sowjetunion hinübergeretteten Staatlichkeit, sie erlaubte zudem einigen wenigen, auf mehr oder weniger legalem Wege zu immensem Reichtum zu gelangen, während ein Teil der Bevölkerung verarmte. Seitdem wird die Verwestlichung als »Liberalisierung« in den Ländern der vormaligen Sowjetunion weithin mit enthemmtem Kapitalismus und staatlichem Chaos identifiziert. Dies erklärt den raschen Aufstieg von Putin in der Nach-Jelzin-Ära, da er als Ordnungsfaktor wahrgenommen wurde und einer Mehrheit der Bevölkerung offenbar bis heute unverzichtbar erscheint.
Die immense Machtfülle des russischen Präsidenten hängt mit der Verbindung zweier institutioneller Strukturen zusammen: der des Deep State, wie dies in den USA genannt wird, also der Sicherheitsorgane, des Militärs, der Polizei, des Verfassungsschutzes sowie paramilitärischer Organisationen einerseits und der der orthodoxen Kirche und ihrer Autoritäten andererseits. Es handelt sich um eine Entwicklung nicht nur zur gelenkten Demokratie, sondern auch zur gelenkten Wirtschaft und Kultur. Diese neue alte Form des Autoritarismus schließt zweifellos an zaristische Traditionen an, wird aber auch als Alternative zur liberalen Gesellschaft und der für sie typischen Multikulturalität und Individualisierung gesehen. Interessanterweise trägt die Entwicklung in der Türkei zur Autokratie unter Recep Tayyip Erdoğan ganz ähnliche Züge: auch dort der Rückgriff auf traditionelle Werte und Religion, die Schwächung des Parlamentarismus und der Meinungsvielfalt, die Beschwörung nationaler Größe. Auch dort eine, wenn auch ganz anders gelagerte Reaktion auf den Triumphalismus des Westens.
Der humanitäre Interventionismus des Westens – der NATO, der USA, auch Frankreichs und Deutschlands – ist der zunächst am sympathischsten erscheinende Zug des westlichen Triumphalismus nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Herrschaftssystems. In der Wahrnehmung der ersten Jahre war eine einzige Supermacht nach dem Sieg im Kalten Krieg übrig geblieben, nämlich die USA, die nun in der Lage war, die Welt nach ihren Vorstellungen unter dem Stichwort New World Order neu zu gestalten. Der humanitäre Interventionismus wollte dabei nicht die nationalen Interessen der USA, sondern die humanitären der Weltgemeinschaft zugrunde legen. Insbesondere sollten mit unterschiedlichen Formen der Intervention massive Menschenrechtsverletzungen abgestellt und Regime gestürzt werden, die ihre Macht durch Folter und Terror absichern. Um dieser Politik eine internationale völkerrechtliche Basis zu verschaffen, mussten die Gewichte innerhalb der Charta der Vereinten Nationen deutlich verschoben werden. Konzipiert war die Charta als ein System kollektiver Sicherheit, das die Souveränität der Nationalstaaten – demokratisch oder undemokratisch verfasst – zum Ausgangspunkt nahm und die einzelnen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen vor den Übergriffen anderer bewahren sollte. Akteur war dabei nicht die Generalversammlung, sondern der Sicherheitsrat, der mit seinen fünf ständigen (und zehn nicht ständigen) Mitgliedern eine Art globale Weltpolizei installierte, die von den Atommächten dominiert war (jede dieser Atommächte hat eine Vetoposition im Sicherheitsrat), was von vornherein ausschloss, dass Entscheidungen des Sicherheitsrates in Konflikt mit den Interessenlagen der Atommächte geraten könnten. Die siegreichen Alliierten des Zweiten Weltkriegs, USA, Russland, Großbritannien und Frankreich, ergänzt durch China, bildeten so eine Art Ältestenrat der Weltpolitik, gegen dessen Willen keine militärische Intervention möglich war. Insbesondere war damit ausgeschlossen, dass die Vereinten Nationen in einen offenen Konflikt zwischen den Supermächten hineingezogen werden konnten. Vor allem die USA und die Sowjetunion, später Russland, nutzten ihre Vetoposition, um sich auch in Fällen eklatanter Menschenrechtsverletzungen schützend vor Verbündete zu stellen.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 zog eine zweite normative Säule der Völkergemeinschaft ein, die Jahrzehnte später zur Grundlage humanitärer Interventionen des Westens, vor allem der USA und der NATO, aber auch einzelner europäischer Staaten wurde.
Noch in den 1950er- und 1960er-Jahren war die westliche Moderne in den Metropolen der arabischen Welt, auch im Iran oder in der Türkei, hoch angesehen. Dies äußerte sich in einer Orientierung in den urbanen Mittel- und Oberschichten an westlichen Lebensformen, Kleidungsstilen und einer Distanz zu religiösem Fundamentalismus und klerikalen Machtansprüchen. Im Falle der Türkei war diese prowestliche Haltung seit Kemal Atatürk zur Staatsdoktrin geworden, die Türkei etablierte, als eine der ersten Nationen der Welt, das Frauenwahlrecht, forcierte das Bildungswesen und die staatliche Infrastruktur, drängte auch in Gestalt von Bekleidungsvorschriften religiöse Sitten und Gebräuche zurück, war allerdings nicht in der Lage, diese neue nationale Identität inklusiv zu gestalten und die große Minderheit der Kurden in dieses Projekt zu integrieren. Dieses Experiment wurde vom Westen in seiner Bedeutung nicht oder jedenfalls zu spät erkannt: eine im Ganzen an europäischen Idealen orientierte Staatsverfassung in einem überwiegend muslimisch geprägten, außerhalb der großen Städte stark religiösen Land.
In der gesamten muslimisch geprägten Region scheint es angesichts der verlorenen Attraktivität des liberalen Ordnungsmodells des Westens nur zwei stabile politische Optionen zu geben: eine islamistische, wie sie die Taliban in Afghanistan, die Mullahs im Iran oder die Muslimbruderschaft in Ägypten realisierten, oder eine antiislamistische, von Militär und Ordnungskräften gestützte diktatorische, wie unter Mubarak und jetzt al-Sisi in Ägypten, unter Assad in Syrien, unter Hussein im Irak. Die leitende Idee westlicher Militärinterventionen, dass der Sturz von Diktatoren in der MENA-Region (Middle East and North Africa) eine Eigendynamik Richtung liberale Demokratie auslösen würde, ist jedenfalls so gründlich enttäuscht worden, dass man diese Vorstellung auf absehbare Zeit als unrealistisch aufgeben sollte.
Auf Betreiben insbesondere Frankreichs intervenierte der Westen gegen das libysche Militärregime von Muammar al-Gaddafi, und die Prophezeiung des langjährigen Diktators wurde wahr: Der Westen bombte auf diese Weise islamistischen Terroristen von Al-Qaida, Al-Nusra-Front und anderen nahestehenden Kräften den Weg frei, um in der Region Einfluss zu nehmen. Die bittere, für liberal Gesinnte schwer verdauliche Erkenntnis lautet: Unter den aktuellen kulturellen Bedingungen der MENA-Region führt der Einfluss der Bevölkerungsmehrheit, ungefiltert durch gewachsene demokratische Institutionen und eine freie, differenzierte Presselandschaft, meist zur Vormachtstellung islamisch-fundamentalistischer Bewegungen und Parteien, die das für die liberale Demokratie so zentrale Prinzip der Trennung von Staat und Religion ablehnen. So schwer es fällt, das zu akzeptieren: Die normativen Fundamente der Baath-Regime, auch des Najibullah-Regimes in Afghanistan nach dem erfolglosen Einmarsch der Sowjetunion, oder auch der Monarchien in Jordanien oder Marokko, stehen den normativen Prinzipien einer liberal verfassten Demokratie weit näher als das Mullahregime des Iran, der saudische Feudalismus, die Taliban, von Al-Qaida und Al-Nusra-Front oder Hisbollah ganz zu schweigen. Der Flirt des Westens mit dem Islamismus zur Bekämpfung der Sowjetunion – zunächst in Afghanistan und dann zur Bekämpfung des sowjetischen Einflusses im gesamten arabischen Raum – war und ist ein totaler Fehlschlag. Der Westen hat damit potenzielle Bündnispartner vor den Kopf gestoßen und die Natter genährt, die ihn nun beißt.
Die Terrormilizionäre des HTS, ursprünglich ein Ableger von Al-Qaida, wurden im Spätherbst 2024 in wenigen Tagen zu Freiheitskämpfern umetikettiert, die das syrische Volk von einem Machthaber erlösten, der seinerseits einen blutigen Kampf gegen das eigene Volk geführt hatte. Es ist eine Tatsache, dass Alawiten, Drusen, Christen und Juden in Syrien das Assad-Regime über Jahrzehnte für das geringere Übel hielten und stützten, angesichts der einzig realistischen Alternative eines fundamentalistischen muslimischen Gottesstaates oder eines Kalifats, wie es der IS im Irak und in Syrien einrichten wollte. Der blutige und rücksichtslose Krieg des alawitischen Regimes galt in erster Linie seinen islamistischen dschihadistischen Gegnern. Die vor Baschar al-Assad nach Deutschland Geflüchteten gehörten zu großen Teilen diesem Milieu an, eine beunruhigende Tatsache, die in der Flüchtlingskrise 2015/16 gerne übersehen wurde. Schon damals mahnten Kenner des Nahen Ostens, genau hinzusehen, wer da bei uns Aufnahme suchte. Die folgende lange Serie von Attentaten, Amokläufen, Messerattacken und Terroranschlägen zeigte, wie berechtigt die damals ungehörten Sorgen waren.
Selbst das Niederringen des in der Welt arabischer Feudalregime verhassten Saddam Husseins oder Muammar al-Gaddafis hat dem Westen in der Region keinerlei Sympathien eingebracht. Das unausgesprochene Bündnis George W. Bushs mit Saudi-Arabien im Vorfeld des zweiten Irakkriegs 2003 hat die radikalisierte Jugend in den arabischen Ländern erst recht gegen den großen Feind aufgebracht – der kleine Feind vor Ort, die Feudalregime der Golfregion, erscheint seitdem als das kleinere Übel.
Man kann das auch zugespitzter formulieren: Der humanitäre Interventionismus des Westens ist, jedenfalls was die MENA-Region zwischen Libyen und Afghanistan angeht, auf ganzer Linie gescheitert. Die Chance, liberale Werte in dieser Region zu etablieren, die in den 1950er- und 1960er-Jahren noch bestand, beschränkt sich unterdessen auf Länder wie Tunesien, vielleicht eines Tages auch wieder auf die Türkei. Kleine Pflänzchen der Hoffnung in einer Wüste des Fundamentalismus, Dschihadismus und Feudalismus. Die MENA-Region ist für die liberale Weltordnung, was immer man im Detail darunter verstehen mag, auch aufgrund eigenen Verschuldens des Westens auf absehbare Zeit verloren.
Die Erosion sozialer Marktwirtschaft
Die Rede vom Sieg der liberalen Weltordnung war in den späten 1980er- und dann in den gesamten 1990er- und frühen Nullerjahren nicht mehr von den Grundgedanken der sozialen Marktwirtschaft, sondern von denjenigen Milton Friedmans und Friedrich August von Hayeks, also eines marktradikalen Programms des Staatsabbaus und der Globalisierung geprägt. Der sogenannte Washington Consensus formulierte diese neue Interpretation der liberalen Weltordnung.
Der Terminus Washington Consensus wurde erst seit einer Konferenz in Washington, D. C., im Jahr 1990 üblich, und der Ökonom John Williamson, der ihn verwendete, wehrte sich dagegen, den Washington Consensus als Zusammenfassung einer marktradikalen oder marktfundamentalistischen, neoliberalen Programmatik zu verstehen. Er selbst habe diese Empfehlungen, die die Politik des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank, auch der US-Regierungen seit Ronald Reagan und zahlreicher US-amerikanischer Thinktanks und Interessenvertretungen der Wirtschaft prägten, jedenfalls nicht in diesem Sinne gemeint. Der Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz kam in seiner Kritik an der Politik des IWF zunächst zu einem differenzierten Urteil, wonach der Fehler nicht so sehr die Leitlinien gewesen seien, sondern ihr einseitiger Einsatz in den Krisenstaaten Lateinamerikas. Die Beurteilung fällt jedoch insgesamt sehr kritisch aus. Der Washington Consensus war darauf gerichtet, eine Alternative zu staatszentrierten und sozialistischen Politikentwürfen zu formulieren. Er versuchte, kurz nachdem Ronald Reagans Präsidentschaft zu Ende gegangen war und George Bush Senior einen stärker konsensorientierten Politikstil praktizierte, die wirtschaftlichen Eliten der USA für die Kooperation mit den lateinamerikanischen Eliten zu gewinnen und zu diesem Zweck gemeinsame Leitlinien zu formulieren, wie fiskalische Disziplin (gegen die wachsenden und teilweise exorbitanten Verschuldungen lateinamerikanischer Staaten), die Umstellung sozialer Leistungen ganz in der angelsächsischen Tradition auf Armenhilfe und Grundversorgung im Bereich Gesundheit und Bildung, Flat Tax, also der Abschied von der Umverteilung durch stark progressive Einkommens- und Vermögensbesteuerung, Handelsliberalisierung, Öffnung für Auslandskapital, Privatisierung staatlicher Leistungen, Deregulierung der Märkte und Garantie von Eigentumsrechten (gegen die Nationalisierung von Unternehmen und die Beschlagnahmung von Privatvermögen). Die leitenden wirtschaftspolitischen Vorstellungen waren also makroökonomische Disziplin, Staatsrückbau und Stärkung der Marktökonomie sowie Öffnung der nationalen Ökonomien gegenüber der Globalisierung.
Sowohl von den Befürwortern des Washington Consensus wie von seinen Kritikern wird heute eingeräumt, dass gerade die lateinamerikanischen Länder, die sich daran orientiert haben, keine der erwarteten entwicklungspolitischen Erfolge aufweisen konnten, ja sogar stärker krisenanfällig wurden. Der für uns interessante Konflikt ist derjenige zwischen den ostasiatischen Entwicklungsstrategien und den lateinamerikanischen. Die Entwicklungsstrategien Chinas, aber auch der sogenannten Tigerstaaten in Ost- und Südostasien, auch Japans in den Jahrzehnten zuvor, stützten sich auf ein hohes Maß an staatlicher Steuerung und Staatsintervention. Der chinesische Entwicklungsweg ist, anders als der russische, nach dem Ende der Sowjetunion weder von einer generellen Öffnung für ausländisches Kapital noch von Wechselkursfreigabe noch von einem generellen Staatsabbau geprägt, war aber insgesamt, ökonomisch gesehen, weit erfolgreicher. Das Davos-Bündnis von 2017 zwischen europäischen Freihandelsbefürwortern und China entbehrt jeder ökonomischen Fundierung, und die breite Akzeptanz ist wohl nur darauf zurückzuführen, dass sowohl in den Reihen der Spitzenpolitiker als auch in den Reihen der journalistischen Kommentatoren ökonomischer Sachverstand nicht weit verbreitet ist. Am Ende ging es vielleicht nur um einen politischen Warnschuss dem neu gewählten US-amerikanischen Präsidenten Trump gegenüber, Missverständnisse als Kollateralschaden in Kauf nehmend. Dies wird sich vermutlich jetzt in der zweiten Amtszeit von Donald Trump nicht wiederholen.
Die neue Programmatik war auch deswegen politisch so erfolgreich, weil der linke Keynesianismus die Stabilitätsorientierung Keynes’ durch ein Programm des kontinuierlichen Staatsausbaus ersetzt hatte. In extremen Positionierungen wurden gar alle Impulse für Wirtschaftswachstum und Produktivitätszuwachs dem staatlichen Deficit Spending zugeschrieben. Dass damit Staaten, Regierungen und andere staatliche Körperschaften ihre Handlungsfähigkeit über kurz oder lang einbüßen und am Ende angesichts deregulierter Finanzmärkte zum Spielball von Spekulanten werden, wie am Beispiel Griechenlands, Portugals, zeitweise auch Spaniens und Irlands vorexerziert, war den Protagonisten dieses Pseudokeynesianismus nicht bewusst. Hohe Staatsverschuldungen sind dann leicht zu verkraften, wenn die Zinslasten nahe null sind, wie sie es in Europa seit den 2010er-Jahren bis in die Post-Covid-Zeit waren. Unterdessen hat sich das geändert, mit der Folge, dass hoch verschuldete Länder massiv steigende Zinslasten zu bewältigen haben, die rasch in eine erneute Staatsschuldenkrise führen können, während Deutschland in der Coronakrise gewaltige Summen bereitstellen konnte, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen einzudämmen, ohne auf Dauer die Maastricht-Kriterien zu verletzen. Die oft, auch aus der Wissenschaft, kritisierte sparsame Haushaltspolitik Deutschlands erwies sich in beiden Krisen, der Weltwirtschafts- wie der Coronakrise, als Segen: Sie gab der Politik den notwendigen Spielraum, um den konjunkturellen Abschwung, ganz im Sinne des originalen, stabilitätsorientierten Keynes, abzufangen. Dazu trug allerdings auch die robuste ökonomische Ausstattung Deutschlands bei, unter anderem auch eine Folge der Agenda-Reformen und des deutschen Systems beruflicher Bildung, das die Jugendarbeitslosigkeit niedrig hält und der mittelständischen gewerblichen Wirtschaft eine gewisse Stabilität gibt, die durch ein Übermaß an Akademisierung, unterlassene Investitionen in die Infrastruktur und die digitale Transformation unterdessen allerdings zunehmend bedroht ist.
Ich halte den Paradigmenwechsel von der sozialen Marktwirtschaft zum Marktradikalismus für einen Rückfall ins 19. Jahrhundert. Zwar lässt sich damit die Marktdynamik erhöhen, zugleich aber sinkt die Inklusion in doppelter Hinsicht: die Inklusion auf den Arbeitsmärkten und die sozialstaatliche Inklusion.
Die empirischen Daten sind eindeutig: Während in den drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg alle, zumal die Arbeitnehmerschaft, vom Wirtschaftswachstum profitierten, änderte sich dies in den USA schon in den 1980er- und in Deutschland und Europa in den 1990er-Jahren. Die USA hatten die noch weit extremeren Daten mit einer Konzentration auf wenige obere Prozent der Bevölkerung und der Abkopplung von rund der Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Wirtschaftswachstum seit Ende der 1970er-Jahre. In Deutschland setzte der Trend zu dramatisch wachsender Ungleichheit erst nach der Wiedervereinigung Mitte der 1990er-Jahre ein und hält dann rund ein Jahrzehnt an, gestoppt erst durch die Agenda-Reformen 2005 und die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt eines Großteils der Transferempfänger. Der Gini-Koeffizient stieg entgegen den öffentlichen Wahrnehmungen nach Inkrafttreten der Arbeitsmarktreformen nicht mehr an, die Ungleichheit der Sekundäreinkommen nahm also in Deutschland nicht mehr zu. Die insgesamt günstige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hatte einen doppelten Preis, nämlich eine Politik des Forderns und Förderns, also die zum Teil sehr restriktiven Kriterien, was Arbeitsunfähigkeit anging, und die generelle Lohnzurückhaltung in den Tarifverhandlungen. Die sinkenden Lohnstückkosten in Deutschland setzten die umgebenen Volkswirtschaften Frankreichs, Italiens, zunehmend auch Großbritanniens unter Druck und verschafften im Verein mit dem Euro, der als Währung angesichts der deutschen Produktivitätsentwicklung unterbewertet war, eine stabile, zunächst überwiegend über Außenhandelserfolge möglich gewordene Entwicklung, die dann auch wieder der Arbeitnehmerschaft in Gestalt von realen Lohnsteigerungen zugutekam. Deutschland wandelte sich vom kranken Mann Europas in den späten 1990er- und frühen Nullerjahren zum Stabilitätsanker und ökonomischen Motor des Euroraums.
In den Jahren der Kanzlerschaft Angela Merkels wurde dieser Kurs allerdings nicht fortgesetzt. Diejenige Politikerin, die einen noch weit radikaleren Umbau von Staat und Wirtschaft in Richtung Liberalisierung noch 2003 gefordert hatte, bediente sich ab November 2005 als Kanzlerin eines moderierenden Politikstils, der scharfe Konturen vermied und wirtschaftspolitisch von den Erfolgen der Agenda-Reformen zehrte. Im Verein mit den koalierenden Sozialdemokraten wurde die Dividende der Arbeitsmarktreformen einem Ausbau der Transferleistungen zugeführt (Mütterrente und Frühverrentung), was zwar die Kritik aus den Gewerkschaften und der Linken nicht milderte, aber die Weichen gegen eine Fortsetzung der von ihrem Vorgänger Gerhard Schröder nur mit Mühe durchgesetzten Politik der ökonomischen Dynamisierung bei weiterhin hohen Sozialleistungen stellte.
Die aktuelle wirtschaftliche Schwäche Deutschlands geht nicht nur auf die Folgen der Coronakrise zurück, auf die wir in Teil B noch ausführlich eingehen, sondern auch auf den abrupten Anstieg der Energiekosten als Folge der Sanktions- und Embargomaßnahmen gegenüber Russland in Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine 2022. Hinzu kommen die teils wenig effektiven, aber oft teuren Maßnahmen zum Klimaschutz, wie etwa die Subventionierung der Anschaffung von Elektroautos, die in der Gesamtbilanz beim aktuellen Energiemix in Deutschland in Bezug auf die Strombereitstellung erst ab einer Fahrleistung von über 90 000 km eine günstigere CO2-Bilanz aufweisen als ein »Benziner«.[2] Das alles führt zu einer langsamen Erosion der internationalen Konkurrenzfähigkeit Deutschlands, zu stagnierender Produktivität und bürokratischer Überregulierung. Auch das in der Vergangenheit international gepriesene Niveau beruflicher Qualifikation hat nachgelassen. Die berufliche Bildung verzeichnet einen Nachwuchsmangel, und auf den Arbeitsmärkten fehlt es an qualifiziertem Personal in vielen Bereichen, was besonders für die mittelständische, technisch-handwerklich ausgerichtete Wirtschaft gilt. Die drei Jahre Ampelregierung bis Ende 2024 haben diese sich schon früh abzeichnenden Probleme nicht gemildert, sondern durch eine ökonomisch rücksichtslose und technologisch uninformierte grüne Agenda verschärft.
Interessant ist, in der globalen historischen Betrachtung, dass ganz unterschiedliche Strategien erfolgreich sein konnten: sehr stark marktorientierte in den USA, teilweise auch in Großbritannien, und eine an sozialen Bürgerrechten orientierte wie in Skandinavien, wie auch die im Wesentlichen auf Kooperation und eigenen vorausgegangenen Leistungen gestützten Sozialstaatssysteme Deutschlands und Frankreichs. Jedenfalls erweist sich die Höhe der Staats- und auch der Sozialstaatsquote nicht als Hemmnis für eine gute Produktivitätsentwicklung und außenwirtschaftliche Erfolge. Jenseits des oben beschriebenen Paradigmenwechsels politischer, ökonomischer und sozialstaatlicher Programmatik zeigen sich die realen Stellgrößen als erstaunlich resistent. So ist weder zutreffend, was von Neokonservativen und Wirtschaftsliberalen immer wieder behauptet wird, nämlich dass eine uferlose Ausweitung der Sozialstaatsquote stattgefunden habe, noch ist die Einschätzung richtig, die von links vorgebracht wird, dass in den letzten Jahrzehnten in Europa der Sozialstaat abgewrackt worden sei. Wir leben in Europa nicht in einem durch und durch von kapitalistischer Marktwirtschaft geprägten System. Die Staatsquote bewegt sich in den meisten europäischen Ländern oberhalb der 40 Prozent und die Sozialstaatsquote zwischen 20 und 30 Prozent. So wird die Infrastruktur nicht vom Markt, sondern vonseiten des Staates mit Steuern und Abgaben finanziert und verantwortet, und auch das Bildungssystem als Ganzes ist überwiegend staatsfinanziert und staatlich verantwortet. Die Regulierungen auf dem Arbeitsmarkt schränken in Europa eine Hire-and-Fire-Politik stark ein. Die neoliberale Agenda hat in den meisten Ländern des Westens nur mäßig gegriffen, sie wurde nur teilweise in die Realität umgesetzt, anders als in manchen Ländern des Globalen Südens, wie zum Beispiel in Chile.
Allerdings hat die Globalisierung, insbesondere der Finanzwirtschaft und der Warenmärkte insgesamt, die sozialen Spannungen in den westlichen, ökonomisch entwickelten Ländern verschärft, und das Programm des Sozialstaatsabbaus hat die Inklusionskraft der sozialen Marktwirtschaft geschwächt. Die Krise der liberalen Weltordnung hängt auch mit diesem Phänomen zusammen: dem Eindruck eines Gutteils der Bürgerschaft, vom Wachstum weitgehend abgekoppelt zu sein. Steigende Aktienbewertungen von Konzernen, die den Abbau von Arbeitsplätzen ankündigen, die Entwicklung der Managergehälter im Vergleich zu denjenigen der Belegschaften insgesamt, die Willfährigkeit gegenüber großen internationalen Konzernen, die Kontrolle der Infrastruktur digitaler Kommunikation und Interaktion durch die Big-Tech-Monopolisten aus dem Silicon Valley, aber auch die sozialen Probleme, die mit der politisch weitgehend unkontrollierten Einwanderung in westliche Industrieländer einhergehen, lassen die normative Basis von liberaler Demokratie und Weltordnung erodieren.
Die größte Herausforderung der liberalen Weltordnung ist der Souveränitätsverlust der Nationalstaaten. Sowohl die wirtschaftliche Globalsteuerung als auch der soziale Ausgleich durch progressive Steuern, soziale Anspruchsrechte und Transferleistungen setzen eine funktionierende Staatlichkeit voraus. Diese legt idealiter die Regeln fest, die auf den ökonomischen Märkten gelten, erhebt Steuern, ohne den Wohlhabendsten Schlupflöcher der Hinterziehung zu bieten, und setzt diese sowohl für kollektive Güter wie für den sozialen Ausgleich sowie für Bildung und Kultur ein.
Die westlichen Demokratien hatten unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und des Niedergangs der Demokratie in Zeiten des Faschismus und Nationalsozialismus eine Renationalisierung durchgesetzt und damit eine Politik der wirtschaftlichen Globalsteuerung begonnen, die die Krisenanfälligkeit mindern und einen sozialen Ausgleich im jeweiligen Land ermöglichen sollte. Damit wurde den Bürgerinnen und Bürgern dieser Länder das Versprechen gegeben, dass sich eine ähnliche Entwicklung, ein ähnlicher ökonomischer Kontrollverlust wie Ende der 1920er-Jahre nie mehr einstellen würde. Dieses Vertrauen ist spätestens seit der zweiten Weltwirtschaftskrise in den späten Nullerjahren erschüttert. Die Zweifel sind seitdem gewachsen, ob die Nationalstaaten überhaupt noch in der Lage sind, die notwendigen Regulierungen der Finanzmärkte und generell der Märkte der Waren und Dienstleistungen durchzusetzen, die verhindern, dass ein entfesselter Kapitalismus zwar zu exorbitantem Reichtum einiger weniger führt, aber einen Großteil zurücklässt und am Ende im großen Crash untergeht. Es dominiert der Eindruck, dass der demokratische Staat in großem Umfang einen Kontrollverlust erleidet, nicht nur aufgrund der Migrantenströme, sondern auch wegen der international agierenden Konzerne und der anonymen Akteure auf den globalen Märkten. Der Rechtspopulismus hat daher mit seiner Botschaft der Rückgewinnung nationaler Kontrolle und der Priorisierung nationaler Interessen viel Resonanz in den westlichen Ländern.
Die allermeisten Menschen sind in ihrer Lebensform keine Globalisten, sie leben nicht mal hier, mal dort auf diesem Globus und bedienen sich als Verständigungssprache des globalen Englisch. Vielmehr sind sie, wie zahlreiche soziologische Studien belegen, regional, ja oft genug lokal verwurzelt und erwarten von den staatlichen Institutionen, gegenüber unvorhersehbaren Entwicklungen auf den Weltmärkten geschützt zu werden und als Bürgerinnen und Bürger eines Staates unveräußerliche, auch soziale Rechte zu besitzen.
Oft beginnen die rechtspopulistischen und nationalistischen Formationen im Umfeld des Liberalismus, wie etwa bei der FPÖ in Österreich, bei Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid (PVV) in den Niederlanden oder bei der AfD unter Bernd Lucke in Deutschland, um sich dann vom Liberalismus abzuwenden und die nationalistische Agenda mit einer Verteidigung des Sozialstaats zu verbinden, was unter anderem zur Folge hat, dass die internationalistisch orientierte Linke einen Teil ihrer Wählerbasis einbüßt. Das programmatische Versagen der liberalen Weltordnung besteht darin, diesen Widerspruch zwischen einer Globalisierung der Waren- und Dienstleistungsströme und zunehmend auch des Arbeitsmarktes auf der einen und der demokratischen Gestaltungskraft von Nationalstaaten auf der anderen Seite kaum thematisiert, jedenfalls nicht in ein kohärentes Gesamtbild überführt zu haben. Die Spannung zwischen kosmopolitischer Liberalität und demokratischer Souveränität hat massiv zugenommen.
Man kann es auch anders, philosophischer, formulieren: Der im Liberalismus von Anbeginn angelegte Widerspruch zwischen der Befreiung des Individuums und der kollektiven Gestaltung der Lebensbedingungen bricht heute mit Macht auf. Die Befreiung des Einzelnen, einschließlich der einzelnen Produzenten auf globalen Märkten, gerät in Konflikt mit der Idee der demokratischen Gestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, dem Kernanliegen sozialer Marktwirtschaft. Mehr noch: Kollektive und individuelle Autonomie treten auseinander und führen zu einer tiefen Krise der Demokratie.