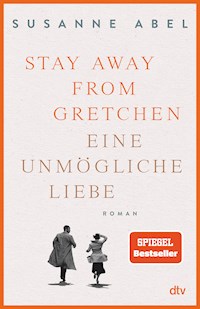10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Gretchen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wer ist Familie? Nach dem Nr. 1-SPIEGEL-Bestseller ›Stay Away From Gretchen‹ nun der zweite Roman der Ausnahmeautorin Tom Monderath ist frisch verliebt: Mit Jenny erlebt er die glücklichste Zeit seines Lebens. Bis er durch Zufall auf seinen Halbbruder Henk stößt, der alles über ihren gemeinsamen Vater wissen will. Doch Konrad starb vor vielen Jahren und seine demente Mutter Greta kann Tom nicht befragen. Als sich weitere Halbgeschwister melden, wird es Tom zu viel. Jenny und Henk hingegen folgen den Spuren Konrads. Selbst fast noch ein Kind, kämpfte Toms Vater im Krieg, geriet in amerikanische Gefangenschaft, bevor er in den späten 40er-Jahren nach Heidelberg kommt. Dort verliebt er sich Hals über Kopf in die junge Greta, nicht ahnend, dass ein Geheimnis aus der dunkelsten Zeit des Nationalsozialismus ihre gemeinsame Familie ein Leben lang begleiten wird ... Ein spannender und berührender Roman über Liebe, Verlust, zweite Chancen und die Sprengkraft des Schweigens – sowie über trügerische Gewissheiten und die Frage, was Familie zusammenhält. »Abel schreibt unterhaltsame, sogar humorvolle Romane aus dem Elend, in das wir alle hineingeboren werden, ohne es uns aussuchen zu können. Chapeau!« Stern »Eine seltene literarische Perle. Die Geschichte von Toms und Gretchens Familie sollte Schullektüre werden!« WDR Alle Bände der ›Gretchen‹-Reihe: Band 1: Stay away from Gretchen – Eine unmögliche Liebe Band 2: Was ich nie gesagt habe – Gretchens Schicksalsfamilie Lesen Sie auch »Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104«, den berührenden neuen Roman von Susanne Abel über die lebenslange Liebe zweier Heimkinder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Tom Monderath ist frisch verliebt: in Jenny und auch in deren vier Monate altes Söhnchen Carl. Nach Jahren, in denen er sich nur seiner Karriere beim Fernsehen gewidmet hat, erlebt er mit ihnen die glücklichste Zeit seines Lebens. Bis Henk van Dongen in Köln auftaucht – sein sieben Jahre älterer Halbbruder, auf den Tom durch Zufall über eine DNA-Suche gestoßen ist. Tom ist ratlos und wütend zugleich: Was hat sein Vater Konrad vor ihm und seiner Mutter verborgen? Konrad kann Tom nicht mehr befragen, er ist vor vielen Jahren gestorben, Greta ist dement und lebt in ihrer eigenen Welt. Tom macht sich auf die Suche nach Spuren seines Vaters und stößt auf einen kleinen Jungen, der seine Familie im Krieg verlor und erst als junger Medizinstudent in Heidelberg mit Greta Liebe und Zukunft fand. Bis die Schatten der Vergangenheit die beiden einholen. Wird es Tom gelingen, das Schweigen zu brechen und die Geschichte seiner Familie zusammen mit Jenny und Henk neu zu schreiben?
Ein spannender und berührender Roman über Liebe, Verlust, zweite Chancen und die Sprengkraft des Schweigens
Von Susanne Abel ist bei dtv außerdem erschienen:
Stay away from Gretchen. Eine unmögliche Liebe
Susanne Abel
Was ich nie gesagt habe
Gretchens Schicksalsfamilie
Roman
Für Gudrun Schönherr und Thomas Abel,
meine Geschwister, die ich nie kennenlernte
»Es gibt keine Geheimnisse,
die die Zeit nicht irgendwann offenbart.«
Jean Racine, Britannicus (1669)
EINS.
Sommer 2016
»Gorilla! Das ist die Entdeckung des Sommers«, sagt Tom. Er lässt das Eis aus siebzigprozentig geschmolzener Schokolade, das Jenny ihm zum Probieren gegeben hat, in seinem Mund schmelzen und gibt ihr einen schokoladigen Kuss.
Dabei ist sie für ihn die Entdeckung dieses Sommers, denkt er, schiebt den Kinderwagen, in dem Jennys zehn Wochen altes Baby Carlchen schläft, und schlendert mit den beiden in Richtung Friedenspark. Wie so oft plaudert Jenny pausenlos vor sich hin, als könne sie gar nicht für sich behalten, was sie alles weiß. »Wusstest du, dass dieser Weg nach einem kleinen Jungen benannt wurde, der hier von der Hitlerjugend zu Tode getreten worden war?«
Hans-Abraham-Ochs-Weg, liest Tom auf dem Straßenschild, beißt von seiner Eiswaffel ab und schüttelt den Kopf.
»Wusstest du, dass es hier im Park ein Denkmal für John Lennon gibt?«
Bevor Tom antworten kann, führt sie ihn durch die zu einem Rosengarten umgestaltete Festungsmauer zu dem vier Meter Durchmesser großen Rund, in dem Lennons Friedenssong von 1971 mit Marmor eingelassen wurde. »Das wurde an seinem 32. Todestag eingeweiht.«
Carlchen meldet sich und hat ganz offensichtlich Hunger. Sie setzen sich im Schatten auf eine Bank, und während Jenny den Kleinen stillt, hat Tom dieses Imagine im Ohr. Er hätte sich niemals vorstellen können, sich derart zu verlieben. Und schon gar nicht in sie. In Jenny, diese Enzyklopädie auf zwei Beinen, mit der er seit Jahren zusammenarbeitet, und die ihm mit ihrem nerdigen Ständig-alles-wissen-und-erzählen-Müssen immer auf die Nerven gegangen war. Und dann hat ihn völlig überraschend der Blitz getroffen, so kitschig wie in jedem blöden Hollywoodfilm – und alles ist anders. Zack! Alles! Was vorher kacke war, ist plötzlich toll. Vor allem an ihr. Aber auch an dieser Kölner Südstadt, um die er eigentlich immer einen Bogen gemacht hat. Er überlegt, ob das mit seinem Vater zu tun haben könnte, denn der ist als Kind hier aufgewachsen und hat ihm einmal davon erzählt.
Stopp, denkt Tom und hört Carlchen schmatzen und schlucken. Er will nicht schon wieder an seinen Vater denken. Er will hier sein. Neben Jenny. In der Gegenwart und nicht in der bescheuerten Vergangenheit. Aber es gelingt ihm nicht, denn sein verstobener Vater hat sich vor ein paar Wochen in seine Gedanken gefressen, und nun wird er ihn einfach nicht mehr los.
Über ein Ahnenforschungsportal hatte Tom einen DNA-Test gemacht, um Nachforschungen über seine mütterliche Linie anzustellen. Dabei bekam er die verschlüsselte Nachricht: halfbrother match. Und zwar gleich doppelt. Die Auswertung war klar: väterlicherseits. Noch ein Familiengeheimnis, dachte Tom damals. Mit einer dementen Mutter und Problemen im Job war sein Leben kompliziert genug. Da brauchte er nicht auch noch vermeintliche Halbbrüder.
»Bist du denn gar nicht neugierig?«, hatte Jenny, über deren Account die Nachforschungen veranlasst worden waren, ihn gefragt.
»Nein«, antwortete Tom. Und dennoch schoben sich Gedanken an die unglückliche Ehe seiner Eltern immer wieder in den Vordergrund. Es wunderte ihn nicht, dass sein Vater Konrad offensichtlich mindestens zwei Geliebte gehabt hatte. Aber sich mit den Ergebnissen dieser Liebschaften zu befassen, das passte ihm nicht in den Kram. Er wollte lieber in der Gegenwart bleiben und seine eigene neue Liebe genießen. Deshalb hat er bis jetzt nicht auf das Ergebnis reagiert.
»Lies mal«, sagt Jenny nun ein paar Tage nach ihrem gemeinsamen Eisessen und dreht ihm ihren Laptop hin.
Über das Ahnenforschungsportal ist eine verschlüsselte E-Mail eingegangen.
Mein Name ist Henk van Dongen. Ich bin 1964 geboren, lebe in Amsterdam und habe vor Kurzem durch Zufall erfahren, dass der Mann, den ich immer für meinen Vater gehalten habe, offensichtlich nicht mein Vater ist. Nach dem Ergebnis des DNA-Tests scheinen wir denselben Erzeuger zu haben.
Erzeuger! Seltsamer Begriff, denkt Tom und hat, obwohl er es nicht will, wieder ein eventuelles Doppelleben seines Vaters vor Augen. Trotzdem reagiert er nicht auf das Schreiben des fremden Holländers.
Doch der gibt nicht auf. Und schickt kurze Zeit später ein Foto hinterher.
»Jetzt wird es langsam unheimlich«, sagt Jenny und zeigt ihm das Bild.
Tom spürt, wie seine Knie weich werden. Er muss sich setzen. Denn ihm ist, als würde er in einen Spiegel schauen. Nur, dass sein grinsendes Ebenbild einen Bart rund um den Mund trägt – einen Henriquatre – und etwas faltiger ist. »Krass!«
Es dauert keine halbe Stunde, dann haben Tom und Jenny alles über den sechs Jahre älteren Henk van Dongen herausgefunden. In Zeiten von Instagram und Facebook ist das einfach. Für ihn als Journalisten sowieso. Und erst recht für Jenny, die Recherche-Queen. Weil er weiter anonym bleiben will – und damit Henk ihn nicht umgekehrt ausspionieren kann –, legt Tom einen extra E-Mail-Account an, ändert seinen Vornamen zu Theo und verwendet als Familiennamen den Geburtsnamen seiner Mutter: Schönaich. Trotz der phänomenalen Ähnlichkeit lässt er die DNA noch einmal in einem deutschen Labor abgleichen. Vielleicht auch nur, um Zeit zu schinden. Die 99,9-prozentige Bestätigung überrascht ihn nicht. Dennoch will er auf Abstand bleiben und schlägt Henk vor, dass man sich ja im Laufe des Sommers einmal in Holland treffen könne. Unverbindlich.
»Klar«, schreibt dieser zurück und bittet um ein Foto.
»Mam, wo hast du eigentlich die Kinderbilder von mir?«, fragt Tom beim nächsten Besuch bei seiner Mutter Greta.
»Bilder? Das weißt du doch«, sagt sie und beißt in das Croissant, das er ihr mitgebracht hat.
Tom muss schmunzeln, denn er hat sie durchschaut. Seitdem sie an Alzheimer erkrankt ist und sogar Alltäglichkeiten vergisst, hat sie eine Antworttechnik entwickelt, die sie immer gut dastehen lässt und bei der kein Außenstehender auf die Idee käme, dass etwas mit ihr nicht stimmt.
Tom sucht im früheren Büro seines Vaters und in seinem ehemaligen Kinderzimmer. Vergeblich. Im Wohnzimmer schließlich findet er in der Schublade des Wandschranks stapelweise unsortierte Fotos. Er wühlt, findet Bilder seiner Eltern in Brüssel, wo sie anlässlich der Weltausstellung 1958 waren.
»Da warst du noch jung«, sagt Greta, die, neugierig geworden, neben ihm steht und ihm das Foto aus der Hand nimmt.
»Du bist lustig. Da war ich noch Quark im Schaufenster. Das war 12 Jahre vor meiner Geburt.«
»Du weißt auch nicht immer alles besser, Konrad.«
»Mam. Ich bin doch nicht Konrad, sondern Tom.«
»Ich bitte dich!«, antwortet Greta empört.
Sie zieht ein Foto, das Tom am ersten Schultag mit einer Schultüte zeigt, aus dem Stapel. »Schau mal. Unser Thommy.«
»Ich bin doch dein Thommy, Mam.«
»Konrad. Ich bitte dich!«, sagt sie empört.
Tom nimmt das Bild an sich und spürt, wie sich der Boden unter ihm auftut, weil Greta weiter darauf besteht, dass er nicht ihr Sohn, sondern ihr Ehemann ist.
Mit überhöhter Geschwindigkeit fährt er Richtung Innenstadt. Er rast nicht nur, weil er vor seinen Gefühlen davonfahren will. Die zunehmende Verwirrtheit seiner Mutter Greta geht ihm unter die Haut. Seit ihre Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert wurde, hat er gelernt, damit umzugehen. Doch dass sie offensichtlich nicht mehr weiß, wer er ist, schmerzt ihn bis ins Mark.
Er schickt Henk das Schulfoto. Keine zwei Tage später überfällt der ihn damit, dass er am 1. Juli nach Köln kommt – geschäftlich. Tom wundert sich, welche Geschäftstreffen ein Intensivpfleger aus Amsterdam im Rheinland hat, kann jedoch nicht nachfragen, ohne dass Henk erfährt, was er schon alles über ihn weiß.
Erst will Tom antworten, dass er leider verreist ist, doch Jenny überzeugt ihn, die Angelegenheit nicht weiter aufzuschieben, und so lässt er sich auf ein Treffen ein und schreibt Henk, dass er ihn am Bahnhof abholen wird.
Weil er zu spät dran ist und man wie immer vor dem Deutzer Bahnhof vergeblich nach einem Parkplatz sucht, stellt er den Wagen im Halteverbot ab und hetzt durch die Eingangshalle. Außer Atem kommt er auf dem Bahnsteig an.
»Achtung bitte auf Gleis 11. Die Ankunft des ICE 129 aus Amsterdam verzögert sich um fünfzehn Minuten. Grund dafür ist eine Betriebsstörung.«
Tom rückt sein Baseballkäppi zurecht, holt tief Luft und überlegt, ob er kehrtmachen und seinen Wagen umparken soll.
»Herr Monderath?« Eine schrille Stimme unterbricht seine Gedanken.
Vor Tom hat sich eine vielleicht fünfundfünfzigjährige Fremde mit einem bändchengeschmückten Rollkoffer und einer Vorliebe für Pink, kurze Röcke und Sonnenstudios aufgebaut. Er verzieht sein Gesicht zu einem Lächeln, denn er ist es gewohnt, erkannt zu werden. Schließlich moderiert er seit Jahren die Hauptnachrichten bei FFD, einem großen deutschen Fernsehsender.
»Und ich hab noch zu meiner Annita gesagt: ›Das issa, sach ich.‹ Aber sie hat gesagt: ›Nee!‹ Und jetzt sind Sie es doch …«
Kichernd steht plötzlich auch die erwähnte Freundin neben ihr, schaut an Tom hoch, als wäre er das siebte Weltwunder, zückt ihr Smartphone und fragt, ob sie ein Selfie mit ihm machen können.
»Klar.« Tom tritt zwischen die beiden Damen, geht ein wenig in die Knie, um mit ihnen auf einer Höhe zu sein, und lächelt routiniert in Annitas Handy.
»Ich hoffe, Sie kommen bald zurück. Geht es Ihnen denn wieder gut?«, sagt die Braungebrannte, die der Aussprache nach dem Kölner Uradel entstammt, und tätschelt seinen Arm.
»Ja, klar«, antwortet Tom und will nur noch weg, bevor sich auch die umstehenden Reisenden Gedanken über ein Selfie mit ihm machen.
»Kann ich vielleicht ein Autogramm haben?«, fragt Annita.
»Tut mir leid, aber ich hab keine Autogrammkarten dabei.«
Im nächsten Moment streckt sie ihm einfach ihren Reiseproviant entgegen, den sie in einer Metzgerei erstanden hat, und kichert nervös. »Sie sehen in natura übrigens viel besser aus als im Fernsehen. Also Ihre Augen … ich hätte nicht gedacht, dass die so blau sind.«
Tom lächelt gequält, schreibt Alles Gute, Tom Monderath auf den Schweinekopf und wünscht den beiden Freundinnen, von denen er mittlerweile weiß, dass sie übers verlängerte Wochenende nach Malle fliegen, einen schönen Urlaub. Er entschuldigt sich, sagt, dass er dringend telefonieren müsse, und macht auf dem Absatz kehrt.
»Und alles Gute für Ihre Gesundheit!«, ruft ihm da Annita laut hinterher.
Tom fingert nach seiner Sonnenbrille, schiebt die Baseballkappe tiefer ins Gesicht und geht Richtung Gleisende, wo keine Menschen stehen.
Alles Gute für Ihre Gesundheit! Das ist nett gemeint, aber er kann es nicht mehr hören. Früher hat er die Begegnungen mit seinen Zuschauern immer genossen. Aber das ist vorbei, seit alle über seine Gesundheit reden und ihn mitleidig anschauen.
PANIKATTACKE! Die ›Bild‹-Zeitung hat ihm diese Diagnose bescheinigt, als Tom vor zwölf Wochen während seiner Nachrichtensendung eine Art Schwächeanfall hatte. Live. Und ganz Deutschland hat zugeschaut. Als DAS DRAMA UM TOM MONDERATH wurde das Thema medienwirksam ausgeschlachtet, in höchstpeinlicher Betroffenheit. Plötzlich schien es geradezu en vogue zu sein, jemanden zu kennen, der mindestens einen kannte, der auch unter Panikattacken litt.
Nur er, der Hauptakteur, äußerte sich nicht, was zu immer neuen Spekulationen Anlass bot. Tom bekam lukrative Angebote. Er wurde zur Teilnahme an Talkshows eingeladen, und sogar ein Verlag trat mit einer größeren Summe an ihn heran. Aber er dachte gar nicht daran, sich zu erklären, und vereinbarte mit seinem Chef einen zweimonatigen Sonderurlaub. Krankschreibenlassen war keine Option, auch deshalb nicht, weil Tom dem nächsten Arzt, der mit irgendeiner Psychodiagnose herumfantasiert hätte, höchstwahrscheinlich an den Kragen gegangen wäre. Er war nicht krank! Und es ging ihm nicht schlecht!
Im Gegenteil. Mit Jenny und Carlchen erlebt er gerade die glücklichste Zeit seines Lebens. Nach Jahren auf der Überholspur, in denen es um nichts anderes ging als um seinen Job und seine Karriere, hat er diesen Break mehr als verdient.
Inzwischen ist Tom am Ende des Bahnsteigs angekommen und hat von dort einen Blick auf das Gebäude, um das er seit fast drei Monaten einen großen Bogen gemacht hat: den Sender. Nicht einmal letzte Woche, als er die Verlängerung seiner Auszeit verhandelt hat, war er hier. Heute jedoch ging es nicht anders. Die Züge aus Amsterdam fahren den Hauptbahnhof nicht an, sondern halten nur an dieser ewig im Bau befindlichen, unübersichtlichen Station zwischen Messe und linkem Rheinufer – der schäl Sick, wie man in Köln sagt.
Jenny, von der er sich vor einer halben Stunde verabschiedet hat, ruft ihn an. »Ich hab gerade gesehen, dass der Zug verspätet ist.«
»Ich würde am liebsten wieder abhauen.«
»Ach komm, das wird bestimmt gut.«
Tom ist sich da nicht so sicher.
»Ich würde so gerne Mäuschen spielen.«
Die beiden Frischverliebten hauchen Zärtlichkeiten ins Telefon, bis Jennys Schnurren von hohem Kindergeschrei unterbrochen wird. »Da hat einer Hunger«, sagt sie, widmet sich ihrem Baby und verabschiedet sich von Tom. »Bis später, mein Süßer.«
Um weder das Sendegebäude vor sich noch die beiden Mallorca-Freundinnen hinter sich zu sehen – die ihm winken, sobald er in ihre Richtung blickt –, hat Tom während des Gesprächs einen Sommerflieder betrachtet, der hinter dem Gleis aus dem Schotter wächst und seine Äste bis auf den Bahnsteig streckt. Erst als er sein Handy wegsteckt, nimmt er wahr, dass der Busch voller Marienkäfer ist.
Einen unwirtlicheren Ort hätten sie sich für die Begattung nicht aussuchen können, denkt er, beugt sich vor und betrachtet ein Sonnenkäferweibchen, das Blattläuse verspeist, während sich das Männchen auf ihrem Rücken an sie klammert.
Anfang Juni? Wie kann das sein, wo die Paarungszeit normalerweise doch Ende März ist, fragt er sich.
Er googelt und wird in seinem Zweifel bestätigt.
Die Natur ist also auch nicht mehr das, was sie einmal war, denkt er und gönnt es den beiden. Er weiß, dass Marienkäfer sich achtzehn Stunden lang paaren und dass die Weibchen sich gerne von mehreren Männchen begatten lassen – obwohl ein einziges Mal für eine Befruchtung auch genügen würde.
Ein Zug fährt durch, aber das bringt die kopulierenden Käfer nicht aus der Ruhe.
Tom schmunzelt. Dass er sich an diesen Kram noch erinnert. Vor ewigen Zeiten musste er in Bio ein Referat über diese Insekten halten, eine Strafarbeit, weil er im Biologieunterricht mit provozierenden Fragen zum Thema Aufklärung gestört hatte. Vierzehn war er da vielleicht und interessierte sich für kaum etwas anderes außer Sex. Eigentlich sollte Tom über die unkontrollierte Verbreitung des asiatischen Marienkäfers referieren, blieb aber nach einer kurzen Einführung prompt an einer Besonderheit hängen, die sowohl die asiatischen als auch die europäischen weiblichen Marienkäfer verbindet: der Spermatheca, in der die Weibchen die Spermien aufbewahren.
Eine Spermientheke, was für eine praktische Einrichtung!
Mit diesem Satz hatte er damals die gesamte Klasse zum Grölen gebracht und der Lehrerin hektische Flecke ins Gesicht getrieben.
Irre, dass man so einen Scheiß nicht vergisst.
»Achtung bitte auf Gleis 11. Einfahrt des ICE 129 mit Weiterfahrt nach Frankfurt Flughafen. Dieser Zug verkehrt heute in umgekehrter Wagenreihung. Die Wagen der ersten Klasse befinden sich in den Abschnitten D bis E.«
Na super, denkt Tom. Genau am anderen Ende.
Wie eine quarzgraue Schlange kriecht der Intercity-Express in den Bahnhof. Tom hechtet an ihm entlang, vorbei an den beiden Malle-Touristinnen, die ihm winkend ein aufgekratztes »Tschöchen« zurufen. Als der Zug endlich steht, spürt Tom, dass sein Herz schneller schlägt. Vor Aufregung. Die Trittbretter werden ausgefahren. Türen gehen auf. Reisende steigen aus. Tom reckt den Hals und versucht, zwischen den Aussteigenden Henk zu erblicken. Vergeblich.
»Hallöchen«, raunt ihm eine hellblonde Dragqueen nasal zu. Sie klimpert mit den künstlichen Wimpern, macht eine ausladende Handbewegung und schwebt über den Bahnsteig. »Wen haben wir denn da?«
Tom lächelt gequält. Er hätte sich denken können, dass hauptsächlich Männer aussteigen würden. Fröhlich, in Grüppchen, mit viel Gepäck, Küsschen-Küsschen und großem Hallo. Er läuft den ganzen Bahnsteig wieder zurück, aber zwischen all den Touristen, die offensichtlich den Christopher Street Day besuchen wollen, ist kein Henk in Sicht. Die Türen schließen. Der Zug rollt an. Da tippt ihm von hinten jemand auf die Schulter. Tom schnellt herum.
»Theo?«
Vor ihm steht sein biologischer Halbbruder: Henk van Dongen.
»Hi«, antwortet Tom, mustert den Fremden, mit dem er bisher nur per E-Mail kommuniziert hat, hält ihm die Hand hin und registriert, dass wenigstens die anders aussieht als seine eigene.
»Ich wusste es«, sagt Henk.
»Was?«
»Dass du aussiehst wie ich. Nach dem Kinderbild wusste ich es.«
»Hattest du eine gute Reise?«, fragt Tom auf Holländisch, weil man das so fragt und er in seiner Aufregung irgendetwas sagen muss, um sich zu beruhigen.
»Es war ein wenig turbulent«, antwortet Henk, dem die Verlegenheit ins Gesicht geschrieben ist.
»Was hältst du davon, wenn wir irgendwo eine Kleinigkeit essen gehen?«
»Gute Idee.«
Mit dem Strafzettel im Handschuhfach und Henk auf dem Beifahrersitz fährt Tom nach Köln-Dünnwald, einem Stadtteil, in dem er, soweit er sich erinnern kann, noch nie war. Davon ausgehend, dass in einer Vorstadt-Trattoria keiner die Abendnachrichten schaut, hofft er, dass ihn dort niemand erkennt. Schon gar nicht mit Sonnenbrille und Baseballkappe.
»Wohnst du hier in der Nähe, Theo?«, fragt Henk.
»Ja«, lügt er und fährt zum zweiten Mal über dieselbe Kreuzung, weil er hier ohne Navi aufgeschmissen ist.
»Was hältst du davon, wenn wir mit einer gemischten Vorspeisenplatte beginnen?«, schlägt Tom vor, als sie endlich bei dem Italiener in der Odenthaler Straße angekommen sind, den er im Netz ausfindig gemacht hat. »Gibt es irgendetwas, was du nicht isst?«
»Ich esse alles!«
Als der Ober kommt, bestellt Tom eine Flasche Wasser und Antipasti Misto.
Henk studiert die Speisekarte und ordert: »Ich hätte gerne die Bistecca Pizzaiola, aber ohne Kapern.«
Der Kellner hat Mühe, das Holländisch-Deutsch zu verstehen, und schreibt sich alles auf. Als er fertig ist, fragt Henk, ob er statt der Pasta Pommes haben könne.
»Si, mio Signore«, sagt der Ober, notiert weiter und wendet sich dann Tom zu.
Doch bevor er seine Bestellung abgeben kann, meldet sich Henk noch einmal zu Wort. »Sorry, streichen Sie das. Ich nehme doch lieber eine Pizza Margherita.«
Während der Kellner angestrengt lächelt, ist Tom sprachlos. Henk bestellt, wie er das gewöhnlich macht. Umständlich. Unentschlossen. Verwirrend. Kann es sein, dass solche Marotten genetisch bedingt sind? Mit äußeren Ähnlichkeiten, der gleichen Stimmlage oder auch einer gleichen Gangart hat er gerechnet. Aber damit?
»Und was darf ich Ihnen bringen?«, will der Ober wissen.
»Bistecca alla Casa«, sagt Tom so entschieden wie noch nie. »Und bringen Sie uns eine Flasche Chianti.«
»Sehr gerne, Signor Monderath«, sagt der Kellner und sammelt die eingeschweißten Speisekarten ein.
Fuck, denkt Tom und taxiert Henk durch seine dunklen Gläser, ob er etwas gemerkt hat.
Offensichtlich nicht, denn der schaut sich die Plastikreben über dem schief hängenden Bild der Seufzerbrücke an, auf dessen Rahmen der Staub flirrt und kleine Spinnfäden im Sonnenlicht glänzen. »Schön hier«, sagt er.
»Ja«, antwortet Tom automatisch, obwohl er selten in einer derart geschmacklos eingerichteten Bude wie dieser war, und überlässt Henk das Vorkosten, nachdem der Ober die Flasche Chianti entkorkt hat. Der Holländer schnuppert, schlürft, schlotzt und nickt schließlich anerkennend – genauso wie Tom es sonst immer macht. Wie um Himmels willen kann das sein?
Der Kellner füllt zwei Rotweingläser und empfiehlt sich. Normalerweise fällt es Tom leicht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Daraus hat er schließlich auch einen Beruf gemacht. Aber die Umstände und vor allem Henks Verhalten irritieren ihn. Händeringend sucht er nach einer Smalltalk-Strategie.
»Ich hab’s gewusst!«, unterbricht Henk seine Überlegungen.
»Was?«
»Du bist dieser Nachrichtensprecher.« Er spricht langsam, als wäre jedes Wort ein Triumph. »Das Foto, das du mir geschickt hast, habe ich auch bei StayFriends gefunden. War ganz ein-fach.«
Wie in Zeitlupe nimmt Tom seine Sonnenbrille ab, grinst Henk an und prostet ihm zu. Dann schauen sich vier auffallend blaue Augen lange an.
»Das ist definitiv das Verrückteste, was ich je in meinem Leben erlebt habe«, sagt Tom nach einer gefühlten Ewigkeit und schüttelt lachend den Kopf.
»Kann ich absolut bestätigen.«
Sie essen und reden, und reden und essen und lachen. Suchen und finden immer neue Gemeinsamkeiten. Sie lieben den Sommer mehr als den Winter. Sie reden wild gestikulierend. Haben andauernd kalte Füße und müssen immer in Bewegung sein.
»Und wie sieht es mit der Liebe aus?«, will Henk wissen.
»Frauen! Definitiv!«
»Ok, dann haben wir hier den ersten wichtigen Unterschied«, lacht Henk und kann Tom nicht verstehen. Männer sind doch eindeutig aufregender, in jeder Hinsicht.
»Du hast keine Ahnung, wovon du redest!«, empört sich Tom schmunzelnd. Er hat den Eindruck, dass er diesen Holländer schon ewig kennt. »Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen?«
Henk schwärmt von einer glücklichen Kindheit auf dem Land, in der es ihm an nichts fehlte. Einzig Geschwister hätte er gerne gehabt.
»Weißt du, in welchem Verhältnis deine Mutter und mein Vater standen?«, fragt Tom.
»Offensichtlich in einem innigen. Zumindest einmal, oder?«
»Ja, aber was sagt sie?«
»Meine Mutter ist tot. Ich kann sie leider nicht mehr fragen.« Henk schenkt sich Rotwein nach und ergänzt: »Wim fragen will ich nicht. Das würde ihm vermutlich das Herz brechen.«
»Wim?«
»Er hat mich großgezogen. Ich hätte mir keinen besseren Vater wünschen können als ihn.«
Tom denkt darüber nach, ob das einen Unterschied macht. Biologisch oder nicht? Prägend ist doch der soziale Einfluss.
»Er hat mich immer unterstützt«, fährt Henk fort. »Wim war der Erste, dem ich gestanden habe, dass ich schwul bin.«
»Und? Wie hat er reagiert?«
»Er hat gesagt, dass es einzig und allein wichtig ist, dass ich glücklich bin. Und dann hat er sich mit jedem in der Familie angelegt, der anders dachte.«
Tom überlegt, wie das im umgekehrten Fall gewesen wäre. Wahrscheinlich wäre Schwulsein für seinen Vater unter die Rubrik »psychische Krankheiten« gefallen. Nicht auszudenken, was dieser veranstaltet hätte, wenn Tom auch in dieser Hinsicht nicht seinen Erwartungen entsprochen hätte. Wahrscheinlich hätte Konrad ihn in eine Umerziehungstherapie gesteckt. »Da hast du wirklich Glück gehabt.«
»Und jetzt erzähl von deinem Vater. Wie ist er?«
Um Zeit zu gewinnen, winkt Tom den Kellner heran, bestellt eine weitere Flasche Wasser und versucht es erst einmal mit einer halbwegs neutralen Beschreibung. »Er hat ungefähr genauso ausgesehen wie ich.« Wir zu sagen, bringt er nicht über die Lippen.
»Und sein Charakter? Sein Wesen?«
»Da gibt es gar nicht so furchtbar viel zu erzählen. Er hat viel gearbeitet und war wenig zu Hause und … Ein typischer Rheinländer, Mitglied in jedem Verein, einer, der besonders an Karneval zu Hochtouren aufläuft und …« Tom stottert sich etwas zusammen, denn er will Henk nicht offenbaren, was für ein schlechtes Verhältnis er zu seinem Vater hatte. Das ganze Thema hat er in den letzten Jahren ad acta gelegt. Dass es jetzt wieder geballt hochkommt, stört ihn sehr.
Der Kellner erlöst ihn, fragt, ob sie noch etwas wünschen, und da auch Henk den Kopf schüttelt, verlangt Tom die Rechnung und gibt vor, noch zu einem wichtigen Termin zu müssen.
Weil sie zu viel Wein getrunken haben, lassen sie das Auto stehen und fahren mit einem Taxi in die Innenstadt. Henk ist auffallend schweigsam und schaut ernst aus dem Fenster. Auch Tom stellt keine Fragen, da er befürchtet, dann auch selbst Antworten geben zu müssen, die er nicht geben will.
Auf der Deutzer Brücke flattern Regenbogenfahnen, wie in ganz Köln an diesem Wochenende. Außer natürlich am Dom, denkt Tom grinsend.
»Sehen wir uns wieder?«, fragt Henk.
»Bestimmt«, antwortet Tom und ist sich nicht sicher. »Ich bin oft in Holland.«
Vor dem Steigenberger am Rudolfplatz nehmen sie sich zum Abschied in den Arm. Schweigend. Dann lässt Tom sich den knappen Kilometer nach Hause ins Gereonsviertel fahren. Er ist froh, wieder allein zu sein, erschlagen von dem, was sich in den letzten Stunden zugetragen hat. Kopfschüttelnd denkt er darüber nach, wie es sein kann, dass von den Milliarden Spermien, die sein Vater lebenslang produziert hat, zwei das Rennen gemacht und zwei so ähnliche Typen wie ihn und Henk produziert haben?
Er bezahlt den Taxifahrer und sieht beim Aussteigen Henks Handy auf dem Sitz liegen. Es scheint ihm aus der Tasche gerutscht zu sein. Fuck! Tom atmet genervt durch und bittet den Fahrer, ihn zurück zum Hotel zu bringen. Dort steigt er aus und betritt die Lobby. Auf dem Weg zur Rezeption wird er von hinten umarmt. Erschrocken dreht er sich um und blickt in die hellgrauen Augen eines gebräunten Mittdreißigers.
»Henk! Darling. Ich habe schon gesehen, du hast das Zimmer neben mir. Seit wann bist du hier?«, fragt der Fremde auf Englisch mit schwedischem Akzent und wirft sich Tom an den Hals.
Bevor er erwidern kann, dass es sich um eine Verwechslung handelt, mustert der Schwede Tom von oben bis unten und sagt laut: »Gut siehst du aus ohne Bart – so viel jünger.«
Tom sieht sein Konterfei in der Spiegelung der Drehtür und findet auch, dass er ohne Bart gut aussieht. »Aber ich …«
Er hat keine Chance.
»Ich habe dir so viel zu erzählen«, sagt der Schwede, auf dessen T-Shirt groß Synchro Libido steht, nimmt seine sieben Shoppingtüten vom Boden auf und eilt balletteus Richtung Aufzug.
Tom folgt ihm, denn wenn Henk sein Zimmernachbar ist, dann muss er das Handy ja nicht unpersönlich an der Rezeption abgeben.
Synchro Libido drückt auf die Acht, erzählt, dass er kürzlich in der wichtigsten Sportsendung Schwedens aufgetreten ist. »Fernsehen! Verstehst du?« Er nimmt sich selbst aufs Korn, sagt, er sei jetzt ein Fernsehstar, und verdreht die Augen. »Und jetzt rate mal, wer noch da war.«
Tom zuckt die Schultern, doch selbst wenn er es gewusst hätte, hätte er keine Chance gehabt, zu antworten.
»Natalia Ischtschenko! Diese Russenbitch.«
Tom versteht nur Bahnhof, bis ihm einfällt, dass er den Namen bei seiner Recherche über Henk gelesen hat. Natalia Sergejewna Ischtschenko ist eine russische Olympiasiegerin im Synchronschwimmen, die die Bestrebungen der Männer, mit dieser Sportart ebenfalls bei Olympischen Spielen antreten zu können, kategorisch ablehnt. Als Co-Trainer der niederländischen Synchronschwimmer-Nationalmannschaft kämpft Henk ebenfalls dafür, dass männliche Synchronschwimmer auch bei Olympia und nicht nur bei den Gaygames antreten dürfen.
»Die hat uns doch wirklich als ›widernatürlich‹ bezeichnet, dieses vertrocknete Neutrum!« Wie Giftpfeile schießen die Worte aus seinem Mund.
Im vierten Stock hält der Lift. Die Tür öffnet sich, und mit lautem »Salut les chéries« steigen zwei Franzosen zu – offensichtlich auch Synchronschwimmer, denn auf ihren Baseballkappen ist SIRÈNE zu lesen, was Tom mit Meerjungfrau übersetzt.
Grosses Bises mit Synchro Libido. Auch Tom wird rechts und links und noch mal rechts geküsst. Die beiden Sirènes – eine blond, die andere schwarzhaarig – sind ebenfalls begeistert von seinem jungen Aussehen und bemerken kichernd, dass er doch zugeben soll, dass er etwas hat machen lassen.
»Nichts! Ich schwöre«, sagt Tom, doch die drei Männer glauben ihm kein Wort und reden wild durcheinander auf ihn ein.
Da öffnet sich in der achten Etage die Fahrstuhltür, und das fröhliche Geschnatter verstummt schlagartig. Vor der Tür steht Henk. Der Echte. Der Ältere. Der mit Bart. Wie bei einem Tennismatch schießen die Köpfe von Synchro Libido und den beiden Sirènes von links nach rechts und zurück, während Henk Tom erklärt, dass er eben runterfahren wollte, um zu sehen, ob er sein Handy vielleicht im Eingangsbereich verloren habe. Tom grinst, hält ihm das Smartphone hin und will sich verabschieden, als Synchro Libido endlich seine Sprache wiederfindet.
»Mooo-ment!« Mit einer eleganten Bewegung stellt er sich vor den Aufzug und nimmt Tom so jegliche Fluchtmöglichkeit. »Wie konntest du uns deinen Zwillingsbruder nur verheimlichen?«, sagt er vorwurfsvoll zu Henk.
Das meinen auch die beiden Sirènes und fordern ihren holländischen Freund auf, ihnen den jungen, gut aussehenden Mann doch bitte vorzustellen.
Es braucht nur einen kurzen Blick von Tom, dann weiß Henk, was er zu sagen hat. »Das ist Theo. Mein Kölner Bruder.«
»Theeeeo!«, rufen die drei im Chor und sind sich einig, dass darauf erst einmal etwas getrunken werden muss.
Sie müssen Tom nicht wirklich überreden – er findet es durchaus witzig, einmal nicht der prominente Anchorman zu sein, sondern einfach nur Theo, der Bruder von Henk. Der gutaussehende Bruder!
Erst wird die Minibar in Henks Zimmer geplündert, und mit jedem Schluck lungern sie relaxter auf dem Hotelbett und den herangeschobenen Sesseln. Bevor sie verdursten, geht Synchro Libido nach drüben in sein Zimmer, leert dort den Kühlschrank und bringt zusätzlich noch eine Flasche Sekt mit, die er zum Vorglühen besorgt hat. Die Neugier der Sportlerkollegen aus Schweden und Frankreich kennt keine Grenzen, und es macht Henk und Tom – beziehungsweise Theo – Spaß, ihnen einen Bären aufzubinden und zu erzählen, dass sie nach der Geburt getrennt wurden und sich erst vor Kurzem wiedergefunden hätten.
»Neiiiiin!« Synchro Libido fängt mit der Fingerspitze eine Träne der Rührung auf.
Als Toms Handy klingelt, strecken die Jungs neugierig die Hälse und sehen Jenny auf dem Display.
»Deine Frau?«, fragt die blonde Sirène.
»Ja«, antwortet Tom nach kurzem Zögern, denn das hat er noch nie gesagt. Aber Freundin oder gar Kollegin trifft es nicht.
»Und sie heißt Jenny?«
Er nickt und nimmt den Anruf entgegen.
»Na? Hast du dein Treffen mit Henk schon hinter dir?«, will sie wissen.
»Nein.«
Henk und die anderen wagen es kaum, Luft zu holen, und starren Tom an.
»Kannst du nicht reden?«
»Nicht wirklich«, sagt Tom. Und dann stellt sie ihm lauter Fragen, die er mit Ja oder Nein beantworten kann.
Ob Henk nett ist? Ja!
Ob sie sich gut verstanden haben? Ja!
Und ob …
Da hält es Synchro Libido nicht länger aus, und er ruft laut: »Hallo, Jenny.«
»Hi, Jenny«, rufen nun auch die anderen.
»Wo bist du denn?«, will sie wissen.
»Im Steigenberger«, antwortet Tom, wechselt auf FaceTime und lässt alle nacheinander in die Kamera grüßen.
Jenny ist begeistert. Und die Jungs sind es von ihr.
»Wir müssen uns unbedingt bald kennenlernen, Henk«, sagt sie.
»Ja. Unbedingt!«
Im Hintergrund meldet sich Carlchen. »Okay, mein Typ wird verlangt. Habt noch viel Spaß. Wann kommst du nach Hause?«
»Morgen«, säuselt Synchro Libido, gibt Tom ein Küsschen auf die Wange und verabschiedet sich von Jenny mit einem fröhlichen: »Love you.«
Nachdem Tom als Theo sämtliche Wann-, Wie- und alle weiteren Fragen über Jenny beantwortet hat und die Jungs in Entzücken über die Bilder vom süßen Carlchen ausgebrochen sind, sagt er, dass es nun doch Zeit für ihn sei, nach Hause zu gehen.
»Das kommt überhaupt nicht infrage«, meinen die Franzosen.
Auch für Synchro Libido ist das keine Option. »Du kommst mit uns ins Corner.«
»Was ist denn das Corner?«, will Tom wissen.
»Du kennst das Corner nicht? Als Kölner?« Synchro Libido ist konsterniert.
»Es ist eine Kneipe«, klärt Henk auf, zieht sich ein frisches T-Shirt an und hüllt sich in einen Nebel aus Gaultier.
Tom registriert, dass es sich dabei um denselben Duft handelt, den er selbst seit den Neunzigern verwendet – wenn auch in einer anderen Dosierung –, und entscheidet, dass ein ordentliches Kölsch nach dem klebrigen Sekt nicht verkehrt sein kann.
Nachdem sich alle außer Tom umgezogen haben, überqueren sie den Habsburgerring, und in der Sekunde, in der sie in die Schaafenstraße einbiegen, bereut er, dass er nicht doch auf dem Nachhauseweg ist. Vor ihm liegt das sogenannte Bermudadreieck, in dem sich eine Schwulenbar an die andere reiht. Diese Ecke hat er als geborener Kölner noch nie betreten. Er hat Fluchtgedanken und ist atemlos. Wie Helene Fischer, die aus Boxen wummert, über denen auf der Straße Regenbogenfahnen hängen. Als würden sie es ahnen, haken sich die beiden Franzosen rechts und links bei Tom unter und schieben ihn beherzt weiter in die Straße hinein, in der alles, was sie wollen, da und die große Freiheit pur, ganz nah ist. Alles singt und tanzt. Nach fünfzig Metern ist kein Weiterkommen. Um Tom herum räkeln sich Männer in schwarzen Netzhemdchen oder mit nichts als einem Piercingring am Oberkörper. Viele tragen knapp geschnittene Lederhöschen, manche Chaps, mit wenig drunter. Tom wird taxiert, abgeschätzt, angeflirtet. Es verunsichert und amüsiert ihn gleichermaßen. Ihm schießt durch den Kopf, dass das Drama um Tom Monderath eine überraschend neue Richtung bekäme, wenn jemand in genau diesem Moment ein Bild von ihm machen und an die Presse durchstechen würde.
»Hier, Theo!« Synchro Libido hat sich durch den Pulk gekämpft und drückt Tom eine Flasche Kölsch in die Hand.
Die Weather Girls lassen es Männer regnen, und alles bebt.
Zweites Kölsch. Nun ist Freddy Mercury nicht zu stoppen. Die Männer um ihn herum auch nicht. Sie singen, lachen, tanzen, küssen einander. Tom krallt sich an seiner Flasche fest und tanzt nicht. Dabei tanzt er gerne, wenn inzwischen auch nur noch an Karneval. Wieder drängt sich sein Vater vor und lässt sich auch mit dem nächsten Kölsch nicht wegspülen.
Okay, dann bin ich halt auch ein typischer Rheinländer, der nur an Karneval zu Hochtouren auflaufen kann.
Er spürt eine Hand auf seinem Arsch. Eine wissende Hand, die meint, zu ihm zu gehören wie der Name auf der Tür von Marianne Rosenberg. Fuck! Schlagartig ist Tom stocknüchtern, dreht sich um, sieht ein lüsternes Lächeln. Er weiß, dass das hier auf jeden Fall keine wahre Liebe ist, die nie mehr vergeht, und ergreift in der wabernden Masse die Flucht. Vom Straßenrand aus hält er Ausschau nach Henk, kann ihn aber nirgendwo entdecken und geht.
»Tom!« Keine hundert Meter weiter hat Henk ihn eingeholt.
»Sorry«, sagt Tom. »Das ist nicht meine Welt. Lass uns irgendwann wieder in Ruhe treffen, aber …«
»Ich verstehe, dass das für einen Hetero gewöhnungsbedürftig ist«, sagt Henk.
»Ja, das ist es. Außerdem brauche ich dringend eine Mütze Schlaf.« Tom legt seine Hand auf Henks Schulter, sagt »Tschüss« und geht leicht wankend in Richtung Friesenviertel.
Henk folgt ihm. »Ich kann dich doch jetzt nicht gehen lassen. Nicht nach dem, was heute alles passiert ist.«
Alle paar Meter bleiben sie stehen und drehen sich mit den ewig gleichen Argumenten im Kreis. Tom will Henk nicht auch noch zeigen müssen, wo er wohnt. Deshalb steuert er schließlich einen Taxihalteplatz an, obwohl er weiß, dass der Fahrer ihn höchstwahrscheinlich rausschmeißen wird, wenn er hört, dass das Ziel seines Fahrgasts gerade mal vierhundert Meter weit entfernt ist.
»Lass uns telefonieren, Henk«, verabschiedet sich Tom und hat schon den Türgriff des Daimlers in der Hand.
»Ich hab noch eine Frage«, sagt Henk.
»Ja?«
»Weiß dein Vater, dass du dich mit mir triffst?«
Zögerlich schlägt Tom die Taxitür wieder zu. Der Fahrer flucht wild gestikulierend. Doch das registriert Tom nur am Rand, denn der Gedanke, dass Henk annimmt, sein Vater würde noch leben, erschüttert ihn geradezu. Wie kann er nur auf diese Idee kommen? Ich habe doch immer in der Vergangenheitsform von ihm geredet …
Als zwei Fahrgäste in den Wagen hinter seinem Taxi steigen, flippt der Fahrer aus und brüllt: »Verschwindet, ihr besoffenen Idioten! Ihr macht mir das ganze Geschäft kaputt!«
»Sorry!« Tom legt den Arm um Henk und geht mit ihm ein paar Meter vom Taxi weg. Vor der Leuchtwerbung einer Versicherung, auf der eine glückliche Familie in einem SUV-Cabrio dem Morgenrot entgegenfährt, bleibt er stehen. »Mein Vater ist tot. Schon seit fast zwanzig Jahren.«
Henk starrt ihn ungläubig an. »Ich dachte …« Als hätte er keine Kraft mehr, länger aufrecht zu stehen, rutscht er an der Plakatwand nach unten und bricht in Tränen aus.
Tom geht neben ihm in die Hocke, auch wenn er keine Idee hat, was er jetzt sagen könnte.
»Entschuldige, ich weiß, das ist bekloppt«, erklärt Henk schließlich, als er sich wieder gefangen hat.
Hilflos denkt Tom, dass dieser Typ gerade mehr um seinen Vater weint, als er es jemals getan hat. Was für eine verrückte Geschichte!
»Woran ist er gestorben?«
»Herzinfarkt.«
Kopfschüttelnd starrt Henk vor sich hin. »Seltsam, ich denke auch immer, dass ich einmal an einem Herzinfarkt sterbe.«
»Wie kommst du denn darauf?«
»Keine Ahnung. Oder vielleicht ist es doch eine …«
»Was?«
»Eine Vorahnung. Vielleicht weiß man ja tief in sich, woran man einmal sterben wird.« Und dann erzählt Henk von seinem Beruf als Krankenpfleger, in dem er regelmäßig dem Tod begegnet und Gespräche mit Sterbenden führt. Zuletzt flüstert er: »Irrerweise sagen viele, dass sie das Wissen um ihr Ende schon lange in sich tragen.«
»Ich bin mir schon immer sicher, dass ich steinalt werde«, antwortet Tom und spricht nicht aus, dass er denkt: Hoffentlich bekomme ich dann kein Alzheimer wie meine Mutter.
Schweigend sinnieren sie vor sich hin, und nicht einmal Tom stört es, hier an der Ehrenstraße auf dem Bordstein zu sitzen und die lauten Nachtschwärmer aus dem Kölner Umland an sich vorbeiziehen zu lassen.
»Ich hab einen Wunsch«, sagt Henk plötzlich. »Ich würde gerne sein Grab besuchen.«
Tom schaut einer pinkfarbenen Stretch-Limousine hinterher, aus deren heruntergelassenen Scheiben Bergischgladbacherinnen mit aufgespritzten Fahrradschlauchlippen kreischend Abschied vom Junggesellinnenleben nehmen – und gibt ihm keine Antwort.
»Du denkst jetzt bestimmt, dass ich verrückt bin, oder?«
»Nein«, lügt Tom und kann es nicht fassen. Er würde jetzt eigentlich auch gerne laut in die Nacht schreien.
»Kannst du mir sagen, wo er begraben ist?«
»Melatenfriedhof«, antwortet Tom leise.
Henk zückt sein Smartphone und gibt den Friedhof in den digitalen Stadtplan ein. »Der ist ja ganz in der Nähe!« Er rappelt sich auf und wankt in die Richtung, die ihm auf dem Display angezeigt wird.
Fassungslos schaut Tom ihm nach, wie er, ohne nach rechts oder nach links zu schauen, einfach den vierspurigen Ring überquert. Ein Auto muss ausweichen und hupt. Zeitverzögert zeigt Henk ihm den Mittelfinger und geht weiter.
»Verflucht! Was soll das denn? Es ist mitten in der Nacht.«
Doch Henk reagiert nicht.
Tom weiß, dass er ihn so nicht gehen lassen kann. Er steht auf und läuft hinter ihm her. Zum Glück springt die Fußgängerampel gerade auf Grün. »Komm, ich bringe dich ins Hotel. Schlaf dich dort erst einmal aus«, sagt er, als er ihn eingeholt hat.
»Nein!« Mit starrem Blick aufs Handydisplay geht Henk in Richtung Westen und lässt sich von sämtlichen Argumenten, vor allem von dem, dass der Friedhof nachts verschlossen ist, nicht aufhalten.
Und so wanken sie durchs Belgische Viertel, über den Brüsseler Platz, wo Hunderte durstige Menschen den Verkehr und auch den Ordnungsdienst nicht durchlassen und auf Hochbeeten sitzen, weil sie nicht mehr stehen können. Wo Geschrei und Gelächter von den Wänden der Häuser hallt und verstärkt wird und eine Akustik entsteht, als würden achtzigtausend Zuschauer einem Spiel zwischen Real Madrid gegen den FC Liverpool entgegenfiebern. Mindestens.
Was für ein Segen, dass ich hier weggezogen bin, denkt Tom und stolpert hinter dem zielstrebigen Henk her.
Sie unterqueren eine Bahnbrücke, auf der ein nicht enden wollender Güterzug rattert und die anwohnenden Kölner endgültig vom Schlafen abhält. Henk steckt sein Handy ein und hält sich die Ohren zu. Doch anstatt weiter geradeaus zum Friedhof zu gehen, biegt er danach links ab. Tom ist es recht.
»Hier war ich schon mal«, sagt Henk und schaut in Richtung Süden, wo nichts zu sehen ist als schwarze Nacht.
Klar warst du schon mal da, denkt Tom bitter. Hier ist ja auch der Schwulenstrich.
»Hier ist die gay-cruising-area.«
»Ach«, erwidert Tom mit gespielt überraschter Miene und überlegt, wie er Henk zurück in die Innenstadt lotsen könnte. »Man lernt doch immer noch dazu.«
Vom nahen Hügel, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Inneren Grüngürtel aus den Überresten der zerbombten Ruinen aufgeschüttet wurde, weht eine Haschischwolke herüber. Henk nimmt die Fährte auf und ruft Richtung Glut: »Habt ihr vielleicht noch einen Joint übrig?«
»Das kannst du vergessen«, raunt Tom. »Die denken bestimmt, du bist ein Bulle. Dope ist hier nicht so legal wie in deiner Heimat.«
»Klar, Digga«, antwortet eine Stimme aus der Dunkelheit.
Kurz danach sitzt Tom neben Henk auf dem Gras, zieht den Rauch in den letzten Lungenzipfel und hofft, dass der Holländer den Friedhofsbesuch vergessen hat.
»Hatte er eine schöne Bestattung?«
»Hör mal, das ist alles bescheuert! Es ist kurz nach vier. Der Friedhof hat zu, lass uns zurückgehen.«
Mit spitzen Fingern hält Henk den Joint, damit ja kein Krümelchen verschwendet wird. Er zieht, sagt mit glasigen Augen »Bullshit!« und macht sich wieder auf den Weg.
An der Aachener Straße steuert er die Tankstelle an, und während er am Nachtschalter mit dem Verkäufer verhandelt, beschließt Tom, dass er das nächste Taxi anhalten und abhauen wird. Doch wenn man eins braucht, dann kommt keins. Natürlich! Dafür kommt Henk zurück mit einer Flasche Rüttgers Club, einer Tüte Chips und Schokolade.
Die Tafel verputzen sie, noch bevor sie die vierspurige Straße überqueren, und als sie vor dem Friedhofsportal ankommen, steht schwarz auf weißer Emaille das, was Tom seit einer Stunde gepredigt hat: Öffnungszeit im Sommer 7 Uhr.
Henk reißt die Chipstüte auf und schaufelt den Inhalt in sich hinein, als könne er so besser denken. Dann schauen sie einander an. Lange. Sehr lange. Keiner zuckt. Ohne Tom aus den Augen zu lassen, stellt Henk die Flasche auf den Boden und macht eine Räuberleiter.
»Das ist nicht dein Ernst«, flüstert Tom und entdeckt das Verschworene in Henks Blick. Ohne eine Sekunde weiter zu überlegen, stellt er seinen Fuß in Henks Handflächen und stemmt sich an der Friedhofsmauer hoch, als hätten sie beide das schon hundert Mal so getan. Oben hält er sich mit einer Hand fest, streckt die andere aus, nimmt erst die Sektflasche entgegen und hilft dann Henk auf die Mauerkrone. Hinter ihnen ist alles schwarz.
»Komm. Lass uns verschwinden. Wir können morgen …«
»Bullshit!«, unterbricht ihn Henk und lässt sich langsam an der Friedhofsmauer hinab. Er streckt die Hand nach der Sektflasche aus, die Tom ihm reicht, bevor er seinen Widerstand aufgibt und Henk folgt.
»In welche Richtung?«
Tom hat keine Ahnung. Und die hätte er auch nicht, wenn es hell wäre, denn es ist ewig her, dass er das Grab seines Vaters besucht hat. Um genau zu sein, war das letzte Mal auch das einzige Mal – am Tag der Beerdigung. Aber weil er am 2. April bei der Beisetzung von Guido Westerwelle eine Sondersendung moderiert hat, erinnert er sich an breite Wege. Ein straßenartiges Netz. Da müssen sie hin.
Nichts ist zu sehen, nicht einmal ein Pfad. Vorsichtig tasten sie sich parallel zur Mauer an einer Gräberreihe entlang. Vereinzelt flackern Grablichter, aber die haben keine Kraft, die Umgebung zu erhellen, und so erkennen sie auch dann nichts, als sich ihre Augen ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt haben. Über ihnen färbt sich der Himmel langsam dunkelblau. Humboldt hätte es auf seinem Cyanometer mit neununddreißig bestimmt.
Verrückt, denkt Tom, dass ihm das gerade jetzt einfällt. Als kleiner Junge wollte er Naturforscher werden. Damals schenkte ihm Konrad eine kleine, runde Pappscheibe, mit der er wie der große Forschungsreisende das exakte Blau des Himmels definieren konnte.
Erste Umrisse erscheinen. Von Bäumen. Hecken. Grabmalen. Ohne Henk würde Tom durchdrehen. Ohne Henk wäre er auch nicht hier, wo kein Lebender etwas zu suchen hat, auf diesem Gelände, das im Mittelalter vor der Stadtmauer lag, Hinrichtungsstätte war, und wo jahrhundertelang die Aussätzigen von Köln untergebracht waren.
Sie gelangen auf eine breite Querstraße, und in der Geschwindigkeit, mit der die Erde sich um die Sonne dreht, wird es heller. Aus dem Schwarz treten schemenhafte Figuren hervor. Tom findet alles gruselig, aber irgendwie gibt ihm der ältere Bruder – Bruder, denkt er, kann ich wirklich Bruder sagen? –, der zielstrebig Richtung Westen geht, ein Gefühl von Sicherheit. Verrückt. Als würde Henk seine Gedanken erraten oder als hätte er dieselben Ängste, greift er nach Toms Hand und drückt sie kurz. Tapfer gehen sie weiter. Von Minute zu Minute verdrängt der Tag mehr die Nacht, das Licht gibt Farben preis, die die Vögel mit ihrem immer lauter werdenden Morgenkonzert begrüßen.
Tom wünscht sich, dass die Posaunenengel, die den Verstorbenen den Weg zur Auferstehung weisen, auch Henk und ihm zeigen, wo es langgeht. Vergebens. Sie rühren sich nicht.
Von der Aachener Straße hört Tom ein Martinshorn. Ob sie jemand beobachtet hat, wie sie über die Mauer gestiegen sind?
Die Polizeisirene entfernt sich, als vor ihnen ein in Stein gehauenes Mitglied der Kölner Prinzengarde strammsteht. Er muss nicht mehr die Prinzen während der Karnevalszeit bewachen, sondern alle Kölner, die hier ihre ewige Ruhe gefunden haben: die Millowitschs, Ostermanns oder Wischnewskis, aber auch die ungezählten Schmitzens, Küppers und Schulzes. Hier auf Melaten hat er Ewigkeitssession.
Dieser freundlich dreinblickende Soldat ist für Tom die Orientierung. Ihn hat er sich gemerkt. Jetzt geht er schneller, zieht Henk an der Hand mit, vorbei an einem überlebensgroßen Erzengel, vor dem der Grünspan nicht haltmacht und der nach oben zeigt, dorthin, wo nicht nur das Jüngste Gericht wartet, sondern auch die Tauben herkommen, denen es egal ist, auf wem sie ihre Kacke hinterlassen. Tom erinnert sich, dass rechts das Feld mit den uniformen steinernen Grabkreuzen liegt, wo die Opfer der sogenannten Tausend-Bomber-Nacht von 1942 und die Toten des Peter-und-Paul-Angriffs vom Juni 1943 in Massenbestattungen beerdigt wurden.
Danach kommen Gräber, die bunt sind und geschmückt mit Luftballons, Girlanden, Windrädern und Teddybären. Unter ihnen liegen Kinder, die starben, bevor ihr Leben begann.
»Wie schrecklich«, sagt Henk und bleibt an den Fotos und Worten hängen, die neben den Namen stehen: Dem über alles geliebten Louis, Der unvergessenen Paula, Dem Sonnenschein Thomas, dem seine Schwester einen eingeschweißten Brief an die kleine Trauerweide gebunden hat: Du bist der Bruder, den ich nie kennenlernen durfte. Was hätten wir alles zusammen machen können, wenn du gelebt hättest?
»Komm«, sagt Tom, der weiß, dass es jetzt nur noch ein paar Meter sind.
Und dann, nach all diesen opulenten Skulpturen und liebevoll gepflegten Gräbern, hinter einer Thujahecke, stehen sie plötzlich vor einem schwarzen polierten Granit mit der Inschrift
MONDERATH
Auf der Platte, die das Grab verschließt, stehen in der Reihenfolge ihrer Geburt
Wilhelm 1895–1933
Ida 1900–1943
Franz 1921–1942
Konrad 1928–1997
Lizzy 1933–1943
Tom zeigt auf den schmucklosen Stein. »Konrad. Das war er.«
»Die anderen sind die Eltern und Geschwister?«, fragt Henk.
Tom nickt. Ihm fällt auf, dass er seinen Vater zum ersten Mal inmitten seiner Familie sieht. Und nicht allein.
»Dann war Konrad also nach 1943 der einzig Überlebende? Mit fünfzehn Jahren?«
»Ja. Scheißkrieg«, sagt Tom und denkt, dass Konrads Geschwister sehr jung starben. Lizzy mit zehn, und Franz wurde gerade mal einundzwanzig.
Henk köpft die Sektflasche, hält sie Richtung Grabstein, wie ein Glas, das man zum Toast hebt, nimmt einen Schluck und reicht sie an Tom weiter. Der lässt die süße Plörre durch seine Kehle rinnen und liest die unterschiedlichen Sterbejahre. Seltsam. Er weiß nicht, warum, aber er ist immer davon ausgegangen, dass sein Vater die gesamte Familie bei einem einzigen Bombenangriff verloren hat. Krampfhaft versucht er sich zu erinnern, was Pap darüber erzählt hat. Mit seinem vom Alkohol und Haschisch benebelten Gehirn lässt es sich schwer denken, aber das Gefühl macht sich breit, dass er als Kind einmal nachgefragt hat und dann nie wieder, weil er nach der knappen Antwort spürte, wie sein Vater in einer tiefen Traurigkeit versank.
»Es ist ein schöner Ort.« Henks Worte holen ihn in die Gegenwart zurück. Tom schaut zu Henk, der sich auf den Boden setzt und an den Grabstein lehnt. »So friedlich.«
»Stimmt.« Tom setzt sich neben ihn. Sein Blick fällt auf das Kalksteingrabmal gegenüber, auf dem oberhalb des Familiennamens ein Satz eingraviert ist: DIE LIEBE HÖRET NIMMER AUF.
Mit einem Mal erinnert sich Tom daran, wie sein Vater abends im Bett mit ihm kuschelte, wie er ihm aus dem ›Struwwelpeter‹ vorlas und lachte, weil der kleine Tömmes, wie er ihn liebevoll nannte, das halbe Buch auswendig konnte. Wie er ihn beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielen gewinnen ließ. Ihn im Auto vorne sitzen ließ, obwohl es verboten war. Wie sie im Siebengebirge Steine suchten und sein Pap ihm erzählte, dass Riesen diese dort abgelegt hatten. Seit Jahrzehnten hat er nicht mehr an diese Liebe gedacht, sondern nur an die Kälte, die später zwischen ihnen gewesen war.
Und dann taucht vor seinem inneren Auge die Szene auf, die Tom immer wegschieben muss, wenn sie ihn einholt. Der letzte Moment mit seinem Vater. Der letzte Blick, bevor er damals als Siebenundzwanzigjähriger nach Paris fuhr. Pap hatte ihn um ein klärendes Gespräch gebeten, aber Tom sagte, er habe keine Zeit, und ging. Grußlos. Konrad starb noch am selben Tag. Seither verdrängt Tom den Gedanken, dass er das Herz seines Vaters endgültig gebrochen hatte und deshalb schuld ist an seinem Tod.
Henk hält die Flasche gegen das Licht, um zu sehen, wie viel noch drin ist. »Der Rest ist für ihn.«
Nacheinander stehen sie auf, treten vor das Grab, halten die Flasche gemeinsam und lassen den Sekt auf die Granitplatte fließen. Tom fragt sich, ob Konrad etwas von Henks Existenz wusste.
»Prost, Pap«, sagt er, und zum ersten Mal seit Jahrzehnten fühlt er sich ihm nahe. Hat Sehnsucht nach ihm. Und würde so gerne mit ihm reden und alles verstehen.
»Prost«, sagt Henk mit Tränen in den Augen. »Ohne Konrad würde es mich nicht geben.«
Tom ist froh, dass er nicht allein hier ist, dass Henk neben ihm steht.
Ein Rabe lässt sich auf dem Lebensbaum hinter dem Grabstein nieder.
»Krraaab, krraaab, krraaab«, krächzt er, und es ist Tom, als würde er sie beobachten. Von diesem grünen Symbol der Ewigkeit aus. »Krraaab, krraaab, krraaab.«
ZWEI.
Mai 1933–Juli 1943
»Krraaab, krraaab, krraaab«, krächzte der Rabe auf der Thuja hinter dem Pfarrer, der den blumengeschmückten Sarg mit Weihwasser besprengte. »Krraaab, krraaab, krraaab.«
Der fünfjährige Konrad sah, wie der Vogel hinter einer Weihrauchwolke verschwand.
»Wir bitten dich, Gott. Komm Wilhelm Monderath mit deiner Liebe entgegen und nimm alle Schuld von ihm«, sagte der Priester, und dann sah Konrad, wie sechs Männer sich gleichzeitig nach den Tauen bückten, die unter dem Sarg hindurchliefen, sie anzogen und ihn langsam in das Erdloch hinabließen.
»Krraaab, krraaab, krraaab.«
Als die Männer die Seile hochgezogen hatten und nach einer Verbeugung zur Seite gegangen waren, trat Konrad, der von allen Conny genannt wurde, mit seiner Mutter und seinem zwölfjährigen Bruder Franz einen Schritt vor, griff wie sie in das aufgeschüttete Erdreich und warf eine Handvoll ins Grab. Dann noch eine. Es klang hohl, als die Erde auf das Holz aufschlug. Conny konnte sich nicht vorstellen, dass sein Vater jetzt da unten in dieser Holzkiste lag, obwohl er gesehen hatte, wie über ihm der Sargdeckel geschlossen und dann zugeschraubt worden war.
»Krraaab, krraaab, krraaab.« Der Weihrauch war verflogen, und der Rabe breitete die Flügel aus, flog tief eine Runde über der schwarz gekleideten Trauergemeinde und stieg dann in die Lüfte.
Zitternd drückte Conny die Hand seines großen Bruders und hielt sich an ihm fest, sonst wäre er vielleicht auch weggeflogen. Geflohen. In den Himmel, wo sein Vater jetzt eigentlich war, wie ihm die Oma erzählt hatte. Verstohlen blickte Conny nach oben. Aber da war nicht einmal eine Wolke zu sehen, auf der Pap hätte sitzen können.
»Was haben wir für ein Glück, so eine Weitsicht hat man nur selten.« Das hatte sein Vater am Samstag gesagt. Am Samstag! Und jetzt war er nicht mehr da. Dabei war der Samstag erst vor vier Tagen gewesen.
Pap hatte Conny mit zum Dom genommen, zu einem Termin, den er mit dem Dombaumeister gehabt hatte.
»Das ist mein Jüngster«, hatte Pap ihn dem Chef vom Dom vorgestellt.
Und oben, in fünfundvierzig Meter Höhe auf der Dachgalerie, hatte Conny durch die steinerne Brüstung hindurchgeschaut und zwischen den kleinen Spitzbögen auf das Häusermeer geblickt, die vielen Kirchtürme bewundert und begeistert ausgerufen: »Köln ist die schönste Stadt von der ganzen Welt!«
Pap streichelte ihm lachend über den Kopf und antwortete: »Und eine der ältesten Deutschlands. Deine Vaterstadt.« Dann zeigte er in den Kölner Süden, wo sie wohnten. Ganz nahe am Rhein, von dem Conny sicher war, dass er der größte Fluss von der ganzen Welt war.
»Hast du den Dom auch gebaut, Pap?«, fragte Conny, denn sein Vater war Architekt. Der beste von der ganzen Welt.
Pap lachte und meinte, dass der Dom schon vor vielen hundert Jahren errichtet worden war, lange vor seiner eigenen Geburt.
Sicherlich war der Dom die allerälteste Kirche von allen. Auf der ganzen Welt.
»Und siehst du da hinten das Siebengebirge?« Wilhelm Monderath zeigte auf eine Gebirgskette am Horizont.
Conny stellte sich auf die Zehenspitzen, den Hals gestreckt, und zog sich an der steinernen Brüstung hoch, aber er konnte trotzdem nicht darüberblicken. Da nahm sein Vater ihn auf den Arm, und jetzt konnte auch Conny sehen, was er gemeint hatte.
»Von dort kommen die Steine, mit denen man den Dom gebaut hat«, sagte er. Conny erkannte die Hügel und sog den warmen Pap-Duft aus Nadelholz und Zigaretten in sich auf. Später, das nahm er sich vor, wollte er einmal so groß sein wie sein Pap, denn dann würde er den besten Überblick haben. Von allen.
»Wie viele Hügel sind das?«, fragte Pap, und Conny zählte sie. Laut. Bis fünf, denn die anderen Zahlen kannte er noch nicht.
»Sechs. Und. Sieben«, ergänzte Pap und erklärte ihm anschließend, wie die Berge entstanden waren. »Vor langer Zeit, lange bevor es den Dom gab, staute sich das Wasser im Rhein und konnte nicht weiterfließen. Da kamen sieben Riesen und schaufelten das Flussbett frei. Und als sie mit ihrer Arbeit fertig waren, klopften sie ihre Spaten auf den Boden, damit sich der Dreck löste. Die Dreckklumpen, die abfielen, kann man heute noch sehen. Sieben Stück.«
Der Herr Dombaumeister wollte Pap etwas zeigen. Deshalb gingen sie weiter und stiegen immer höher bis auf die siebzig Meter hohe Aussichtsplattform des Vierungsturmes. Conny konnte kaum atmen, weil es so schön war. Eine Möwe segelte im Wind. Er blickte ihr nach und entdeckte auf den Tabernakeln der Turmobergeschosse überlebensgroße Engel. Sie musizierten.
»Das sind Friedensengel«, erklärte sein Pap ihm. »Sie wachen über die Stadt.«
Da spürte Conny, dass ihm in Köln niemals etwas passieren würde.
Auf der Rückfahrt durfte er im Auto vorne sitzen, wie immer, wenn er mit Pap allein unterwegs war.
»Wenn du willst, können wir bald mal einen Ausflug ins Siebengebirge machen«, sagte sein Vater und gab Gas.
»Sind die Riesen weg?«, fragte Conny, denn er hatte Angst vor ihnen.
Normalerweise gingen er und sein Bruder Franz nach dem Abendbrot immer auf ihr Zimmer, um vor dem Zubettgehen noch ein wenig zu spielen. Aber an diesem Samstag meinte ihre Mutter, dass sie sitzen bleiben sollten, weil sie eine Überraschung hätte. Conny liebte Überraschungen und schaute sie erwartungsvoll an.
»Ihr bekommt noch ein Geschwisterchen«, sagte seine Mam strahlend.
Und so wie Pap schaute, wusste er es bereits.
»Ich will dann aber ein Schwesterchen«, rief Conny, und alle lachten.
»Ich will auch ein Mädchen!« Sein Vater legte den Arm um Mam und gab ihr einen Kuss auf die Wange.
»Mal sehen, was der Klapperstorch bringt«, antwortete sie.
»Wenn es ein Mädchen wird, dann soll sie auf jeden Fall Lizzy heißen«, meinte Pap und bat Franz, das Grammofon anzuwerfen. Dann tanzte er mit Mam, die immer noch ihre Schürze umhatte, zum Schlager von Willi Ostermann Walzer und sang lauthals mit: »Einmal am Rhein und dann zu Zwei’n alleine sein.«
Mit dem Lachen seiner Eltern aus dem Nebenzimmer und der Überlegung, woher der Klapperstorch die Kinder bekam, schlief Conny ein.
Am nächsten Morgen zerfetzte ein Schrei seine Träume. Innerhalb von Sekunden standen er und Franz dort, woher das Schreien gekommen war: im Schlafzimmer ihrer Eltern. Conny sah, wie sein Vater auf dem Rücken lag. Mit offenem Mund, sein Gesicht war dunkelblau. Die Mutter schüttelte ihn heulend und flehte, er möge zurückkommen. Aber Pap reagierte nicht und hatte die Augen so komisch offen. Auch Franz sprang auf das Bett und schüttelte seinen Vater ebenfalls, schrie und weinte. Wie gelähmt stand Conny in der Tür und vergaß zu atmen.
Stumm beobachtete er, wie immer mehr Menschen in die Wohnung kamen. Nachbarn. Leichenbeschauer. Verwandte. In der Stube wurde das Grammofon zur Seite geräumt und auch der Tisch, damit in der Mitte Platz war für den Sarg, in den sie seinen Vater gebettet hatten, den Rosenkranz um die weißen Finger gelegt. Die Fensterläden wurden verschlossen, Stühle rund um den Sarg gestellt und Kerzen angezündet.
Großmutter Helene kam aus Lindenthal und beweinte ihren Sohn. Stundenlang. Als sie ging, sagte sie zu Mam: »Ich habe selbst zwei Männer verloren.« Ihren Enkeln schaute sie beim Abschied tief in die Augen. »Ihr müsst jetzt tapfer sein.«
»Ja«, sagte Franz.
Conny nickte und hielt die Luft an, denn er mochte Großmutter Helenes Atem nicht, der immer nach Veilchenpastillen und Zwiebeln roch.
Dass sie tapfer sein sollen, sagten auch Oma Katring und Opa Max, die zu Fuß die zwei Kilometer aus dem Färberviertel gekommen waren. Und als sie aufbrachen, ermahnten sie Franz, dass er jetzt auf seine Mutter aufpassen müsse. Und auf den kleinen Bruder.
Dann kamen die vier Geschwister von Mam. Nach und nach. Blass und erschrocken. Aus ganz Köln. Auch sie meinten, die Jungen sollten tapfer sein.
Am Morgen vor der Beerdigung war auch Heinrich, der Bruder des Vaters, den alle nur Drickes nannten, angereist. Extra aus Berlin. Er schaute sich den toten Wilhelm lange an. Mit seinen geröteten Augen, die seine dicken Brillengläser vergrößerten. Dann legte er den Arm um Mam, ging mit ihr ins Nebenzimmer, und Conny hörte, wie seine Mutter weinte und etwas von Umständen sagte.
Jetzt war er allein mit seinem Vater. Zum ersten Mal, seit dieser sich nicht mehr bewegt hatte und so seltsam aussah. »Pap«, flüsterte er.
Doch sein Vater reagierte nicht. Er roch auch anders als sonst. Nach Apotheke. Zaghaft berührte Conny die bleichen Hände und erschrak, weil sie kalt waren – und hart. »Pap«, flüsterte er ein weiteres Mal.
Und als er wieder nicht antwortete, legte sich graue Schwere über Conny, die alle Farben erstickte.
»Wir müssen uns fertig machen«, sagte Franz am Morgen der Beerdigung, und dabei überschlug sich seine Stimme. Wie öfter in letzter Zeit. Er knöpfte Conny den Matrosenanzug zu und zog ihm einen geraden Scheitel durch sein Haar. Dann stopfte er sich das Braunhemd des deutschen Jungvolks in seine kurze Hose, nahm Conny bei der Hand und ging mit ihm und Mam durchs Treppenhaus. Die Aufwartefrau kehrte die Treppe und schaute nicht mürrisch wie sonst, denn heute waren sie etwas Besonderes: die Kinder, die jetzt keinen Vater mehr hatten.
Unten auf der Straße hatte Onkel Drickes die Tür zu seinem Mercedes 260 aufgehalten, Franz und Conny waren nach hinten geklettert, und ihre Mam hatte auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Und so waren sie aus der Kölner Südstadt herausgefahren, über die Ringe, auf denen das geschäftige Treiben weitergegangen war, als wäre dies ein Mittwoch wie jeder andere. Und nicht der Tag, an dem die Welt stillstand.
»Krraaab, krraaab, krraaab.«
Tapfer stand Conny zwischen seiner Mutter und Franz, gab Menschen, die »Herzliches Beileid« sagten, die Hand und machte einen Diener. Er schaute in keine Gesichter, nur auf Schuhe, und hörte: »Krraaab, krraaab, krraaab.«
Als die Kränze auf dem zugeschaufelten Grab verteilt waren und das Kreuz mit der Inschrift Wilhelm Monderath 22.8.1895–13.5.1933 in die Erde gesteckt wurde, wünschte Conny sich, einer der Riesen würde kommen und seinen Vater wieder ausgraben. Aber es kam keiner.
Onkel Drickes fuhr sie zurück in die Kölner Trajanstraße. Er schaltete den Motor nicht aus, als er vor dem Haus hielt. »Du kannst dich jederzeit bei mir melden, Ida, wenn ihr etwas braucht. Wir sind eine Familie.« Dann wandte er sich seinen Neffen zu und versprach: »Ich werde mich jetzt wie ein Vater um euch kümmern.«
Franz deutete ein Nicken an, und Conny schaute fragend.
So schaute er immer noch, als Onkel Drickes längst wieder nach Berlin gefahren und in der Wohnung alles fremd war, weil sein Vater fehlte.
»Darf ich mit Conny noch ein bisschen in den Römerpark?«, fragte Franz vielstimmig.
Ida nickte. »Du hörst auf deinen großen Bruder, ja?«
Conny nickte auch.
Franz nahm ihn bei der Hand, die sich warm anfühlte und an der er sicher war. Mit jedem Schritt über die Straße in den Park hinein fiel das Schwere von ihm ab, denn hier waren keine schwarz gekleideten Erwachsenen, die seltsam schauten. Hier waren Maikäfer, die er gleich mit Franz fangen würde.
Doch der blieb plötzlich stehen und schaute neugierig Richtung Universitätsgebäude, vor dem eine ungewohnte Betriebsamkeit herrschte. »Komm«, sagte er zu Conny und ging schneller.