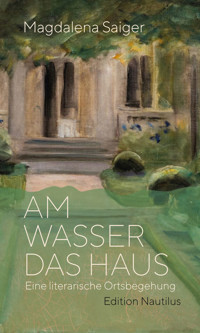Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Diesen Text wird nie jemand lesen.« Ein namenloser Erzähler, der seinem Erfolg im Kunstbetrieb und der Zivilisation den Rücken kehrt und ins Offene aufbricht. Ein Kunstwerk, das bei seiner Vollendung schon wieder zerstört werden soll. Und ein Dorf, das nur noch in den Erzählungen eines Einzelnen existiert. Zwei Männer begegnen sich dort, wo auf Google Maps die Umrisse unscharf werden, im Hinterland bei der Autobahn, wo schon lange niemand mehr absichtsvoll hingelangte. Der eine will in einer verlassenen Lagerhalle ein gigantisches Labyrinth aus Papier erschaffen, das nie jemand zu Gesicht bekommen soll. Sein Vorhaben entwickelt er, grimmig und entschlossen, im Zwiegespräch mit einem Publikum, dem er sich zugleich vehement verweigert. Der andere, der von ihm Giacometti genannt wird und dessen Anwesenheit ihm zunächst gar nicht gelegen kommt, widersetzt sich dem Lauf der Dinge, indem er Nacht für Nacht von seinem Dorf erzählt, das hier einst gestanden hat, bevor es einer Kohlegrube weichen musste. Einander beäugend, suchend und doch auf Abstand haltend bewegen sich die beiden Gestalten am Rand der Grube, ungewollt Verbündete in der Verteidigung des Ortes gegen Anfechtungen von außen. Magdalena Saigers Debüt ist ein poetischer, kunstvoll konstruierter Roman über die Suche nach Wahrhaftigkeit in einer entfremdeten Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MAGDALENA SAIGER, geboren 1985, lebt in Hamburg. Sie studierte Germanistik und Geschichte in Berlin und Madrid und promovierte an der Universität Hamburg in Geschichte. Mit dem Manuskript von Was ihr nicht seht oder Die absolute Nutzlosigkeit des Mondes war sie Preisträgerin des Hamburger Literaturpreises 2020.
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a
D-22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus 2021
Deutsche Erstausgabe März 2023
Umschlaggestaltung:
Maja Bechert
www.majabechert.de
Porträt der Autorin Seite 2:
© Andreas Hornoff
1. Auflage
ISBN EPUB 978-3-96054-310-7
Inhalt
WAS IHR NICHT SEHT ODER DIE ABSOLUTE NUTZLOSIGKEIT DES MONDES
EPILOG
DAS LETZTE
QUELLEN
Was ihr nicht sehtoderDie absolute Nutzlosigkeit des Mondes
Diesen Text wird nie jemand lesen.
Würdet ihr ihn lesen, ihr würdet euch wundern.
Wer kann schon damit rechnen, dass es das gibt: dass jemand aufbricht, sein Leben aufgibt, wie es doch recht glatt lief zuletzt. Und sucht sich einen Ort, der einem Nirgends nahekommt, sehr nahe, und baut dort unermüdlich, Tag und Nacht, an dem Kunstwerk, das nie jemand sehen wird – nicht weil sich niemand dafür interessieren würde, sondern weil es nie jemand sehen soll. An dem Kunstwerk, versteht ihr. Die Redewendung vom Hören und Sehen, das einem vergeht, hier würde sie wahr. Aber ihr, so viel ist sicher, werdet das nicht erlebt haben.
Es hat mich lange schon umgetrieben: Dass auf die Schönheit immer folgt, dass eure Blicke auf ihr umhertappen, grapschend und doch nichtig, und schon nach Worten suchen für irgendein Urteil, ein achtlos dahingesagtes Ach im Weitergehen und halb schon wieder auf der Suche nach einem Kaffeelatte, einem Klo oder einem Spiegel. Dass auf die Schönheit immer folgt: der Markt, der nichtswürdige. Ich bin so, dass ich das schwer aushalte. (Ich bin so geworden.) Habt ihr euch nie gefragt, was die Gioconda denken muss vor euren hochgereckten Tätzchen mit den Endgeräten. Aber nein, ihr fragt euch nie. Mit diesem Wissen war ich längst beladen.
Und dann hat mir neulich der Atem gestockt, als ich –.
Ich war eingenickt in der Bahn und aufgeschreckt, als der Fahrer mich anrempelte auf seinem letzten Kontrollgang. Endhaltestelle: Betriebsbahnhof. Ein Vagabund sei ich, und fand im abschätzigen Blick auf meine zerrissene Jeans volle Bestätigung, ein Vagabund, das Wort fand ich in seiner Altertümlichkeit nicht so übel, aber übel war, wie er mich rausgeworfen hat, bugsiert, sagt man, und wie ein Koffer stand ich dort, unsanft abgestellt, auf dem Betriebsgelände. Es dämmerte schon, der Schaffner löschte die Lichter, alle zugleich mit einem Hebelumlegen, schloss ab und brodelte leiser werdend davon. Ich solle selber sehen, wie ich von hier weg – …
Und jetzt stellt euch vor: Schotter und Gleise, schön im Wechsel, Schotter, Gleis, Schotter, darüber einiges an Stromversorgung samt zugehörigen Pfosten, und jedes Gleis führt geradewegs auf ein Garagentor zu, das schottergrau ist und geschlossen bis zum Boden aus: Schotter, kotztrist, das absolute Ende, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann steht da, fünf Armlängen von euch entfernt, exakt in der Mitte dieser absurden Anlage, und ihr könnt innerlich mitzählen, wie lange es dauert, bis das Bild von der Netzhaut im Gehirn anlangt: einundzwanzig, zweiundzwanzig, ein Hirsch. Der Schauer über die Haut zeigt es euch an: Das Bild ist da, obwohl es nicht sein kann – tatsächlich, leibhaftig, ein Hirsch.
Es gibt eine Verbindung von zart und mächtig, von verwegen und konzentriert, von flüchtig und robust, von weiblich und Macker, von überlegen, ratlos, bedrängt, abgeklärt, enorm, die sich exakt nur in einem Hirsch verwirklicht, der reglos dasteht und sein Geweih balanciert, und er tut das königlich wie ein Artist, der die sieben Eier so meisterhaft auf seinem Kinn trägt eins über dem andern, dass ihr ganz vergesst, dass Eier fallen können und zerbrechen. Der Hirsch stand ohne Regung, ein Hinterbein sacht angewinkelt und den Blick zu mir gewandt mit Augen, für die der Begriff Rehaugen abgedroschen wäre.
Überhaupt die Vergleiche. Der Hirsch ist von Natur aus einzig.
Ich sah die Flanke des Tiers sich sanft heben und senken unter dem dünn verkrusteten Fell und fühlte, wie mein eigener Atem
ging
und kam
ging
und kam, das ehrlichste Muster der Welt.
Es gibt diese Liebesgedichte, love poems, die beschreiben, wie die Zeit stillsteht und die Welt in einer Umarmung vergeht, ein Schmu ist das. Aber hier, ich habe es erlebt. Es verging eine Sekunde, es verging ein Jahr, es verging irgendeine Zeit, und wir standen dort, am Ende der Welt, in der Mitte der Welt, fünf Armlängen voneinander entfernt, in namenloser Zugewandtheit, und ich war der Stammesführer Bars, dem der Wunderhirsch das Land Ungarn zu Füßen legt, und war die polnischen Mönche mit Blick auf die gesegnete Stätte für den Bau ihrer Klöster, ich war die huddled masses vor der Freiheitsstatue im Novembernebel, war der Schamane vor dem weißen Boten der Anderswelt, ich war die Heilige Ida, die den Hirsch aus Stein an ihre Hüfte drückt auf ewig über dem Portal einer Kathedrale, war Hubertus, der das immer noch frische Wunder vom Heiligen Eustachius geerbt hat, und ich brauchte kein Kreuz zwischen den Ästen des Geweihs und keine tausend brennenden Kerzen auf seinen Spitzen, um so wach zu sein und so stumm und zu wissen: Du musst dein Leben ändern.
Wie ausgelutscht die Worte sind. Ich schreibe Erweckung, und ihr denkt an Saulus auf der staubigen Landstraße nach Damaskus, ich schreibe Wunderhirsch, und ihr denkt an Jägermeister und Folklore in schwulstigen Wandrahmen, ich schreibe Stammesführer, und ihr werdet gleich ganz national, ich schreibe Anmut, und ihr denkt an die Rehaugen (Rehaugen!) der Bibliothekarin, ich schreibe Lebenändern, ihr habt dazu Kalendersprüche und Ratgeber und Erfahrungen, ich schreibe Schönheit, und da wird es am schlimmsten.
Ich schreibe: Es war einfach nur ein Hirsch.
Und: Ich sah ihn.
Aber durch und durch und durch.
Dass es mich jetzt noch schaudert.
Aber ihr wart nicht dabei.
Warum ich das erzähle: Das war der Beginn.
Es heißt, Karl der Große sei auch einmal einem Hirsch begegnet, auf der Jagd, und anstatt das Tier zu erschießen, legte er ihm ein kostbares Halsband um, das trug die Worte: Lieber Jäger, lass mich leben, ich will dir mein Halsband geben, und ließ ihn frei. Das in etwa meine ich – und nicht, dass sie in Magdeburg den Hirsch wie eingefroren auf eine Säule stellen, eine Hirschsäule!, schon das Wort ist ein Hohn und nicht besser als die Hirschleichen mit stumpfen Glasaugen an den Wänden von Adelsgalerien und Waidmannswohnzimmern, also Möchtegernadelsgalerien. Dass ich ausgerechnet bei Karl dem Großen auf Verständnis stoßen würde, wer hätte das gedacht.
Dass ihr mich recht versteht: Um Hirsche geht es mir nicht.
Aber um das, was mich antreibt seit damals dort draußen.
Den Ort zu finden war nicht leicht. Er durfte nicht zu finden sein, eigentlich noch nicht einmal von mir oder Leuten wie mir, darin bestand das Paradox meines Findens, und er durfte nicht bleiben, nicht länger jedenfalls als bis zum Abschluss des Werks – sollte ich schreiben: zur Vollendung? –, dafür aber wiederum lange genug.
Es kostete mich Tage, die ich über Wälder hinwegflog und über weit wuchernde Industriegebiete, über Talsenken, Weinberge und Flughafenhangars, im Tiefflug von Google Maps mit wechselnden Maßstäben, bis mir jedes Maß verschwamm und jeder Wald ein Fleckchen Moos und jede Gesteinskerbe der Cañon de Somoto sein konnten, jede Landschaft mit gleicher Wahrscheinlichkeit die Landkarte dieser Landschaft. Die kleingewürfelten Teppichmuster der Landwirtschaft verhießen nichts Gutes, ahnte ich doch auf den fein verzweigten Borten der Feldwege misstrauische Bauern auf Traktoren hin und her patrouillieren auf der Suche nach Schädlingen und Unkraut wie mir. Manchmal schraubte ich mich höher hinauf in großen Zügen, zog die Gefilde unter mir beiseite, ließ Flüsse zu Fäden werden und übersprang eine Grenze wie nichts, denn von hier oben ist das die Grenze: ein Nichts zwischen zwei Farnen, und ernstzunehmen nur die atemberaubende Kante zwischen Land und Meer, die ihr dort unten mit einem Sandschäufelchen in der Hand überquert. Ich schwebte eine Zeitlang über der flirrenden Bläue, durchzogen von schwachen Copyright-Inschriften (© 2020 Google) und den gestrichelten Nähten der Fährverbindungen von Kiel nach Klaipeda und von Poti nach Warna, verwarf aber die Idee, nach einer aufgegebenen Bohrinsel zu suchen, und wandte mich dem Festland zu: Hinterland war, was mich ansprach, je tieferes Hinterland, desto besser, das Hinterland von Hinterländern, die Zuflucht hinter der Zuflucht, und so wagte ich über graubraunen Flächen, deren Gestalt mir unberechenbar genug erschien, den Sturzflug, notierte erste Koordinaten und löschte sie, wenn im Näherkommen die Bildauflösung zu fein wurde, denn das bedeutete: Dort sind Menschen, hic sunt homines, ich aber suchte einen Ort, an dem es Löwen gibt.
Mein Unterfangen führte mich auf die Dorfanger verlassener Siedlungen im tiefsten Litauen und durch Ebenen am Gelben Fluss, wo die Kamerabilder aneinanderstießen und eine schlecht vernähte Kante bildeten, einen nebligen Schlund, in dessen Weichbild ich mich zoomend Stoß um Stoß versenkte. Die Abbruchkante des Definierten. Dort wäre die Falte, in der ich Schutz finden würde vor allen Blicken.
Doch am Ende lag, was ich suchte, näher als gedacht: Ich hatte schon mehrfach den Globus umrundet in seltsamen Schlieren, war wieder einmal zurückgekehrt zum Ausgangspunkt und betrachtete soeben die Windungen eines Autobahnkreuzes, des letzten vor der Grenze, plötzlich fasziniert von der Form dieses vierblättrigen Kleeblatts, in dem wir rechts abbiegen, um nach links zu fahren, und in dem alle Richtungen des Winds einmal im Kreis gehen, ehe sie sich zerstreuen. Eine kleine Asymmetrie ließ mich aufmerken, ein winziger Fussel seitab, dem ich, ein wenig gelangweilt von der Einfalt der mehrspurigen Achsen und Schleifen, folgte und der mich auf einmal im Nirgends zurückließ. Ich schreckte auf wie aus einem kurzen Schlummer und brauchte mehrere Züge, um wieder auf Schrift zu stoßen, in alle Richtungen fehlten die Angaben, so dass ich schon fürchtete, das Programm hätte einen Aussetzer. Aber dann setzten die Linien wieder ein, die das Bild in vertrauter Manier durchkreuzten, die Namen – in zwei Sprachen schon, eine Mischgegend – und Nummern, Ergebnis der menschlichen Wut zu benennen und zu markieren: Wir kennen uns aus, wir finden uns zurecht, und dich finden wir überall.
Dazwischen aber lag eine seltsam schrundige Fläche ohne Anhaltspunkt, die hellbraunen Schlieren wie von Säure zerfressen und nicht zu vereinbaren mit den zarten, aber unbeugsamen Rasterlinien der Bildquadrate, die alle vereint den Globus zusammensetzen. Ich kehrte immer wieder um und überquerte mehrmals in verschiedenen Flughöhen die merkwürdigen Schraffuren, unfähig zu begreifen, was hier vorzufinden sein mochte. Wald war es nicht, auch kein Wasser, eher ein fahles Feld, eine öde Platte, in die ein Riese vor langer Zeit etwas Unleserliches gekratzt hatte, das nun den Blicken entzogen war durch eine schlechtere Auflösung. Eine aus der Landkarte gefräste und beiseitegeworfene Fläche, die weniger durch ihre Größe als durch die Schludrigkeit ihrer Umrisse auffiel. Terrain vague. Am westlichen Rand des seltsamen Gebildes endete der bindfadendünne Pfad, der mich hierher geführt hatte, vor einem kleinen Haufen ausgekippter Würfel.
Vielleicht hatte ich genug über der Welt gekreist. Jedenfalls mietete ich mir am nächsten Tag einen Wagen, legte einen Notizblock und einen Umschlag mit etwas Geld auf den Beifahrersitz, warf Schlafsack, Unterwäsche und Zahnbürste auf die Rückbank, wer konnte schon wissen, und fuhr Richtung Autobahn. Bis auf eine kurze Pause an einer Raststätte mit dem klingenden Namen eines nahen Moorgebiets – ich tankte, nahm eine Portion lauwarmer Pommes zu mir und stellte mir vor, wie irgendwo hinter den Parkflächen lautlos das Moor vertrocknete – fuhr ich durch, amüsiert von der Neuheit der Ameisenperspektive und hin und wieder zu meinem Vogelauge dort oben hinaufblinzelnd. Die Welt war doch groß und kein bisschen abstrakt; nie war mir mein Käferdasein bewusster als in dem Gewirr der Schilder, Fluchten, Erdformationen, das ich fast schon für überholt gehalten hatte in meinem Flug.
Es ging schon gegen Abend, als ich mich meinem Ziel näherte. Der Verkehr nahm mehr und mehr ab, je näher ich der Grenze kam, ich schnitt in den Biegungen übermütig drei Fahrbahnspuren, im Rückspiegel entfernte sich die gleiche Leere, die sich unerschöpflich vor mir auffaltete, zerlegt von den Schatten der Kiefernstämme, die sich flach über die Autobahn warfen, mir den Blick zersäbelten.
Mit heller Freude stellte ich fest, dass ich den Abzweig nicht fand. Mehrmals fuhr ich an der nächstmöglichen Ausfahrt zurück, schlich, die Nase dicht an der Windschutzscheibe, die fragliche Stelle entlang, hielt schließlich ein ausreichendes Stück entfernt auf dem Standstreifen und ging zu Fuß die Leitplanke entlang, als suchte ich eine verlorene Radkappe.
Erst jetzt – die Natur hatte weiter gewirkt und die klarkantigen Bilddaten von Google hinter sich gelassen – erkannte ich den schmalen Pfad, der ein Stück unterhalb der Böschung verlief, stürzte mich durch schulterhohes Gestrüpp, das sich fest um Papiertaschentücher und Plastikflaschen wickelte, den Abhang hinunter und folgte dem unebenen Verlauf moosbewachsener, rissiger Platten, deren Richtung sich in einer Biegung von der Fahrbahn löste. Vogelgezwitscher umgab mich und eine pochende Neugier: Hier?
Hier. Maschendraht, von bleichen Grassträhnen durchflochten und in der Höhe ein wenig zusammengesackt, ein Tor, das lange nicht geöffnet worden war, auf mein Zerren hin aber nachgab, ein Hof mit aufgeplatzten Platten, umgeben von drei Gebäuden: zwei flachen Nutzbauten mit staubtrüben Fenstern und angelehnten Türen vor einer sich aufwölbenden Halle, in der einst die Drachen gehaust haben mussten. Es knirschte unter meinen Schritten, zerbröseltes Gemäuer, geborstenes Fensterglas, Drahtgeflecht. Die Dächer waren von fedrigen Birkenzweigen aus den Dachrinnen gesäumt, schienen aber noch heil – und dahinter: der Mond.
Die Leere.
Das Ende der Welt, und alle fahren mit Softpop im Radio daran vorbei.
Das Blinde am blinden Fleck ist nicht der blinde Fleck.
Natürlich hatte ich recherchiert: Ein Tagebau hatte hier zu wüten begonnen, bis die Aktionärsversammlung vor der Präsentationsleinwand im Congress Centre irgendeiner weit entfernten Stadt befand, dass der Erdboden, sie rümpften gelangweilt-verärgert die Nasen, doch nicht genug hergab, nicht den Erwartungen entsprach, und die Herde der Bagger anderswo ihr grölendes Fressen veranstaltete.
Zurückgeblieben: die gefledderte Welt. Krater, Furchen, Geröllhalden, ein staubiger Kessel, die im Halbrund geschliffene Spur einer gewaltigen Tatze, die sich hier spielerisch die Krallen geschärft hatte und dann abgelenkt wurde, andernorts zuschlug, ein riesenhaftes Wesen, Bestie oder frustrierter Gott, der sich entfernt hat.
Wie eine Burg aber standen die verlassenen Betriebsgebäude auf einem Sockel am Rande der Tiefe – eine uneinnehmbare Festung, in drei Richtungen durch den Graben gedeckt und in der vierten von ungepflegtem Wald flankiert.
Nein, dies war nicht der Mond und nicht die innere Mongolei; es gibt tiefere Gruben und ergiebigere Kohlevorkommen, das Unternehmen war damals enttäuscht gewesen, nach kurzer heißer Phase: ein Flop, auch wenn das Wort nur hinter vorgehaltener Hand fiel, und auch unter fotografischen Aspekten hielt der Anblick den Panoramen der Lausitz nicht stand, wer filmt noch das Auslaufen der Marco Polo, seit es die MSC Gülsün gibt, aber genau das war ja das Gute, wer sollte mich hier suchen.
(Sogar Tschernobyl ist ja längst ein gut erschlossenes Motiv geworden und beliefert seinen Markt, ich zählte vierzehn Fotoausstellungen und neun Filme auf den großen Festivals in den letzten fünf Jahren. Das nennt ihr weit draußen, einen lost place, an dem ihr euch beeilt, vor den anderen auf den Auslöser zu drücken.
Die verrammelte Garage des Nachbarn im eigenen Hinterhof ist der fernere Planet.)
Und dann war auch noch von einem See die Rede – von einer ganzen Seenlandschaft, in großspurigeren Ankündigungen –, der in sogenannter naher Zukunft hier entstehen sollte, die Gegend noch über die Grenzen der Grube hinaus fluten und in ein Naherholungsgebiet (für wen eigentlich, aus welcher Nähe?) verwandeln. Ich nickte zufrieden, als ich davon las. Dies würde nicht von Dauer sein.
Hier also. Hier.
Ich sah mich noch ein wenig um, blickte ehrfürchtig in die Kathedrale der Maschinenhalle hinauf und vermaß mit den Blicken ihre Höhe, sie war zu meiner Freude bis auf wenige Hinterlassenschaften leer, ich erlaubte mir den Übermut und drehte mich mitten im Raum auf der Stelle, ich nickte und kicherte, ging dann zum Auto zurück und notierte in eine Spalte das Vorgefundene: Stahlstreben, Holzpaletten, verstreute Reste von (vermutlich) Dynamit, die geschätzte Fläche und Höhe der Halle, in eine andere das Notwendige, beginnend mit: Gartenschere, Spaten, Seil, ersetzte Gartenschere durch Machete, als ich an die Größe der Schösslinge dachte, die ich würde entfernen müssen, um den Weg für den Wagen freizumachen. Dann fuhr ich zurück, einen kleinen Jubel auf den Lippen.
Keine zwei Wochen später war ich wieder da – ich hatte mir in der Zwischenzeit einen gebrauchten Wagen gekauft, einen Kombi, beworben für Familienurlaube in Schweden (allein dass ich mich für das Auto interessierte, machte mich in den Augen meines Gegenübers zum Familienvater) –, und richtete mir in einem der Flachbauten ein Lager ein aus dem, was ich besorgt hatte: ein Lager für mich – Gaskocher, Matratze, Wolldecken, Zigaretten, Wasserkanister, ein paar Flaschen Aquavit, ein Band über die Kulturgeschichte des Labyrinths, einer über japanische Wandschirme, einer über Optik, dazu eine Handvoll Bildbände, die ich für vage relevant hielt –, ein Lager mit dem Material, das sich seitdem mit den erstaunlichsten und notwendigsten Dingen füllte. Ich durchstreifte über Tage die Innenräume und die Ränder der Schlucht, suchte in leerstehenden Teeküchen und verwucherten Schrotthaufen zusammen, was sich gebrauchen ließ, und sortierte abends im Licht meiner Stirnlampe die Stapel, fertigte neue Listen an: Bestand, Bedarf.
Der Weg zum nächsten Baumarkt war nicht weit, ein auf die Wiese gesetztes Industriegebiet mit XXL Möbelwelten und Gartencentern, wie vom Himmel gekippt aufs freie Feld, Hier investiert Europa in die ländlichen Regionen, zog den blechernen Verkehr an wie ein Magnet, doch vermied ich, allzu oft dort einzukaufen, fuhr lieber weite Strecken für eine Handvoll Dinge, die so, nebeneinander auf dem Kassenband vorwärtsruckelnd, haushaltsüblich unverdächtig wirkten.
In den Nächten fertigte ich Zeichnungen an, kauernd im Licht einer Funzel, bis sich ringsum die Stapel meiner Papiere schichteten, die ich im Morgenlicht, nach einem kurzen Mahl und einem Schwall Wasser über Gesicht und Achseln – ein an einer Außenwand angebrachter Wasserhahn hatte sich spuckend in Gang bringen lassen –, wieder zur Hand nahm, übermalte, beschriftete, vermaß, neue Besorgungslisten erstellte: Winkel, Schrauben, Kerzen, Kreide, Akkuleuchten, Folie, Leinwand, Samt, ich wusste noch nicht recht und spielte mit den Formen und Oberflächen.
Bild oder Raum, am Anfang war das noch eine Frage.
Was sollte es werden?
Der große Wurf. Ich musste dafür viel verwerfen, vieles zerschlug sich von selbst, zerschellte an den Begrenztheiten der Materie, der Statik, der menschenmöglichen Kraft. In manchen Momenten wusste ich deutlicher als in anderen, wie ich mich überhob, überheben musste. Dann öffnete ich eine Dose Büchsenfraß, wärmte sie über einem kleinen Feuer hinter der Halle und aß mit dem einen Löffel, schlief nach zwei tiefen, puren Schlucken Aquavit ein und fand im glücklichen Fall im Traum einen Zipfel dessen wieder, was mir vorschwebte.
Was sollte es werden?
Ein Gespinst. Ich wusste: Es muss sich das Licht drin verfangen. Es muss einen durchleuchten, umfangen, überspülen, erheben, beleben, fesseln, waschen, freigeben. Ein Labyrinth, in dem ihr jede Größe und Winzigkeit einnehmen könnt: als Kröte im satten Grasland, als Koloss hoch über der Meerenge, den Blick auf die Länder, die hinter den Wassern sein müssen, als Fisch, der seine Farbe mit dem Schwarm teilt. Ein Raum, der innen ist und außen zugleich und wo für einen Augenblick (wir sagen Augenblick und meinen Sekunde und sagen Sekunde und meinen Moment und sagen Moment und meinen Wimpernschlag) das Gleichgewicht der Welt hergestellt ist. Es ist das Labyrinth in euch selbst, das müsst ihr geahnt haben; hier aber findet ihr hinein.
Labyrinthe im eigentlichen Sinne sind – dem unpräzisen Sprachgebrauch zum Trotz – nicht identisch mit Irrgärten. Im Gegensatz zu einem Irrgarten, der viele Wege zur Wahl anbietet, die sich kreuzen, darunter auch Sackgassen, führt das Labyrinth durch das Abschreiten von unübersichtlichen Umwegen, unter fortwährend pendelndem Wechseln der Richtung, aber kreuzungsfrei zum Zentrum. Die einzige Sackgasse eines Labyrinths liegt demnach: im Zentrum.
Wie es zur Überlagerung der Begriffe kam, bleibt zu klären. Am wahrscheinlichsten ist die Annahme, dass – spätestens in hellenistischer Zeit – die vermutlich im Labyrinth abgebildete Tanzfigur nicht mehr verstanden wurde. Mit der Schaffung von Irrgärten im 15. Jahrhundert beginnt endgültig die Säkularisierung der Labyrinth-Vorstellung.
Am sechsten Tag traf ich auf Giacometti. Ich kam mit der Materialfrage nicht recht voran und hatte mir vorgenommen, die Morgenstunden in der Halle zu verbringen, die Wanderung des Lichts zu verfolgen und in Skizzen zu vermessen: die Kegel der sonnigen Tage und wann sie mit ihren Suchbewegungen die untere, wann die obere Kante der Wände erreichten, die wolkigen Schatten des diffusen Regenlichts, und zu errechnen, wie es stehen würde im April, im Juni, im September und zur Sonnwende im Winter.
Ich hockte also am Boden, die Türflügel zum Vorraum und nach draußen standen weit offen, und der Bleistift hielt das Licht fest, das immer schon weiter war, überholte es dann leichthin auf Rechenwegen, wusste im Vorhinein über seinen Weg Bescheid, ein Göttergefühl –
– da wurde die helle Fläche vor mir durchkreuzt von einem Schatten. Ich erstarrte, und auch der Schatten, der von hinter mir auf die Wand vor mir fiel, stand so starr, dass ich einen Moment glaubte, er sei mein eigener, der sich losgemacht hatte und mir jetzt entgegentrat.
Ich überlegte, ob ich genug getrunken hatte, doch nein, fiebrig fühlte ich mich nicht.
Dann räusperte sich eine Stimme, die lange nicht mehr gebraucht worden zu sein schien, länger als meine eigene, die ich räuspern musste, ehe ich antwortete.
Hau ab, sagte der Schatten, und weil er aussprach, was ich dachte, war mein Zweifel bezüglich unserer Identität nicht ausgeräumt.
Ich wartete, ob noch etwas kam, während er offenbar wartete, dass ich seiner Aufforderung folgen würde. Ich überlegte, ob der Satz gewalttätig geklungen hatte und dass ich in meiner Kauerposition eine schlechte Ausgangslage für einen Kampf hatte. Aber die Stimme hatte auf müde Weise entschieden geklungen und nicht mehr jung. Körnig, rau; ob Mann oder Frau, war nicht zu sagen. Ich richtete mich langsam auf und wandte mich um.
Im Gegenlicht des Durchgangs stand eine Gestalt in einem übergroßen Anorak, der viel zu breit über kantige Schultern hing, ein angetrockneter, unbrauchbarer Flügel, ein Heldenmantel, nachdem der Held in den Sumpf gefallen und zur Lachnummer geworden ist. Das graue Haar war ungleichmäßig verstruppt, wie mit einem stumpfen Messer gestutzt, die Beine, dünn wie Storchenstängel, erahnbar in verbeulten Arbeitshosen, die Hosenbeine, zu lang, schlugen Falten über groben Schuhen (in etwa meine Größe). Ihr kennt die Porträts von Giacometti – Giacometti, der im Regen die Straße überquert und unter dem Zelt seines Parkas auf Henri Cartier-Bresson zuhuscht, Giacometti mit herbem Gesicht wie von ihm selbst geformt, der die Arme auf dem Tisch verschränkt hat und den Blick nicht abwendet, nie mehr, denkst du, wird der den Blick abwenden. – Hier stand er vor mir. Die Arme hingen herab, man hätte es fast lässig nennen können, aber die Hände kneteten die Luft, was ich als Anzeichen einer Erregung nahm. Noch immer hingen die zwei Worte in der Luft und wollten sich nicht setzen.
Wer sind Sie, fragte ich, um das Schweigen zu brechen, und meine Stimme klang wie lange nicht gebraucht. An dieser Anrede haben wir seitdem nichts mehr geändert: Ich sprach per Sie, er duzte mich, wenn er mich denn ansprach. Seinen wirklichen Namen habe ich nie erfahren, so blieb er Giacometti für mich, der ihm kein Begriff ist, wüsste er, dass ich ihn so nenne, er würde vermutlich sagen: Nicht mein Problem.