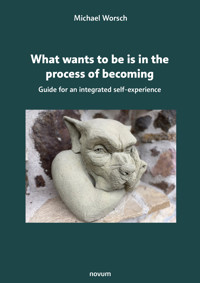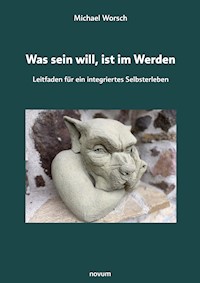
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was sein will, ist im Werden – diese Grundannahme erinnert uns daran, dass sich Selbstentfaltung nicht erzwingen lässt. Sie soll Menschen auch dazu anregen, den Weg ins Freie anzutreten, ihrer Sehnsucht nach dem Ganzen zu vertrauen und die Schattenseiten der Seele im Licht der Sonne zu betrachten. Dieses Selbsterleben ist eine Reise zum Herzen – und von dort ins Freie. Erst, wenn der Mensch der Sehnsucht folgt, kann er sich entfalten, wie es der eigenen Bestimmung entspricht. In essayistischer Form beleuchtet Michael Worsch den Rundhorizont seiner Praxiserfahrungen als Psychotherapeut und Theaterregisseur mit Blick auf Symbolisierungsprozesse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Impressum 3
Widmung 4
Einleitung 6
Terminologischer Diskurs 22
Erstes Kapitel 38
1.1 Erfahrungen aus der Praxis 39
1.2 Manch Perspektivenwechsel 53
1.3 Probleme der Verständigung 64
1.4 Sozialpsychologischer Diskurs 80
Zweites Kapitel 97
2.1 Erfahrungen mit Ablehnung 98
2.2 Erfahrungen mit Benutzung 112
2.3 Sehnsucht nach dem Ganzen 129
2.4 Tiefenpsychologischer Diskurs 147
Drittes Kapitel 163
3.1 Moralvorstellung und Genugtuung 164
3.2 Ausflug in Gegenwelten 179
3.3 Anhaftung gilt es zu lösen 193
3.4 Affekttheoretischer Diskurs 211
Viertes Kapitel 224
4.1 Gefühlte Unbefangenheit 225
4.2 Schritt für Schritt ins Freie 240
4.3 Im Licht der Veränderung 251
4.4 Identitätstheoretischer Diskurs 271
Fünftes Kapitel 284
5.1 Symbolisierungsprozesse 285
5.2 Im Kraftfeld des Lebensstroms 306
5.3 Einladung zum Experiment 318
5.4 Neurobiologisch spekulativer Diskurs 343
Schlussworte 360
Literaturverzeichnis 361
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2022 novum publishing
ISBN Printausgabe:978-3-99131-715-9
ISBN e-book: 978-3-99131-716-6
Lektorat:Mag. Elisabeth Pfurtscheller
Umschlagfoto:www.die-klause.at Gesundheitsgut Bad Gleichenberg
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen:Bilder 1, 4–17: Michael Worsch,
Bilder 2–3: Zarbock, Gerhard (2014), Praxisbuch Verhaltenstherapie,
Bild 18: Greif, Siegfried (2001), Selbstorganisierende Prozesse beim Lernen und Handeln
www.novumverlag.com
Widmung
Für Lena Valeria
„Was sein will, ist im Werden“,
dachte die Schildkröte und schlüpfte.
So begann die Reise in den Ozean.
Ich danke meinen engsten Vertrauten für ihre Unterstützung in den vielen Dialogen; jenen Lehrenden, die mir den Zugang zur eigenen Dunkelkammer öffneten. Danken möchte ich auch den Menschen, die ich ein Stück weit begleiten durfte, indem sie mir ihre Erfahrungen anvertrauten. Ich wünsche jenen, die das Buch in ihren Händen halten, dass sich ihr Interesse an Psyche, Kunst und Therapie damit vertieft. Und ich wünsche mir, dass die mir Unbekannten diesen Leitfaden weiterspinnen, anderen zutragen.
Bad Gleichenberg, Herbst 2022
Wichtiger Hinweis:
Der Verlag hat gemeinsam mit dem Autor große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte lassen sich Fehler nicht ganz ausschließen. Autor und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht.
Einleitung
Was ist ein Leitfaden? Dieser zieht sich als Orientierungslinie durch Phasen unseres Lebens. Er ist auch ein Garn, aus dem der Stoff für Erzählungen gewoben wird. Und schließlich ist er ein Symbol für die Sinnbildung, wo es um das Erkennen und Herstellen von Zusammenhängen geht. Unüberschaubar ist die Vielzahl an Publikationen zum Begriff des Selbstkonzepts. Meine persönliche Auffassung leitet diese Abhandlung ein. Was ist ein Selbstkonzept? Am ehesten lässt es sich als Resümee sämtlicher Erfahrungen, des Wissens um einen selbst, sein Denken, Fühlen und Handeln verstehen. Unendlich viele Aspekte und womöglich unaufgelöste Konflikte bilden ein Netz aus Erfahrungswissen, Wünschen und Sehnsüchten, Hoffnungen und Befürchtungen, Interessen und Bedenken. Das Selbstkonzept ist auch eine Art Fundus für gelungene und misslungene Strategien, gleichsam die Konsequenz aus Versuch und Irrtum im Laufe des Lebens. Insofern ist dasSelbstkonzeptmodifizierbar. Durch aufwühlende Ereignisse und erschütternde Vorfälle kann es zu Verwerfungen des bisherigen Selbstkonzepts kommen.
Wer sind wir und wie viele, wenn Gestalten auf der inneren Bühne in Dialog treten? Ich orientiere mich unter anderem am Ego-State-Modell nach Watkins und Watkins (2012). Es scheint so, dass aktuelle Konzeptionen des Selbstden Begriff der Identität modifizieren, insofern Identität einst als stabile Selbstgleichheit galt. Tendenzen in diese Richtung begannen Teilidentitäten und postmoderne Identitätskonstruktionen (Keupp et al., 1999) in den relevanten Diskurs aufzunehmen. Heute weist die gesellschaftliche Komplexität in Bezug auf Gender und Queer Dekonstruktionen normativer Identitätskonstruktionen auf. Anlässlich steigender Komplexität vermag psychotherapeutische Arbeit die Integration von Partialkonzepten des Selbst zu fördern. Daher werde ich mich mit demintegrierten Selbsterlebenund demkontrastiven Selbstkonzeptbefassen, das ich vomnegativen Selbstkonzeptunterscheide.
Ein integriertes Selbsterleben verstehe ich als Prozess, der fortlaufend zu Stimmigkeit und Konsistenz führt. Ein kontrastives Selbstkonzept zeichnet sich hingegen durch Trennwände zwischen konformen und non-konformen Verhaltensweisen aus. Wie ich erläutern werde, sehe ich dieses Konzept als ein in der Regel vorgängiges Modell, um mit den Widersprüchlichkeiten zwischen Innen und Außen zurande zu kommen. Insofern befinden sichSelbstgefühl,SelbstbildundSelbstwertmiteinander im Clinch, was für Betroffene und ihre Bezugspersonen anstrengend sein kann. Folglich interessieren mich über weite Strecken vorliegender Arbeit Formen von Ambivalenz und Ambivalenzspaltung.
Wohin geht die Reise?
Für ein nahtloses Gewand braucht es einen passenden Stoff, den der Leitfaden für einintegriertes Selbsterlebenweben soll. Es liegt der Schluss nahe, dassLebenskunsterst damit beginnen kann, einintegriertes Selbsterlebenzu realisieren, wenn Emotionen unmittelbar und strukturell an Symbolisierung gekoppelt werden können. Auf dem Feld der Kunst ist vieles davon möglich. Doch es bedarf therapeutischer Kompetenz, um Emotionalität und Symbolisierung im Sinne der Mentalisierungspraxis strukturell zu koppeln. Strukturelle Koppelung bedeutet, dass sich Komponenten und Funktionen, mehr als nur Relationen, zu einem System organisieren lassen. Ein komplexer Prozess, der Kompetenz in Hinblick auf die Selbstregulierung abverlangt.
Insofern ist einintegriertes Selbsterlebendie dynamische Organisation auch zuwiderlaufender Tendenzen. Integration kann vorankommen, wenn zwischen Polaritäten eine Synthese gelingt undAmbivalenznicht mehr zu Spaltungen führt. Ambivalenz ist daher ein wesentlicher Faktor, den es zu modifizieren gilt. Das bedeutet an erster Stelle die Haltung zu inneren Konflikten sowie den Umgang mit äußeren Konflikten. So beinhaltet Selbstregulierung betreffend Konflikte auch Lösungskompetenz und Multiperspektivität als Voraussetzung fürAmbiguitätstoleranz,ein Zulassen von Mehrdeutigkeit. Naturgemäß betrifft dies sowohl kreative als auch soziale Kompetenzen.
Welche Trajektorie (Anziehungskraft) dirigiert die generelle Ausrichtung von uns Menschen? Es ist unsere Wachstumstendenz, die qualitativ zu verstehen ist. Wenn qualitatives Wachstum zutreffen soll, dann impliziert dies (in Anlehnung an die Physik) Syntropie im Unterschied zu Entropie. Es ist im Hinblick auf den Unterschied zwischen integriertem Selbsterleben und kontrastivem Selbstkonzept naheliegend, die unzureichende Integration widersprüchlicher Facetten von der lebensgeschichtlichen Entwicklung her zu sehen. Integration erfordert in allen Fällen die Ablöse affektiver Überwältigung durch Symbolisierungsprozesse. Mentalisierungspraxis realisiert sie mithilfe kunstaffiner Gestaltungsmittel. Integration verweist auf eine holistische Tendenz von Wachstum, die regulative Zielvorstellung meines transdisziplinären Konzepts.
Ein holistisches Verständnis
Ein holistisches Verständnis sieht nicht nur globale Zusammenhänge, wie wir sie heute kennen, sondern ist ein Modell, das durch dieSpekulative Philosophievon Alfred North Whitehead (1984) artikuliert wurde. Holismus als Überbau systemischen Denkens übersteigt unseren heutigen Horizont. Ich erachte ihn als Entwurf, wobei es für das Verstehen psychischer Selbstorganisation erheblich ist, biologische, soziale, kulturelle und transzendentale (spirituelle) Komponenten zu berücksichtigen. Ich deute den Begriff ‚Selbst‘ nicht adäquat als ‚Seele‘. Allemal bedeutet ein holistisches Verständnisseelischer Wirklichkeit, dass es sich um Felderfahrung handelt, die nicht beim individuellen Ichbewusstsein und seinem begrenzten Wissenshorizont haltmacht. Indem das ‚Selbst‘ im Grunde eine rückbezügliche Bezeichnung für ‚Eigenes‘ darstellt, lässt sich der Begriff ‚Seele‘ durchaus überindividuell und transpersonal auffassen. Mein Ansatz schließt ein Vorleben und Nachleben jener Entität, wie die ‚Seele‘ hinlänglich vorgestellt wird, aus. Meine Auffassung verweigert sich jedoch nicht der Annahme, dass es sich bei derseelischen Wirklichkeitum ein allumfassendes Informationsfeld handeln könnte.
Spekulationen über ein ‚wissendes Feld‘ sowie zahlreiche Phänomene im Kontext von Aufstellungen legen die Vermutung nahe, dassrepräsentierende Wahrnehmungeine Informationserfassung ermöglicht, die nicht auf das subjektive Ich von Menschen beschränkt ist. Weiterreichende Spekulation betreffen den Begriff ‚Weltgeist‘, der von Friedrich Hegel (Taylor, 1983) stammt. Dieser große Geist gestaltet das Universum in der Weise, dass sich durch das Bewusstsein des Menschen das Universum explizit selbst reflektiert. Einen Schritt weiter in diese Richtung öffnet sich die Tür zum Mystizismus. Ich denke da an erster Stelle an Meister Eckhart.
In einer langen Reihe religiöser und spiritueller Traditionen positioniert sich Veit Lindau (2018), die Energie des Universums sei schlicht Liebe. Richard David Precht referiert diesbezüglich über den Logiker Charles Sanders Peirce(1839-1914). Die zentrale formende Kraft erkennt Peirce in der Liebe und für ihn ist sie untrennbar mit der Natur verbunden. Precht referiert: „Allein durch die Kraft der Liebe entwickelt sich die Evolution immer höher“ (Precht 2019, S. 461). Dies ist eine adäquate Vorstellung von Syntropie. Liebe wie Seele könnten demnach Felderfahrung vermitteln, die jene Allverbundenheit zu erkennen gibt, die auch mit dem übereinstimmt, was Wilhelm Schmid sagt: „Der Sinn der Liebe ist, dass sie Sinn schafft!“ (Schmid 2017, S. 21). Zudem orientiere ich mich amBuch der Wandlungen(Wilhelm, 1986), am Taoismus, der die großen Wechselwirkungen im Gleichgewicht der Gegensätze beschreibt.
Schluss mit dem Benutzen
Dieser Titel soll in aller Deutlichkeit darauf aufmerksam machen, welche Beweggründe mich zu meinem Engagement für Menschen veranlasst haben, die sich zutiefst wünschen, dass ihnen Liebe widerfährt, jedoch immer wieder an jemanden geraten, bei dem sie sich nach einer gewissen Zeit als benutzt erkennen. Colin C. Tipping empfiehlt in seinem BuchIch vergebe(2010) einen radikalen Abschied vom Opferdasein. Sein Ansatz durchquert das konstruktivistische Paradigma, wonach wir gefühlte Wirklichkeiterzeugen, indem Überzeugungen sie konkretisieren oder in anderen Worten das manifestieren, was es seelisch und gefühlt zu lösen gilt. Aber auch aus psychoanalytischer Sicht sind wir zur Zurücknahme von Projektionen und Auflösung von Abwehrkonstellationen angehalten, die mit Schuldzuweisung und Wiedergutmachung korrelieren. Einfach gesagt, es gibt nichts zu richten, zu erzwingen, zu bedauern.
Wenn wir uns dabei ertappen, dass wir projizieren, können wir realisieren, dass wir wieder einmal rechthaben wollen, dass dahinter Urteile walten, die auf Genugtuung aus sind, für etwas, von dem wir glauben, dass es uns angetan wurde, obwohl es einfach geschah und nicht der Bedeutung entsprach, die wir diesbezüglich hineingelegt haben. „Häufig finden wir Menschen, die unseren auf sie projizierten Selbsthass nicht nur annehmen, sondern verstärken, indem sie ihn auf uns zurückprojizieren. Ein solches Verhältnis nennen wir ‚co-abhängig‘. Der Partner erfüllt die Funktion, den Mangel in uns zu kompensieren, indem er ständig wiederholt, dass wir in Ordnung sind. So vermeiden wir das Schamgefühl, dass wir so sind, wie wir sind. Wir tun im Gegenzug dasselbe. Beide lernen, sich gegenseitig durch eine stark an Bedingungen geknüpfte Liebe, die auf den darunter liegenden Schuldgefühlen beruht, zu manipulieren. In dem Moment, in dem uns die andere Person ihre Bestätigung entzieht, sehen wir uns wieder mit unserem Schuldgefühl und unserem Selbsthass konfrontiert. Dann bricht alles in sich zusammen. Liebe verwandelt sich unmittelbar in Hass, und jeder Partner greift den anderen an“ (Tipping 2010, S. 93).
Dass wir unsEntschuldungvon anderen nicht mehr erwarten, sie für ihren Widerstand nicht ablehnen, dass wir keine Genugtuung fordern, wo wir enttäuscht werden, dass wir letztlich aus Anschuldigung, vorwurfsvoller Anklage und Beziehungsabbruch nicht den Schluss ziehen, erneut zum Opfer geworden zu sein, das ermöglicht allein die Auseinandersetzung mit demSchattenin uns, aus dem heraus wir nicht nur einstecken, sondern auch heftig austeilen. Nur die Zurücknahme der übermäßigen Bedeutung, die wir uns für den Anderen zuschreiben, macht uns offen für den Sinn der Liebe, befreit von Erklärungsmodellen, mit denen wir recht haben wollen.
Meine Metapher zum Selbsterleben
Ich möchte mein Verständnis von Ich und Selbst mit einer Metapher vorstellen. Ich verstehe das Ich als Konstrukteur der komplexen Architektur psychischer Selbstorganisation. Indem Freud darauf hinwies, dieses ‚Ich‘ sei nicht Herr im eigenen Haus, deute ich aus heutiger Sicht die Lage folgendermaßen: Substrukturen der Architektur entsprechen Räumlichkeiten in diesem Gebäude. In dessen Räumen logieren Selbstanteile, die insgesamt vom Selbstsystem zur Selbstwertregulierung laufend organisiert und reorganisiert werden müssen, um letztlich dem integrierten Selbsterleben des Ich als Konstrukteur und Organisator möglichst wenig Schwierigkeiten zu bereiten. Doch verhalten sich manche Selbstanteile wie Störenfriede, da sie sich sowohl untereinander als auch in Bezug auf den Hausherrn nicht anstandsgemäß gebärden. Insofern werden diese besonders unliebsamen Bewohner in den Keller gesperrt. Andere greifen in das Regime des gestressten Gastgebers von den oberen Penthouse-Departements her ein, erheben relativ hohe Ansprüche und sparen nicht mit Kritik an den Gepflogenheiten der Haushaltsführung.
Manche Selbstanteile, deren Herkunft aus Beziehungsgeschichten mit der Außenwelt stammt, erweisen sich als bedürftig und maßloser als die Bewohner des Dachgeschosses. Wieder andere planen Aufstände, aus Gründen, die sich der Einsicht des Eigentümers vollständig entziehen. Wie ich die Metapher einlösen will, soll sich im Laufe der Abhandlung weisen. Dazu sind auch die Theoriehinweise im Anhang jedes Kapitels gedacht. Ich will vorausschicken, dass das ‚Ich‘ durch seine Funktionen bestimmt ist und als Konstrukteur der Selbstorganisation, als Bauherr der Architektur, teils aus Identifizierung, Imagination und Instinkt, jedenfalls als Urheber von Subjekt- und Objektprozessoren (Moser, 2008) zu verstehen ist. Kein leichter Job.
Im Anhang zur Einleitung verweise ich auf Konzepte der Ich- und Selbstpsychologie. Daniel Hells Anmerkung zum Spannungsfeld zwischenSelbstbildundSelbsterlebenkündigt an, inwiefern ich auf mein Konzept zweier Regime des Ichbewusstseins und dessen geteiltes Selbsterleben gekommen bin. „Um das ursprüngliche seelische Selbsterleben lagern sich im Selbstbild die verschiedensten Schichten der historischen und biografischen Sozialisation ab. Was wir so als ‚Selbst‘ bildlich wahrnehmen, besteht nicht mehr nur aus unseren Gefühlen und Empfindungen, sondern auch aus den Vorstellungen und Reflexionen, die wir von Vorbildern übernehmen. […] Wird das Selbstbild für einen Menschen wichtiger als das Selbsterleben, erhält es eine Macht, die einen Menschen erdrücken kann. Kaum etwas anderes macht einen Menschen psychisch so verletzlich wie ein rigides oder überforderndes Selbstbild, das der Seele keinen Raum lässt“ (Hell 2013, S. 22-23). Hell nennt es ‚Selbsterleben‘, ich nenne es Selbstgefühl.
Die Organisationsstruktur des Systems Ich
Wer „Ich“ sagt, meint sich selbst. So ist das sprachgebräuchlich. Diese Selbstbezeichnung verweist auf die Urheberschaft des Subjekts. Und nur ein Ichbewusstsein kann dies sagen, denken, fühlen. In anderen Worten: Das Ich organisiert Wirklichkeit. Doch fordern zwei Fronten dieses Ich. Es gilt ein Regime gegenüber dem Außen zu errichten. Das handelnde Ich ist Organisator der Umweltbeziehungen. Ich nenne es dasweltbezogene Ich. Das zweite Territorium dehnt sich nach innen aus, betrifft dieInnerlichkeitdes Subjekts. Auch sie will wahrgenommen sein. Daher nenne ich diese Ausrichtung des Bewusstseins dasselbstbezogene Ich. Im Grunde ist das Ich strukturell einheitlich, nur seine Funktionen wechseln: Es richtet die Aufmerksamkeit nach außen, dann wieder nach innen. Im günstigen Fall gelingt die Oszillation zwischen den beiden Funktionen. Das ist ein komplexes Aufgabenspektrum.
Indem das Ich Wirklichkeit organisiert, verkürzt gesagt, Eindrücke aufnimmt und Ausdruck dafür finden soll, wird es sich dementsprechend auch dem Erleben, nicht nur dem Handeln, widmen. Aus diesem Grund systematisiert das Ich sein Selbsterleben.Wie ich mit meiner Metapher gezeigt habe, und Freud zustimme, ist das Ich nicht Herr im eigenen Haus. Mit dieser Gegebenheit interner Schwierigkeiten versucht das Ich auch, im Binnenraum ein Regime zu errichten. Es läuft da draußen nicht immer alles so, wie es locker zu verkraften wäre. Eindrücke erwirken schwer verdauliche Erlebnisse. Manches, was sich in der Welt ereignet, lässt sich durch dasselbstbezogene Ichzur Aufrechterhaltung der Hausordnung nur dadurch bewerkstelligen, dass es zwar Ereignisse nicht verhindern, aber Erlebnisse verdrängen kann. Zu diesen Erlebnissen zähle ich in erster Linie die Enttäuschung von Wünschen und Erweckung von Ängsten. An dieser Feststellung lässt sich bereits erkennen, dass die Binnenstruktur des Ichbewusstseins zwei Erlebnisweisen organisiert.
Ich verwende im Lauf der Abhandlung zwei Formen des Selbsterlebens, die ich nun vorstelle. Ich fange mit jenen Erlebnissen an, die dasselbstbezogene Ichin den Keller sperrt, weil sie dasweltbezogene Ichbei seiner Arbeit stören. Diese Erlebnisweise nenne ich dasSelbsterleben in Wahrheit.Davon ist abzulesen, dass abzüglich der weggesperrten Erlebnisse die weltbezogene Seite den NamenSelbsterleben aus Gewohnheitverdient. Der Vorteil dieser zwei Namen soll sich als handhabbar erweisen. Es besteht die Möglichkeit, Erlebnisweisen wegzusperren, sie auf ihre Grundmotive hin zu prüfen, letztlich alle Erlebnisse zu einem einheitlichen Selbsterleben zu verknüpfen, worunter ich dasintegrierte Selbsterlebenverstehe.
Um die Situation andersherum zu beschreiben: Was hinlänglich als Authentizität bezeichnet wird, verstehen wir auch als Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit uns selbst, manchmal auch anderen gegenüber. Dies würde bedeuten, dass sich die beiden Erlebnisweisen gegenseitig nicht ausschließen. Ich möchte dieses Verständnis nachschärfen. Dasweltbezogene Ichorientiert sich ausschließlich an Ereignissen in der Außenwelt und ist dadurch strukturell mit Handlungen, Auftreten, Erscheinen und nicht zuletzt mit ‚Ankommen‘ befasst. Der Ertrag dieses Wirkens für den Selbstwert und das Selbstbild füllt dasSelbsterleben aus Gewohnheitwie einen Speicher.
Ist der Speicher voll, fühlen wir uns gut, ist er wenig befüllt oder leer, fühlen wir uns schlecht. Dasselbstbezogene Ichbefasst sich mit diesem Ertrag und den im Speicher befindlichen Erlebnissen. Nun hat es strukturell die Aufgabe, diese Erlebnisse auf die Grundbedürfnisse, Wünsche und Selbstachtung hin zu prüfen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist in dem Fall dasSelbsterleben in Wahrheit,oftmalsalsSelbstgefühlbenannt, welches Wohlbehagen und Stimmigkeit signalisiert, weil der Selbstwertpegelstand hoch ist. Andernfalls, weil das Ergebnis der Prüfung Unbehagen und Unstimmigkeit signalisiert, werden Aspekte desSelbsterlebens in Wahrheitin den Keller gesperrt. Was den Selbstwert stabilisieren und das Selbstbild intakt erscheinen lassen soll.
Wenn das Wirken im Außen und das Fühlen im Innen übereinstimmen, dann wurde nichts in den Keller gesperrt. Es handelt sich umintegriertes Selbsterleben,das sich stimmig anfühlt. Es lässt sich erahnen, was es bedeutet, wenn dasSelbsterleben in Wahrheitkeinen Einlass insSelbsterleben aus Gewohnheitfindet. Die Bedeutung des Wirkens nach außen und der Erfolg von Anpassung an die Umwelt werden übergewichtig. Stellen wir uns vor, eine Persönlichkeit orientiert sich vornehmlich an Wirkungen im Außen und vernachlässigt deren Überprüfung in Bezug auf dasSelbstgefühl. Wie Alexander Lowen (1986) sagt, investiert das Ich nur noch insImage(engl.). Dieser Begriff ist vom inneren BildImage(franz.) zu unterscheiden.
Falls dasselbstbezogenemit demweltbezogenen Ichverwechselt wird oder sie gegeneinander ausgetauscht werden, entsteht ein schwerwiegendes Problem. Dadurch ist die Verleugnung desSelbstgefühlsnicht ausgeschlossen. Es gibt einen Trick. Ich gehe von einemkontrastiven Selbstkonzeptaus, wenn es dem Subjekt gelingt, sich gleichsam in zwei Welten, wenn nicht daheim seiend, so zumindest abwechselnd hin und her zu bewegen. Wir können uns das so vorstellen: Jemand wirkt mit Erfolg desweltbezogenen Ichsund von daher imSelbsterleben aus Gewohnheitgut angepasst an die Realität, während er oder sie dasSelbsterleben in Wahrheitgut kennt, nicht in den Keller sperrt, sondern in eine Gegenwelt verlegt. Das, so meine ich, verdient die Zuschreibungkontrastives Selbstkonzept.Ich sage dazu vereinfachtheimliches Selbst. Kontrastivbedeutet ein heimlichesSelbsterleben in Wahrheit, das schon in harmloser Tagträumerei seinen Ausgang nimmt, um auf Kurzurlaub – mit Abstand von Forderungen des Alltags und konventionellen Realitätserfahrungen desSelbsterlebens aus Gewohnheit – Bedürfnisse und damit Entgrenzung auszuleben. Diese Entgrenzung schließt naturgemäß, wie es beim Tagtraum bereits der Fall ist, Illusionieren nicht aus. In vielen Fällen übernimmt das Illusionieren die Aufgabe der Selbstbelohnung. Ich werde im Laufe der Abhandlung auf den Motivator ‚Lust-Ich‘ zu sprechen kommen.
Natürlich wird es immer Situationen und Anlässe geben, wo wir keineswegs bereit sind, und es auch unklug wäre, dasSelbsterleben in Wahrheitöffentlich preiszugeben. Daher ist es verständlich, dass wir uns auch verstellen, um uns zu schützen: vor Schmach, vor Angriffen, vor Enttäuschung. Das sollte uns aber nicht daran hindern, die Wahrhaftigkeit vor uns selbst zu bekennen, sie nicht zu vernebeln oder zu verschleiern. DasSelbsterleben aus Gewohnheiterträgt ein erstaunlich hohes Maß an Unstimmigkeit zwischen Selbstbild und Selbstgefühl, sofern dasweltbezogene IchBestätigung des Selbstwerts organisiert. Die Wahrscheinlichkeit einer Selbsttäuschung und schließlich Selbstverleugnung nimmt zu. Dies betrifft nicht allein private Beziehungen. Es betrifft durchwegs Selbstausbeutung aufgrund oft jahrelangen Erduldens von Unzumutbarkeit, von Leistungsdruck durch innere Antreiber, die damit einhergehende Selbstüberforderung in beruflichen Handlungsfeldern. Hingegen ist dasSelbsterleben in Wahrheitdarauf bedacht, dass zwischen Selbstbild und Selbstgefühl Stimmigkeit vorherrscht. Dafür muss aber dasselbstbezogene Ichonline bleiben. Es wird hinreichend viele Gelegenheiten geben, anderen gegenüber Aufrichtigkeit zu zeigen, unverhohlen einen Standpunkt zu vertreten und dem Selbsterleben in Wahrheit die Treue zu erweisen.
Da ich mir vorgenommen habe, einen Leitfaden für einintegriertes Selbsterlebenzu spinnen, so will dieses Projekt dazu ermutigen, eingesperrte Erlebnisweisen und Erfahrungen aus Gegenwelten zu integrieren. So mögen im Laufe der Zeit auch Erfahrungen desSelbsterlebens in Wahrheitauf eine kreative und unkonventionelle Weise Einlass in dasSelbsterleben aus Gewohnheitfinden. Dass dieses Identitätsprojekt vor der Herausforderung steht, jene unliebsamen Erfahrungen aus dem Keller zu befreien, nach C.G. Jung denSchattenin das Selbst zu integrieren, ist kein leichter Vorgang. Aber er lohnt sich allemal, denn dieSehnsucht nach dem Ganzen(Lacan, 1994) ist stets auch ein Heimweh nach der ungebrochenen Ursprünglichkeit.
Die Selbstwertregulierung
Ursprünglich entsteht einSelbstgefühlaus Beziehungserfahrungen, in denen wir uns wohlwollend behütet fühlten. Durch die nach G.H. Mead so genannten signifikanten Anderen, das ist zuerst einmal die Mutter, erfahren wir unser Selbstgefühl mittels versorgender und liebevoller Zuwendung sowie durch Spiegelung im Glanz ihrer Augen (Kohut, 1976). Dieser Glanz vermittelt die Grundlage für Selbstachtung, sich in Ordnung zu fühlen und ein wertvolles Wesen zu sein. Noch handelt es sich nicht um Anerkennung von Leistung, sondern um das entzückende Glück, mit der eigenen Lebendigkeit willkommen zu sein.
Der Vergleich mit anderen beginnt, wo wir uns als Ähnliche oder Verschiedene erkennen. Die Grundlage für Verähnlichung liegt in der Anpassung an die uns vermittelten Forderungen von Bezugspersonen und in dem Bestreben der Nachahmung – ein anderes Wort für Identifikation. Wir gleichen uns an und indem wir das tun, vergleichen wir uns mit anderen. So entsteht das Selbstbild. Sind wir ihnen ähnlich, fühlen wir uns in Ordnung. Fehlt die Verähnlichung, fühlen wir uns fremd, mutterseelenallein. Das Vertrauen ins Selbstgefühl kann wachsen, wenn unser Gefühlsausdruck verstanden und durchmarkierte Spiegelungfür uns selbst signifikant wurde. Markierte Spiegelung durch Bezugspersonen ist als Bezeichnung unseres Empfindens zu verstehen (siehe Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2019) und so lernen wir die Regungen unserer Lebendigkeit von den Regungen anderer zu unterscheiden.
Damit ist es möglich, auch unlustvolle Gefühle als eigene anzunehmen und in weiterer Folge in unser Selbsterleben zu integrieren. Dies vollzieht sich nicht zuletzt dadurch, dass unlustvolle Gefühle durch markierte Spiegelung undSymbolisierungmittels Sprache zu erträglichen Bewusstseinsinhalten werden können. Selbstgefühl heißt der Fragestellung nach: „Kann ich mich selbst fühlen?“ Sich selbst fühlen, Gefühle nicht allein auf andere zu beziehen, sondern als Zustandsanzeigen des Selbsterlebens zu verstehen, verlangt zuallererst, dass unser Gefühlsausdruck für uns bezeichnet und uns belassen, nicht enteignet wurde.
Unsere Gefühle der Zuwendung werden durchnarzisstische Besetzungvon Bezugspersonen enteignet. Wir verschenken das Gefühl, ohne zu ahnen, dass wir dessen beraubt werden. Vereinnahmende und benutzende Bezugspersonen tragen dazu bei, dass wir mehr die Gefühle der anderen empfinden als die eigenen und dies nicht unterscheiden können. Somit folgt, dass wir uns in emotionaler Nähe zu jemandem sofort in dessen System verstricken. Es entsteht die Frage: „Darf ich mich selbst fühlen?“ Bin ich verstrickt, fehlt mir die Unterscheidung. Ist dies der Fall, finde ich keine Antwort. Denn ich lebe das Leben der anderen, um in mir anwesend zu sein. Ein fremdes Selbst ist eine durch narzisstische Besetzung verinnerlichte Erfahrung. Oder es handelt sich um ein leeres Selbst, sofern wir realisieren, dass wir das wahre Selbst durch Enteignung zur Verfügung gestellt haben. In beiden Fällen überrascht uns eines Tages die Erkenntnis, dass wir für uns selbst gar nicht stattfinden. Somit wird die nächste Frage gelöscht: „Was bin ich mir selbst wert?“ Der Grund für diese nicht gestellte Frage ist in der Biografie angelegt.
So stellt sich die Herausforderung, im Durchschreiten von Täuschungen und Leere, die durch Ent-Täuschung entstehen, Vertrauen ins Selbstgefühl zu finden. Die Prüfungen einer nahezu initiatischen Erfahrung betreffen die Feuerprobe und die Wasserprobe, die Begegnung mit der Angst. Angst kann als Signal für einen anstehenden Entwicklungsschritt gesehen werden. Wenn ja, kann die Entwicklung in Bewegung kommen. Die Umwandlung einer Angsterregung in Gestaltungswillen bedeutet Initiation. Die Feuerprobe kann als Befeuern und Verbrennen der Ängste und Zweifel verstanden werden. Die Wasserprobe hingegen betrifft die Hingabe an zartes sowie ausdrucksstarkes Fühlen. So erwecken wir mit demSelbstgefühldie zärtlichen wie auch die angriffigen und verteidigenden Gefühle, die letztlich dazu verhelfen, die Selbstgrenze anzuerkennen.
Wer sich verstrickt oder sich ängstlich von der Welt zurückzieht, kennt auch seine Selbstgrenze nicht wirklich. Ist ihr Barrierewert hoch, fühlen wir uns eindringlichen Reizen gegenüber geschützt. Ist ihr Barrierewert niedrig, fühlen wir nicht den Unterschied zwischen Ich und Du, zwischen Innen und Außen, zwischen Welt und Selbst, sind verletzlich oder vereinnahmend. Dramatische Beziehungen, spürbar an einer verschwommenen oder aufgelösten Selbstgrenze, ringen um Unterscheidung und heben diese notwendige Differenz durch Verschmelzung von Ich und Du auf.
Analog dazu hat die biologische Zellmembran die Aufgabe, Nährendes hereinzulassen, Verdorbenes abzugeben und im Schließen Ruhe zuzulassen, um der Verwertung und Erholung zu dienen (Lipton, 2009; Davis, 2020). Eine auf Dauer geschlossene Selbstgrenze wäre ein Widerspruch in sich selbst, denn dies würde psychosoziale Kontaktlosigkeit implizieren. Eine ständig offene Selbstgrenze wäre in Bezug auf den Selbstschutz eine große Gefahr aufgrund hoher Verletzlichkeit. So gestaltet sich Selbststeuerung alsPulsationzwischen den Polen offen und geschlossen. Selbststeuerung bedeutet vor allem Handhabe gegenüber Kränkungen, die wir nicht verhindern, aber verarbeiten können.
Das Problem der Genugtuung
Viele Narrative schildern langjährige Kränkungen. Unterschiedliche Kränkungsereignisse verbindet das Erleben vonAblehnung. Mit der Zeit stieß ich auf unterschiedliche Formenverinnerlichter Ablehnung.Dies entspricht dem Begriffintrojizierte Sanktion.Es stellte sich der Eindruck ein, dem Kind sei Enttäuschung auch als Ablehnung seiner Person widerfahren. Wie mir Klienten und Klientinnen erzählen, musste es sich nicht um Entwertung und Strafmaßnahmen handeln. Dennoch wurde Ablehnung empfunden, indem sich Unverständnis gegenüber Sehnsucht oder Enttäuschung an die Verunmöglichung koppelte, Ablehnung und Auflehnung zum Ausdruck zu bringen. Ablehnung bedeutet Unterbindung der damit verbundenen Regungen. Von wem aus, ist manchmal nicht so klar.
Jedenfalls wurde aus Unterbindung eine Ablehnung verpönter Regungen wie beispielsweise Wut. Aus der Repression von Aggression wurde Sanktion. Und sie begann sich zunehmend als Gewissensnot, Schuldgefühl, Selbstzweifel, Minderwertigkeit, Unzulänglichkeitsgefühl und Angst vor der Angst zu verfestigen. Die Wechselwirkungen schaukelten sich zu innerer Unruhe und zu einer Verselbstständigung der inneren Kritiker, Antreiber und Bestrafer auf (Roediger, 2018). So lässt sich einnegatives Selbstkonzeptbeschreiben. Es entwickelte sich ein Verlangen nach Genugtuung, die sich je nach Temperament und Charakter als eine der Varianten äußern sollte: Wiedergutmachung oder Vergeltung, vielleicht auch Verheimlichen und Betören. Viele meiner Gespräche brachten Motive hervor, die nach Satisfaktion verlangten, um Selbstwert und Selbstbild auf die eine oder andere Weise zu rehabilitieren.
Satisfaktionist ein Begriff, der ursprünglich aus der Duelltradition stammt. Wer sich beleidigt, in seiner Ehre angegriffen fühlte, verlangte Genugtuung, selbst wenn er im Duell getötet werden konnte. Die Koppelung an den Selbstwert ist dadurch mehr als offensichtlich. Aus heutiger Sicht korrespondiert Satisfaktion mit dem Begriffnarzisstische Gratifikationunter dem Vorzeichen von Entschädigung. War eine offen ausgetragene und faire Konfliktbereinigung zwischen Eltern sowie zwischen ihnen und Kindern nicht möglich, hinterließen Kränkungen, Verletzungen, Traumatisierungen sanktionierende Spuren im Gedächtnis des Kindes. Von daher beziehe ich das Erleben verinnerlichter Ablehnung in meine Betrachtung desSelbsterlebens in Wahrheitmit ein. DasSelbsterleben aus Gewohnheitkämpft mit Eifer dagegen an. Das geht lange Zeit gut, weil sich Erfolg von Leistung im Außen einstellt.
Den Kern des Problems verstehe ich alsverinnerlichte Ablehnung,die auf der Unterdrückung verpönter Regungen basiert und damit den Zugang zu Erfahrungen in den Dunkelkammern des Kellers versperrt. DasSelbsterleben in Wahrheitdrängt jedoch mit all seinen Regungen, seien es Wünsche nach wie auch Ängste vor der immer schon ersehnten Befreiung. Diese Befreiung ist gewiss nicht durch Genugtuung, sei sie eine Wiedergutmachung, Vergeltung oder Verheimlichung, gegeben. Befreien heißt Liebe von Schuld und Scham zu befreien. Befreien heißt Ausdruck von Empörung an den Tag legen, wo Unrecht empfunden wird. Befreien heißt letztlich Vergeben, Verzeihen als Verzicht auf Genugtuung. Dass durch Frustration der Grundbedürfnisse und Kränkungen des Selbstwerts Motive nach Rache, Sühne, Bestrafung, Schadenersatz, Entschädigung, Tatausgleich, Wiedergutmachung, Forderungen nach Gerechtigkeit entstehen, muss nicht aufwendig hinterfragt werden. Der mäßige Erfolg durch Vergeltung liegt daran, dass wir uns durch einen Gegenschlag nicht besser fühlen, indem wir unsererseits Unrecht begangen haben. Bestrafung erinnert an restriktive Familienverhältnisse gedemütigter Kinder, die sich auf drastische Folgen durch Revanche einstellen mussten, wenn sie ihren Gefühlen der Auflehnung und Empörung Ausdruck verleihen wollten.
Wiedergutmachen kann eine Ausgleichshandlung sein. Wenn wir uns damit selbst verleugnen, hilft auch sie einer Verbesserung des Selbstgefühls nichts. Vielleicht ging es in der Kindheit auch anders zu. Obgleich Wiedergutmachung erwirkte, sich neuerlich in Ordnung zu fühlen, auch Reue gezeigt oder von Eltern eingefordert wurde, konnte das Kind keinen anderen Ausweg finden, als Genugtuung durch Verheimlichung seinesSelbsterlebens in Wahrheitin die Unerreichbarkeit und damit in eine für andere nicht nachvollziehbare Gegenwelt zu verlegen. Unterschiedliche Ausdrucksformen der Satisfaktion, Rehabilitation und narzisstischen Gratifikation verstehe ich als Möglichkeiten, sich Genugtuung als Entschädigung für Kränkungen und verinnerlichte Ablehnung zu organisieren. Meinem Dafürhalten nach tut Vergeben gut, Verzicht auf Genugtuung. Aus dem Vergeben entsteht Güte oder fördert sie, wo ihr Keim in uns schlummert, seitdem wir atmen. Aber vielleicht brauchen wir für dieses Vergeben Geduld. Denn weder lässt sich Gewesenes abschneiden oder nachhaltig wegsperren, noch lässt sich Kommendes erzwingen. So möchte ich meine einleitenden Gedanken mit den Worten Rainer Maria Rilkes abrunden.
Über die Geduld
Man muss den Dingen
die eigene, stille
ungestörte Entwicklung lassen,
die tief von innen kommt
und durch nichts gedrängt
oder beschleunigt werden kann,
alles ist austragen – und
dann gebären …
Reifen wie der Baum,
der seine Säfte nicht drängt
und getrost in den Stürmen des Frühlings steht,
ohne Angst,
dass dahinter kein Sommer
kommen könnte.
Er kommt doch!
Aber er kommt nur zu den Geduldigen,
die da sind, als ob die Ewigkeit
vor ihnen läge,
so sorglos, still und weit …
Man muss Geduld haben
Mit dem Ungelösten im Herzen,
und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben,
und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache
geschrieben sind.
Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wenn man die Fragen lebt,
lebt man vielleicht allmählich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages
in die Antworten hinein.
Rainer Maria Rilke,
Viareggio bei Pisa, 23. April 1903
Terminologischer Diskurs
Die Bezeichnung Diskursanalyse bezieht sich auf Argumentationsstränge meiner Recherchen. Insofern dienen Aussagen der zitierten Autorenschaft dem Vergleich mit meiner Darlegung von Sachverhalten. Dies ist eine Einladung, meine Texte durch die Diskursanalyse zu reflektieren. Überdies entspricht das umfangreiche Zitieren meiner Begeisterung für Autoren und Autorinnen, die im aktuellen Diskurs oftmals nicht erwähnt werden, wenngleich ihre wissenschaftlichen Arbeiten grundlegend für unseren Erkenntnisfortschritt sind. Sollte meine Auswahl den Eindruck einer Überfrachtung erwirken, empfehle ich, die Abschnitte einfach zu überspringen und meinem Leitfaden zu folgen. Aber vielleicht bietet sich meine Abhandlung auch als ein Handbuch zur Reflexion von Psyche, Kunst und Therapie an.
Der Einstieg in die Diskursanalyse legt Perspektiven der Ichpsychologie durch Peter Kutter und Hermann Roskamp mit Bezug zu Freud dar. Aus ihrer Sicht ist das Ichbewusstsein als Teilgebiet der Persönlichkeit aufzufassen. James Glover spricht von Ich-Kernen, die allmählich zum kohärenten Ich-Selbst-System verschmelzen. Otto Kernberg sieht das Selbst als Aspekt der Ichstrukturen und definiert Ichschwäche als Fehlen eines integrierten Selbst. Die Folge seien dissoziierte, abgespaltene Ichzustände. James Masterson bezieht sich auf Kernberg und erläutert die sich allmählich herausbildende Differenzierung von Selbst- und Objektvorstellungen mit besonderer Bezugnahme auf das Borderline-Syndrom. Eine Weiterführung der Differenzierung von Ich und Selbst nimmt Kernberg vor, der das Selbst als intrapsychische Struktur versteht, die aus Selbstrepräsentanzen und den damit verbundenen Affektdispositionen zusammengefügt ist. Es folgen ergänzende Definitionen von Thomas Stüttgen, Erich Neumann, William Davis. Edith Jacobson erkennt Selbstrepräsentanzen aus Beziehungserfahrung. Perls, Hefferline und Goodman sehen das Selbst als Integrator.
Peter Fonagy et al. halten sich an William James, der das ‚I‘ vom ‚Me‘ unterschieden hat. Sie sprechen vomkonstitutionellen Selbst(I) undkategorialen Selbst(Me). Damit nähere ich mich der Bezeichnung wahres Selbst, das ich mit meinem Begriff des Selbsterlebens in Wahrheit gleichsetze. Demgegenüber tangiert das kategoriale Selbst als ‚Me‘ bei James meinen Begriff des Selbsterlebens aus Gewohnheit. In weiterer Folge werden mit Alexander Lowen und Will Davis das Selbstgefühl, mit Otto Kernberg und Edith Jacobson das Selbstwertgefühl erläutert. Hiermit liegt die Verbindung zur Selbstwertregulierung nahe. Insofern mündet die Darlegung von Kernberg zum integrierten Selbst in die Unterscheidung anderer Formen des Selbsterlebens. Das falsche, fremde, leere und geteilte Selbst werden umrissen. Fonagy, Gergely, Jurist und Target nehmen dabei Bezug auf Donald Winnicott. Das geteilte Selbst, von Alexander Lowen dargelegt, erweist sich als Divergenz zwischen Selbstbild und Selbstgefühl.
Perspektiven der Ichpsychologie
Peter Kutter formuliert im Vorwort zurIchpsychologie(1974) die Definition des Ich wie folgt: „Das Ich ist Träger des Bewusstseins, stellt eine Struktur bzw. Organisation als ein ‚Teilgebiet der Persönlichkeit‘ dar und vermittelt zwischen Trieben, Realität, Über-Ich und Ich-Ideal. Es ist verdrängende bzw. abwehrende Instanz, Ort der Repräsentanzenwelt, der Sublimierung und ein mit bestimmter Energie besetztes System. Ich bedeutet zugleich Subjekt im Gegensatz zu Objekt, Organ der Selbsterhaltung, Stätte der Angst (S. Freud 1926) und Ursprung des Denkens, der Wahrnehmung und der Motorik. Es repräsentiert eine Stätte der Beobachtung (A. Freud 1936), ein Organ der Anpassung an die Umwelt, eine ‚Organisation‘ mit der Fähigkeit zur ‚Synthese‘ (Nunberg (1930) und ist dabei ‚Niederschlag der aufgegebenen Objektbeziehungen‘ (S. Freud 1923)“ (Kutter 1974, VII).
Im Anschluss daran erweitert Hermann Roskamp die angeführte Definition, indem er ebenfalls auf Freud verweist, der das eigentliche Subjekt der Person nicht substanziell, sondern durch seineFunktionendefiniert sieht. Die anwachsende Beherrschung körperlicher Funktionen führt zu einem Kern oder in anderen Worten zum „Körper-Ich“ (Freud 1923, S. 255). „Sie betreffen aber auch die Kommunikation mit der sozialen Umwelt, die Interaktionen von Mutter und Kind. Aus den diesen beiden Erfahrungsbereichen, der körperlichen und der sozialen Sphäre entstammenden Informationen integriert sich im Zuge zahlloser Unterscheidungen von innen und außen zunächst ein ‚anfängliches Real-Ich‘“ (Freud, S. 1915a; S. 228 in: Roskamp 1974, S. 5).
Obwohl Freud ein primäres Lust-Ich konzipiert hatte, das seiner Natur nach von ihm vollständig unter dem Primat des Unbewussten [Es] gedacht worden war, korrigierte er später, über ein primäres Real-Ich würde sich ein purifiziertes Lust-Ich und schließlich ein sekundäres Real-Ich bilden. „In seinen ‚Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens‘ (Freud 1911 G.W., Bd. 8, S. 230) hatte Freud die Vorstellung der Umwandlung eines frühen ‚Lust-Ichs‘ in ein ‚Real-Ich‘ eingeführt. Dieses anfängliche ‚Real-Ich‘ geht nicht direkt in dasendgültige‚Real-Ich‘ über, sondern wird unter dem beherrschenden Einfluß des Lustprinzips durch ein ‚Lust-Ich‘ ersetzt“ (Psychologie des Unbewußten. Studienausgabe Band II, 1975 f. S. 97 in: Freud 1975, S. 97f.). Freud (1937) hatte darauf hingewiesen, dass die Psychoanalyse nur bei einem „Normal-Ich“ durchgeführt werden könne. Meinem Verständnis nach kann der freudsche Begriff „Normal-Ich“ mit dessen Begriff „endgültigesReal-Ich“ gleichgesetzt werden.
Übereinstimmend mit Beschreibungen der Repräsentanzenwelt von Sandler und Rosenblatt (1962) und dem Begriff Ich-Identität von Erikson (1956) sieht Kernberg das Selbst als Aspekt der Ichstrukturen. Würde hingegen ein integriertes Selbst fehlen, so spiegle sich die ‚Ichschwäche‘ in voneinander dissoziierten oder abgespaltenen Ichzuständen. Seine Hypothesen zum Ursprung der Ichbildung umfassen folgende Merkmale: „erstens die Differenzierung zwischen Selbst- und Objektimagines und zweitens die Integration libidinös-bestimmter mit aggressiv-bestimmten Selbst- und Objektimagines“ (Kernberg 1983, S. 189-190). Indem Wahrnehmung und Gedächtnisspuren sich immer genauer zuordnen lassen, „werden allmählich Selbstimagines und Objektimagines voneinander abgegrenzt“ (Kernberg 1983, S. 190). Den Begriff der Imago erläutere ich im weiteren Verlauf der Abhandlung (siehe fünftes Kapitel).
Ein zweiter Entwicklungsschritt, „nämlich die Integration derjenigen Selbst- und Objektimagines, die unter dem Einfluß libidinöser Triebabkömmlinge und der dazugehörigen Affekte entstanden sind, mit jenen anderen Selbst- und Objektimagines, die unter dem Einfluß aggressiver Triebabkömmlinge und der dazugehörigen Affekte aufgebaut wurden“ (Kernberg 1983, S. 190) misslinge bei Borderline-Störungen. Insofern sollten genügend befriedigende und lustvolle Erfahrungen dem Säugling die Möglichkeit bieten, die „grundlegende, zunächst noch zu einer Einheit verschmolzene Selbst-Mutter-Imago, auf der das Urvertrauen beruht“ (Kernberg 1983, S. 191) aufzubauen. Eine drastische Störung sei gegeben, wenn der Aufbau einer „total-guten Selbst-Objekt-Imago“ bzw. eines „guten inneren Objekts“ nicht entwickelt werden konnte (Kernberg 1983, S. 191). So müssten die extrem gegensätzlichen und widerstreitenden Selbst- und Objektimagines aus Gründen der Abwehr voneinander getrennt gehalten werden. DieSpaltungals Abwehrvorgang ist hiermit benannt, die Grundlage von Ambivalenz erkannt.
James Masterson (1980) bezieht sich auf Kernberg und gliedert den Entwicklungsverlauf in vier Phasen, wovon ich ergänzend zu Kernberg seine Beschreibung der letzten Phase zitieren möchte. „Phase 4:Während der vierten Phase verschmelzen die ‚guten‘ und ‚bösen‘ Selbstbilder zu einem integrierten Selbstkonzept; mit anderen Worten, Selbstbilder stellen unter dem Einfluß polar entgegengesetzter emotionaler/interpersonaler Erfahrungen Kohärenz und Kontinuität her, Affekte werden integriert, gemildert und unterliegen dann weiterer Differenzierung, und das Selbstkonzept des Kindes und sein tatsächliches Auftreten oder Verhalten im sozialen Feld nähern sich an. Gleichzeitig verschmelzen auch die ‚guten‘ und ‚bösen‘ Objektbilder, so daß die ‚guten‘ und ‚bösen‘ Mutterbilder in eine Konzeption von der Mutter als ‚totales‘ Objekt integriert werden, eine Konzeption, die sich der Wirklichkeit der Mutter im interpersonell-perzeptuellen Feld des Kindes stark annähert“ (Masterson 1980, S. 31–32).
Differenzierung von Ich und Selbst
Heinz Hartmann missfiel die Doppeldeutigkeit des Begriffs ‚Ich‘ – einmal zur Charakterisierung des regulierenden Anpassungsorgans als Teil der Person, dann wieder als Bezeichnung der Gesamtperson –, und er führte den TerminusSelbstein. Er verstand darunter ausschließlich dieSelbstrepräsentanz, so formuliert Mentzos „die Summe der inneren Bilder von sich selbst“ (Mentzos 2003, S. 41). Moser und von Zeppelin fassen einSelbstganz ähnlich auf: das „Insgesamt der affektiven Rückkoppelungen aller Art und der zugeordneten Bilder“ (Moser & von Zeppelin 1996, S. 133). Thomas Stüttgen (1985) vermittelt ein Bild vom Selbst, das derinnerpsychischen Repräsentanzemotionaler Befindlichkeit des Ichs entspricht. Die Affinität zwischen bildhaften Vorstellungen und leiblichen Empfindungen fällt auf.
Im Anschluss an Hartmann (1964) versteht Kernberg das ‚Selbst‘ als „eine intrapsychische Struktur, die sich aus mannigfachen Selbstrepräsentanzen mitsamt seinen damit verbundenen Affektdispositionen konstituiert“ (Kernberg 1983, S. 358). Edith Jacobson unterscheidet einIchals ‚strukturelles seelisches System‘ vomSelbstin Anlehnung an Hermann Hartmann (1939) und vonSelbstrepräsentanzen.Selbst- und Objektrepräsentanzen würden die „unbewußten, vorbewußten und bewußten intrapsychischen Repräsentanzen des körperlichen und seelischen Selbst im System Ich“ (Jacobson 1978, S. 30) bezeichnen. Die Errichtung des Systems Ich gehe mit der Entdeckung der Welt der Objekte einher und münde in die zunehmende Unterscheidung zwischen dieser und dem Selbst. „Aus den stetig sich vermehrenden Erinnerungsspuren lustvoller und unlustvoller triebhafter, emotionaler, ideationaler und funktioneller Erlebnisse und aus den Wahrnehmungen, mit denen sie assoziativ verknüpft werden, erwachsen Imagines der Liebesobjekte wie auch des körperlichen und seelischen Selbst. Anfänglich vage und veränderlich, erweitern sie sich allmählich und entwickeln sich zu konsistenten und mehr oder weniger realistischen intrapsychischen Repräsentanzen der Welt der Objekte und des Selbst“ (Jacobson 1978, S. 30). Die Darlegungen von Kernberg, Masterson und Jacobson sind deckungsgleich.
Die Gründer der Gestalttherapie sehen das Selbst als ‚Integrator‘, insofern als synthetische Einheit. Entfremdungen des Selbst verstehen sie als ‚Ich‘. „Das Ich (d. h. die vielfältigen Identifizierungen und Entfremdungen) muß durch Experimente bewußter Wahrnehmung der eigenen verschiedenartigen Funktionen gestärkt werden, bis spontan die Empfindung dafür auflebt, daß ‚Ich‘ es bin, der dieses denkt, wahrnimmt und fühlt“ (Perls, Hefferline, Goodman 1979, S. 18). Daher benennen sie im Gegensatz dazu das Selbst als System der „ständig neuen Kontakte“ (Perls, Hefferline, Goodman 1979, S. 17). Sie verstehen Kontaktnahme „als Verlangen und Zurückweisen, Annähern und Vermeiden, Empfinden, Fühlen, Nutzbarmachen, Einschätzen, Kommunizieren, Kämpfen usw.“ (Perls, Hefferline, Goodman 1979, S. 11). Im fünften und letzten Kapitel nehme ich im Zusammenhang mit Schemata darauf Bezug.
I und Me bei William James
William James hat die Begriffe ‚I‘ und ‚Me‘ geprägt. „Das ‚kategoriale Selbst‘ bezieht sich auf die Repräsentation all jener Merkmale und Eigenschaften, die man sich selbst zuschreibt, […] und die man großteils aus den Reaktionen, mit denen einem die soziale Umwelt begegnet, erschlossen hat“ (Fonagy, Gergely, Jurist & Target 2019, S. 211). Im Unterschied dazu ist unter dem von James genannten ‚I‘ das subjektive oder konstitutionelle Selbst zu verstehen. Es soll sich als zweckdienlich erweisen, das ‚kategoriale Selbst‘ vom ‚konstitutionellen (körperlichen) Selbst‘ als daswahre Selbstzu unterscheiden, da dieses ‚kategoriale Selbst‘ auch dasfremde Selbstin sich trägt, was zu einer Verfälschung imSelbsterleben aus Gewohnheitbeiträgt. Fonagy, Gergely, Jurist und Target erachten es als wichtig, den Prozess nachzuvollziehen, durch den das Verstehen des Selbst als mentaler Urheber aus der interpersonalen Erfahrung auftaucht. Für sie besteht ein enger Konnex zwischen der Mentalisierung und der Entwicklung des Selbst.
Ich und Selbst bei Antonio Damasio
Damasio versteht das ‚Ich‘ als Produkt der Sprache im Unterschied zum ‚Selbst‘. InIch fühle, also binich(Damasio, 2000) unterscheidet er drei Formen der Selbstbewusstheit: Proto-Selbst, Kernselbst und autobiografisches Selbst. „Das Proto-Selbst beruht auf der ‚Gesamtheit jener Hirnmechanismen […], die fortwährend und unbewusst dafür sorgen, dass sich die Körperzustände in jenem schmalen Bereich relativer Stabilität bewegen, der zum Überleben erforderlich ist‘“ (S. 36). Kernbewusstsein, Grundlage des Kernselbst, tauche auf,„wenn die Repräsentationsmechanismen des Gehirns einen vorgestellten, nicht sprachlichen Bericht erzeugen, in dem niedergelegt ist, wie der eigene Zustand des Organismus davon beeinflusst wird, dass er ein Objekt verarbeitet, und wenn dieser Prozess die Vorstellung von dem verursachenden Objekt verstärkt, so dass es in einem räumlichen und zeitlichen Kontext hervorgehoben wird“(Damasio [1999] 2000, S. 205 in: Fonagy, Gergely, Jurist & Target 2019, S. 88).
Das Selbstgefühl
Will Davis erkennt im ‚Selbstgefühl‘ des Kleinkindes bereits das Selbst als primär organisierende Instanz bzw. intentionales Zentrum der Subjektivität, was er als teleorganisch versteht, d. h. als angeborene Fähigkeit, den notwendigen Bedürfnissen eines lebendigen Organismus zu dienen. Damit schwenkt er zu Maturana und Varela, indem er deren Ansatz in biologischer Terminologie durch Paraphrasierung mit den in Klammern eingeführten psychotherapeutischen Termini ergänzt. „Wenn eine Zelle [das Selbst] mit einem Molekül [seinem Umfeld, z. B. einem Objekt] interagiert und es in seine Prozesse mit einbezieht [Introjektion, Identifikation, Internalisierung], dann wird das Ergebnis dieser Wechselwirkung nicht durch die Eigenschaften des Moleküls [des Objekts] bestimmt, sondern durch die Art und Weise, wie dieses Molekül [das Objekt] von der Zelle [dem Selbst] aufgenommen [‚gesehen‘] wird, während es das Molekül [das Objekt] in seine autopoietische Dynamik einbezieht. Die Änderungen, die aus dieser Interaktion entstehen, sind durch die eigene Struktur und Einheit der Zelle [des Selbst] verursacht worden“ (Maturana & Varela 1998, S. 51f.; in: Davis 2020, S. 172–173).
Sicherheit und Wohlbefinden seien Indikatoren für das Vertrautsein mit dem Selbstgefühl. Darüber hinaus würde das Selbstgefühl weder zu Bewertungen noch zu Urteilen verleiten. Ryan und Brown paraphrasieren: „In wirklicher Selbstbestimmung gibt es kein fixes Konzept eines Selbst, das zu schützen oder zu verbessern wäre“ (Ryan und Brown 2003, S. 75; in: Davis 2020, S. 159). So ist auch Thomas Fuchs zu verstehen: „Also gleicht der Leib einem Felsgrundunerschütterlicher Gewissheiten […]wie ein vor-prädikatives (präreflexives) Wissen.Radcliff hat kürzlich dargelegt, dass basale körperliche Empfindungen gleichzeitig Erfahrungen von Körperzuständen als auch Erlebnismodi der Welt sind. Das gilt speziell für ‚existenzielle Gefühle‘ wiesich zuhause zu fühlenoderzur Welt zu gehören“ (Fuchs 2009, S. 574; in: Davis 2020, S. 156). Ich teile diese Auffassung, nenne dies aber ‚das Wesen der Liebe‘.
Das Selbstwertgefühl
Mit Blick auf äußere Faktoren fallen folgende Komponenten der Selbstwertregulierung auf. (1) Effektive libidinöse Befriedigung durch Bezugspersonen; (2) Erfüllung von Ich-Zielen durch soziale Effektivität und Erfolg; (3) produktive Verwirklichung intellektueller und kultureller Bestrebungen. Will heißen, die libidinöse Besetzung des Selbst werde durch Liebe und Befriedigung seitens der Bezugspersonen, durch Erfolg in der sozialen Realität, durch eine Harmonie zwischen Selbst und Überich sowie durch die Wiederbestätigung der Liebe innerhalb der Objektrepräsentanzen, schließlich durch Triebbefriedigung und körperliche Gesundheit verstärkt. „Ein Selbst mit erhöhter libidinöser Besetzung – sozusagen in Frieden und glücklich mit sich selbst – ist auch in der Lage, äußere Objekte und ihre verinnerlichten Repräsentanzen stärker zu besetzen. Erhöht sich die narzißtische Besetzung, so wächst im allgemeinen zugleich auch die Fähigkeit, zu lieben und zu geben, Dankbarkeit zu empfinden und auszudrücken, Anteilnahme für andere aufzubringen, sexuelle Liebe, Sublimierung und Kreativität zu steigern“ (Kernberg 1983, S. 364). Dies steigere dieGütegegenüber inneren Objekten und realen Personen und festige somit die Bindungsbeziehungen. Dieser Gedanke schenkt Zuversicht.
Kernberg definiert den normalen Narzissmus, die libidinöse Besetzung des Selbst, durch eine psychische Struktur, die sowohl libidinös wie aggressiv besetzte Anteile integriert. „Umgekehrt verringert sich die libidinöse Besetzung des Selbst beispielsweise bei einem Verlust äußerer Liebesquellen, beim Scheitern in der Erreichung von Ich-Zielen oder in der Erfüllung von Ich-Ansprüchen, unter Überich-Zwängen infolge für das Über-Ich unannehmbarer Triebbedürfnisse, im Gefühl des Unvermögens, den Erwartungen des Ich-Ideals zu genügen oder allgemein bei Frustration von Triebbedürfnissen oder körperlichen Krankheiten“ (Kernberg 1983, S. 364). Das ‚Selbstwertgefühl‘ hänge jedoch von der libidinösen Besetzung desintegrierten Selbstab. Und kurz darauf: „der Überich-Zwang läßt das Ich glauben, daß es die Liebe seiner inneren ebenso wie seiner äußeren Objekte nicht mehr ‚verdient‘“ (Kernberg 1983, S. 364).
Die Intensität bzw. der Pegelstand des Selbstwertgefühls sei als Marker zu verstehen, inwiefern und auf welchem Pegelstand das Selbst narzisstisch besetzt sei. „Das Selbstwertgefühl bezeichnet also die differenzierten Ebenen narzißtischer Besetzung, während diffuse Gefühle von Wohlbehagen, Lebenslust, Euphorie oder Befriedigung als primitive Äußerungen des Narzißmus gelten können. So sind zum Beispiel – wie Jacobson (1964) ausgeführt hat – Stimmungsschwankungen das Hauptmerkmal einer relativ primitiven Stufe der vom Über-Ich bestimmten Regulation des Selbstwertgefühls; auf fortgeschritteneren Stufen der Überichfunktion tritt an die Stelle von Stimmungsschwankungen die präziser abgrenzende kognitive Einschätzung oder Kritik des Selbst“ (Kernberg 1983, S. 360-361).
Ein integriertes Selbst
Das normale Selbst ist alsintegriertes Selbstaufzufassen, insofern sich mannigfacheSelbstrepräsentanzendynamisch zu einem Ganzen organisieren.‚Selbstrepräsentanzen‘ stellen affektiv-kognitive Strukturen dar, welche die ‚Selbstwahrnehmung‘ einer Person in ihren realen und fantasierten Interaktionen mit Bezugspersonen widerspiegeln. Andererseits zählen zum Selbst ‚Objektrepräsentanzen‘, die Kernberg als verinnerlichte Repräsentanzen der Interaktionen mit signifikanten Bezugspersonen versteht. Dazu zählt er Idealselbst- und Idealobjektvorstellungen „auf verschiedenen Stufen der Depersonifikation, Abstraktion und Integration in allgemeine Ich-Ziele und Ideale“ (Kernberg 1983, S. 358–359).
Diese Leistung des Ichs bringe einrealistisches Selbstkonzeptdes Ichbewusstseins hervor. „Daraus erklärt sich auch das Paradox, dass die Integration von Liebe und Hass eine Voraussetzung der normalen Liebesfähigkeit ist“ (Kernberg 1983, S. 359). Sandler und Rosenblatt bezeichneten dies als Spannungsverhältnis zwischen Real- und Ideal-Selbst. So würden auch Objektrepräsentanzen an der Regulation des Selbstwertgefühls beteiligt sein, sofern sie als Quelle narzisstischer Zufuhr und libidinöser Besetzung des Selbst zu erachten seien. „Die kritischen oder strafenden Aspekte des Über-Ichs regulieren das Selbstwertgefühl durch die vorwiegend ‚negative‘ Funktion der Kritik am Selbst“ (Kernberg 1983, S. 362). Konträr zu diesenSanktionenstünde das Ich-Ideal als Substruktur des Über-Ichs, welches aus der Integration von Idealobjekt- und Idealselbstimagines resultiere, da diese von der frühesten Kindheit an ins Über-Ich introjiziert worden seien. „… und es erhöht das Selbstwertgefühl, wenn das Selbst seinen Forderungen und Erwartungen entspricht“ (Kernberg 1983, S. 362).
Das falsche und das leere Selbst
Fonagy, Gergely, Jurist und Target (2019) beziehen sich auf Donald Winnicott, um im Rahmen ihres Mentalisierungskonzepts mangelnde Spiegelung bzw. Nichtverstehen des Säuglings durch seine Betreuungsperson auf die Entwicklung eines‚falschen Selbst‘zu beziehen. „Wenn sich dieses Verhalten trotz hartnäckiger Bemühungen des Babys fortsetzt, sind Winnicott zufolge mehrere Reaktionen möglich: Es ist denkbar, dass das Selbst überwältigt wird oder dass es voller Angst weitere Übergriffe erwartet und sich selbst nur dann zu erleben vermag, wenn es diesen Übergriffen entgegenwirkt; eine weitere Möglichkeit besteht schließlich darin, dass es sich fügt, seine eigenen Gesten verbirgt und auf diese Weise seine eigenen Anlagen untergräbt. Im letzteren Fall, so vermutete Winnicott, wird das Selbst seine betreuende Umwelt nachahmen, sich mit dem Mangel abfinden, auf kreative Gesten verzichten und vielleicht sogar vergessen, dass es sie je gab. Winnicott vertrat die Auffassung, dass der Säugling gefügig auf die Gesten der Betreuungsperson eingehe, so als wären sie seine eigenen, und dass diese Willfährigkeit der Struktur des falschen Selbst zugrunde liege“ (Fonagy, Gergely, Jurist & Target 2019, S. 202).
Winnicotts Sichtweise der Merkmale deswahren Selbstimpliziert, dass dasfalsche Selbstan seiner fehlenden Spontaneität oder Originalität zu erkennen ist. Betroffene würden auch im späteren Leben geradezu nach äußeren Übergriffen suchen, um die Erfahrung der ‚gefügigen Bezogenheit‘ zu wiederholen und sich damit der eigenen Existenz zu versichern. „Winnicott beschrieb auch jenes Selbst, das real zu sein scheint, aber auf Identifizierungen mit frühen Objekten aufgebaut ist, so dass ihm etwas fehlt, das einzig und allein ihm selbst gehört. Winnicott erläuterte, dass sich das falsche Selbst mitunter als real behauptet und auch auf andere real wirkt, aber eine Art mechanischer Existenz führt, in der jede genuine Verbindung zwischen intentionalen Zuständen und Handlungen fehlt. Ein Selbst, dessen konstitutioneller eigener Zustand nicht anerkannt wurde, ist ein leeres Selbst“ (Fonagy, Gergely, Jurist & Target 2019, S. 202–203). Insofern beinhaltet das Selbsterleben aus Gewohnheit auch ein falsches Selbst.
Die Leere spiegle fehlende Affektaktivierung im konstitutionellen (wahren) Selbst. So wurde das Erleben bedeutungslos, die Suche nach starken Bezugspersonen, um sich an ihnen aufzurichten, ein fortwährendes Bemühen. „Das falsche Selbst erfüllt nach Winnicott die Funktion, das wahre Selbst zu verbergen und somit zu schützen. Das wahre Selbst ist der konstitutionelle Zustand, der in weiten Teilen durch mütterliches Spiegeln nicht repräsentiert wurde. […] Die Symptombildung bringt das wahre Selbst vielleicht zum Ausdruck, weil das auftauchende Selbst auf diese Weise in der Vergangenheit gespürt hat, dass es existieren konnte, ohne von einer Umwelt, die seine kreativen Gesten durch eigene ersetzte oder sie ignorierte, überwältigt zu werden“ (Fonagy, Gergely, Jurist & Target 2019, S. 203).
Das fremde Selbst
Wenn traumatische Erfahrungen das Kind dazu zwingen sollten, sich von Schmerz zu dissoziieren, identifiziere es sich mit dem Aggressor über das ‚fremde Selbst‘. „Das leere Selbst wird daraufhin vom Bild des Aggressors kolonialisiert, und das Kind erlebt sich als böse und monströs“ (Fonagy, Gergely, Jurist & Target 2019, S. 205). Hinzukomme die massive Scham durch Brutalisierungserfahrungen und damit die Gefahr der Zerstörung des Selbst. Das Team stellt fest, dass einfremdes Selbstin jedem von uns eingelagert sein könne. In der frühen Entwicklung versuche das Kind, sich von diesem ‚fremden Selbst‘ durch Externalisierung zu befreien; entfalte sich die Mentalisierungsfähigkeit allmählich, werde diesesfremde Selbstins ‚Selbst‘ verwoben und erzeuge ein illusionäres Kohärenzgefühl.
„Das desorganisiert gebundene Kleinkind wird das Verhalten der Mutter daher häufig kontrollieren und manipulieren; dies ist Teil eines Prozesses projektiver Identifizierung, durch den das Kind sein Bedürfnis zu befriedigen versucht, das Selbst als kohärent zu erleben und den fremden Teil seiner Selbststruktur außerhalb, in anderen (gewöhnlich in der Mutter) wahrzunehmen. Die Desorganisation des Selbst führt zur Desorganisation der Bindungsbeziehungen, indem sie ein ständiges Bedürfnis nach dieser projektiven Identifizierung – der Externalisierung des fremden Selbst – erzeugt“ (Fonagy, Gergely, Jurist & Target 2019, S. 19). Hiermit sind Bindungstraumata und das Borderline-Syndrom angesprochen.
Negatives Selbstkonzept
„Dasnegative Selbstkonzeptist charakterisiert durch anhaltende Überzeugungen, als Person minderwertig, machtlos und wertlos zu sein. Sie können von tiefgreifenden und andauernden Gefühlen der Schuld und Scham begleitet sein. Diese können sich darauf beziehen, dass die Person die widrigen Lebensumstände nicht besser bewältigen oder das Leid anderer nicht verhindern konnte“ (Reddemann & Wöller 2017, S. 19). Auf die Personen meiner Klientel trifft häufig einnegatives Selbstkonzept(Cloitre et al., 2012) zu, wobei Gründe dafür sowohl in der Erfahrung von Ablehnung und Benutzung als auch in der Überforderung durch den Druck des Über-Ichs und antreibenden Eifer zu finden sind. Vollumfänglich treffen die Störung der Affektregulierung und interpersonelle Störungen mit Blick auf eine komplexe posttraumatische Belastungsreaktion (kPTBS) selten auf Personen meiner Klientel zu, auch wenn Gewalterfahrung und Zeugenschaft von Gewalt in ihren Narrativen auftauchen.
Im Gegensatz dazu habe ich den Begriffkontrastives Selbstkonzeptoderheimliches Selbstgewählt, um ein Überwiegen der salutogenen Persönlichkeitsanteile gegenüber maladaptiven Anteilen hervorzuheben, wenngleich es sich umAmbivalenzspaltungund um Abwehrkonstellationen handelt. Die Bezeichnung ‚maladaptive Anteile‘ möchte ich relativieren und spreche von dunklen Facetten oder Schattierungen der Gesamtpersönlichkeit. Häufig stelle ich ein Spannungsfeld zwischen passiv erfahrener und aktiver Ablehnung, ein Oszillieren zwischen Neigungen zurReviktimisierungund zunarzisstischer Gratifikationdurch Wiedergutmachung, Vergeltung, Verheimlichung oder Betörung fest. Probleme derAffektregulierungim engeren Sinn von erhöhter Reaktivität tauchen sowohl bei Männern und Frauen meiner Klientel auf, wobei es sich meinem Verständnis nach umnarzisstische Wutund oftmals Angst vor der Wut handelt. Überdies tun sich Menschen, die von einer Erschöpfungsdepression betroffen sind, äußerst schwer, positive Emotionen in ihrem Zustand zu generieren oder zu registrieren.
Das geteilte Selbst
Alexander Lowen geht davon aus, dass wir zu unserem Körper eine doppelte Beziehung haben: „Wir können ihn direkt durchs Fühlen erleben oder wir können eine Vorstellung von ihm haben“ (Lowen 1986, S. 42; vgl. Hell, 2013). Sei die persönliche Identität allein auf dem Selbstbild [Ego] aufgebaut, liege eine Störung der Selbstbeziehung vor. „Das falsche Selbst bleibt an der Oberfläche als das Selbst, das der Welt präsentiert wird. Es steht im Gegensatz zum wahren Selbst, das hinter der Fassade oder dem Image wohnt. Dieses wahre Selbst ist das fühlende Selbst, aber es ist ein Selbst, das versteckt und verleugnet werden muß“ (Lowen 1986, S. 59). Lowens Beschreibung war für mich Anlass, einheimliches Selbstals Ergänzung zum Selbsterleben in Wahrheit hinzuzufügen.
Für nachfolgende Argumentation ist Lowens Sichtweise von großer Bedeutung, weil ich auf Ambivalenz und Ambivalenzspaltung Bezug nehmen werde: „Es gibt im Organismus nur eine Energie oder Kraft. Diese Kraft oder Energie ist identisch mit dem, was die Psychoanalyse unter Libido versteht, und ebenfalls mit Freuds Eros. […] Die Spaltung der Einheit des Impulses ist die Grundlage des Ichbewusstseins, denn sie ermöglicht eine spätere Wiederzusammensetzung der Komponenten für eine wirksamere Reaktion. Damit die beiden Komponenten wieder miteinander verschmelzen können, darf die Spaltung nicht zu weit gehen“ (Lowen 1988, S. 108). Ein für daskontrastive Selbstkonzeptrelevanter Aspekt von Abwehr soll im Unterschied zumintegrierten Selbsterlebenfolgendermaßen beschrieben werden: „Wo die Verschmelzung vollständig ist, kann der Beobachter die beiden Komponenten nicht voneinander abgrenzen. Unvollständige Verschmelzung erzeugt Ambivalenz und irrationales Verhalten. […] Vollständige Entmischung muss gleichbedeutend sein mit der psychotischen Spaltung“ (Lowen 1988, S. 116).
Zusammenfassung
Aktuell herrscht Konsens darüber, dass ein Selbstbild der eigenen Wahrnehmung entspricht und dieses sich zugleich am Idealbild bemisst. Letzteres entspricht dem, wie man sein möchte und sich auch von anderen idealerweise gesehen wissen will. Selbstbild und Idealbild werden somit dem Selbstkonzept zugeschrieben. Das Selbstkonzept steht unter dem Einfluss von vergangenen Beziehungserfahrungen, die verinnerlichte Urteile über einen selbst inkludieren. Als stabil gilt ein ausgewogenes Selbstkonzept. Es ist mir unter Berücksichtigung von Spaltungsvorgängen in ein ‚Lust-Ich‘ und ‚Real-Ich‘ sowie der Instanz ‚Über-Ich‘ und dessen Substruktur ‚Ich-Ideal‘ daran gelegen, die unterschiedlichen Termini auf einen gemeinsamen Nenner mit dem ‚Selbstkonzept‘ zu bringen. Aus der Zweiteilung des Selbsterlebens aus Gewohnheit und in Wahrheit geht jedenfalls ein ‚geteiltes Selbst‘ hervor.
Es ist ein Entwicklungsstrang unter dem Aspekt der Realerfahrung, ein zweiter unter dem Aspekt der Idealisierung zu erkennen. Realerfahrung schließt die Entfaltung des Kindes fördernde, aber auch einschränkende Vorgänge durch Eltern mit ein. Idealisierung betrifft sowohl die Vorbildwirkung von Bezugspersonen als auch die kindliche Nachahmung. Idealisierung bringt jedoch auch übertriebene Ansprüche an sich hervor; beispielsweise den Perfektionismus aufgrund mangelnder Unterstützung. Vorbildwirkung und Nachahmung bedeuten Identifizierung. Hinzu kommen Bewältigungsreaktionen gegenüber Frustration der Grundbedürfnisse: Strategien des Erduldens oder Vermeidens sowie diverse Kompensationen, die als Übertreibung gelten. Letztere ist auch als Überidentifikation oder im Gegenteil als Rebellion zu verstehen. Diese Gliederung korreliert mit den Schutzstrategien des angepassten und des rebellischen Schattenkindes (Stahl, 2017). Dies alles hinterlässt den Eindruck einer hohen Komplexität.
Indem ich Selbstgefühl und Selbstkonzept mit Auswirkung auf das Selbsterleben einmal als integriert, dann wieder als kontrastiv konzipiere, ordne ich dem Selbstkonzept das Selbsterleben aus Gewohnheit zu. Selbstbild und Idealbild erzeugen das Spannungsfeld innerhalb des Selbsterlebens aus Gewohnheit mit der Bürde, Unstimmigkeit lange Zeit ertragen zu können. Hingegen zeigt sich das im Laufe der Zeit gestärkte Selbsterleben in Wahrheit als unbeirrbares Selbstgefühl. Zur Anwaltschaft der Grundrechte beauftragt das selbstbezogene Ich das weltbezogene Ich. Allmählich gelingt ein Wachsen aus Verletzungen und Erfahrungen von Ablehnung. Es überwiegt zunehmend Güte. Ein kontrastives Selbstkonzept ist Produkt der Unvereinbarkeit zwischen illusionierendem Idealbild und konform zugeschnittenem Selbstbild unter dem Druck eines inadäquaten Über-Ichs. Insofern besteht ein Kontrast zwischen dem weltbezogenen und dem selbstbezogenen Ich, wobei letzteres seine reflexive Funktion zugunsten eines oft exzessiven und damit toxischen Lustgewinns aufgibt. In einer weniger drastischen Form kann ein heimliches Selbst jenes Selbsterleben in Wahrheit beinhalten, das geheim gehalten werden muss, um es zu schützen. Alternativ dazu ist an Eigenverantwortung auf Basis eines konsensorientierten Wertesystems zu denken.
Erstes Kapitel
„Man muss ein Stück Chaos in sich haben,
um einen tanzenden Stern gebären zu können.“
Friedrich Nietzsche
Stolpern im Lebenslauf
In der Einleitung habe ich meine Konzeption des Leitfadens für ein integriertes Selbsterleben mit einem ersten Überblick vorgestellt. In wesentlichen Grundzügen war mir daran gelegen, die Reiseroute zu skizzieren und auf ein holistisches Verständnis des Selbsterlebens aufmerksam zu machen. Der Aufruf „Schluss mit dem Benutzen!“ sollte damit auf ein zentrales Anliegen der Abhandlung hinweisen. Über meine Metapher vomHausherrn Ichsteuerte ich auf die Betrachtung zu, wonach das Selbsterleben vom Ichbewusstsein hervorgebracht wird.
Das System Ich hat Struktur und eine Grenze. Dem Ich wurden zwei Funktionen zugeordnet. Dasweltbezogene Ichbeobachtet und handelt. Dasselbstbezogene Ichbeobachtet das beobachtende und handelnde Ich. Es bewertet die Erlebnisse auf ihren Einfluss für den Selbstwert und das Selbstbild hin. DasSelbsterleben aus Gewohnheitpasst sich den Umweltbedingungen an. DasSelbsterleben in Wahrheithingegen betrifft das stimmige oder unstimmige Verhältnis zwischen Selbstgefühl und Selbstbild. Ich unterscheide zwischen integriertem Selbsterleben und Kompromissen als Folge eines kontrastiven Selbstkonzepts. Ich bin in der Einleitung auf drei Komponenten der Selbstregulierung eingegangen: Selbstgefühl, Selbstbild und Selbstwert. Das Selbsterleben in Wahrheit konveniert mit dem Selbstgefühl.
(1.1) Für das erste Kapitel habe ich mir vorgenommen, Erfahrungen aus der Praxis zu sammeln und sie zu unterbreiten. Der TitelStolpern im Lebenslaufverweist auf Ereignisse im Leben jener, die mit Problemen zu mir kommen, weil ihre Gewohnheiten der Lebensgestaltung gestört wurden, massive Belastungen daraus entstanden sind. (1.2) Überdies mag es gelingen, Fehleinschätzungen in Bezug auf Störungsquellen nahezulegen. Dazu zählen Schuldzuweisungen, Enttäuschungen und schmerzliche Selbsttäuschung. Viele Probleme lassen sich beheben, wenn Verständigung im Dialog gelingt. (1.3) So endet das erste Kapitel mit der Darlegung von Korrespondenzen zwischen Kommunikationsstil und Beziehungsschemata bei der Verständigung bzw. Nichtverständigung. (1.4) Der Anhang reflektiert die hierfür relevanten sozialpsychologischen Theoreme.
1.1 Erfahrungen aus der Praxis
Meine Praxis im Vulkanland
Über zehn Jahre arbeite ich in der Südoststeiermark, genauer, im Vulkanland. Ich begleite Menschen aus unterschiedlichen Milieus. Es sind durchwegs Lebensbelastungen beruflicher und privater Herkunft, die zu Störungen des Befindens, zu anhaltenden Beschwerden sowie Belastungsreaktionen geführt haben. Ich unterlasse hier eine Kategorisierung der Diagnosen und klinischen Befunde. Der gemeinsame Faktor betrifft die graduell unterschiedlich starke Beeinträchtigung der Selbstbeziehung. Ich vertrete eine phänomenologische Haltung, mit der ich den Menschen begegne und sie im Gespräch kennenlerne. Je nach Art und Schweregrad der Beeinträchtigung seelischer Gesundheit und deren Folgen führtLernen aus Beziehungserfahrungim psychotherapeutischen Handlungsrahmen zu mehr Lebensqualität, sofern Erkenntnisse zu Veränderungsstrategien und Umsetzungsmaßnahmen im Alltag beitragen können. Es liegt in der Entscheidungshoheit jeder Person, die angebotene Form derreflexiven Selbstbeziehungim Alltagshandeln zu praktizieren. Die Einladung zur Betrachtung der Lebensgeschichte, zur Erkundung prägender Eindrücke, aus denen spezifische Verhaltensweisen und Überzeugungen hervorgegangen sind, verstehe ich als Kontaktangebot in diesem Rahmen.
Der Erstkontakt
Es ist oft erstaunlich, auf welche Weise meine Anwesenheit im Erstgespräch wahrgenommen wird. Die ersten Minuten einer Situation, in der wir uns als Gegenüber kennenlernen, verlaufen unterschiedlich und mit offenem Ausgang. Es kann sein, dass mich die Person mit fragendem Blick und Schweigen dazu auffordert, die Führung zu übernehmen, indem ich beispielsweise durch die Frage „Was ist denn der Anlass, dass sie jetzt bei mir sind?“ das Gespräch in Gang bringe. In anderen Fällen sitzen wir nach der Begrüßung noch nicht, da beginnt die Person von sich aus zu reden, was bis zu fünfzehn Minuten dauern kann, ohne dass ich von meiner Zuhörerrolle in die Erkundungshaltung als Fragensteller wechsle. Das sind zwei markant unterschiedliche Beispiele. Viele Erstsituationen verlaufen als Dialog zwischen Erkundungsfragen meinerseits sowie Ausführungen meines Gegenübers.
Auffällig sind Erzählweisen, die mich in eine Art Zeugenschaft versetzen, indem die erzählende Person zu Ereignissen und Vorgängen in jüngster Vergangenheit mir gegenüber Fragen aufwirft, sie aber unmittelbar selbst mit Erklärungen beantwortet. Zwar beinhalten diese Selbsterklärungsansätze immer auch einen Zweifel, ob diese Ursachenzuschreibung zutreffend sein könnte, doch will der Erzählfluss von mir nicht unterbrochen werden. Allemal geht es darum, nach und nach eine etwas luftigere Atmosphäre herzustellen, eine interessierte Aufgeschlossenheit zu vermitteln, um den Menschen mir gegenüber kennenzulernen.
Der grundsätzliche Handlungsrahmen beinhaltet die Erwartung einer Hilfestellung durch mich, ganz gleich, was der Anlass dafür sein mag. Es bedarf des Einfühlungsvermögens, dem Menschen in einer vertrauensbildenden Konversation entgegenzukommen. Wenn ich erfahrungsgemäß zwanzig Minuten als Erkundungsphase bestimme, folgt hernach die Aufmerksamkeitslenkung auf Erlebnishintergründe von Problemen, was so viel heißt wie den Fokus auf Bedürfnisse und Beweggründe zu richten. In sehr vielen Fällen mündet das in zwei Aussagen: „Ich möchte mich wieder in meinem Körper spüren!“ und „Ich möchte wieder Ich sein, so wie ich mich von früher kenne!“ Dieses ‚Früher‘ liegt oft viele Jahre zurück.
Ansatz der Prozessgestaltung