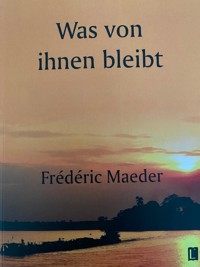
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Literareon im utzverlag, München
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Erzähler findet nach dem Tod seiner Mutter in ihrem Nachlass Aufzeichnungen über ihre jüngeren Jahre. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Erinnerungen an die mit ihrem Gatten im Belgisch-Kongo verbrachten, teils schicksalsschweren Jahre 1928 bis 1947. Die Aufzeichnugen enthalten auch sehr spärliche Hinweise auf einen unbekannten albanischen Grossvater mütterlicherseits. Trotz sorgfältigem Durchsuchen des Nachlasses findet der Erzähler keine weiteren Erkenntnisse zu diesem Vorfahr; die Spur verliert sich. Doch im Verlauf dieser Suche kommen alte, sorgfältig aufbewahrte und teils vergilbte Dokumente zum Vorschein, die im Erzähler eine bewegende familienhistorische Gedanken - Entdeckungsreise auslösen. Sie führt zum Eintauchen in die familiäre Vergangenheit im Belgisch-Kongo, dem Geburtsland des Erzählers, an das er keine Erinnerungen mehr hat - und zur Auseinandersetzung mit dem lange verdrängten Andenken an seinen Vater und dessen frühen Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Frédéric Maeder
Was von ihnen bleibt
Roman
Literareon
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.
© 2023 Frédéric Maeder
Titelabbildung: Tracy Angus-Hammond | pixabay
Printed in EU
Literareon im utzverlag
Tel. 089–30779693 | www.literareon.de
ISBN 978-3-8316-2411-9
Für meine Nachkommen – im Andenken an unsere Vorfahren
„Everyone has to lose the people they most love. Those before us die to lead us on: that’s the way of things. It’s ordinary.”
Nicolas Rothwell, in Red Heaven (2021), chapter VII: Envoi: Bodensee
„... what is the point of living if not to live through tales, and then retell them, and be consoled by their words as they flowed through time: words that give us the surest sense of knowing who and where we are.”
Nicolas Rothwell, in Belomor (2013), chapter IV: Mingkurlpa
Inhalt
1 Vor langer Zeit
2 Über mich
3 Überraschungen
4 Hinwendung
5 Kleinchen
6 Triptychon
7 Schweigen
8 Leid
9 Du, Verunfallter
10 Mount Lindesay
Dank
1Vor langer Zeit
In der guten Stube standen unsere besten Möbel: unter der flachen Deckenleuchte der runde Tisch mit vier Stühlen und entlang der einen Innenwand die ausladende Anrichte, deren Aufsatz kunstvolle Schnitzereien zierten. In der Ecke, wo sich die Aussenwände trafen, machte sich ein hoher Geschirrschrank breit. Die mit Zierschliffen versehenen Scheibchen seiner Sprossentür luden zum Blick auf das schöne Geschirr und die Gläser ein. An der anderen Innenwand harrten zwei weitere Stühle der seltenen Ereignisse, bei denen um den runden Tisch mehr als vier Sitzgelegenheiten benötigt wurden.
Es könnte ein November- oder Dezembertag gewesen sein, abweisend neblig draussen, wohlig warm drinnen. Was in der guten Stube vor sich ging, kündigte Festliches oder Wichtiges an. Mein grosser Bruder war ausser Haus. Damit verschaffte er mir, dem fünf- oder sechsjährigen Knirps, das Privileg, meine Mutter mit niemandem teilen zu müssen. Nur ich und sie waren im Haus; nur ich und sie in der guten Stube. Wunschlos glücklich kniete ich auf einem der gobelinbestickten Stühle am runden Tisch und beobachtete reglos Mutters Handgriffe.
Zuerst breitete sie ein flauschiges Tuch auf dem Tisch aus und legte einen weissen Lappen dazu. Dann schloss sie den linken Flügel der Anrichte mit einem goldenen Schlüsselchen auf und zog die oberste Schublade sachte bis zum Anschlag heraus. Zwei darin übereinander ruhende Einlagen hob sie an kleinen Klappgriffen geschickt aus ihrer Verankerung und legte sie neben das glatt gestrichene Tuch.
Entzückt betrachtete ich das Wunder: Weinrot breiteten sich zwei wundersame Landschaften vor mir aus, und wenn ich sie berührte, streiften meine Fingerchen über Samt. In diesen dunkel schimmernden Gefügen lagerten in schmalen Kuhlen und Klüften vollkommen unterschiedliche Gegenstände.
In der einen Einlage erblickte ich Reihen von Messern, Gabeln und Löffeln in verschiedenen Grössen. Mattsilbrig blinkten sie im kraftlosen Winterlicht. Jedem Stück stand für sich allein eine eigene kleine Halterung zu. Alle waren darin so befestigt, wie sie kaum je auf dem Tisch neben dem Geschirr zu sehen sein würden, nämlich auf ihren Längskanten stehend. Wie stramm die gesamte Anordnung und, gleichwohl, wie gefällig der Anblick! Welche Farbkontraste und welche Formenvielfalt! Und wie erregend mein Tasten nach warmem Samt und kühlem Silber!
Beim Anblick der zweiten Einlage mischten sich Ratlosigkeit und Verwirrung in mein Entzücken. In der weinroten Auskleidung ruhten in Passförmchen zwei lange Kolonnen von Elefäntchen-Paaren, links grössere, wie Eltern, und rechts kleinere, wie Kinder oder Junge. Das sah nach einem ganz aussergewöhnlichen Spielzeugkasten aus. In meiner Wunschvorstellung bewegten sich die vielen Tier-Miniaturen augenblicklich vor mir über eine Urwaldlichtung und fügten sich unter meinen Befehlen schnaubend und rüsselschwingend zu immer neuen Herden-Formationen. Dabei liess meine Fantasie die Realität weit hinter sich, denn so ausgestaltet, wie die Elefäntchen-Paare in ihren Bettchen vor mir lagen, war ihre Bewegungsfreiheit für immer eingeschränkt: Sie lagen oder standen einander so gegenüber, dass sich ihre leicht durchhängenden Rüssel berührten. Ich fand das lustig; doch was mich an diesen vermeintlichen Spielzeugfiguren verwirrte, war etwas anderes: das schmale, dünne Brett, das mit seinen Enden auf den Köpfen der Elefäntchen ruhte und von den sich berührenden Rüsseln der grösseren Tiere in der Mitte gestützt wurde. Dieses Brett war bei den kleineren Paaren kürzer und leichter und bedurfte keiner Stütze; die Rüsselchen trafen sich hier wie zum Kuss unter dem Brett, ohne dieses zu berühren.
Ganz im Banne dieser Niedlichkeit blickte ich zu Mutter hoch, und die liess mich wortlos lächelnd gewähren. Ich hob eines der Eltern-Paare aus seinem Bettchen und bestaunte die glatte gelblichweisse Figur aus der Nähe: Alle Einzelheiten, die ich aus meinen Tierbüchern über Elefanten kannte, fand ich hier, mit Ausnahme der Farbe, wirklichkeitsgetreu geschnitzt und geritzt und poliert vor mir. Als ich beobachtete, wie Mutter die Elefäntchen behandelte, wurde mir klar, dass es sich nicht um Spielzeuge handeln konnte. Sorgfältig untersuchte sie alle Paare, wie um sich zu vergewissern, dass sie die lange Nacht auf ihren Lagern unbeschadet überstanden hatten, wischte flüchtig mit dem Lappen darüber und reihte die ganze grosse Schar neben der Einlage auf dem Tisch auf. Der Anblick dieser Herde beglückte mich und ich war sicher: Hier liegt ein Schatz, den Mutter eigens für mich gehoben hat!
Aber ich spürte auch, dass Schönheit und Eigenart dieser Figuren nicht Selbstzweck sein konnten. Mutter sah die Frage in meinen Augen und sagte: Stell dir vor, ein Teller liegevor dir auf dem Tisch. Jetzt platziere ich ein grösseres und ein kleineres Elefäntchen-Paar rechts neben deinem Teller – so.
Aus der anderen Einlage entnehme ich nun ein grosses und ein kleines Messer. Beide lege ich mit der Spitze ihrer flachen Klinge auf die Brettchen, die auf den Köpfen der Elefäntchen ruhen; das grosse Messer auf die grössere und das kleine Messer auf die kleinere Figur. Diese Elefäntchen-Paare sind unsere Messer-Bänklein, die ich bei besonderen Gelegenheiten aufdecke. Nun verstand ich, welche Aufgabe diesen Kunstwerken zugedacht war und weshalb sie so und nicht anders geformt waren. Zusammen mit den auf ihnen ruhenden Messern wirkten sie in diesem einen Augenblick auf mich wie kleine, aber edle Prunkstücke aus einer Märchenszene.
Mutter sprach zu mir auch über das Material, aus dem die Figuren beschaffen seien. Sie nannte es kostbar und ich hörte ein Wort, das mir Rätsel aufgab. Denn ich wusste, wie Elfen aussahen; sie schwebten und hüpften durch eines meiner liebsten Bilderbücher. Staunend und neidisch konnte ich endlos durch die Geschichte von Tun und Lassen dieser scheinbar schwerelosen geflügelten Kleinstwesen blättern. In meinem Buch traten sie alle als winzige Mädchen auf. Sie trugen knapp bemessene, die Körperchen umschmiegende Kleidchen aus grünen Blumenblättern und ebenso grüne Pantöffelchen, auf denen sie, wenn sie nicht gerade durch die Lüfte schwebten, auf leisen Sohlen Überraschungen bereiten konnten. In ihren durchsichtigen Flügelchen spiegelte sich ein hellgrüner Abglanz der Kleidchen und ihres langen Haars, das ihnen als geschmeidige Mähne aus Gras weit über die Schultern floss. Am längsten verweilte mein Blick jeweils auf jenem Elfchen, das neben einer Glockenblume im Gras kniete und mit einer Flöte in Händen und am Mund hinauf gegen eine dunkelblaue Blüte musizierte, als gelte es, allein mit diesen Klängen das weitere Gedeihen der Blume sicherzustellen.
Und ja, man konnte die makellose Haut der Elfchen auch als gelblichweiss bezeichnen. Zudem hatten sie alle lange schlanke Beinchen. Aber wenn ich die Elefäntchen-Paare neben meinem imaginären Teller musterte, fiel mir immer noch schwer, sie mit den noch viel kleineren, grazilen Gliedern der Elfen in Verbindung zu bringen. So blieb Mutters Hinweis, die Messer-Bänklein seien aus Elfen-Beinen geschnitzt worden, für mich ein Rätsel. Aber Mutter musste wissen, wovon sie sprach, und für eine Klärung blieb ohnehin keine Zeit mehr. Mutter hatte die Einlage mit dem Silberbesteck vor mich hingeschoben und bezog mich jetzt in das weitere Geschehen ein.
Jetzt darfst du mir ein Stück nach dem anderen reichen, wenn ich es dir sage. Beginne oben links, mit den grossen Messern, hörte ich Mutters leise Stimme. Ernst und erwartungsvoll nickte ich.
Achtsam und geduldig, in Gedanken versunken und manchmal versonnen lächelnd, polierte Mutter nun ein Besteckteil nach dem anderen. Den Lappen tränkte sie ab und zu mit einer stechend riechenden Flüssigkeit. Die gereinigten Stücke legte sie nicht sofort in ihre samtene Ruhestätte zurück, sondern reihte sie neben dem Besteckkasten auf dem flauschigen Tuch auf. Während einer kurzen Pause liessen wir unsere Blicke zufrieden auf dem in neuem Glanz strahlenden Silber ruhen.
Mutter strich zärtlich über mein Haar, dann setzte sie ihre Arbeit still und in unverändertem Rhythmus fort.
Ich hatte alle Zeit, den Inhalt der weinroten Landschaft zu erkunden. Messer, Gabeln, Löffel, alle in verschiedenen Ausführungen: Ich zog sie aus ihren Halterungen, wog sie prüfend in meinen Händchen, betastete und verglich ihre Formen und Verzierungen. Für die kahlen Äste der Birnbäume, die vor den Fenstern unter winterlichen Windstössen zitterten, hatte ich keine Augen. Das Rumpeln und Keuchen des nahenden Drei-Uhr-Zugs drang nicht zu mir. Aufmerksam musterte ich die üppig verzierten Griffe der verschiedenen Esswerkzeuge, die keineswegs alltägliche Eleganz der Messerklingen, die vornehmen Wölbungen der Löffel und Gabeln. Bei jedem Teil, das ich Mutter weiterreichte, strichen die Kuppen meiner Fingerchen rasch über zwei kleine Vertiefungen in der silbernen Oberfläche. Bei den Messern entdeckte ich sie gleich nach dem Griff am noch stumpfen Teil der Klinge; bei Gabeln und Löffeln auf der Unterseite, wo sich die Griffwölbung zu verbreitern begann. Es handelte sich immer um die gleiche Kerbung, doch nicht immer liess sie sich gleich deutlich wahrnehmen.
Mochten diese Prägungen noch so abgeschliffen oder zerkratzt sein, einem inneren Drang folgend musste ich sie an jedem Messer, jeder Gabel und jedem Löffel aufs Neue ertasten. Für mich lag in diesem zwanghaft-spielerischen Tun eine flüchtige Magie. Was diese winzigen Zeichen im Silber bedeuten könnten, kümmerte mein kindliches Gemüt nicht. Noch fragte ich nach keiner Entschlüsselung. Unter dem liebevoll gewährenden Blick meiner Mutter glitten meine Fingerchen unbekümmert wieder und wieder über dieses Д. М.
*
Wenige Jahre später. Ich konnte schon lesen und schreiben.
Niemand in unserer Familie nannte sie einfach Oma oder Omi oder Grossmama; weder Baba noch Nonna. Jeder dieser Begriffe hätte für sich allein zu bezeichnen vermocht, wer sie für uns war. Die andere Grossmutter hatten wir nie gekannt, denn sie war lange vor unserer Rückkehr aus Afrika in die Schweiz verstorben. Trotzdem war die eine nie nur die Omi, sondern stets die Wiener Oma. Mein Bruder und ich wussten: Aus Wien, das bedeutete aus einem Nachbarland und aus einer weit entfernten Grossstadt.
Befand sich die Oma dort, wo sie hingehörte, also in Wien, bekamen mein Bruder und ich über sie seltsame Geschichten zu hören. Nicht selten wurde über sie gelächelt oder gar gefrotzelt. Aber aus Gründen, die uns Kindern damals verborgen blieben, gab es unter den Eltern auch Streit wegen dieser Oma. Das geschah vor allem dann, wenn die Eine ihren Besuch bei uns angekündigt hatte. Vater konnte nicht verhindern, dass solche Besuche manchmal sogar auf Weihnachten fielen. In diesen Fällen stand uns eine Adventszeit bevor, in der sich die Spannung zwischen unseren Eltern unheilvoll aufzuladen pflegte. Trotzdem gelang es unserer Mutter fast immer, aus der Tiefe ihres friedfertigen Wesens erstaunliche Kräfte abzurufen. So sorgte sie während dieser Zeiten der Prüfung zumindest äusserlich für sogenannt frohe Weihnachten.
Solche Festtage lagen hinter uns. Die Wiener Oma residierte seit einiger Zeit als Feriengast in unseren engen Verhältnissen und versuchte beharrlich, diese in eine Bühne zu verwandeln. Darauf hatten wir alle, Erwachsene und Kinder, gefälligst als Statisten um Ihre Hoheit zu tänzeln. Vater zog in dieser Lage das beste Los. Ohne sie wirklich spielen zu müssen, schlüpfte er in die Rolle des hart arbeitenden, verantwortungsbewussten Prokuristen. Er floh so oft und so lange er konnte von der häuslichen Bühne an seinen Arbeitsplatz ausser Haus. Mein Bruder, stolze fünf Jahre älter als ich, meldete sich in voller Skimontur ebenfalls unverfroren als Statist ab. An den nahen Hängen wollte er selber eine Hauptrolle übernehmen. Blieben ich und Mutter. Letztere war damit allein der Wiener Oma ausgeliefert, denn klein und hilflos, wie ich damals war, musste ich sie in den Fängen Ihrer Hoheit zappeln lassen.
Aus sicherer Entfernung hörte ich, wie die beiden sich in der Küche stritten. Die Wiener Oma wollte ihrer Tochter gebieterisch eine Lektion im Backen von Topfenstrudel erteilen. In diesem Haus seien ja nicht einmal über Weihnachten Mehlspeisen aufgetragen worden, die diesen Namen verdienten. Die Tochter, wissend, wie ihre Küche nach dieser Lektion aussehen würde, wehrte sich, wenn auch nur halbherzig und schliesslich erfolglos. Ich lauschte weiter, wie die Wiener Oma ihrer Gehilfin Anordnungen erteilte und sie kritisierte oder lächerlich machte, wenn etwas schiefzugehen drohte. Mit der Zeit wurde es etwas stiller, nach und nach legte sich der Aufruhr. Bald darauf drang der versöhnliche Duft bis zu mir, den ein im Backofen schmorender Topfenstrudel verströmte.
Ich lag auf meinem Bett und hatte die Qual der Wahl. Vor mir lag der Stapel der zu Weihnachten erhaltenen Bücher. Ich betrachtete und streichelte sie, wog sie in der Hand. Ich verglich die farbenprächtigen Schutzumschläge miteinander, roch an den noch druckfrischen Seiten, konnte mich aber nicht entschliessen, mit welcher Lektüre ich beginnen wollte. Mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen, war eine fragwürdige Fertigkeit, die ich mir erst viel später aneignete. Also: Welches Buch zuerst? Wem gebührte der Vorrang, und weshalb? Spielerisch zögerte ich den Augenblick des vorübergehenden Abschieds aus der Realität hinaus. In welche der vor mir verheissungsvoll ausgebreiteten Welten wollte ich mich als erste hinüberlesen? Sollte es Bambis Kinder, Tecumseh der Berglöwe oder doch eher Am Silbersee sein?
Diese Konzentration auf mir Wesentliches wurde geräuschvoll gestört. Während der Topfenstrudel in der Küche still und wohlriechend seiner Vollendung entgegendampfte, liess die Wiener Oma im Salon den Vorhang für einen weiteren Akt auf der Bühne unserer engen Wohnung heben. Ich hörte, wie meine von der Küchenepisode längst erschöpfte Mutter von Ihrer Hoheit ans Klavier beordert wurde. Stockend begann sie, Melodien zu klimpern, die ihrer Mutter als Begleitung zu einem der nachmittäglichen Auftritte dienen sollten. Ich vernahm langes bedachtes Räuspern. Danach ein noch heiserleises Modulieren einiger Höhen und Tiefen in verschiedenen Lautstärken zur Vorbereitung von Lunge und Kehle. Schliesslich ein kraftvoll vibrierendes Summen, mit dem der Begleiterin am Klavier angezeigt wurde: Ich bin bereit! Während Mutter ihre Akkorde lustlos vom Blatt in die Tasten tropfen liess, erhob sich aus der alten Wiener Brust ein Sturm von Klängen. Er fesselte mich gegen meinen Willen, ja, er rang mir ungläubiges Staunen ab.
Melodie um Melodie, schütter untermalt mit Klängen aus dem lange nicht mehr gestimmten Klavier, drang gegen Wände und Fenster des Salons. Lied um Lied entwich in durchdringender Klangfülle durch Türe, Küche und Korridor in Richtung meines Zimmers, meines Betts und meiner gemarterten Ohren.
Hastig schlug ich die Zimmertür zu und griff nach dem Silbersee. Doch noch konnte ich mich nicht aus dieser turbulenten Realität verabschieden. Noch pochte mein Herz ein paar lange Schläge für unsere leidende Mutter, unser aller Engel auf Erden. Ich fühlte, ich wusste: Nicht das Chaos in der Küche, nicht das Versagen am Klavier bedrückte sie in diesen Augenblicken am meisten. Es war ihre Angst, die Wiener Oma werde ihrem Mezzosopran, hatte sie ihn erst einmal zu annähernd jugendlicher Geschmeidigkeit warm gesungen, auch dann noch freien Lauf lassen, wenn der Vater, müde von der Arbeit, das Haus betrat.
Immerhin dies blieb Mutter erspart. Das improvisierte Wiener Rezital der einstigen Operettensängerin nahm beizeiten ein Ende. Der Tag schien gerettet. Am Silbersee rauschten die Ahornwälder im Abendwind. Mit letzten Sonnenstrahlen glitt ein warmer Schimmer übers Dach des Blockhauses. Graue lebhafte Wasserzünglein beleckten den schmalen Streifen Strand, auf dem das Ruderboot am Trockenen lag. Das leise Knirschen der elterlichen Schlafzimmertür zeigte mir an, dass Mutter sich kurz hinlegte zu einem ihrer friedlichsten Augenblicke, wenn die Wiener Oma unter uns weilte. Aus der Küche vernahm ich Selbstgespräche und lautes Hantieren am Backofen. Eine Mehlspeise, die diesen Namen verdiente, harrte endlich ihres Verzehrs.
Über die Landschaft am Silbersee senkte sich die Nacht. Am klaren Firmament funkelte ein Diamantenmeer. In der tiefen Dunkelheit, die das Blockhaus umgab, begann sich das nächtliche Leben der Tierwelt zu regen. Mich schauderte. Da war ein Rascheln von Laub und ein Knacken von Ästen; ein Fauchen und Grunzen und Schmatzen; ein Trippeln und ein Tappen. Da blinkten gelbe und grüne und rote Augenpaare, da roch es unversehens nach Fuchs oder Dachs. In weiter Ferne hallte das lang gezogene Klagelied eines Kojoten oder Wolfs zum Himmel. Was würde in dieser Nacht auf die friedlich im Blockhaus schlafende Familie zukommen? Etwas musste bald geschehen, denn so dick war das Buch nicht.
Unter die Laute aus der Tierwelt mischten sich plötzlich auch Geräusche, die nur von einem Menschen herrühren konnten. Unsichere, leicht hinkende oder schleifende Schritte näherten sich langsam meiner Blockhaustür. Hatte ich sie vor dem Zubettgehen auch gut verriegelt?
Bevor ich mich erheben und dies überprüfen konnte, klopfte es schon an die Tür. In meiner Benommenheit brachte ich keinen Laut hervor. Leise ächzend senkte sich die Klinke und langsam öffnete sich die Tür. Ich hatte keinen Fluchtweg mehr, konnte mich nicht mehr ins Ruderboot werfen und über den Silbersee absetzen. In der Tür stand die Wiener Oma!
Ich starrte sie an, als wäre sie der leibhafte Schratt aus dem kanadischen Urwald. Auf der Schwelle hielt sie kurz inne und musterte mein Zimmer und mich. Ich sass mit angezogenen Beinen auf dem Bett, den aufgeschlagenen Silbersee auf den Knien. Missmutig verharrte ich stumm und versteinert. Leicht schwankend bewegte sich die Wiener Oma gegen die Mitte des Zimmers. In Sekundenbruchteilen, die sich traumähnlich dehnten, nahm ich Einzelheiten dieser Erscheinung erstmals in meinem kindlichen Leben bewusst wahr.
Vor mir stand eine untersetzte Gestalt, weder schlank noch korpulent, vom Alter gebeugt. Die Füsse steckten in schräg abgetreten Hausschuhen. Um die Beine schlotterte ein dunkler Faltenrock, hell gesprenkelt wie mit Reiskörnern beworfen. Auf dem leicht vorgereckten Hals sass der Kopf mit einem schlohweissen Gewirr als Haarpracht. Eine kräftige Nase und wulstige Lippen prägten das Gesicht. An ihren Ohrläppchen tanzten Perlhänger. Durch schlierige Brillengläser richteten sich wässrige Augen auf mich.
Mit dem, was mich nun unerwartet von der ersehnten Flucht in die raunenden Ahornwäldern Kanadas fernhielt, hätte ich mich unter gewissen Umständen abfinden können. Doch vergeblich starrte ich auf die Hände der sich nähernden Gestalt. Mir wurde kein Teller dargereicht, auf dem ein mit Puderzucker bestäubtes Stück Topfenstrudel thronte. Das allein hätte mich mit dem Verhalten des Eindringlings versöhnen können.
Enttäuscht und trotzig den Silbersee umklammernd schwieg ich weiter.
Die Wiener Oma lächelte, ihr goldener Eckzahn blinkte. Und die Hände mit den knotigen Fingern waren nicht etwa leer.
Vielmehr hielten sie mir leicht zitternd etwas entgegen, das ich weder erwartete noch erwünschte. Na mach schon, nimm und schau es dir an!, zischte sie und legte ein abgegriffenes Wachstuchheft neben mich aufs Bett. Verständnislos starrte ich auf den Einband, der längst seinen ursprünglichen Glanz verloren hatte.
Nichts hätte mich weniger interessieren können. Nach nichts sehnte ich mich mehr als nach den Ufern des Silbersees.
Na mach schon, schau es dir endlich an!, drängelte sie ungehalten. Ich wollte meine Ruhe; vor Streit mit ihr fürchtete ich mich. Seufzend streckte ich meine Hand nach dem Heft aus. Ziellos begann ich, darin zu blättern. Die Seiten fühlten sich steif und widerspenstig an. Viele waren mit ausgeschnittenen Zeitungsartikeln beklebt. Ich sah eine Schrift, die mir in alten Büchern schon begegnet war und die ich nur mit Mühe hätte entziffern können. Aber all das vergilbte Geschreibsel liess mich ohnehin kalt.
Anders verhielt es sich mit jenen Seiten, auf die Artikel mit Fotografien oder gar nur einzelne Aufnahmen in Postkartenformat geklebt waren. Beim Anblick dieser Bilder wich meine Gleichgültigkeit einer immer lebhafteren Neugier. Was sich meinen Augen darbot, war überaus ungewöhnlich; es entstammte einer mir damals noch gänzlich fremden Vergangenheit und Welt. Von den Bildern ging ein Sog aus, der mich unwiderstehlich vom Ufer des Silbersees hinweg in ein ganz anderes Reich zu locken vermochte.
Auf den verblassten und nicht immer scharfen Aufnahmen war stets die gleiche Frau zu sehen, jeweils in anderer Aufmachung und vor anderem Hintergrund. Sie war stattlich und alle ihre Kostüme schmeichelten ihrer Gestalt. Doch mehr als das Aussehen dieser Frau interessierten mich die Hintergründe, vor denen sie posierte, und vor allem ihre Kostüme. Diese amüsierten mich mit ihrer märchenhaften Vielfalt.
Unwillkürlich begann ich mich zu fragen, welche Tätigkeiten oder Lebenslagen einer jeweils zur Schau gestellten Verkleidung zugeordnet werden könnten.
Zwei Aufnahmen zeigten die Schöne im Profil. Auf beiden Bildern trug sie einen tellerförmigen und üppig geschmückten Hut. Hier stand sie, einen grossen Schirm unter den Arm geklemmt, vor einer Kulisse, die einen Treppenaufgang erahnen liess. Dort stemmte sie fröhlich lachend die rechte Faust in die Hüfte, während sie mit der linken einen langen Heurechen schulterte. Ihr Rock war tief ausgeschnitten und sie stand vor einem mit knorrigen Föhren bestückten Hintergrund.
Auf einem kleineren Zeitungsausschnitt präsentierte sich die gleiche Frau vor einem Hintergrund mit Säulen und bemalten Tapeten. Diese Umgebung strahlte Wohlstand aus, dessen sich die Abgebildete offensichtlich erfreute. In ihrem schneeweissen, über und über mit feinen Blattornamenten durchwirkten Kostüm sah ich ein Fest- oder gar ein Hochzeitskleid.
Schliesslich blieben meine Finger in einer der letzten Seiten des Hefts gefangen. Das Blatt war steif und dick. Da war kein Zeitungsartikel mehr eingeklebt, sondern nur der kartonharte Abzug einer alten Fotografie. Der Hintergrund sah nach Prunkgemach aus. Und dazu passte die im Vordergrund das gesamte Bild vereinnahmende Gestalt auf geradezu ideale Weise: Ich sah ein Geschöpf, das unbeschreiblich reich sein musste.
Sein Lebensinhalt bestand unzweifelhaft darin, in Schönheit zu erstrahlen. Die Hausherrin, die Adlige, die Geliebte des Grafen; wer auch immer sie sein mochte, sie erheischte Bewunderung. Über die linke Schulter hinweg blickend wandte sie mir ihr Gesicht zu. Ihre grossen Rehaugen liess sie herausfordernd in den meinen ruhen, ohne auch nur mit den Wimpern zu zucken. Diese Geste unterstrich sie mit der Andeutung eines spöttischen Schmunzelns; zwei Grübchen umspielten dabei ihren Mund. Ohne Scheu lud mich dieses Geschöpf ein hinzuschauen, nur immer hinzuschauen.
Kind, das ich war, konnte ich dieser Aufforderung nicht widerstehen. Anfänglich fiel mir schwer, mich aus dem Bann des verheissungsvollen Antlitzes zu lösen. Dann begann ich doch, die Gesamtheit der mich bezaubernden Erscheinung zu mustern:
Die Verführerin trug ein faltenlos den Körper liebkosendes Samtgewand. Während es sich hauteng um den Oberkörper schmiegte, gewann es von den Oberschenkeln abwärts an Weite. Gegen den Boden hin fächerte es derart aus, dass von Schuhen oder Fesseln nichts zu sehen war. Am Saum dieser kleinen Schleppe prangte rundum eine feine weisse Fellverzierung. Sie wirkte wie die zahme Gischt einer Meeresbrandung. Der Strand, über den hin sie tanzte, war hier allerdings ein kunstvoll gewobener Teppich.
Ich war im Begriff, den Reizen dieses Wesens zu erliegen. Der Herausforderung ihrer Rehaugen fühlte ich mich willenlos ausgeliefert. Zögerlich wollte ich zu ihr auf den Teppich treten und mit einem Finger nur ihr Samtgewand streicheln. Wer weiss: Vielleicht hätte sie mich anstelle der stets übermüdeten Mutter für einen kurzen Augenblick in ihre Arme geschlossen?
In solchen Tagtraum entrückt, starrte ich auf das Bild vor mir. Doch während meines Sehnens rückten fleckige Finger in mein Blickfeld und wiederum wurde ich gegen meinen Willen in eine unerquickliche Wirklichkeit zurückgeholt. Verstört blickte ich auf: Über mich beugte sich der Störfaktor mit blinkendem Eckzahn. Anstelle verführerischer Rehaugen sah ich fahle Augäpfel. Für einen Augenblick entstellte die Andeutung eines Lächelns das gepuderte Gesicht. Dieses musternd verharrte ich, nach wie vor sprachlos, Auge in Auge mit der Wiener Oma. Mit klammen Händen entzog sie mir langsam, keinen Widerstand duldend, das geheimnisvolle Wachstuchheft und nahm es an ihrem Busen in Schutz. Ich fühlte mich verlassen, betrogen, eines Traums abrupt beraubt.
Der Augenblick gerann zu einem Knoten aus Enttäuschung und Verwirrung. Was eigentlich sollte das alles? Was bezweckte die Wiener Oma mit diesem Auftritt? Was ich spürte, sengte mein kleines Herz: Die in meiner Vorstellung so innig angestrebte Nähe zu Schönheit in weiblicher Gestalt wurde mir verwehrt. Deshalb wollte ich auch nicht weiter in der Wirklichkeit selber verweilen. Ich musste in eine Welt entfliehen, die keinen Bezug mehr hatte zu Rehaugen und zur Wiener Oma.
Verstimmt griff ich wieder zum Silbersee und hoffte, an seinem Gestade den Vorabend bis zur Rückkehr des Vaters von der Arbeit in ungestörter Idylle verbringen zu können. Mit dem aufgeschlagenen Buch auf den Knien verfolgte ich aus den Augenwinkeln noch den Abgang des Eindringlings. Mir den Rücken zuwendend, schwankte sie schweigend zur Tür. Gerade als ich erleichtert aufatmen und mich wieder dem Schutz des traulichen Blockhauses überlassen wollte, hielt die Wiener Oma im Türrahmen inne. Noch einmal drehte sie sich zu mir und tappte mit der einen Hand wiederholt auf den Deckel ihres bauchigen Heftes. Meines letzten Quäntchens Aufmerksamkeit gewiss und bevor sie im schon dunkeln Korridor verschwand, liess sie mit heiserer Stimme noch ein paar rätselhafte Worte in meinem Zimmer schweben:
Aufgegeben – alles aufgegeben – und dann dieser Albaner!
2Über mich
Wann immer ich in früheren Jahren jemandem meinen Lebenslauf unterbreiten musste, ereignete sich in nachfolgenden Vorstellungsgesprächen Ähnliches: Geboren im Belgisch-Kongo? Können Sie mir das kurz erläutern?, wurde ich gefragt.
Die Frage überraschte mich nicht. Die afrikanischen Fakten und Legenden, die unser Leben in der Schweiz oft mehr als nur diskret begleiteten, fand ich selber aufregend und romantisch. Aber sie waren immer auch mit einem Zwiespalt verbunden.
Zum einen konnte niemandem verborgen bleiben, dass unser Vater in der Schweiz nicht glücklich war. Im Kongo hatte er sich in privaten und halbstaatlichen belgischen Kolonialunternehmungen emporgearbeitet. Dort war er respektiert und ihm war in verschiedenen Anstellungen beachtliche Verantwortung übertragen worden. In der Schweiz war ihm von all dem nichts mehr vergönnt. Unterfordert, unzufrieden und ausgebeutet fristete er hier ein Dasein als Angestellter von Gnaden eines ehemaligen Schulkollegen, der es zu einem eigenen Geschäft gebracht hatte.
Zum anderen kam ich mit meinen eigenen Kongo-Gefühlen nie wirklich ins Reine. Denn die Zeitspanne, die ich dort verbracht hatte, lag in der Vergangenheit gänzlich jenseits meiner Erinnerungsschwelle. Als wir in die Schweiz zurückkehrten, war ich noch keine drei Jahre alt. Im Unterschied zu meinem Bruder konnte ich deshalb nie aus einem eigenen Vorrat an afrikanischen Erfahrungen und Erinnerungen schöpfen. Das wurmte mich oft, es fühlte sich an wie eine Blösse oder Wunde. Geburtsort: Costermansville am Kivusee – war das nicht ein Silbengemisch, in dem sich schon Kolonialgeschichte und Eingeborenenwelt spiegelten? Und hätte ich die ehemalige belgische Ortsbezeichnung mit dem heutigen Bukavu ersetzt, wäre eine Lautfolge entstanden wie geschaffen als Titel für kongolesische Kindheitserzählungen! Doch weder Bilder noch Gerüche, weder Klänge noch körperliche Empfindungen aus meinen allerersten Lebensjahren am Kivusee waren in mir haften geblieben. Hilflos und gedemütigt stand ich da, wenn es im Kindergarten hiess: Wie kannst du nur behaupten, du seist in Afrika geboren, wenn du nicht einmal schwarze Haut hast! Womit hätte ich mich rechtfertigen sollen?
In diesem Zusammenhang empfand ich zudem als trauriges Paradox, dass mein Erinnerungsvermögen gerade erst während unserer langen Rückreise in die Schweiz zu erwachen begonnen hatte. Eine Befindlichkeitserinnerung, nur mehr unscharf bebildert, aber mit umso heftigeren Empfindungen nachwirkend, blieb mir immer und lebhaft abrufbar: mein Elend auf der scheinbar ewig dauernden Schiffsreise, während der ich ununterbrochen seekrank war. Es war eine namenlose Pein, für mich als Kleinkind neu und bedrohlich, die meinen Leib erfasste, marterte und nicht wieder freigeben wollte. Ich überlebte von Erbrechen zu Erbrechen. Neidisch sah ich meinen Bruder und andere Kinder auf Deck ihre Kreise ziehen und ihre Spiele geniessen, während ich mich vor Schwäche nicht rühren konnte und die Nähe der Mutter mich vor dem Untergang bewahrte. Jenes kindliche Gefühl des Ausgeliefertseins an ein lähmendes körperliches Unwohlsein, begleitet von Angst und Hoffnungslosigkeit, eröffnete in meinem Gehirn ähnlich einem Geburtsschmerz den seltsamen Reigen frühester Langzeiterinnerungen.
Eine zweite folgte dieser ersten auf den Fuss, auch sie noch von der Rückreise aus Afrika. Diesmal waren es beängstigende Bilder, die mich nie mehr gänzlich losliessen: Auf jener Reise nach Europa legten wir gewisse Strecken auch per Eisenbahn zurück. In einem Abteil sass ich Mutter gegenüber. In Netzen und Ablagen direkt über unseren Köpfen lagerten Teile unseres Gepäcks. Bei einem ruckartigen Halt des Zugs löste sich aus der Ablage über mir ein Tropenhelm, fiel herunter und traf Mutter mit seinem stahlharten Rand an der Stirn. Mutter erlitt eine klaffende Platzwunde, aus der ihr das Blut in Strömen über Stirn und Gesicht floss. Bei diesem Anblick erstarrte ich in kindlichem Schreck. Eine unsägliche Angst, nun sei es um Mutter geschehen, erfasste mich, und ich blieb untröstlich, bis die Wunde gereinigt und verbunden war. Dieses Bild von Mutters blutüberströmtem Gesicht und das Elend der Seekrankheit wanderten fortan Hand in Hand als Geschwisterpaar frühester Erinnerungen meinem Lebensweg entlang. Im Fall von Mutters Stirn half die Natur dem erinnerten Wiedererleben unfreiwillig nach: Die Narbe der Platzwunde verschwand nie mehr ganz. Sie verheilte, sie glättete sich, zog sich zusammen und wechselte ihren Teint. Aber ich nahm sie bis an Mutters Lebensende wahr. Und immer, wenn dies bewusst geschah, sass ich wieder als Kleinkind im Zug und sah die Rinnsale von Mutters dunklem Blut vor mir.
*
Können Sie das kurz erläutern? – Natürlich musste ich mich in solchen Situationen dazu zwingen, ein paar unverfängliche Sätze über meine Eltern und ihre Zeit im Kongo zu äussern. Im Zusammenhang mit meiner Stellenbewerbung ging es dabei ja um eine blosse Nebensache, wenn auch um eine nicht alltägliche.
In Wirklichkeit konnte man dem afrikanischen Schicksal unserer Eltern mit kurzen Erläuterungen niemals auch nur annähernd gerecht werden. Es waren im Gegenteil häufige und längere Erzählungen, die mein Bruder und ich von der Mutter oder von schweizerischen oder belgischen anciens congolais immer wieder gehört hatten. Am wenigsten wussten wir allerdings von den ersten fünf Jahren, die Vater noch als Junggeselle im Kongo verbracht hatte. Aus eher vagen Andeutungen war uns nur bekannt, dass er, völlig auf sich allein gestellt, Ende 1927 als erst 22-Jähriger in Stanleyville, dem heutigen Kisangani, Fuss gefasst hatte. In dieser Stadt an der grossen Biegung des Kongo-Flusses im Norden des Landes hatte er sich im Dienst von Belgiern, Griechen oder Armeniern bestätigt und sich eine Existenz aufgebaut.
Wären entsprechende Aufnahmen vorhanden, könnte von der anschliessenden Periode hingegen eine abenteuerlich-romantische Video-Dokumentation zusammengestellt werden. In einem Teil würde sie von Vaters Europaurlaub nach der ersten fünfjährigen Vertragsperiode handeln: die lange Reise aus dem Herzen Afrikas über Ägypten, den Nahen Osten, Griechenland, den Balkan, Wien und zurück in die Schweiz; der coup de foudre, der in der Donaumetropole zwischen ihm und der blutjungen Margaretha Maery aufloderte; kurze Wochen darauf die Vermählung der beiden im idyllischen Kirchlein von Ferenbalm in der Schweiz; der beängstigende, den jungen Gatten völlig ermattende Malariaschub unmittelbar vor der Wiederausreise Richtung Afrika; das schöne Grossstadt-Einzelkind, das geschworen hatte, ihm bedingungslos in den Busch zu folgen!
Einen weiteren Teil dieser Dokumentation würde ich der Reise des jungen Paars nach Afrika widmen. Szenen von wahrhaft reisehistorischem Interesse würden darin in praller Vielfalt und Fremdartigkeit wiederbelebt. Wer sich wie selbstverständlich der heutigen Langstreckenmobilität erfreut, würde kaum glauben können, auf welchem Weg die zwei Neuvermählten vor rund 90 Jahren den Belgisch-Kongo erreichten: Bern – Mailand – Brindisi im Zug; zwei Etappen von Brindisi nach Athen und von Athen nach Alexandria mit dem majestätischen Doppeldecker-Hydroplan Satyrus der British Imperial Airways; Alexandria – Kairo im Zug; anschliessend drei Tagesetappen mit dem normalen Flugzeug Kairo – Wadi-Halfa, Wadi-Halfa – Khartum und Khartum – Juba an der Grenze zwischen Sudan und Belgisch-Kongo; und endlich, in vier Tagen, über 1.000 km im Auto von Juba über Aba nach Stanleyville am Kongo-Fluss. Dort traten Max und Margaretha Maery am 1. Mai 1933 ihre gemeinsamen Tropenjahre an!
Mit besonderem Stolz zeigte Mutter uns jeweils die zwei oder drei dunklen, unscharfen Fotografien des massigen Wasserflugzeugs der British Imperial Airways. Auf der einen schaukelte es am Anker vor Athen; auf einer anderen sah man das Innere einer der luxuriösen Kabinen; die dritte war aus der Luft über dem Meer aufgenommen und zeigte weit unten einen grossen Dampfer im Mittelmeer. Wer sich solche Flüge mit einem der wenigen damals im Einsatz stehenden Wasserflugzeuge leisten konnte, wurde beneidet. Die beiden Etappen mit der Satyrus gehörten zu Mutters Höhepunkten auf dieser Hochzeitsreise.
Den folgenden 15 Jahren würde eine blosse Dokumentation allein nicht mehr gerecht. Wohl existieren aus dieser Epoche ein paar vergilbte Schwarz-Weiss-Aufnahmen. Ihr Anblick vermittelte mir zumindest eine Ahnung der äusseren Umstände des damaligen Lebens in jenem Land von schier unbegrenzter Ausdehnung und Mannigfaltigkeit. Was diesen Bildern an fotografischer Subtilität abging, machten sie mit einzigartiger Authentizität wett: von den Eltern – meist von der Mutter mit ihrer behüteten Voigtländer – festgehaltene Augenblicke aus dem kolonialen Alltag im Busch. Um jede dieser Aufnahmen, und mochte sie ästhetischen Ansprüchen noch so wenig genügen, rankten sich Erinnerungen der Eltern und teils sogar des Bruders. Aber selbst die Gesamtheit all dieser Bilder und der dazugehörigen Legenden ergäbe bestenfalls ein Gerippe für die vollständige Kongo-Saga unserer Familie. Die Chronologie dieser Saga liesse sich zwanglos in Kapitel gliedern, die den Namen jener Orte trügen, wo unsere Eltern oder die ganze Familie kürzere oder längere Zeit gelebt hatten.
Das letzte Kapitel unserer Kongo-Saga könnte ausklingen mit der Beschreibung eines nostalgischen Blicks von unserem Haus auf dem Hügel über die Stadt Bukavu und den Kivusee, wo wir lebten, bevor wir nach Europa zurückkehrten. Dazu würden die Erinnerungen unserer Eltern an jene letzte Etappe im Kongo gehören: fruchtbare, unberührte Landschaften von berückender Schönheit; ein gesundes, relativ kühles Klima; eine stattliche Familienunterkunft mit eigenem Gärtchen; ein viel beschäftigter, für seine Fähigkeiten geschätzter Vater.
In diesem Haus auf dem Hügel über der Stadt verbrachte ich jene ersten Jahre, die sich meiner eigenen Erinnerung bis heute so beharrlich entziehen.
*
Kurze Erläuterungen zu jenem Teil unserer Familiengeschichte wurden unweigerlich zum oberflächlichen Abklatsch. Selten hakten meine Befrager nach, kaum jemand war an irgendwelchen Einzelheiten näher interessiert. Begreiflicherweise wollte in solchen Situationen niemand wissen, weshalb es meinen Vater in so jungen Jahren zuerst nach Belgien und dann in die afrikanische Urwaldkolonie verschlagen habe. Mir wurde auch keine Frage dazu gestellt, wie eine Schweizer Familie kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs von Bukavu am Kivusee zurück in die Schweiz gelangt sei. Auch das wäre freilich kaum kurz zu erläutern gewesen: Es dauerte nämlich 36 Tage. Davon verbrachten wir deren sechs in einer Barke auf dem Kongo-Fluss meerwärts schaukelnd und deren 16 auf einem Hochseeschiff von Matadi nach Antwerpen.
Nie werde ich Mutters Schilderungen der auf dem Kongo-Fluss verbrachten Tage und Nächte vergessen: jenes gespenstische Dahingleiten in schwebender Stille, meist zwischen undurchdringlichen, dampfenden Vegetationswänden hindurch, oft auch entlang ausgedehnter Fluss-Archipele; die schwer lastende, fast tropfend schwüle Hitze; die im dumpfen Dämmerlicht aufscheinenden Trugwahrnehmungen; das mit dem Sonnenuntergang sich ankündende, in der Nacht dann förmlich krepierende Gezeter nachtaktiver Urwaldwesen; die Angstschauer der Passagiere, wenn am vorüberhuschenden Ufer grüne und gelbe Doppelpunkte im Dunkel der Nacht aufleuchteten – die ganze lange Reise ein filmreifes Nachwort zum letzten Band der Kongo-Saga!
*
Wer meinen Lebenslauf studierte und mich kritisch in Augenschein nahm, interessierte sich aber nicht für die Einzelheiten unserer afrikanischen Legenden. In den Vorstellungsgesprächen stand mein fachliches und menschliches Rüstzeug für die jeweils ausgeschriebene oder angebotene Stelle zur Diskussion.
Was mein Lebenslauf enthielt, stand im Vergleich zum Roman meiner Eltern in beschämendem Gegensatz: weitgehend ereignislos; bieder; bar jeglicher Glanzpunkte; ohne Ausreisser nach oben oder unten; schon gar keine trotzige Emigration ins europäische Ausland und von dort in einen Urwald. Was nicht im Lebenslauf zu lesen war: dass ich mich bis zur Matura treiben liess; dass ich Aufsätze liebend gern schrieb und die Naturwissenschaften mir die frühen Jahre nachhaltig verdüsterten; dass ich in der Jugend Lesen, suchtähnlich genossen, lange Zeit als alle meine Wünsche erfüllenden Lebensinhalt betrachtete; dass sich dazu später noch Sport und eine Freundin als weitere Leidenschaften gesellten. Wer mich danach fragte, durfte wissen, dass ich Kindheit und Jugend in einem bescheidenen familiären Umfeld verbrachte und dass es meinem Bruder und mir an nichts fehlte.
Sonderwünsche oder Luxus blieben aber immer Träume. Wir wuchsen ohne Auto und ohne Fernsehen auf.
Der Lebenslauf enthielt den Hinweis darauf, dass ich in einem Zähringerstädtchen an der Emme grossgeworden bin und meinen dortigen Wohnsitz erst nach dem Studium aufgegeben habe. Aber niemand interessierte sich für das Bild, das ich zeitlebens als Heimat in mir trug: wie der Fluss am Fuss des Städtchens eine weite Schlaufe durch eine Bresche zieht, die er sich während Äonen aus dem Sandstein hat schaben müssen; wie ein steiler Burgfels an dieser Schlaufe Aug in Auge mit vier behäbigen Flühen hinfristet; und wie mir diese Flühe stets wie gedrungene, verschworene Schwestern vorgekommen sind, die ihr Wächteramt durch alle Zeiten über die zu ihren Füssen grünenden Auen versehen.
Mein Studium war es, das meine Befrager interessierte: Was ich mit dem erworbenen Diplom machen wolle, welche Richtung ich einzuschlagen gedenke, was für Karriereziele mir vorschwebten? Auch nach langem, von Praktika, Militärdienst und Reisen unterbrochenem Studium hatte ich keine klaren Antworten auf solche Fragen. In unserer Familie hatte niemand je Recht studiert; für Beratung und Begleitung war ich auf meine zwei Freunde angewiesen, die den gleichen Studiengang belegten. Fachkundige Mentoren hatte ich keine; ersehnte Nachdiplomstudien in den USA scheiterten an fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten. Nach dem frühen Tod des Vaters erlag ich den Schalmeienklängen eines Berufsoffiziers im familiären Freundeskreis: Eine Offizierslaufbahn würde meine Karriere als Jurist untermauern helfen, Beförderungsdienste seien für mich als Halbwaise deshalb ein Muss!
In Befolgung dieses Märchens verlor ich kostbare Zeit und wurde ein alter Oberleutnant der Schweizer Armee; vielleicht auch ein zynischer. Als Infanterie-Mitrailleur und Korporal lernte ich Wertvolles: unverbrüchliche Kameradschaft mit Metzgern, Käsern, Matrosen, Postangestellten, Lehrern, Kranzschwingern und vielen anderen Unvergesslichen; ich lernte auch erstaunliche Lasten tragen und endlose Märsche überstehen. In der Offiziersschule lernte ich dann in meine eigenen Abgründe starren: Wochenlang trieben mich Mordfantasien um, wie eine Glut geschürt vom Gehabe eines unnahbaren, sadistischen Klassen-Instruktors. Während die Kameraden in den Urlaub entlassen wurden, kam meine Chance: Als Strafe für ungenügende Schiessleistungen musste ich den Nachmittag allein mit dem Instruktor im Pistolenstand verbringen. Bei jedem neuen Laden des Magazins zitterte und fieberte ich: Du lädst, entsicherst und, anstatt die Scheibe ins Visier zu nehmen, drehst du dich überraschend zu dem hinter dir stichelnden Sadisten um und richtest die Waffe lächelnd auf ihn – einfach so, um mindestens seinen Gesichtsausdruck zu geniessen. Das Abdrücken – na ja, warten wir mal ab, wie sich die Szene entwickelt!
Ich liess die Chance verstreichen, und eine bessere kam nie wieder.
Keiner meiner Befrager wollte je wissen, weshalb meine Offizierskarriere nicht stetiger und steiler verlaufen sei. Die meisten waren der Ansicht, ich erfüllte die fachlichen Anforderungen für die zu besetzende Stelle. Und da ich keine gefestigten Vorstellungen von einem eigentlichen Karriereziel hatte, verlief der Beginn meines Berufslebens unspektakulär, irgendwie erratisch. Ich liess mich auf unterschiedliche Rechts- und Arbeitsgebiete ein und scheute mich nicht vor abrupten Richtungswechseln. Das bereute ich später nie, denn so weitete sich mein Horizont und ich liess meinen fachlichen Abneigungen und Vorlieben Zeit, sich deutlich zu manifestieren.
*
Ähnlich sprunghaft wie im Berufsleben manifestierten sich auch Abneigungen und Vorlieben in der Pflege meiner Beziehungen. Zweifel an meiner geschlechtlichen Identität hegte ich nie. Gender fluidity war noch nicht der Hype der Stunde. Damals galt noch nicht als rückständig, wer sich outete und sagte: Ich liebe Frauen, und nur sie! Gewiss, auch diese Vorliebe verschonte mich nicht vor manchem trial by error mit entsprechenden Höhen und vor allem auch Tiefen.
Als ich ins Richteramt gewählt wurde, war ich schon verheiratet und Vater zweier Kinder. Vier andere juristische Berufe lagen hinter mir. Hatte ich als Richter meine Berufung gefunden? Im Rückblick weiss ich mit Sicherheit nur, dass diese Arbeit meinem Wesen besser entsprach als jede frühere Erwerbstätigkeit. Ob die jahrzehntelange Beschäftigung mit Recht und Gerechtigkeit mein Leben zu einem allumfassend erfüllten gemacht hat, lasse ich dahingestellt.
Nur so viel: In jenen Jahren relativen beruflichen Erfolgs liess ich geschehen, dass sich die weiteren Puzzleteile meines Lebens eins ums andere, nie hinterfragt, aber unaufhaltsam, in einem stereotypen Rahmen ineinanderfügten: das Häuschen am Waldrand in der Agglomerationsgemeinde; ein grosses, glitzerndes Auto; Familienferien an gefragten Destinationen; mehr und weniger erhebendes Sozialleben; Engagement in Schul- und Planungskommissionen; zeit- und energieraubende nebenberufliche Verpflichtungen; rapide abnehmende sportliche Betätigung; praktisch gänzliches Austrocknen kultureller Interessen; häufige Überstunden und zu Hause verrichtete Büroarbeit; Absterben der ehelichen Beziehung; Trennung und Scheidung.
Lebensabschnittspartnerschaft und die sie begleitende Unbekümmertheit waren mir fremd. Die Zäsur zermalmte alle meine Gewissheiten als Privat- wie auch als Berufsmensch. Sechs lange Jahre lebte ich danach allein in einer kleinen Wohnung, deren Lage ich so gewählt hatte, dass die Kinder keinen langen Weg zu mir zurücklegen mussten, um mich zu besuchen. Aber die Kinder kamen nicht. Dafür erhielt ich Telefonanrufe und Briefe mit wortreichen Begründungen, warum sie mich meiden wollten und weshalb ich ihre Nähe nicht verdiente. Es waren Argumente, die kein Kind sich je hätte ausdenken können. Stundenlang sass ich in der Freizeit auf meinem kleinen Sofa, starrte in die Ecke und lauschte in die Stille. Ich hatte die Kinder verloren und war im Begriff, mich selber zu verlieren. Im Spiegel erforschte ich das eingefallene Gesicht eines kinderlosen Vaters. Ich sah glanzlose, ausgedörrte Augen, aus denen sich die letzte Träne längst verabschiedet hatte. Mit diesen Geisteraugen blickte ich ängstlich der kommenden Nacht entgegen, die ich wieder durchwachen würde. Und am nächsten Morgen würde ich todmüde, aber rasiert und korrekt gekleidet auf dem Richterstuhl in meinem Büro Platz nehmen, ein dickes Dossier aufschlagen und für die kommenden Stunden in einen tiefen Stupor aus Trauer und Orientierungslosigkeit verfallen.
Wer in eigenen Problemen versinkt, kann sich kaum dazu aufraffen, tagein, tagaus den Streit anderer zu schlichten oder zu entscheiden. Wie sollte ich in solcher Verfassung den hohen Ansprüchen des Kollegiums gewachsen bleiben? Wie konnte ich so noch auf Augenhöhe zusammen mit ihnen richten? Selbstzweifel und Versagensängste zogen mich hinab in subdepressive Gemütssümpfe.
Erst nach qualvollen Jahren fand ich zurück in ein gefestigtes Berufs- und Beziehungsleben, das seinen Namen verdiente. Allen Widrigkeiten zum Trotz hatte ich mich im Amt oft mehr schlecht als recht über Wasser halten können. Erst nach der Krise wurde ich zu dem Richter, auf den ich mit gutem Gewissen zurückblickte. Ich liebte die Arbeit wie nie zuvor und entwickelte bis anhin nicht gekannte fachliche Leidenschaften. Eingebettet blieb ich in ein Kollegium strenger, aber verständiger Richterinnen und Richter.
Unterstützt wurden wir alle von einer grossen Schar hoch qualifizierter guter Geister auf allen Stufen, die zusammen das Räderwerk eines grösseren Gerichts in Bewegung halten.
*
Lange Jahre in ein und demselben Beruf prägen jeden Menschen in mannigfacher Weise. Was eine weitere Öffentlichkeit von Richterinnen und Richtern hält, ist oft wenig schmeichelhaft. Die Empfindungen reichen von Angst bis Spott. Sie richten sich entweder gegen falsche Urteile oder gegen menschliche Schwächen, manchmal gegen beides und oft aus Prinzip. Damit lernt ein Richter zu leben. Er versucht immer wieder, den Mitmenschen Sinn, Tragweite und Mechanismen seiner Arbeit in die Umgangssprache herunterzubrechen; er bemüht sich, das Wesen von Recht und Gerechtigkeit, vor allem auch die Bedeutung von Verfahrensregeln, verständlich zu machen.
Ein schmerzlicher Kritikpunkt und zugleich ein unlösbares Paradox ist die Rechtssprache. Wie alle anderen verfasste auch ich Urteilsbegründungen, von denen ich wusste, dass nur Vertreter der Anwaltschaft und anderer Gerichte sie verstehen würden. Das scheint mir erwähnenswert, um eine prägende Hinterlassenschaft der langen Richterjahre eigens hervorzuheben: Keine härtere Sprach- und Schreibschule ist denkbar als die in meinem Amt durchlebte. Keine direktere Stilkritik ist vorstellbar; keine, die auf persönliche Eigenheiten oder Empfindlichkeiten weniger Rücksicht genommen hätte. Meine Sprache wurde in der Werkstatt des Gerichts modelliert und gebrannt. Damit wurde sie gleichzeitig in jene Fesseln gelegt, die der stilistischen Freiheit des Richters die amtsimmanenten Grenzen setzen.
Nie hätte ich mich darüber beklagt. So und nicht anders musste unser wichtigstes Arbeitsinstrument gehandhabt werden. Aber heute, Jahre nach dem Abschied aus dem Amt, liegt Bedauern im Rückblick: Ich erinnere mich, wie die sprachlichen Fesseln sich am Tag des Abschieds nicht unbesehen abstreifen liessen! Noch Jahre nach Beendigung meines Berufslebens haftete Pedanterie an meiner Sprache. Es geschah gegen meinen Willen, ich konnte nicht mehr anders. Die Rechtssprache hatte meine Ausdrucksweise wohl geschärft, sie aber gleichzeitig verkümmert. Was im Amt so gezielt und ernsthaft kultiviert worden war, genügte mir im Ruhestand nicht mehr. Ohne das am Gericht Verinnerlichte zu verleugnen, musste ich meiner Sprache zu einem Leben danach verhelfen.
*
Die Jahre verstrichen. Das Auseinanderdriften der Familie, Trennung und Scheidung; die Verbitterung über die Parodie des Zivilgerichts, die Enttäuschung über die groteske Spiegelfechterei der Scheidungsanwälte und der anschliessende fruchtlose Kampf um Kontakte mit den Kindern – alles war irgendwann Vergangenheit, eine Erinnerung. Tief auf den Grund meines Wesens senkte sich der Nachhall eines Schmerzes; er war da und er blieb, aber er machte mich nicht mehr krank. Die Kinder wuchsen heran. Zögerlich heilte Zeit die Vaterwunde – hüben und drüben. Irgendwann begann auch sie zu vernarben und im gegenseitigen Verhältnis begann eine neue Zeitrechnung.
In diese neue Zeitrechnung fiel meine zweite Ehe. Auch sie musste sich in Stürmen bewähren, erlitt aber nie gänzlich Schiffbruch. Während vieler Jahre wuchsen meine neue Gattin und ich miteinander und aneinander. Wir schafften es, gemeinsam über das Älterwerden zu lächeln und die verbleibende gemeinsame Zukunft mit einer gewissen Gelassenheit anzugehen. Wenige Jahre vor der Beendigung unseres Berufslebens wagten wir uns sogar noch an ein Projekt Altersvision, nicht ohne für ein paar kurze, lichte Augenblicke gutschweizerische Zurückhaltung und Bescheidenheit links liegen zu lassen.
Es begegnete uns, besser: es widerfuhr uns beiden im selben Augenblick und bezog sich auf dieselbe Weichenstellung. Aus Tiefen jenseits rationaler Überlegungen aufblitzend handelte es sich um ein non cogito – ergo sum; ich denke nicht – also lebe ich!
Jahrtausendwende: Versonnen standen wir da, sahen und staunten erneut. Vor und unter uns die Torbay Bay im Süden Westaustraliens, an die wir genau ein Jahr zuvor schon unsere Herzen verloren hatten. Weit, so unendlich weit ausladend und gerahmt von kantig-wilden Klippenzügen und einem breiten blendenden Saum aus Sand; seit einem Jahr Gegenstand unserer Träume und Sehnsüchte. Aber im Unterschied zum Vorjahr war das Flecklein Erde, auf dem wir standen, jetzt überraschend zum Kauf ausgeschrieben. Im Schatten der turmhohen Eukalypten verharrten wir beide wie in Trance. Wir waren Gefangene widerstreitender Gefühle, und eine Verwegenheit kitzelte uns. Ein mehrstimmiges Rauschen untermalte die Szene, aus der Ferne von der Brandung herauf, über uns vom Wind im mächtigen Geäst. Beide ruhten wir mit dem gleichen Gedanken in den Augen des anderen, und beide wussten – wenn je, so hier und jetzt!
Noch im gleichen Urlaub erstanden wir dieses Grundstück in the middle of nowhere. Zwei Jahre später stand ein kleiner Bungalow darauf.
Hätten wir solche Träume je zuvor ausgesprochen, das Für und Wider ihrer Verwirklichung gegeneinander abgewogen und zerredet: Ausser Missmut, Ernüchterung und Streit wäre daraus nichts geworden. Der Traum hätte leicht zum Albtraum verkommen können. So jedoch verhalf uns ein Handstreich des Bauchgefühls zu einer Verrücktheit, die entweder mit Kopfschütteln oder der Bemerkung quittiert wurde: Schön und gut wäre das schon, aber uns fehlt der Mut dazu; und überhaupt, dafür sind wir ohnehin zu alt.
Das Wissen um diese Bleibe für einen Teil unseres Lebens danach half mir durch die letzten Berufsjahre. Diese waren belastend und zehrten an meinen nachlassenden Kräften.
Manchmal drohte mein fachliches Selbstverständnis zu erodieren. Allein die Vorstellung vom Bungalow im Schatten der Eukalypten und vom Blick über Wetland, Bucht und Klippenlandschaft erwies sich als schützende Hand über meinen verbleibenden Richterjahren.
*
Kurze Zeit nach dem Abschied aus unseren Berufen packten wir die Koffer und reisten erneut nach Down Under. Diesmal nicht, um bloss ein paar kurze Ferienwochen, sondern erstmals, um den ganzen europäischen Winter dort zu verbringen.
Seitdem führten wir das Leben danach auf verschiedenen Kontinenten – chasing the summers, wie die Australier sagen. Diesem neuen Lebensrhythmus blieben wir lange Jahre treu, begünstigt von Glück und leidlich erhaltener Gesundheit. Nie bereuten wir jenen traumwandlerisch gefällten Entscheid. Im Gegenteil: Unser kleines Haus liebten wir geradezu zärtlich, in ihm fühlten wir uns geborgen und zugleich frei wie sonst nirgends. Freundschaften mit Einheimischen wurden Teil unseres Lebens und erweiterten immer wieder unsere Horizonte. Majestät und Würde der uns umgebenden Natur prägten uns über die Monate und Jahre, die wir an der Torbay Bay verbrachten, tief. Kinder, mittlerweile auch Enkelkinder, besuchten uns in diesem Refugium. Bald verstanden sie aus eigener Anschauung, weshalb wir immer wieder dorthin zurückkehrten.
So also wanderten wir lange Jahre durch den Spätherbst unseres Lebens: Verweilten wir längere Zeit in der Schweiz, sehnten wir uns nach der Torbay Bay. Hielten wir uns während vier oder fünf Monaten in Australien auf, freuten wir uns wieder auf Europa.
*
3Überraschungen
Es geschah einige Jahre nach der Beendigung unseres Berufslebens.
Zum wiederholten Mal weilten wir seit Monaten in unserem Haus über der grossen Bucht, die zwischen Albany und Denmark am Südatlantik liegt. Der lange Aufenthalt neigte sich dem Ende zu. In unserem Teil des Kontinents herrschte Spätsommer; die Schatten wurden länger und die Nächte kühler, die Winde verloren ihre ungestüme Kraft.
Es war später Nachmittag. Ich sass auf der Veranda, liess meinen Blick über die Küstenlandschaft schweifen und wartete.
Noch stritten sich im nahen Dickicht lautstark die Honeyeater. Auf einem Baumstrunk am Rand unseres Grundstücks sass ein Kookaburra. Der gedrungene Leib des behäbigen Einzelgängers verharrte reglos, den runden Kopf und den kurzen Schnabel leicht zur Seite geneigt. In den langen Schatten des benachbarten Hains ruhten fünf altersschwache Schafe. In ihrer Mitte graste friedlich eine Kängurumutter mit ihrem Jungen.
Über allem hing in der Thermik ein Adler. Ein dicht verwobenes Heckenmeer dehnte sich zwischen unserem Grundstück und dem Strand aus, gegen den der Wind gischtdurchwirkte Wogenketten trieb. Die auflandige Brise trug den Puls der Brandung bis an mein Ohr. Am Horizont verliefen die karg bewachsenen Steilabhänge der Dünen- und Klippenlandschaft. Auf diese Topografie zauberte die tief stehende Sonne weiche Schattenornamente. Am Horizont flimmerte ein durchsichtiger Hauch von Blau, der sich in der Höhe in eine nicht mehr blendende Farblosigkeit auflöste.
Ich wartete mit Vorfreude: Bald würde die sinkende Sonne in meinem Rücken die lang gezogene Flanke des Torbay Hill entlanggleiten und dahinter verschwinden. Für wenige Augenblicke würde ihr Licht noch die Kontraste zwischen dunkler Bucht und hellem Himmel beleben und der eine oder andere Kalksteinabsturz würde kurz erglühen. Auf den entfernten Dünenkämmen würden die Turbinen der Albany Wind Farm wie winzige schneeweisse Spielzeuge aufblitzen. Ihre gewaltigen Rotorblätter würden als kaum noch erkennbare gleissende Nädelchen bedächtige Bewegungen im Abendwind vollziehen. Nach Sonnenuntergang würden diaphane Schleier aus den Rinderweiden der Torbay-Ebene aufschweben und die Sommernacht ankünden. Das Sirren und Zirpen von Zikaden, später das Quaken und Raunzen von Fröschen in den Wasserlöchern würden das Gurren und Krächzen der Vögel ablösen. Am klaren Nachthimmel würde eine betörende Sternenpracht erblühen.
*
Ein akustisches Signal drang in die Stille dieses australischen Vorabends. Eine Nachricht meines Sohns:
Es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass Grossmutter gestorben ist. 14/04/2010 11.56
Kurz darauf von der Tochter:
Deine Mutter ist gestorben. Ruf mich bitte an. 14/04/2010 12.02
Die Wellen in der Bucht gerannen zu Blei. Über das fahle Blau am Horizont senkte sich ein Flor.
*
Angesichts des greisen Alters unserer Mutter hatte die ganze Familie mit dem Nahen dieses Ereignisses zu leben gelernt.
Alle hatten gedacht, was da bevorstehe, werde uns nicht mehr überraschen. Aber hier fiel es mich an wie aus einem Hinterhalt. Sinnlos, ja, anmassend durchzuckte mich nur: Warum jetzt?
Was diese bescheidene Frau zu Lebzeiten nie von mir gefordert hätte, bewirkte sie nun posthum: Ihr Ableben auferlegte mir ein gnadenloses Hasten rund um den halben Erdball. Pausenlose Geschäftigkeit prägte die folgenden Stunden und Tage. Endlose Telefonate über fiepende Helplines unserer Fluggesellschaft in Sydney, Melbourne, Mumbai oder Dubai. Am anderen Ende immer wieder, wenn auch in verschiedenen Melodien, der scheinbar hilfsbereite, aber alles komplizierende Singsang überforderter Helpdesks.
Es folgten ein flüchtiges Reinigen des Hauses und überhastetes Packen; ein letzter wehmütiger Blick über die Bucht. Anschliessend bereits durch Dämmerung und Nacht die lange Fahrt nach Perth. Zwei Stunden Schlaf. Im Morgengrauen Einchecken in den frühestmöglichen Flug und, erschöpft von Trauer und Hunger, endlich das Versinken im Dröhnen der abhebenden Maschine. Während der Flüge marterte ein aufdringliches Kaleidoskop mein Gehirn. In exzentrischen Rhythmen fügte und bog es Szenen aus der Vergangenheit zu stets neuen bizarren Kaskaden von Bildern mit der Mutter. Weder suchte noch erkannte ich darin Zusammenhänge. Trotz meiner tiefen Ermattung hinderte mich die Strahlkraft dieser flackernden Reigen an jeglichem Schlaf.
In der engen, grauen Heimat gab es kein wirkliches Ankommen, schon gar kein Entkommen. Ich fand weder Ruhe noch Alleinsein. Geschäftigkeit erstickte all meine Emotionen. Imperative der Administration geboten herrisch über meine Zeit; ein Ausscheren schien unmöglich.





























