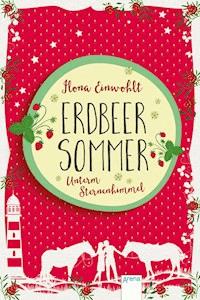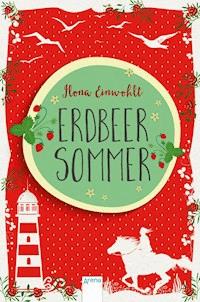1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Du hast mein Herz berührt, doch dein Leben ist enger mit meinem verbunden als es sein darf …
Ein berührender New Adult Roman über eine große Liebe und ein noch größeres Geheimnis
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter fühlt sich Eliza allein und verzweifelt. Zusammen mit ihren besten Freunden Charly und Vincent tröstet sie sich fortan auf Partys mit Gin Tonics, Zigaretten und Sex. Doch dann trifft sie auf Nick: dunkelhaarig, geheimnisvoll und leidenschaftlich wie sie selbst. Der sensible Musiker berührt nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Seele. Für Eliza ist es nach zahlreichen One-Night-Stands das erste Mal, dass sie das Gefühl hat, ihre Sehnsucht nach Nähe und Zärtlichkeit kann gestillt werden. Doch das junge Glück währt nicht lange, denn Eliza entdeckt ein Geheimnis, das alles zu zerstören droht …
Erste Leserstimmen
„unglaublich mitreißender Roman über die ganz großen Gefühle“
„der Schreibstil, die Figuren, das Setting – einfach wunderbar“
„Ich konnte den Roman kaum aus den Händen legen, so sehr hat mich die Geschichte berührt ...“
„eine tolle Geschichte, die ich jedem nur ans Herz legen kann“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Ähnliche
Über dieses E-Book
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter fühlt sich Eliza allein und verzweifelt. Zusammen mit ihren besten Freunden Charly und Vincent tröstet sie sich fortan auf Partys mit Gin Tonics, Zigaretten und Sex. Doch dann trifft sie auf Nick: dunkelhaarig, geheimnisvoll und leidenschaftlich wie sie selbst. Der sensible Musiker berührt nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Seele. Für Eliza ist es nach zahlreichen One-Night-Stands das erste Mal, dass sie das Gefühl hat, ihre Sehnsucht nach Nähe und Zärtlichkeit kann gestillt werden. Doch das junge Glück währt nicht lange, denn Eliza entdeckt ein Geheimnis, das alles zu zerstören droht …
Impressum
Erstausgabe Oktober 2019
Copyright © 2024 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-96087-876-6 Taschenbuch-ISBN: 978-3-96087-959-6
Die Arbeit an diesem Roman wurde unterstützt von einem Autorenstipendium des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.
Covergestaltung: Buchgewand unter Verwendung von Motiven von © Roman Seliutin/shutterstock.com und © artifex.orlova/shutterstock.com Lektorat: Katja Wetzel
E-Book-Version 02.02.2024, 16:15:34.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
TikTok
YouTube
Was von uns bleibt
1
Abschied
Noch viele Jahre später sollte ich mich jedes Mal, wenn meine Füße vor Nässe in meinen Schuhen quietschten, an den Tag der Beerdigung meiner Mutter erinnern. Genauer gesagt, war es keine Beerdigung, sondern nur das seltsame Spiel eines Trauergottesdienstes ohne Sarg und Totengräber, bei dem der Pfarrer in Ermangelung einer echten Leiche symbolisch ein karges Holzkreuz auf einem Grabhügel segnete. Ich glaube, er tat das mir und meinem Vater zuliebe, weil wir, fassungslos vom plötzlichen Unfalltod meiner Mutter, vor allem zutiefst verstört von ihrer fehlenden Hülle waren. Die Leiche meiner Mutter wurde bis heute nicht gefunden, ich weiß nicht, wo sie ist, in welcher Form sie vielleicht auf dem Meeresgrund verwest, ob die Strömung sie in die Tiefen des Ozeans getragen hat oder sie ganz simpel einem Hai zum Frühstück reichte. Manchmal stelle ich mir vor, wie ihr zierlicher Körper damals bei der Explosion des Flugzeugs in zehn Kilometer Höhe einfach in hunderttausend Stücke zerfetzt wurde und sich meine Mutter wie ein segnender Konfettiregen auf die Erde verteilt hat, vielleicht als winziges Staubkorn auf meinem Nachttisch gelandet ist. Manchmal bin ich überzeugt davon, dass meine Mutter durch den Überdruck in die Weiten des Himmels gesaugt und von einer Wolke weich aufgefangen wurde, wo sie jetzt gemütlich sitzt, ihren heiß geliebten Yogi-Tee trinkt und die entspannteste Zeit der Welt genießt. Dann wieder hoffe ich, dass sie damals gar nicht erst in diese Unglücksmaschine eingestiegen ist, weil sie einen heimlichen Lover hatte und mit ihm jetzt irgendwo auf einer Insel glücklich im Paradies lebt.
An jenem Tag regnete es pausenlos, wie es schon den ganzen Februar über geregnet hatte. Die Wege auf dem Friedhof waren schlammig und durchweicht, meine Füße waren binnen kürzester Zeit regenfeucht. Es war keine allzu große Trauergesellschaft, die hier zusammengekommen war, ein paar Kolleginnen, Omi, die nun keine Tochter mehr hatte. Meine Mutter war in der Nachbarschaft nicht sonderlich beliebt gewesen und hatte wenige Freundinnen. Also keine von denen, die sich auf einen Latte macchiato trafen und erstens über ihre Männer, zweitens über ihre Männer und drittens über Männer ablästerten, bevor sie mit sorgenvoller Miene die Neuigkeiten über ihre Töchter austauschten, die sich in jüngster Zeit so seltsam verhielten, rauchten, tranken und ständig neue Freunde hatten. Meine Mutter rauchte selbst, hatte nichts gegen Prosecco und erst recht nicht gegen andere Männer, sie hatte ihre eigenen Vorstellungen vom Frausein und wenig Lust auf Tupperpartys, zu denen sie irgendwann nicht mehr eingeladen wurde. So zart sie auch wirkte, umso energischer konnte sie sein. Ungerechtigkeiten konnte sie nicht leiden und wenn ihr jemand blöd kam, wie es nun mal in Wohnsiedlungen wie unserer passierte, wo manche nichts Besseres zu tun hatten, als sich tagelang über die neue Haarfarbe der Nachbarin zu wundern oder die schlechten Zeugnisnoten der Kinder zu diskutieren, konnte sie richtig biestig werden.
Ihre Leidenschaft galt ihrem Garten, in dem sie in jeder freien Minute werkelte, die ihr der Beruf als Stewardess ließ, nur selten traf sie sich mit ihren einzigen Freundinnen Helen und Marie, um ins Kino oder Theater zu gehen. „Irgendjemand muss ja zu Hause sein, wenn ich mal zu Hause bin“, sagte sie immer lächelnd und meinte damit ganz klar meine ältere Schwester und mich, weil wir ständig auf Achse waren, Schule, Partys, Jungs. Zoé antwortete dann immer ganz cool „Irgendjemand muss hier ja mal Spaß haben!“ und meinte damit ganz eindeutig die schlechte Stimmung zwischen unseren Eltern, die in den letzten Monaten unerträglich geworden war.
Allerdings war Zoés Bemerkung schlichtweg untertrieben. Ich hing jedes Wochenende auf Feten und in Klubs herum, fast immer blieb ich bis in die frühen Morgenstunden, nur selten ging ich alleine nach Hause. Und Zoé hatte in ihrem Leben sowieso permanent Spaß, und zwar von Kindesbeinen an. Zoé sah beneidenswert gut aus, konnte am Tag von einem Joghurt und fünf Erdbeeren leben, ohne magersüchtig zu wirken, und ihre einzige Sorge zu jener Zeit war morgens, welches ihrer hundert Party-Outfits sie abends in welcher Kombination tragen würde. Seit einem halben Jahr hatte sie einen festen Model-Vertrag mit einer Agentur, weshalb sie noch mehr Zeit in ihre Stylings steckte und natürlich noch mehr Partys zur Auswahl hatte. Zoé war einfach ein unbeschwertes, glückliches Menschenkind, auch auf dem Friedhof sah sie an diesem Tag wie auf einem Shooting aus, nur ich wusste, dass ihre Augen hinter der großen dunklen Sonnenbrille knallrot geweint waren. Lieber hätte sie weiterhin mit Mama gestritten, anstatt sie auf diese schmerzliche Art vermissen zu müssen.
Neben Zoé stand ihr aktueller Freund Cicero, ebenfalls ein Model. Immer wieder blickte er auf seine Uhr, offensichtlich hatten beide noch einen wichtigen Termin. Ich dagegen hatte mich bei meinem Daddy untergehakt und ließ meinen Tränen freien Lauf. Sie rollten mir unaufhörlich über die Wangen, wo sie Spuren wie von Schnecken gezogen hinterließen.
Es tat gut, Daddys kräftige Arme zu spüren, und wenn es an diesem Tag so etwas wie Wärme und Trost für mich gab, dann gingen sie von jenen Quadratzentimetern Haut unter seiner Winterjacke aus. Nur mühsam konnte ich den Worten des Pfarrers folgen, der irgendetwas von Engeln, Jesus und Auferstehung erzählte, bevor er ein abschließendes Vaterunser sprach, uns segnete und zum Abschied allen die Hand drückte. Ich mochte mir einfach nicht vorstellen, dass ich jetzt immer hierherkommen und meine Mutter an dieser Stelle betrauern sollte, wie es der Pfarrer uns glauben machen wollte, obwohl es ein tröstlicher Gedanke war. Ich wollte die Erinnerungen an meine Mutter nicht nur an einem Ort begraben, ich wollte sie lebendig und für immer in meinem Herzen behalten. Wie konnte ich sie loslassen, für immer verabschieden?!
Offensichtlich ging es meinem Daddy da ganz ähnlich. Still und gefasst war er, aber ich wusste genau, dass das Leben von nun an für ihn nicht mehr das gleiche sein sollte. Er hatte meine Mutter abgöttisch geliebt, hatte all die Jahre ihren Eigensinn ertragen, ihre wankenden Stimmungen, ihren Hang zu Depressionen, ihre unterdrückten Aggressionen, die sich lautstark im Streit über eine Kleinigkeit entladen konnten, wenn ihre Stimme überschnappte, sie nicht wusste, wohin mit ihren überbordenden Gefühlen, die nicht nur der Familie galten. Hilflos mussten wir mit anhören, wie er beschwichtigend auf sie einredete, sie zu beruhigen versuchte, was sie erst recht provozierte und fast immer mit Türschlagen endete. Verstört von dieser Form der Auseinandersetzung, flüchtete ich mich oft in die Sicherheit meines Zimmers, wo mich später Daddy besuchte und um Verständnis bat, meine Mutter meine es nicht so.
„Aus einem Streit muss man immer als Paar hervorgehen“, betonte er dann jedes Mal. „Und wenn der Rest stimmt, gibt es keinen Grund zu zweifeln.“
Ich war froh, dass er das so sah, denn es stimmte, was Zoé meinte: Die Ehe meiner Eltern war in den letzten Monaten alles andere als freundlich. Ständig lagen sie sich wegen Kleinigkeiten in den Haaren, die Stimmung zwischen ihnen war mies und eigentlich rechneten Zoé und ich jeden Moment mit der Nachricht, dass sie die Scheidung einreichen würden. Wer konnte denn ahnen, dass sich meine Mutter auf eine ganz andere Weise von ihm, von uns trennen würde?
Meinen Blick fest auf das kleine Holzkreuz gerichtet, das bald durch einen massiven Marmorstein ersetzt werden würde, ließ ich die üblichen Händedrücke und tröstenden Beileidsworte über mich ergehen. Mein Daddy nickte jedes Mal mechanisch, ich hatte einen unvorstellbar dicken Kloß im Hals und meinte, ich müsste jeden Moment daran ersticken.
Und dann waren plötzlich alle weg, Omi, die Nachbarn und Bekannten, Helen und Marie, Zoé und Cicero, alles ruhig und still, nur wir beide standen gemeinsam da, wie gelähmt, alleine im Regen. Als ein kühler Luftzug mein Gesicht streifte, und ich ihm nachspürte, fiel mein Blick schräg gegenüber auf eine alte, mit Efeu überwucherte Engelsstatue. Ihr Stein bröselte vor sich hin, dennoch strahlte sie auf mich eine beinahe überirdische Schönheit aus, machte, dass ich mit einem Mal die Enge aus meinem Hals wegatmen konnte, die Trauer aus meinem Herzen lassen. „Ruhe in Frieden!“, flüsterte ich leise und hatte jetzt die Kraft, mich vom Grab meiner Mutter abzuwenden. Ich zupfte meinen Daddy am Ärmel, er folgte mir willenlos, dann liefen wir Hand in Hand den Kiesweg Richtung Ausgang. Versunken in mir, in meiner Trauer, stieß ich gegen einen Stein, in den dünnen und durchgeweichten Schuhen spürte ich diesen typischen Stolperschmerz sofort. Ich weiß bis heute nicht, warum ich mich bückte, um ihn genauer zu untersuchen, es war ein Reflex. Irgendetwas an seiner Maserung weckte meine Neugier, dabei handelte es sich nur um einen eher mandarinengroßen, schwarzen Marmorkiesel, wie sie üblicherweise für Begrenzungen verwendet werden.
„Komm, gehen wir noch einen Café au Lait trinken!“ Daddys Stimme drang wie durch Watte zu mir.
„Gute Idee“, nickte ich, während ich den Stein gedankenverloren in meine Jackentasche steckte. „Du?“ Ich guckte meine Schwester an, die draußen vor der Friedhofsmauer auf mich wartete und eine Zigarette rauchte. Doch sie schüttelte nur den Kopf, nickte Richtung Cicero, der bereits Richtung Auto vorausgegangen war.
„Nee, keine Zeit, wir müssen zum Shooting, die anderen warten schon. The Show must go on, du weißt schon.“
Sie küsste mich, dann lief sie ihm nach. In diesem Moment beneidete ich sie um ihre Leichtigkeit. Zoé grübelte nie lange über etwas, das Wort Traurigkeit kannte sie nicht. Mit meiner Mutter hatte sie, solange ich denken konnte, ein temperamentvolles Verhältnis gehabt, ständig gab es Streit zwischen den beiden, anstrengend für mich.
Wenn meine Schwester in den letzten Monaten so gut wie nie zu Hause gewesen war, lag das nicht nur daran, dass sie als Model so viele Termine hatte.
„Na, dann gehen wir beide eben alleine.“ Daddy seufzte und zog mich Richtung Innenstadt, wo wir kurz darauf bei Kaffee und Streuselkuchen saßen und uns anschwiegen. Niemand von uns wollte reden, schon gar nicht über Mama.
„Hätten wir nicht Omi fragen müssen, ob sie mitkommt?“, bemerkte ich leise scherzend, als mich Daddy nach einer quälend langen halben Stunde zum Abschied fest in seine Arme nahm und an sich drückte, ich schluckte meine aufsteigenden Tränen hinunter. Er war auf dem Weg zur Uni, sein Doktorandenseminar für angehende Chemiker heute Nachmittag würde ihn ablenken, das hatte ich verstanden. Deswegen konnte ich ihm nicht böse sein, selbst wenn ich nicht wusste, wie ich gleich alleine das große, leere Haus ertragen sollte, das mich erwartete.
„Bloß nicht!“ Daddy verzog das Gesicht. Seit ich denken konnte, waren sich die beiden spinnefeind, niemand wusste genau, warum. Auch Mama hatte nicht das beste Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt, angeblich, weil Omi so besitzergreifend und dominant war, und ihre Tochter keinen Hehl daraus machte, dass sie die Freiheit liebte, in jeder Beziehung. Deswegen flog sie ja als Stewardess um die Welt, hoch über den Wolken konnte sie so sein, wie sie wirklich war. Das hatte sie irgendwann so einmal erklärend formuliert, als sie sich wieder einmal für die nächsten vier Tage mit gepackten Koffern in der Hand bei Zoé und mir verabschiedete und ich heulend an ihrem Hals hing. Während meine große Schwester die Coole mimte, vergoss ich unzählige Tränen, ich wollte Mama nie gehen lassen, so, wie ich sie auch jetzt nicht gehen lassen konnte, ich brauchte ihre Nähe, ihre Streicheleinheiten, ihre Küsschen ins Haar, um mich ihr nahe zu fühlen, ich vermisste sie, immer. Später, als ich älter war und Mama wieder Vollzeit arbeitete, hatte ich mich schmerzhaft daran gewöhnen müssen, dass meine Mutter nicht zu denen gehörte, die sich von morgens bis abends um ihre Familie kümmerte, egal, ob sie in der Luft war oder auf der Erde. Mit vierzehn fand ich es dann auch nicht weiter schlimm, dass sie nicht ständig wissen wollte, wo ich steckte und mit wem ich meine Zeit verbrachte. Längst war ich erwachsen und unabhängig geworden. Niemandem Rechenschaft schuldig, wo und mit wem ich meine Zeit verbrachte, das hatte ich wohl von ihr geerbt.
„Bist du zu Hause, wenn ich komme?“, wollte Daddy wissen. Er strich mir sanft eine Strähne aus dem Gesicht, seinen Blick schmerzlich auf mich geheftet. Ich sah meiner Mutter zum Verwechseln ähnlich, je älter ich wurde, umso mehr. Und was er bisher wohlwollend registriert hatte, würde ihn in Zukunft daran erinnern, dass seine geliebte Frau nicht mehr an seiner Seite lebte.
„Ja, klar“, antwortete ich hastig. „Wo soll ich denn hin?“
„Schon gut“, meinte er besänftigend. „Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt alleine sein willst.“ Sagte er, drückte mir noch einen Kuss auf die Wange und war dann im Regen verschwunden.
So lief ich alleine durch die kalten Straßen nach Hause, wo mich schwarz geränderte Umschläge und das blinkende Signal der Telefonanlage empfingen. Ich musste die Ansage nicht abhören, ich wusste, dass es Omi war, die mir ihre Hilfe und Unterstützung anbot, ich könne mich jederzeit bei ihr melden. Ich schob die Sachen achtlos zur Seite, kochte mir in der Küche einen Tee und setzte mich mit dem dampfenden Becher in der Hand nach draußen auf die Terrasse, die Klamotten immer noch regenfeucht. Mama war tot und ich hier alleine, sie war weg, wie in all den vergangenen Jahren und Monaten auch. Diesmal würde sie nicht wiederkommen. Diesmal würde es erst recht keinen Sinn machen, auf sie zu warten, auf ihre Fragen, ein anerkennendes Nicken, Streicheln. Lange saß ich dort, alles nass, bis mich eine Nachricht aus meinen Gedanken riss. Der Teebecher in meiner Hand war kalt geworden, ohne dass ich daraus getrunken hätte. Sie war von Paul. Seufzend las ich seine zögernde Frage, ob er mich anrufen oder noch lieber besuchen dürfe, er wolle mich ja nicht drängen, aber es täte mir ja sicher gut, jetzt nicht alleine zu sein …?! Ach, Paul, dachte ich, du weißt gar nicht, wie gut sich alleine sein anfühlt. Ich fühlte mich zu schwach, ihm das zu antworten, ich hatte es bisher noch nie getan. Dabei war er ein netter Kerl, schmeckte gut, wir hatten uns vor zwei Wochen auf der Fete von Solveig kennengelernt und ich hatte schon vermutet, dass er sich in mich verliebt hatte, natürlich. Sein Werben schmeichelte mir, ich fand es nett von ihm, dass er mich wiedersehen wollte, vielleicht würde ich ihm nachgeben. Er konnte ja nicht wissen, dass ich nirgends länger blieb und mich meist schon vor dem Frühstück zur Tür schlich, den Kopf noch voller Gin, den Körper satt. Wie so oft hatte ich mir am Ende der Nacht oder am Anfang des Morgens jemanden gesucht, der das Partyglück vollkommen macht, der den Rausch vollendet, gesichtslos, namenlos, atemlos. Manchmal blieb ich auch länger, bei Marlon oder Ricki zum Beispiel, aber es führte nur zu Komplikationen, wegen der vielen Gefühle, die Erwartungen in den Raum holten. Anrufen, verabreden, miteinander Zeit verbringen, immer das machen, was der andere toll fand.
Ich war bisher genau zweimal verliebt, mit dem einen war ich sogar ein halbes Jahr zusammen, aber diese komplizierte Treffbeziehung wurde mir irgendwann zu eng, ich meine, er hieß Johannes, hatte einen tollen Hintern und kam immer zu früh. Was ich weiß: Ich hatte weder Zeit für mich noch meine Querflöte gehabt, nur noch verliebt Händchen halten und ins Kino gehen, das gab mir nichts und wenn das Beziehung bedeutete, hätte ich lieber keinen Freund. Seine Küsse passten mir schon bald nicht mehr und so hatte ich irgendwann Schluss gemacht, bevor es zu langweilig wurde. Sehr zur Enttäuschung von meiner besten Freundin Charly, die der Meinung war, wir wären das perfekte Paar gewesen. Sie hielt mich für beziehungsunfähig, für eine, die nur mit den Männern spielte, und meinte, ich könne die armen Jungs doch nicht einfach so benutzen. Sie formulierte es so, benutzen, und ich verbot ihr daraufhin, so über Spaß zu sprechen, den ohne Zweifel alle Beteiligten hatten. Mit einem lag die gute Charly allerdings richtig: Es fiel mir schwer, mich auf andere einzulassen, irgendwann waren mir Küsse und Streicheleinheiten und Zuwendungen zu viel. Ich mochte das Gefühl nicht, mich in ihnen zu verlieren, mich an sie zu gewöhnen und süchtig zu werden, mir war es lieber, ich blieb frei. Paul würde noch eine Weile warten müssen, bis ich wieder tanzte, dachte ich, stellte mein Handy aus und kauerte mich auf dem Stuhl zusammen, die Arme wärmend um mich geschlungen. Auf Partys würde er mich in der nächsten Zeit nicht antreffen, wie konnte ich feiern mit dieser Leere in mir?!
Später kam Vincent. Obwohl er etliche Häuserblocks weiter wohnte, war es, als wären wir wie Geschwister miteinander aufgewachsen. Wir sahen uns täglich, in der Schule, im Bus, nachmittags, in Cafés, auf Partys. Nie mussten wir uns verabreden oder telefonieren, wir trafen uns sowieso, wo ich war, war auch er. Im Gegensatz zu Charly wollte Vincent nicht immer alles von mir wissen. Er löcherte mich nicht mit Fragen, wenn ich in mich gekehrt und zurückgezogen war, ein Blick genügte und er wusste, wenn er mich in Ruhe lassen musste: Weil ich wieder Streit mit Zoé hatte, eine schlechte Note kassiert oder weil meine Flöte kaputtgegangen war. Das war nämlich meine Hauptsorge: Meine Silberflöte, ein Erbstück meiner Omi, deren Klappen und Mundstück generalüberholt waren. Dennoch konnte es passieren, dass mir mitten im schönsten Lauf der Badinerie eine Feder absprang. Daddy hatte deshalb schon oft vorgeschlagen, mir eine neue Querflöte zu kaufen, doch das kam für mich überhaupt nicht infrage. Ich liebte dieses alte Instrument über alles, genauso, wie ich Vincent liebte, wie er jetzt mit seinen glatten, roten Haaren in meinem Zimmer stand. Seit dem Unglück war er ständig in meiner Nähe, oft schlief er bei mir, warum auch nicht?! Charly wusste nichts davon, sie hätte es nicht verstanden, wie man sich lieben konnte, ohne ein Paar zu sein, ohne von einer gemeinsamen Zukunft als Vater-Mutter-Kind zu träumen. Dieser Gedanke passte nicht in ihre romantische Vorstellung von Liebe, zu ihrem Traum von Glück, wie sie ihn in sich trug. Vielleicht wollte sie auch lieber nichts von uns wissen, denn sie war seit einiger Zeit in Vincent verliebt und wünschte sich sehnlichst, mit ihm eine richtige Beziehung zu haben, was immer sie darunter verstand.
Ohne ein Wort zog Vincent mich jetzt in seine Arme und hielt mich fest oder ich mich an ihm. Sein Atem kitzelte in meinem Ohr und ich konnte riechen, dass er Ravioli zum Mittagessen gegessen haben musste. Lange standen wir so da, innig umarmt, seine Art, mich um Verständnis dafür zu bitten, dass es für ihn unmöglich gewesen war, an der Beerdigung meiner Mutter teilzunehmen. Er legte keinen Wert auf solch bürgerliche Gesten des ritualisierten Abschieds, wie er sich ausdrückte, aber sein Herz war voller Trauer. Er hatte Cristina, wie so viele meiner Freundinnen und Freunde, vergöttert – nicht nur, weil sie eine überaus attraktive Frau war, sondern immer aufgeschlossen und herzlich all jenen gegenüber, die mir etwas bedeuteten. Dann kochte sie Kaffee und legte Kekse dazu, ließ sich von ihnen Zigaretten anbieten und liebte es, wenn unser Haus voller junger Menschen steckte. Daddy hatte mit dieser betonten Jugendlichkeit seine Probleme, wie immer zog er sich dann in seine Kellerräume zu seinen Forschungen zurück. Ich wäre ihm gerne gefolgt, weil es mir unangenehm war, wenn sie mit Vincent oder Samuel oder Mateo flirtete.
„Sie ist nicht weg“, flüsterte Vincent tröstend in mein Ohr, „sie ist dir nur vorausgegangen.“ Vincent, der leise Poet, ich schluckte.
„Komm, zieh deine dicke Jacke an, ich hab eine Überraschung für dich“, sagte er nach einer Weile und löste sich aus meiner Umklammerung, strich sich das feuchte Shirt glatt. Ich musste geweint haben. Vincent griff nach meiner Hand und zog mich mit sich, seine grünen Augen funkelten leise und entlockten mir ein Lächeln und so ließ ich mich von ihm mit nach draußen in unseren Garten ziehen. Mamas buntes Blütenrefugium, jetzt im Winter noch kalt, grau und trist, nicht einmal die Schneeglöckchen ließen sich blicken. Wir liefen in die hintere Ecke des Gartens zum alten Apfelbaum, wo eine Strickleiter einladend von oben herunterbaumelte, die Venusfigur blickte uns wissend hinterher.
„Du zuerst!“ Vincent bedeutete mir, nach oben zu klettern. Mit geübten Griffen hangelte ich mich hoch.
„Du spinnst!“, entfuhr es mir, ließ mich jedoch sofort in den Deckenberg aus Schlafsäcken und Kissen sinken, den Vincent hier hoch geschafft hatte.
Wie die Welpen lagen wir dann eng aneinandergeschmiegt in unserem Baumhaus, das wir damals als Kinder mithilfe von Daddy einen ganzen Sommer lang entworfen und gebaut hatten. Misstrauisch beäugt von Mama, die mir, als wir dann älter wurden, nie glauben mochte, dass Vincent nur ein Kumpel für mich war, lästerlich begleitet von Zoé, die ihn abfällig als schwules Weichei bezeichnete, der mit Drogen dealte, um sich als Kerl zu fühlen. Ich hasste sie für diese Bemerkung, weil sie so gemein war und es auch ein bisschen stimmte. Vincent hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich auch für Jungs interessierte und lieber in seinen Lyrikbänden las, als auf den Bolzplatz oder in die Muckibude zu gehen.
Ich liebte Vincent so, wie er war, und wusste, wie er sich anfühlte, überall, aber wir waren nicht das, was man gemeinhin als Freund und Freundin bezeichnete, wir führten keine Beziehung oder träumten von einer gemeinsamen Zukunft. Für das, was uns miteinander verband, gab es keine gängige Kategorie. Es war Liebe, es war Freundschaft, Respekt und tiefes Vertrauen und vor allem eins: Freiheit. Unser Baumhaus wurde zu unserem heiligen Zufluchtsort, wir spielten, wir gammelten, wir machten gemeinsam Hausaufgaben und lernten Vokabeln. Immer gab es einen Vorrat an Schokolade und Saft, später kamen heimlich Zigaretten hinzu. Das war zu der Zeit, als Vincent und ich anfingen uns zu küssen. Nicht, weil wir ein Paar sein wollten, sondern weil wir neugierig auf den anderen waren, unsere Hände und Münder taten es wie von selbst, aus Langeweile, aus Spaß, aus Vergnügen. Einen Sommer lang machten wir nichts anderes, als Nachmittage lang oben im Baumhaus zu liegen und zu knutschen, den anderen zu erkunden und zu erfühlen, versunken in uns, es gab nur Vincent und mich.
Und jetzt lagen wir wieder hier, eng, warm, im Schlafsack die Körperwärme des anderen fühlend. Mittlerweile war es dunkel geworden, Regen tröpfelte leise aufs Dach, das in der hinteren Ecke schon immer eine undichte Stelle hatte. Dort hatten wir einen Eimer aufgestellt, Pling!, machte es jedes Mal leise, wenn wieder ein Tropfen hineinfiel, er lief schon lange über.
„Quítame el pan … pero no me quites tu risa … Nimm mir alles weg, aber lass mir dein Lachen … du sollst nicht traurig sein, geliebte Eliza“, flüsterte Vincent leise und zog mich noch näher an sich. Vincent hatte schon immer ein Faible für Gedichte, seit wir Spanisch als erste Fremdsprache lernten und er die lautmalerische Wärme, die geheimnisvollen Wortbedeutungen jener Sprache nicht spürte, sondern auch verstand, sowieso.
„Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa … vergiss selbst in der dunkelsten Stunde dein Lachen nicht …“
Ich hatte sein Lieblingsgedicht von Pablo Neruda so viele Male gehört, ich kannte es ebenfalls längst auswendig. Ich liebte diese Elogie über das Leben und das Lachen, über das Licht, das alle Dunkelheit überstrahlte.
„… niegame el pan, el aire, la luz … nimm mir alles, nur nicht dein Lachen …“
Lächelnd lag ich da, hörte Vincent mit geschlossenen Augen zu, spürte Wärme und Liebe überall. Tastete nach seinem Gesicht, fuhr mit dem Finger zärtlich die Konturen seines Mundes nach, spielte mit seinen Haaren, umkreiste sein Ohr, rückte noch dichter an ihn heran. Längst schwieg er, hatte nach meinen Händen gegriffen und hatte seinen Mund in meine Haare gedrückt. Lippen fanden sich, Zungen spielten miteinander, wir küssten uns wie damals als Vierzehnjährige, vorsichtig, neugierig und fordernd zugleich.
Diesmal war es anders. Wir waren über vier Jahre älter, wir hatten mittlerweile andere geküsst und wussten, was alles noch passierte, wenn auch der Körper mitküsste. Es wurde ein einziger, langer Abschiedskuss, dem wir uns völlig hingaben, warm, dampfend. Vincents helle, sommersprossige Haut leuchtete im Dunkeln, als er sich über mich beugte, meinen Atem mit seinem Mund verschloss und ich seinen Körper in meinen nahm.
„Es ist wegen Charly, richtig?“, fragte ich, obwohl ich die Antwort kannte. Es war weit nach Mitternacht, als ich die Frage stellte und wir in unserer Küche saßen, ich kochte uns einen Tee. Die kleine Lampe über der Spüle beleuchtete den zarten Zauber zwischen uns und obwohl wir längst wieder angezogen waren, fühlte ich immer noch Vincents Wärme in mir. So würde es zwischen uns immer bleiben, egal, wie viele Charlys es für ihn noch geben würde – und wie viele Pauls ich mit nach Hause nehmen würde. Deswegen war er gekommen, um auf seine Weise Abschied von uns zu nehmen, ein Zeichen, dass es ihm diesmal ernst mit einem Mädchen war, er es versuchen wollte, mit jemandem zusammen zu sein, ein richtiges Paar. Vielleicht war es für ihn auch eine experimentelle Erfahrung, bei ihm wusste man nie so genau. Ich fand Vincent in diesem Moment großartig und war gleichzeitig unendlich traurig. Noch ein Abschied an diesem Tag, doch hatte ich ja längst damit gerechnet. Charly schwärmte schon lange für Vincent. Nachdem zarte Annährungsversuche zu nichts geführt hatten, war sie in den letzten Wochen immer deutlicher geworden. So sehr, dass es mir peinlich war.
Für Vincent. Nicht für Charly. Die hatte ein sonniges Gemüt und schlichtweg eine beschränkte Wahrnehmung dessen, wie sie auf andere wirkte. Sie ließ sich im Szene-Laden jedes Kleidungsstück extra zeigen oder diskutierte an der Eistheke so lange mit der Bedienung, bis die Kugel richtig in der Waffel saß und da war es ihr egal, wenn andere ihretwegen warten mussten oder gar die Augen rollten, nur weil sie sich die Zeit für eine Entscheidung nahm, die sie für sich brauchte, Charly mutete sich zu.
„Wie soll ich das eine tun, ohne das andere zu lassen?“, fragte er grinsend und pustete in seine Tasse. Seine Haare fielen ihm dicht in die Stirn. Meine Finger zuckten, ich hätte sie ihm gerne aus lauter Gewohnheit zurückgestrichen.
„Du musst das eine tun und das andere lassen“, antwortete ich stattdessen. „Sie würde es nicht verstehen.“
Vincent nickte. „Gehen wir schlafen?“
Als ich am nächsten Morgen erwachte, war Vincent schon lange weg, der frühe Vogel war sein Freund. Draußen prasselte der Regen an mein Fenster, immer noch oder schon wieder, ich zog die Decke fester um mich, sie roch noch nach ihm. Trotzdem war mir kalt, ich fror, wie schon seit Tagen. Da wusste ich, ich würde es auch heute nicht schaffen, aufzustehen, um in die Schule zu gehen, sondern liegen bleiben, nachdenken, versuchen, Mama nahe zu sein. Im Dämmerschlaf wurden die Erinnerungen an Mama lebendig, wie sie mit Zoé und mir Schlauchdusche im Garten machte oder mit uns Weihnachtsplätzchen backte. Wie sie mit uns schimpfte, wenn wir mit dreckverschmierten Schuhen nach dem Spielen ins frisch geputzte Wohnzimmer gerannt kamen, um dann mit einer liebevollen Geste unsere Klamotten in die Waschmaschine zu stopfen. Wie sie mich am Frühstückstisch empfing, wenn ich verkatert über meinem Milchkaffee saß. Wie sie nie wissen wollte, wo und mit wem ich die Nacht verbracht hatte, nur ein leises Lächeln im Gesicht. Ich stellte mich schlafend, als Daddy nach mir sah, er kümmerte sich immer, der Duft nach frisch gebackenen Hörnchen zog in meine Nase, ich registrierte es dankbar.
Daddy blieb einen Moment im Türrahmen stehen, als wolle er mir etwas sagen, dann ging er ohne ein weiteres Wort wieder nach draußen. Ich verschlief den ganzen Tag und fühlte mich viel zu schwach, um aufzustehen, ich schaffte es gerade mal aufs Klo und wieder zurück. Als Charly dann am frühen Abend anrief, hatte ich mir gerade in der Küche einen Joghurt geholt und mich in den Sessel vorm Wohnzimmerfenster gesetzt, wo ich gedankenlos nach draußen starrte.
„Mensch, Eliza, du musst endlich raus!“, legte sie los, als ich mich matt meldete und aus Pflichtgefühl fragte, was wir heute in Chemie und Mathe durchgenommen hatten. „Jetzt, wo die Beerdigung rum ist, darfst du doch …“
„Ich kann nicht“, murmelte ich und überlegte, ob ich nicht besser auflegen sollte, anstatt mir ihre Vorwürfe anzuhören. Manchmal war sie wirklich schwer zu ertragen.
„Komm doch vorbei und wir reden ein bisschen, Marlene freut sich bestimmt, wenn du kommst“, fügte sie noch hinzu, als sie mein heftiges Ausatmen spürte.
Bloß nicht, rief alles in mir, und ich erfand rasch die Notlüge, dass ich Daddy versprochen hätte, mit ihm gemeinsam einzukaufen. Lieber würde ich doch freiwillig Vokabeln lernen, als mich von Charlys Mutter in ein behutsames Trauerarbeitsgespräch verwickeln zu lassen. Oder von Charly, die seit Tagen kein anderes Thema kannte als den traurigen Verlust meiner Mutter und ständig mit mir reden wollte. Dabei konnte ich gut für mich sein, musste das Gefühl der Trauer erst mal für mich durchgefühlt haben, bevor ich es mit jemand anderem teilen konnte.
Vincent war eine Ausnahme, er stellte keine Fragen, wir brauchten nicht viele Worte, um uns zu verstehen.
Doch Charly fühlte sich wohl verpflichtet, mit mir über die gestrige Beerdigung zu sprechen und hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht dabei sein konnte. Sie hatte einer Familiensitzung bei einer berühmten Schamanin beiwohnen müssen. Ihre Mutter war so eine, die auf spirituelle Heilung schwor, und der Termin hatte sich nicht verlegen lassen. Charlys Vater war ein Pflegefall, bettlägerig seit einer Hirnblutung, die gesamte Familie litt und auch, wenn Charly es nie so sagte, fand sie die dramatischen Umstände des Verschwindens meiner Mutter weniger schlimm als das, was sie gerade durchmachen musste.
Sein Schlaganfall, das war Charlys Thema, meine fröhliche Freundin war binnen weniger Wochen zu einem kreuzunglücklichen Menschenkind geworden, auch wenn sie es sich nicht anmerken ließ, mit Vincent flirtete, ich wusste es besser, wie sehr sie die Situation belastete. Charly wartete mit Inbrunst darauf, dass dieser qualvolle Moment des Dahinsiechens ein Ende haben sollte, sie von der Verantwortung befreien würde, ihrem Vater hilfreich die Schnabeltasse zu reichen und ihre Mutter bei der Intensivpflege zu unterstützen. Charly nutzte längst jede Gelegenheit, dieser traurigen Stimmung bei sich zu Hause zu entkommen, fälschte Stundenpläne und erfand Arbeitseinsätze, bei denen sie unabkömmlich war, ohne Frage würde der Tod ihres Vaters für sie eine große Erleichterung bedeuten, sie würde nicht wie ich in eine Starre der Trauer verfallen, unfähig, den Alltag mit anderen zu teilen.
„Später treffen sich alle im Lorenzos …“, fragte Charly lauernd. „Da warst du doch lange nicht mehr … Die anderen fragen schon, wo du steckst.“
Ich seufzte, Charly würde nicht lockerlassen, das wusste ich aus anderen Gesprächen. Wenn ich für die nächsten Tage meine Ruhe haben wollte, musst ich mir etwas einfallen lassen.
„Dann wird Vincent auch dort sein“, sagte ich so beiläufig wie möglich, Charly sollte bloß nicht merken, dass ich inzwischen von seinen Absichten wusste.
Am anderen Ende der Leitung war es einen Moment lang still und ich konnte förmlich spüren, wie sich meine Freundin freute.
„Okay, du hast gewonnen“, sagte sie schließlich. „Aber ich schulde dir einen Drink!“ Dankbar darüber, dass sie mich in Ruhe ließ, fragte ich nicht weiter, warum, und legte schnell auf.
So blieb es auch in den folgenden drei Tagen, ich verkroch mich, ging nicht mehr ans Telefon und erst recht nicht in die Schule, weinte, konnte nichts anfangen außer immer wieder im Haus auf und ab zu laufen, wusste nicht, was ich tun sollte, fühlte mich gelähmt und gefangen in einer Person, die mir plötzlich fremd vorkam, die nicht ich war. Die weder Lust auf Gin noch Partys hatte, keine Freude am Joggen oder ihrer Musik, die ihre Haare nicht wusch und sich verkroch. Ich fühlte mich wie eine verlorene Traube unterm Küchenschrank, verloren, vergessen, verschrumpft.
Omi kam und wollte aus Mamas Schatulle eine Goldkette haben, die sie ihr einst zur Konfirmation geschenkt hatte, Daddy suchte sie ihr schulterzuckend heraus. Bei der Gelegenheit fragte er mich, ob ich auch ein Schmuckstück zur Erinnerung haben wollte, ich sah ihn hilflos an, wie konnte ich?! Alles im Haus erinnerte mich an Mama, der Garten, die Möbel, ihr Handtuch hing noch im Badezimmer und die Zahnbürste stand auch noch da. Da zog mich Daddy voller Mitgefühl in seine Arme.
„Mir fehlt sie auch. Sehr sogar, obwohl es in letzter Zeit so kompliziert zwischen uns geworden war“, flüsterte er in meine Haare. „Aber sie hätte gewollt, dass du wieder unter die Leute gehst und dich nicht hier im Haus vergräbst.“
Zur Antwort weinte ich stumm an seiner Schulter. Natürlich wollte Mama, dass es mir gut ging.
„Ich weiß, dass du es kannst, du bist schließlich meine Tochter.“ Daddy schob mich nach einer Weile ein Stück von sich und sah mir prüfend in die Augen. Dann sagte er leise: „Komm, geh dich duschen und umziehen, in einer halben Stunde fahren wir los.“