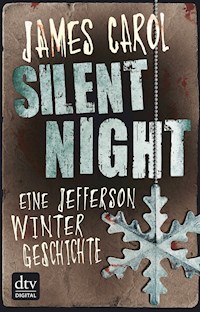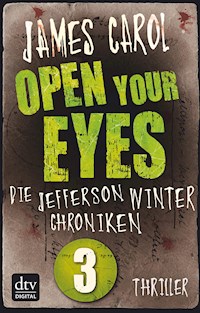7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Jefferson Winter-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der zweite Fall für Jefferson Winter Eine Kleinstadt in Louisiana: Ein Anwalt wird bei lebendigem Leib verbrannt. Ein Video der Tat wird ins Netz gestellt, mit einem automatisierten Countdown. Eins ist klar: Es wird weitere Opfer geben. Und Jefferson Winter bleiben gerade mal 13 Stunden Zeit bis zur tödlichen Deadline.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Ähnliche
James Carol
Watch me
Ich werde es wieder tun
Thriller
Deutsch von Wolfram Ströle
Deutscher Taschenbuch Verlag
Für Cam,Mitverschwörerin und Komplizin
1
Sam Galloway starb einen langsamen, qualvollen Tod, einen Tod, der überhaupt nicht zu seinem Leben passte. Eigentlich hätte er ganz anders sterben müssen. Menschen wie er schliefen friedlich ein oder wurden auf der zweiten Hälfte eines 18-Loch-Golfplatzes von einem Herzinfarkt niedergestreckt. Sie starben nicht, weil jemand sie mit Benzin übergoss und anzündete. Und erst recht nicht starben sie geknebelt mit einem schmutzigen Lappen, der ihre Schreie erstickte, während das Feuer ihnen das Fleisch von den Knochen fraß.
Man könnte Sam natürlich leicht zu einem Opfer der Umstände erklären und seinen Fall der Kategorie »falsche Zeit, falscher Ort« zuordnen. Dieser Fehler wurde in einer solchen Situation häufig gemacht. Der Grund dafür war irrationale Angst. Sobald man sagte, Sam sei zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, konnte man die Schuld an seiner Ermordung dem Schicksal, einem dummen Zufall oder den Launen der Götter geben.
Dann war auch durchaus vorstellbar, dass das, was Sam passiert war, jedem passieren konnte. Und von dort war es kein allzu großer Schritt mehr zu der Folgerung, dass man womöglich selbst der Nächste war.
Doch Sam war nicht zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, und sein Tod war kein unglücklicher Zufall, sondern genau geplant. Jemand hatte Sam als Opfer ausgewählt. Dieser Jemand hatte sich zuerst vorgestellt, was er tun würde, und seine Fantasie dann in die Tat umgesetzt. Und er hatte sehr genau überlegt, wie er Sam verbrennen konnte, ohne dabei erwischt zu werden.
Letzteres war entscheidend. Ohne dabei erwischt zu werden. Darin unterscheidet sich der Profi vom Amateur. Ein Verbrechen zu begehen ist vergleichsweise einfach. Jeder Dummkopf kann das. Ein Verbrechen zu begehen und nicht erwischt zu werden, das ist schon schwieriger.
Der Plan war so weit aufgegangen. Sam war tot und der Täter konnte sich frei bewegen und sein normales Leben weiterführen, als wäre nichts passiert. Wahrscheinlich saß er in diesem Moment zur Feier seines Erfolgs in einem Diner beim Frühstück. Mit Spiegeleiern, einem Stapel von in Ahornsirup getränkten Pfannkuchen, knusprig gebratenem Speck und literweise Kaffee zum Hinunterspülen.
Oder er arbeitete in einem ganz normalen Bürojob. Mit Händeschütteln, Auf-den-Rücken-Klopfen und Manöverkritik des Baseballspiels vom Vorabend am Wasserspender. Ein Spiel, das er gar nicht gesehen hatte, weil er anderweitig beschäftigt gewesen war. Aber er hatte sich im Sportteil der Zeitung darüber informiert.
Ich hatte bis zum Eintreffen der E-Mail in meinem Posteingang vor zehn Minuten noch nie von Sam Galloway gehört. Jetzt konnte ich an nichts anderes denken als an das, was ihm passiert war, und daran, wer als Täter in Frage kam. Vor allem Letzteres.
Ich sah zu meinem aufgeklappten Laptop und dem Koffer auf dem Bett hinüber. In den vergangenen zwei Wochen hatte ich in South Carolina einen Mörder namens Carl Tindle gejagt. Carl saß inzwischen hinter Schloss und Riegel und es war Zeit für den nächsten Fall.
Bis vor fünf Minuten war dieser Fall noch ein Serientäter gewesen, der in Honolulu Prostituierte vergewaltigte. Keine Edel-Callgirls, sondern Billignutten, Mädchen, die als Abschaum galten und niemanden mehr interessierten. Aber deshalb hatten sie trotzdem Gerechtigkeit verdient. Soweit es mich betrifft, zählt jedes Opfer. Ob es eine Prinzessin oder eine drogenabhängige Hure ist, macht dabei keinen Unterschied.
Flüge und Hotel waren gebucht, mein Koffer war gepackt und ich mehr als bereit, Charleston zu verlassen. Nicht dass mich an Charleston etwas gestört hätte, keineswegs. Aber ich war schon zwei Wochen hier und länger als zwei Wochen halte ich es derzeit nirgends aus.
Ich sah wieder auf den Laptop. In meiner Zeit beim FBI hatte ich sehr schnell lernen müssen, Prioritäten zu setzen. Wir arbeiteten immer am Limit, einfach weil draußen zu viele Verbrecher herumliefen. Das letzte Opfer des Vergewaltigers war soeben auf Hawaii gefunden worden, deshalb hatten wir dort etwas Luft. Der Typ würde nicht gleich wieder zuschlagen. So, wie ich es sah, konnte ich Hawaii ohne größere Probleme ein paar Tage verschieben. Bei diesem Sam Galloway dagegen lief uns die Zeit davon.
Absender der E-Mail war Sheriff Peter Fortier aus Eagle Creek im Dayton Parish, Louisiana. Ich hatte weder vom Bezirk Dayton noch von Eagle Creek oder Sheriff Fortier je gehört, was angesichts einer Fläche der Vereinigten Staaten von 9,6 Millionen Quadratkilometern und einer Bevölkerung von fast einer Drittel Milliarde vielleicht auch nicht weiter überrascht.
Der Filmclip im Anhang der E-Mail war insofern interessant, als ich Killer selten bei der Arbeit zu sehen bekam. Meist sah ich nur das Ergebnis. Das konnte eine Leiche sein, aber nicht in jedem Fall. Manchmal gab es nicht einmal einen Tatort. In meiner Zeit beim FBI hatte ich Dutzende Serientäter verhört, ich kannte also genug Schilderungen aus erster Hand, auch wenn sie nicht objektiv waren. Aber egal, wie frisch die Leiche oder wie detailliert die Schilderung, etwas mit eigenen Augen zu sehen war unvergleichlich viel besser, und sei es nur durch die Linse der Kamera einer anderen Person.
Dieser Täter war natürlich nicht der Erste, der sich bei der Arbeit filmte, und ganz gewiss auch nicht der Letzte. Trotzdem war so etwas die Ausnahme und nicht die Regel. Es ist allgemein bekannt, dass Serienmörder oft Trophäen aufbewahren, um ihre Fantasien zu beflügeln, aber dabei handelt es sich in der Regel um unauffällige, unschuldig aussehende Erinnerungsgegenstände, die nur für den Täter eine Bedeutung haben, wie ein Kleidungsstück, eine Haarsträhne oder vielleicht einen Ohrring. Ein Film war selten, weil riskant. Wenn der Falsche ihn sah, wie sollte der Täter sich herausreden?
Ich spielte den Clip noch einmal ab. Die Bildqualität war gut, die Konturen klar umrissen. Das Bild wackelte auch nicht, der Täter hatte die Kamera offenbar auf ein Stativ montiert. Was zugleich bedeutete, dass Sheriff Fortier es mit einem Einzeltäter zu tun hatte. Bei zwei Tätern hätte bestimmt einer die Kamera halten wollen und ich würde jetzt einen schlecht gedrehten Amateurfilm sehen. Ton gab es keinen.
Mit Ton wäre es in gewisser Weise weniger schlimm gewesen. Meine Fantasie füllte die Stille mit Geräuschen, die wahrscheinlich noch grauenvoller waren als die Wirklichkeit.
Der Bildschirm wurde größtenteils von Sam Galloway ausgefüllt. Er lag geknebelt und an Händen und Füßen gefesselt fast wahnsinnig vor Angst auf dem Boden. Sein Gesicht war vor Anspannung dunkelrot angelaufen, die Augen drohten aus den Höhlen zu springen. Sein Anzug war zerknittert und schmutzig, der Kragen seines weißen Hemdes ebenfalls.
Wo er gefangen gehalten wurde, war schwer zu sagen. Der Boden bestand aus schmutzigem Beton, die eine Wand, die ich sah, aus Betonziegeln. Meinem Gefühl nach handelte es sich um einen industriellen Zweckbau, der außerdem irgendwie beengt wirkte, was mich an eine Art Garage oder einen Bunker denken ließ, weniger eine große Lagerhalle. Laut der Zeitangabe in der rechten unteren Bildschirmecke war der Film gestern Abend um kurz nach elf gedreht worden.
Die Uhr auf dem Bildschirm sprang eine Minute weiter auf 23:04. Kurz darauf erschien ein zweiter Mann auf dem Bildschirm. Er war schmächtig und etwa einen Meter fünfundsiebzig groß.
Und er trug einen Kanister.
Der dünne Mann ging zu Sam, wobei er der Kamera immer den Rücken zukehrte. Als Sam ihn bemerkte, erstarrte er. Er sah ihn an und dann den Kanister und warf sich verzweifelt hin und her.
Der Mann schraubte den Deckel des Kanisters auf und kippte den Inhalt über Sam. Benzin spritzte in alle Richtungen. Sam bekam es in die Augen und in die Nase, er ertrank förmlich darin. Seine Kleider und Haare trieften. Der Mann schüttelte die letzten Tropfen aus dem Kanister und stellte ihn auf dem Boden ab. Dann holte er ein Streichholzbriefchen heraus. Der Karton war weiß, kein Logo eines Restaurants oder einer Bar. Er zündete ein Streichholz an, ließ es mit einer beiläufigen Bewegung auf Sam fallen und verschwand vom Bildschirm.
Sam brauchte über zwei Minuten, um zu sterben, zwei Minuten länger, als ein Mensch leiden sollte. Die Schmerzen müssen entsetzlich gewesen sein. Niemand sollte so sterben müssen.
Ein Link in Sheriff Fortiers E-Mail führte mich zu einer primitiven Website. Sie zeigte große weiße Ziffern auf schwarzem Grund. 13:29:23. Rechts davon war die Strichzeichnung einer Partie Galgenmännchen zu sehen. Das Spiel war fast zu Ende, dem Männchen am Galgen fehlten nur noch die Gliedmaßen.
Die Uhr lief, aus der Drei wurde eine Zwei und dann eine Eins. Arme und Beine erschienen in rascher Folge. Zwei Gliedmaßen pro Sekunde. Die letzte Ziffer wurde zu einer Null, die Zeichnung verfärbte sich rot und verschwand.
Aus der Zwanzig wurde eine Neunzehn und auf dem Bildschirm erschien die Basis des Galgens. Mit jeder verstreichenden Sekunde kamen weitere Teile hinzu. Der senkrechte Balken, der Querbalken, die diagonale Strebe, das Seil. Kopf, Rumpf, Arme, Beine. Die letzte Ziffer sprang von Eins auf Null, die Zeichnung verfärbte sich rot und verschwand und der ganze, etwa zehn Sekunden dauernde Vorgang begann von vorn.
Ich fuhr mit der Maus über den Bildschirm und suchte nach versteckten Links. Ich hatte schon beim ersten Mal keine gefunden und fand auch jetzt keine. Auch die Netzadresse sagte mir nichts: www.violescent.com. Einer Google-Suche zufolge handelte es sich bei »violescent« um ein seltenes Wort, das so etwas wie »leicht ins Violett gehend« bedeutete.
Meiner Vermutung nach hatte der Täter eine Art Zufallsgenerator für Wörter verwendet. Wenigstens hätte ich das an seiner Stelle getan. Wenn man sich selbst ein Wort ausdenkt, ist es nie wirklich zufällig, das Unbewusste mischt sich immer ein. Der Name der Website musste noch überprüft werden, aber er war mit ziemlicher Sicherheit eine weitere Sackgasse. Einen Domainnamen unter falscher Identität anzumelden war kein Kunststück.
Ich hatte auch schon daran gedacht, dass das Ganze ein derber Schabernack sein könnte. Man hatte bisher keine Leiche gefunden, keinen Tatort, keinerlei physische Hinweise auf ein Verbrechen. Die Polizei hatte nur den Filmclip und die Website. Viel war das nicht. Trotzdem war ich überzeugt, dass die Tat wirklich begangen worden war.
Denn erstens wurde Sam Galloway tatsächlich vermisst.
Zweitens hatte man die Person im Film eindeutig als Sam Galloway identifiziert.
Drittens und noch wichtiger: Was hätte der Täter von einem solchen Schabernack gehabt? Man tut nichts ohne Grund. Das Ergebnis muss im Verhältnis zum Aufwand stehen. Der aus einer Tätigkeit gewonnene Nutzen muss die dafür aufgewendete Energie überwiegen. Wenn Sam seinen Tod vortäuschen wollte, hätte er das sehr viel einfacher tun können.
Viertens und für mich entscheidend konnte die Filmszene unmöglich gespielt sein. Andernfalls hätte die schauspielerische Leistung einen Oscar verdient.
Einige lange Minuten saß ich da und überlegte, was ich tun sollte, während ein steter Strom von Zahlen und Galgenmännchen über den Bildschirm lief. Hier in Charleston war es jetzt halb zwölf vormittags. Dayton lag eine Stunde zurück, es war dort also erst halb elf. Der Countdown lief Punkt Mitternacht nach Louisiana-Zeit ab. Bis dahin würden weitere 4860 Strichmännchen sterben.
Louisiana oder Honolulu?
Sumpf oder Strand?
Es war im Grunde einfach. Ich werde bei dramatischen Gesten immer schwach und dieser Täter hatte zweifellos einen ausgeprägten Sinn fürs Theatralische. In Wahrheit hatte er mich sofort am Haken gehabt.
2
»Jefferson Winter?«
Die Frage hallte durch den Hangar. Ich drehte mich nach der Stimme um. An der Treppe einer Gulfstream G550 stand ein schwarzer Hüne mit kahl rasiertem Schädel. Der Privatjet wirkte in der großen Halle wie ein Spielzeug, doch der Typ sah im Vergleich zu dem Flugzeug riesig aus, als stimmten die Proportionen irgendwie nicht.
Ich ging auf den Jet zu und das hohle Geräusch meiner Schritte verklang unter den Deckenträgern. Auch von nahem war der Schwarze ein Riese. Knappe zwei Meter und bestimmt hundertzwanzig Kilo Muskelmasse. Ich bin nur eins sechsundsiebzig groß, er überragte mich also um gute zwanzig Zentimeter. Die von den Deckenlampen geworfenen Schatten breiteten sich von seinen Füßen in alle Richtungen aus und verschmolzen zu einem grauen See, in dessen Mitte er stand. An der Brust seiner schwarzen Uniform prangte ein golden glänzender Stern, die Abzeichen an seinen Ärmeln zeigten an, dass er zur Dienststelle des Sheriffs von Dayton gehörte. Sie sahen brandneu aus.
Er war noch jünger, als ich beim ersten Anblick gedacht hatte. Anfang zwanzig, höchstens. Und er hatte ein unschuldiges Babygesicht mit einem offenen, ehrlichen Blick. Ich fragte mich, wie lange das noch so sein würde. Dieser Job machte alle fertig, manche früher, manche später. Irgendwann kamen die dunklen Gedanken.
Ich fragte mich auch, was es mit dem Privatjet auf sich hatte. Das FBI konnte sich eine Gulfstream leisten – sogar zwei –, aber es hatte auch ein Jahresbudget von über acht Milliarden Dollar. Aus dem wenigen, das ich im Internet gelesen hatte, ging jedoch hervor, dass das Sheriff’s Department von Dayton wohl kaum über einen zehnstelligen Etat verfügte. Sechsstellig kam der Wahrheit vermutlich näher und nach Abzug der tagtäglichen Ausgaben konnte nicht mehr viel für die kleinen Luxusdinge des Lebens übrig sein.
Wie eine Gulfstream.
Das Flugzeug selbst verriet nichts. Glänzender weißer Lack, am Heck eine Nummer, mehr nicht. Kein Logo, was ungewöhnlich war. Besitzer von Privatjets wollen in der Regel zeigen, wer sie sind und was sie haben, auch in höchsten Höhen. Ein Privatjet war nicht einfach ein Transportmittel, sondern ein Statussymbol, mit dem man der Welt zeigte, wie wichtig man war. Der Präsident hat nicht ohne Grund eine eigene 747, statt Economy Class zu fliegen. Und der Grund ist nicht, dass es praktischer so ist, auch wenn die PR-Abteilung des Weißen Hauses einen das glauben machen will.
Der Hüne vor mir war nervös, aber bemüht, sich nichts anmerken zu lassen. Seine Bewegungen wirkten etwas ruckartig und er suchte immer wieder entlegene Ecken nach Scharfschützen ab. Außerdem wusste er nicht, wohin mit seinen Händen. Sollte er mir die Hand geben? Mir den Koffer abnehmen? Schließlich traf ich die Entscheidung für ihn. Ich stellte den Koffer hin und streckte die Hand aus. Er zögerte kurz und ergriff sie. Meine Hand verschwand in seiner Pranke, der Händedruck war zu meiner Überraschung aber ganz sanft.
»Netten Flieger haben Sie da«, sagte ich mit einem Nicken zur Gulfstream.
»Schön wär’s.«
Wieder das sonore, tiefe Rumpeln wie von einem Bären, das tief unten im Zwerchfell begann. Die Stimme war noch jung und es fehlte ihr an Autorität, aber es war zu spüren, dass das noch kommen würde. Er trug keine Rangabzeichen an seiner Uniform, stand in der Hackordnung also noch ganz unten. Dem wachen, intelligenten Funkeln seiner Augen nach handelte es sich dabei jedoch um einen vorübergehenden Zustand.
Ein Hüne, ja. Aber alles andere als dumm.
»Wie heißen Sie?«, fragte ich.
»Taylor.«
»Das ist alles? Nur Taylor?«
Ein Nicken. »Nur Taylor.«
»Offenbar haben Sie einen wirklich peinlichen Vornamen.« Ich grinste. »Sie können ihn mir ruhig jetzt gleich sagen. Ich finde ihn sowieso heraus.«
»Das werden Sie nicht«, sagte er und erwiderte mein Grinsen.
Ein Flughafenangestellter tauchte aus dem Nichts auf und ließ meinen Koffer im Frachtraum verschwinden. Er enthielt alles, was ich brauchte. Seit der Hinrichtung meines Vaters reiste ich ständig durch die Welt, immer auf der Jagd nach Serienverbrechern. Mein Zuhause war die jeweilige Hotelsuite, die mein Auftraggeber für mich gebucht hatte. Die Suiten waren unterschiedlich gut ausgestattet, aber das machte nichts. Selbst die einfachste Suite war noch besser als die miesen Motelzimmer, von denen ich in meiner FBI-Zeit mehr als genug gesehen hatte.
Ich besaß sogar ein Haus, oben in Virginia. Man kommt von dort rasch nach Quantico. Ich war seit Jahren nicht mehr dort gewesen und hatte das in naher Zukunft auch nicht vor, trotzdem brachte ich es nicht über mich, es zu verkaufen. Ein Psychiater könnte dafür ein Dutzend Gründe finden, darunter bestimmt auch einige wahre. Wahrscheinlich braucht jeder einen Ort, den er Zuhause nennen kann, auch wenn sich nichts dahinter verbirgt.
Bevor ich beim FBI aufhörte, war ich dort Chef-Profiler, der jüngste in der Geschichte der Abteilung für Verhaltensanalyse. Ich habe wie alle FBI-Agenten Anzug und blank geputzte Schuhe getragen und von frühmorgens bis spätabends für gesichtslose Autoritäten gearbeitet, die ich von Tag zu Tag weniger respektierte. Die Hinrichtung war mein persönliches Damaskuserlebnis. Zwei Tage nachdem der Staat Kalifornien meinem Vater einen tödlichen Giftcocktail verabreicht hatte, kündigte ich.
Wenn ich an meinen Vater denke, sehe ich ihn in der Hinrichtungszelle. Er brauchte zum Sterben sechs Minuten und dreiundzwanzig Sekunden und die meiste Zeit davon war er bewusstlos. Anders als Sam Galloway kam er viel zu leicht davon.
Ich habe die Fallakten gesehen, die Fotos. Mein Vater hat bis zu seiner Festnahme fünfzehn Frauen ermordet. Er hat sie entführt, in die hügeligen Wälder von Oregon gebracht, dort ausgesetzt und sie schließlich mit einem Hochleistungsgewehr mit Nachtzielfernrohr niedergestreckt.
Anschließend hat er sie an Ort und Stelle liegen lassen. Er machte sich nicht einmal die Mühe, ein flaches Grab zu schaufeln. Die Einwirkung des Wetters beschleunigte die Verwesung, Insekten und Tiere taten ein Übriges. Es ist schon erstaunlich, wie schnell Mutter Natur Schönheit zerstört, wie erbarmungslos sie sein kann.
Meiner Meinung nach hätte man das Pentobarbital weglassen können. Mein Vater hätte diese Welt um Atem ringend und bei vollem Bewusstsein verlassen sollen. Das wäre zwar immer noch bei weitem keine Wiedergutmachung gewesen, aber wenigstens ein Anfang.
»Marion«, sagte ich. »Ihre Eltern waren glühende John-Wayne-Fans.«
»Weit daneben.«
»Chuck?«
Taylor lachte nur und ließ mir mit einer Handbewegung den Vortritt. Wir stiegen die Stufen hinauf. Die Flugbegleiterin, die uns an der Tür zur Kabine begrüßte, war Anfang fünfzig. Haare dunkel gefärbt, praktische flache Schuhe. Man hatte sie eingestellt, weil sie ihren Job gut machte, nicht wegen ihres Aussehens, was einiges über den Besitzer des Flugzeugs sagte. Beides hat seine Vorzüge, Aussehen und Tüchtigkeit. Bei Flugbegleitern ist mir Tüchtigkeit allemal lieber. Fliegen ist auch ohne inkompetentes Personal schon nervtötend genug.
Die Einrichtung der Gulfstream war schlicht und unaufdringlich und erinnerte mich an die FBI-Jets. Von dem Pomp und Glitter, den man mit Rockstars oder der Hollywood-Schickeria verbindet, war nichts zu sehen.
Im hinteren Teil waren vier schwarze Ledersessel um einen Tisch mit einer Platte aus Walnussholz gruppiert. Ich machte es mir auf dem Fensterplatz mit Blick nach vorn bequem und legte meinen Laptop auf den Tisch. Taylor zwängte sich mir gegenüber auf den Sitz am Gang und streckte die Beine aus, so gut es ging. Der Jet rollte los und Taylor griff nach dem Sicherheitsgurt.
»Wissen Sie«, sagte ich, »ein Vorteil von Privatjets ist, dass man sich nicht anschnallen muss.«
»Und wenn wir abstürzen?«
»Sterben wir. Dann hilft Ihnen der Sicherheitsgurt auch nichts mehr. Glauben Sie wirklich, dass dieser kleine Gurt Sie rettet, wenn fünfundzwanzig Tonnen Metall mit achthundert Stundenkilometern auf den Boden knallen?«
Taylor sah mich entgeistert an, als hätte ich plötzlich zwei Köpfe. Er hatte die Augen zusammengekniffen und die Stirn gerunzelt. Dieser Blick war mir nicht neu.
»Die Luftfahrtbehörde hat das Anschnallen bei Start und Landung hauptsächlich vorgeschrieben, um die Disziplin aufrechtzuerhalten«, fuhr ich fort. »In einem Notfall möchte man auf keinen Fall, dass dreihundert hysterische Passagiere durch die Gänge rennen. Genauso ist es mit den Sauerstoffmasken. Auch die sollen dazu dienen, die Leute im Griff zu behalten. Aus den Masken kommt reiner Sauerstoff. Wenn Sie das einatmen, werden Sie euphorisch. Wer will schon seine letzten Momente in Angst und Schrecken verbringen, wenn er stattdessen die frohe Erwartung einatmen kann, dass er Gott gleich persönlich gegenübertreten wird?«
Taylor starrte mich nur stumm an.
Gleich darauf bogen wir auf die Startbahn ein und blieben kurz stehen. Dann heulten die Motoren auf und wir wurden nach vorne katapultiert wie der Kiesel von der Schleuder. Die Gulfstream hob viel schneller ab als ein Passagierflugzeug. Draußen vor dem kleinen Bullauge schrumpfte Charleston zu Spielzeuggröße und Carl Tindle verblasste zu einer Erinnerung.
Carl war nicht der schlimmste Fall, mit dem ich zu tun gehabt hatte, aber das machte ihn auch nicht zu einem Heiligen. Mitnichten. Er hatte eine Schwäche für Studentinnen, und wenn er mit einer fertig war, erstickte er sie mit einer Plastiktüte und einem Ledergürtel. Als ich hinzugezogen wurde, hatte er schon acht Opfer auf dem Gewissen.
Carl zu identifizieren war leicht gewesen, das hatte ich bereits am Ende des ersten Tags erledigt. Die größere Herausforderung war, ihn zu fangen. In South Carolina gibt es viele unbewohnte Gegenden und jede Menge Verstecke. Wir stöberten ihn schließlich in einer abgelegenen Hütte in Küstennähe auf. Als er merkte, dass er umzingelt war, ergab er sich ohne einen Muckser.
Im Unterschied zu meinem Vater würde Carl keine Gelegenheit mehr haben, Berufung gegen das Todesurteil einzulegen. Er war klein, schwächlich und so gut wie tot. Das Jahresende würde er nicht mehr erleben. Gut möglich, dass er schon Ende nächster Woche tot war, durch Selbstmord oder Messerstich. Die Gefängnisjustiz war hart und grausam und weit effektiver als die eines Gerichts.
3
Die Flugbegleiterin erschien wieder, als wir die Wolken unter uns hatten. Sie gab uns die Speisekarte, fragte, was wir essen und trinken wollten, und verschwand in der Bordküche im Heck. Als sie mit den Getränken zurückkehrte, stiegen wir immer noch auf. Ich musste wieder an den Besitzer der Gulfstream denken. Hätte ich einen Privatjet, wäre ich sehr wählerisch, wem ich ihn leihen würde. Die Polizei stünde ziemlich am Ende der Kandidatenliste. Am einfachsten wäre es gewesen, Taylor zu fragen, was ich wissen wollte, aber so weit war ich noch nicht.
Ich fuhr meinen Laptop hoch, klickte den Filmclip mit Sam Galloways letzten Momenten an, drückte auf Play und drehte den Bildschirm so, dass Taylor ihn sehen konnte. Vom Heck roch es nach Bœuf bourguignon. Dem Duft nach zu schließen hatte ich eine gute Wahl getroffen.
»Schauen Sie es sich gut an und sagen Sie mir anschließend, was Sie gesehen haben.«
Ich griff nach meinem Kaffee und nahm einen Schluck. Er kam von den Blue Mountains auf Jamaica und war wunderbar sanft. Die Blue Mountains sind ein ideales Anbaugebiet für Kaffee. Der fruchtbare, gut entwässerte Boden ergibt zusammen mit dem relativ kühlen, nebligen, feuchten Klima eine der besten Kaffeesorten der Welt.
Taylor trank eine Pepsi. Er wusste nicht, was er verpasste.
Ich betrachtete ihn. Das flackernde Licht des Bildschirms spiegelte sich in seinen Augen. Zu sehen war eine Folge verzerrter, undeutlicher Bilder. Ich konnte sein Unbehagen an seinem Gesicht ablesen. Zweimal zuckte er zusammen, als erlebte er selbst, was auf dem Bildschirm passierte. Auch er würde den fehlenden Ton überkompensieren, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Die Fantasie würde ihm einen Soundtrack liefern, der mehr mit den Horrorfilmen zu tun hatte, die er gesehen hatte, als mit dem, was er tatsächlich sah.
Das Grau und Weiß seiner Augen verfärbte sich zu Orange und Gelb und in seinem Gesicht zuckte es erneut. Er rieb die Hände aneinander, als stünden seine Finger in Flammen, die er löschen müsste. Auf das Orange folgte Schwarz und er drehte den Bildschirm wieder zu mir zurück.
»Und?«, fragte ich.
Taylor schüttelte den Kopf. »Ich werde nicht bezahlt, um eine Meinung zu so was zu haben, Mr Winter. Das übersteigt meine Gehaltsstufe bei weitem.«
Ich tat so, als müsste ich gähnen.
»Schauen Sie, Mr. Winter, ich bin erst seit einem halben Jahr Polizist. Ich kann Strafzettel ausstellen und bin im Büro so unentbehrlich, dass man mich bis nach Charleston schickt, um Sie abzuholen. Ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, aber was ich anhabe, ist keine Sheriffuniform.«
»Zuerst mal, nennen Sie mich Winter. Zweitens, interessante Wortwahl. Sie hätten jeden Rang nehmen können, aber Sie haben sich für den Sheriff entschieden. Den Mann ganz oben. Das heißt, Sie haben irgendwann und vermutlich mehr als nur einmal vor einem Spiegel gestanden und sich in einer nagelneuen Sheriffuniform gesehen.«
Taylor stieg das Blut ins Gesicht. Der Kontrast war nicht annähernd so stark wie bei Rot auf weißer Haut, aber er war da. Einen Moment lang saß mir gegenüber kein hundertzwanzig Kilo schwerer Hüne, sondern ein Schuljunge, der auffiel, weil er schon immer viel größer und um einiges schwerer gewesen war als seine Mitschüler.
»Außerdem«, fügte ich hinzu, »sind Sie intelligent und wissen ganz genau, dass Ihre Chancen auf diese Uniform im nördlichen Louisiana gleich null sind. Sie werden also die Zähne zusammenbeißen, hart arbeiten und in Ihrem momentanen Umfeld so weit wie möglich aufsteigen, bis Sie genug Erfahrung gesammelt haben, und es dann in einem anderen, weniger rassistischen Teil des Landes versuchen.«
Taylor nahm seine Pepsi und trank einen Schluck.
»Ich höre keinen Widerspruch«, sagte ich.
»Ehrgeiz ist kein Verbrechen.«
»Keineswegs. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie meine Frage beantworten, verrate ich Ihren Kollegen nicht, wie intelligent Sie wirklich sind.«
Wieder ein langer Blick, aber keine Widerrede.
»Sie haben sich in der Aufnahmeprüfung absichtlich ein bisschen dümmer gestellt als Sie sind, stimmt’s? Natürlich nur so, dass Sie noch bequem durchgekommen sind. Sie hätten mit Auszeichnung bestehen können, aber Sie wollten auf keinen Fall, dass sich Ihre Kollegen in Ihrer Gegenwart womöglich unbehaglich fühlen. Vermutlich spielen Sie den naiven, gutmütigen Riesen inzwischen perfekt. An Übung hat es bestimmt nicht gefehlt.«
Auch diesmal protestierte Taylor nicht, was auch gar nicht nötig war. Das schlechte Gewissen stand ihm ins Gesicht geschrieben.
»George«, sagte ich.
»Wie der Typ in dem Buch von Steinbeck?« Taylor schüttelte den Kopf. »Da hätte ich Ihnen mehr Fantasie zugetraut.«
Ich nickte in Richtung Laptop. »Okay, zurück an die Arbeit. Was denken Sie?«
Taylor seufzte und kaute auf der Unterlippe. Dann schüttelte er den Kopf und sagte: »Niemand sollte so sterben müssen.«
Was genau meinen eigenen ersten Eindruck wiedergab. Leider war das eine emotionale Reaktion und deshalb für die Ermittlungen unbrauchbar. »Versuchen Sie es noch einmal, aber diesmal ohne Emotionen.«
Taylor wollte etwas sagen, zögerte und lächelte. »Emotionen.«
»Weiter.«
»Der Mörder könnte ein Roboter sein, so wenig Emotionen zeigt er. Er kommt ins Bild, kippt das Benzin über Sam Galloway, lässt ein Streichholz fallen und verschwindet wieder. Als würde er ein Grillfeuer anzünden. Der Typ ist ein Psychopath, wie er im Buche steht.«
Ich schüttelte den Kopf. »Sie haben in einem Punkt recht. Die fehlenden Emotionen sind entscheidend. Aber Sie irren sich, wenn Sie ihn für einen Psychopathen halten. Das ist er nicht.«
»Natürlich ist er das. Er hat Galloway nicht nur ermordet, sondern regelrecht abgefackelt. Er hätte ihn auf ein Dutzend Arten schneller töten können, zum Beispiel mit einer Kugel in den Kopf. Aber das hat er nicht. Er hat ihn angezündet, und so etwas tut man nur, wenn das Opfer leiden soll.«
»Sie haben gerade zwei und zwei zusammengezählt und fünf herausbekommen. Das ist manchmal gut, aber nicht diesmal.«
»Wie kommt man dann auf vier?«
»Gute Frage.«
»Aber Sie wollen sie nicht beantworten.«
»Noch nicht.«
Mit zwei Klicks rief ich die Website auf.
10:42:08.
Die Partie Galgenmännchen hatte gerade angefangen. Nur die Basis des Galgens und der senkrechte Pfosten waren zu sehen. Eine Sekunde verging und der Querbalken erschien. In Dayton war es jetzt achtzehn Minuten nach eins. Die Zeit verstrich, Mitternacht rückte unaufhaltsam näher. Dass der Täter Mitternacht als Ende seines Countdowns gewählt hatte, zeigte wieder seine Vorliebe fürs Theatralische. Ich drehte den Computer so, dass Taylor den Bildschirm sehen konnte.
»Und was halten Sie davon?«
Weißes Licht zuckte in Taylors Augen auf. Ein Blitz pro Sekunde, wie ein langsamer, gleichmäßiger, entspannter Puls. Zehn Sekunden vergingen, dann zwanzig. Zwei weitere Strichmännchen bissen ins Gras. Taylor starrte auf den Bildschirm.
Und dachte nach.
Dann sah er mich grimmig an. »Das ist eine Ankündigung. Der Täter gibt uns zu verstehen, dass Sam Galloway nur der Anfang war. Er wird wieder töten.«
4
»Darf ich Sie was fragen?«, sagte Taylor.
Ich zog meine Ohrhörer heraus und öffnete die Augen. Der zweite Satz von Mozarts Jupiter-Sinfonie büßte seinen warmen, vollen Klang ein und wurde zu Blech. Ich streckte die Hand nach meinem Laptop aus und die Sinfonie brach ab. Wir waren seit einer Stunde unterwegs, hatten die Strecke nach Louisiana zur Hälfte geschafft, und fünfzehn Kilometer unter uns erstreckte sich das weite, leere Alabama, auf das bald Mississippi folgen würde. Das Bœuf bourguignon hatte meine Erwartungen in vollem Umfang erfüllt, es war fast so gut gewesen wie der Kaffee.
Taylor sah mich mit ernstem Gesicht an und ich wusste, was als Nächstes kommen würde. Ich hatte die Frage schon tausendmal gehört. Was mein Vater getan hatte, war kein Geheimnis, und natürlich waren die Leute neugierig.
Es gab zwei Varianten der Frage. Die erste lautete, wie es möglich war, dass ich nichts mitbekommen hatte. Wie konnte man mit einem Serienmörder unter demselben Dach zusammenleben, ohne etwas zu merken?
Die Antwort darauf war einfach. Mein Vater war intelligent und manipulativ und konnte andere für sich einnehmen. Anders als unser Feuermörder war er tatsächlich ein Psychopath wie aus dem Lehrbuch. Er unterrichtete Mathematik an einem College und war bei Studenten wie Kollegen beliebt. Er vermittelte so glaubhaft, dass er ein ganz normales Leben führte, dass niemand Verdacht schöpfte.
Die zweite Variante der Frage lautete: Wie war es, einen Serienmörder zum Vater zu haben? Darauf antworte ich in der Regel mit einer Gegenfrage. Wie ist es, wenn der eigene Vater Arzt ist, Steuerberater oder Müllmann? Die Gegenfrage wurde oft als unhöflich empfunden und das Gespräch war dann meist beendet. Hätte der Fragesteller über meine Erwiderung nachgedacht, hätte er bemerken können, dass ich seine Frage sehr wohl beantwortet hatte.
Abgesehen davon, dass mein Vater Frauen ermordete, war er ein ganz normaler Typ, der Mathe unterrichtete und zu Hause Frau und Kind hatte. Er verwendete viel Mühe auf sein Alltagsleben. Nichts an ihm fiel auf. Er hat meine Mutter und mich nie geschlagen oder misshandelt. Sein schlimmstes Verbrechen uns gegenüber bestand darin, dass er gelegentlich distanziert war oder autoritär, aber das waren Millionen anderer Väter auch.
Bevor das FBI über uns hereinbrach, waren wir eine durchschnittliche Familie. Einiges lief schlechter als bei anderen, aber wir waren andererseits besser dran als viele andere. Es gab Streit und Versöhnung, Urlaub und gute Zeiten. Auch viele schlechte. Manchmal war das Leben schön wie auf den Bildern von Norman Rockwell, manchmal ähnelte es der Hölle eines Hieronymus Bosch. Manchmal hassten wir einander, dann vertrugen wir uns wieder und gelegentlich liebten wir uns auch. Anders ausgedrückt, wir waren eine ganz normale Familie.
»Nur zu, fragen Sie«, sagte ich.
Taylor zögerte. Auch das machten sie alle. Er blickte durch das kleine Bullauge nach draußen in den blauweißen Dunst. Als er mich wieder ansah, war seine ernste Miene verschwunden.
»Wieso haben Sie diese weißen Haare?«
Ich lachte und schüttelte den Kopf und Taylor fragte: »Was ist denn?«, und wirkte wieder wie ein im Körper eines Riesen eingesperrter kleiner Junge. Unsicher und übermäßig defensiv.
»Nichts. Auf diese Frage war ich nur nicht gefasst.«
»Wenn Sie sie nicht beantworten wollen, verstehe ich das.«
Ich machte eine abwehrende Handbewegung. »Die weißen Haare sind genetisch bedingt. Mein Vater hatte schon mit Mitte zwanzig welche, mein Großvater auch. Ich war einundzwanzig.«
»Das habe ich nicht gemeint. Warum färben Sie sie nicht? Sie sind doch erst, hm, Anfang dreißig? Sie könnten das, ohne dass es albern wirkt.«
Darauf gab es ein Dutzend Antworten, alle mehr oder weniger wahr. Der eigentliche Grund hatte mit der Hinrichtungszelle in San Quentin zu tun. Die letzten Worte meines Vaters hatten mir gegolten. Er hatte mich durch die Plexiglasscheibe angesehen und stumm vier Worte geformt: Du bist wie ich. Ich wusste, dass er nur ein grausames Spiel mit mir treiben wollte. Aber ich würde mich selbst anlügen, wenn ich bestreiten wollte, dass diese Worte eine gewisse Wahrheit enthielten.
Dass ich meine Arbeit so gut mache, hat seinen Grund. Natürlich hat meine Ausbildung in Quantico dazu beigetragen, aber nur zu einem kleinen Teil. Ich weiß, wie Serientäter denken. Doch auch das trifft es noch nicht genau. Was ich tue, geht tiefer als bloßes Wissen. Ich verstehe sie. Ich kann mich in ihren Kopf hineinversetzen, in ihren Schuhen gehen, in ihrer Haut stecken. Etwas in meiner DNA ermöglicht mir, ganz nah an diese Monster heranzukommen, und dieses Etwas stammt ja von irgendwoher.
Das wollte ich Taylor allerdings jetzt nicht näher auseinandersetzen. Kurz zusammengefasst hätte ich sagen können, dass ich mir die Haare nicht färbte, weil mein Vater sie sich gefärbt hatte, aber auch das wollte ich nicht.
Ich antwortete mit einer Gegenfrage. »Warum ziehen Sie beim Gehen den Kopf zwischen die Schultern? Warum halten Sie die Finger an die Handballen gedrückt?«
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden.«
»Die meisten Menschen gehen in der Mitte der Straße, aber gelegentlich begegnet man Menschen am Rand. Den Außenseitern. Wir beide ähneln uns mehr, als Sie denken.«
Taylor lachte schnaubend. »Sicher. Sie sind der geniale Profiler, ich der unerfahrene Polizist. Da kann man schon leicht verwechselt werden. Von unserer Größe und Hautfarbe mal ganz abgesehen.«
»Ich sprach von ähnlich, nicht von identisch. Sie fallen auf, weil Sie ein Schrank von Mann sind. Ich falle auf, weil ich meine Arbeit gut mache und weil mein Vater fünfzehn Frauen ermordet hat. Ihre Art, damit umzugehen, ist sich kleiner zu machen. Deshalb ziehen Sie den Kopf zwischen die Schultern und verstecken Ihre Hände.«
»Und Sie gehen damit um, indem Sie ganz bewusst auffallen. Deshalb färben Sie sich die Haare nicht. Und deshalb ziehen Sie sich an wie das Mitglied einer Grunge-Band.«
Ich hob die Augenbrauen. »Wie bitte?«
»Sie wissen, was ich meine. Die Designer-Jeans, die abgewetzten Stiefel, das T-Shirt, die Lederjacke und die Haare.« Taylor grinste. »Sie sehen vielleicht aus, als wären Sie gerade aus einem Müllcontainer geklettert, aber ein solcher Look will sorgfältig kultiviert werden.«
Jetzt musste ich lachen.
»Okay«, fuhr Taylor fort, »ich habe noch eine Frage. Haben Sie eine Ahnung, wer der Täter ist?«
»Ich habe ein paar Ideen, aber nichts, worüber ich mit Ihnen reden will. Und bevor Sie fragen: Weil man einen Fall mit einem schlechten Profil ganz leicht vermasseln kann. Bevor ich etwas sage, müssen wir uns den Tatort ansehen.«
»Er muss jedenfalls ziemlich intelligent sein. Diese Website zu programmieren kann nicht einfach gewesen sein.«
»Taylor.«
Taylor ignorierte mich. »Wir suchen also jemanden, der mit Computern überdurchschnittlich gut umgehen kann. Ich könnte keine Website mit einem Countdown erstellen, ganz zu schweigen von diesem Galgenmännchen.«
»Meinen Sie wirklich, das ist ein Anhaltspunkt?«
Er nickte.
»Outsourcing«, sagte ich und er sah mich verwirrt an.
»In einem hatten Sie recht: Der Typ ist intelligent. Wie viele Menschen in Eagle Creek können so gut programmieren? Die Antwort lautet: wahrscheinlich keiner. Aber nehmen wir nur übungshalber an, es gäbe zwei oder drei. Wir lassen sie also kommen, verhören sie, bis einer zusammenbricht und gesteht, und der Fall ist abgeschlossen? Nein, wenn der Täter programmieren kann, hätte er das nicht so öffentlich gemacht. Dazu ist er zu schlau.«
»Und deshalb macht er, was alle machen«, sagte Taylor mit einem Seufzer. »Outsourcing. Er beauftragt irgendeinen Programmierer in Mumbai, auf den Philippinen oder in Thailand, ein kleines Programm für ihn zu schreiben. Der tut das für ein Butterbrot und wir könnten diese Spur ein Jahr lang verfolgen, ohne dass wir ihn finden. Okay, sagen Sie es ruhig: blöde Idee.«
Sein Gesicht erinnerte mich an einen Welpen, der ausgeschimpft wird, weil er das Sofakissen zerkaut hat.
»Seien Sie nicht so streng mit sich. Das Leben wäre viel einfacher, wenn der Täter ein größenwahnsinniges Computergenie wäre, eine Art Superman, aber so einfach ist es leider nie.«
Wem sagen Sie das, gab Taylor mir mit einem Augenrollen zu verstehen, einen Moment lang sah er viel älter aus. »Und wenn wir den Tatort nicht finden, Winter? Was dann?«
»Sie werden ihn finden. Unser Täter liebt dramatische Auftritte und ist ein Angeber. Er hält sich für schlauer als wir und will uns das auch zeigen.«
»Wir werden den Tatort also finden, weil er es will.«
»Genau. Was können Sie mir zu Sam Galloway sagen?«
»Nur das, was Sie schon in den Akten gelesen haben, die Sheriff Fortier Ihnen geschickt hat.«
Ich schüttelte den Kopf. »Das Problem mit Akten ist, dass der Mensch an sich faul ist. Wer einen Bericht schreibt, kürzt immer ab. Das macht jeder. Etwas aufzuschreiben braucht Zeit, und der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Verlassen Sie sich nie auf einen Bericht, okay?«
»Okay.«
»Sam Galloway.« Ich nickte aufmunternd.
»Eins achtundsiebzig groß, zweiundvierzig Jahre alt, schwarze, schon stark ergraute Haare –«
Ich simulierte wieder ein Gähnen. »Langweilig. Ich brauche nicht seine Hemdengröße, ich will wissen, wer er war. Was für ein Leben er führte, warum er morgens aufgestanden ist.«
»Er war Anwalt. Verheiratet seit zwanzig Jahren. Drei Kinder, ein Sohn und zwei Töchter.«
»Schon besser. Hatte er Feinde? Affären? Nehmen die Kinder Drogen?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Sie wissen es, weil in Eagle Creek weniger als zehntausend Menschen leben und Sam gerade ermordet wurde. Das heißt, im Moment kursieren alle möglichen Gerüchte.«
»Polizisten sollten sich an Fakten halten, nicht an Gerüchte.«
»Das klingt wie auswendig gelernt. Sagt Fortier das?«
Taylor nickte.
»Okay, vergessen Sie, was er sagt. Polizisten brauchen nicht nur Fakten, sondern Informationen. Fakten sind prima, aber Gerüchte können genauso nützlich sein.«
Taylor überlegte kurz, dann schüttelte er den Kopf. »Von Affären weiß ich nichts. Die Ehe lief gut. Bei den Kindern haben wir auch nichts gefunden. Sie sind zwischen zehn und fünfzehn Jahre alt und offenbar eher brav. Keine Drogen, keine Straftaten, keine Schwangerschaften. Und beruflich hat Galloway sich mit unspektakulären Fällen beschäftigt. Scheidungen, Testamente, Immobilien, in der Art. Er war kein Strafverteidiger oder so, der sich viele Feinde gemacht hätte.«
»Nur dass er doch einen Feind hatte.«
»Und wenn es ihn nur zufällig getroffen hat?«
»Es war kein Zufall. Der Mord wurde von einem bestens organisierten Serientäter begangen, der nichts dem Zufall überlässt.«
»Muss man als Serienmörder nicht mindestens drei Menschen getötet haben?«
»Das ist nur ein Aspekt. Glauben Sie mir, der Typ ist ein Serienmörder. Der Filmclip und der Countdown beweisen das. Nur ein Serienmörder betreibt diesen Aufwand. – Und wie wär’s, wenn wir uns jetzt ein bisschen amüsieren? Vielleicht schnallen Sie sich besser an.«
»Aber Sie sagten doch, Sicherheitsgurte würden nichts nützen«, meinte Taylor verwirrt.
»Nein, ich sagte, sie würden bei einem Absturz nichts nützen. Aber ich bin sicher, wir werden in nächster Zeit nicht abstürzen.«
Ich stand auf und ging nach vorn. Seit 9/11 ist in Passagierflugzeugen die Tür zum Cockpit der Piloten abgeschlossen. Aber wir saßen ja nicht in einem Passagierflugzeug. Hier galten andere Regeln. Die Reichen hatten andere Gesetze als die Armen. Ich klopfte an die Cockpittür und drückte sie auf.
Der Pilot war Ende fünfzig, und dass er früher in der Army gewesen war, sah man ihm sofort an. Misstrauisch musterte er mich über die Schulter, unsicher, ob ich Freund oder Feind war. Oder verrückt.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«
»Ich hoffe es. Wie wär’s, wenn Sie ab jetzt so fliegen, als gehörte das Flugzeug Ihnen?«
»Das geht nicht.«
»Natürlich geht das. Ich wette sogar, dass Sie jedes Mal, wenn Sie sich ins Cockpit setzen, genau davon träumen. Verglichen mit dem Fliegen von Kampfjets muss das hier doch stinklangweilig sein.«
»Woher wissen Sie, dass ich Kampfjets geflogen bin?«
»Nennen Sie es Intuition.«
Ich lächelte verschwörerisch. Der Pilot starrte mich an, dann breitete sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus.
Ich ging zu meinem Platz zurück, bat die Stewardess, sich anzuschnallen, tat das Gleiche und lächelte Taylor zu.
Der erste Looping verschlug mir den Atem.
5
Der Pilot überquerte Dayton Parish von Norden kommend im Tiefflug. Wir flogen auf einer Höhe von etwa tausend Metern, so dass ich einen guten Eindruck von der Landschaft bekam – Wälder und Seen und Farmen, Hügel, die niemand je für Berge gehalten hätte, und einige verstreute, durch gewundene Landstraßen verbundene Ortschaften. Viel Platz und nicht besonders viele Menschen.
Jeder Bundesstaat will einzigartig sein, aber einige sind es mit größerem Recht als andere, und das gilt für Louisiana wie für nur wenige andere. Man trägt die eigenen Besonderheiten dort wie Ehrenzeichen vor sich her. Zum einen ist Louisiana als einziger Staat in Parishes unterteilt statt in Countys. Der Staat entstand aus spanischen und französischen Kolonien und die Aufteilung in »Gemeinden« spiegelt diese katholischen Wurzeln. Der französische und spanische Einfluss macht sich auch in der Architektur und beim Essen bemerkbar und in hundert anderen großen und kleinen Dingen, die Louisiana von den anderen neunundvierzig US-Staaten unterscheiden.
An Dayton fiel mir als Erstes auf, dass das Sumpfland fehlte. Bei Louisiana denkt man immer gleich an Sümpfe und Alligatoren, an Cajun-Essen und an Karneval, weniger an Landwirtschaft. Aber genau die sah ich unter uns, ein Flickwerk von Feldern in verschiedenen Grün- und Brauntönen und dazwischen Farmen.
Dayton lag sechzig Meter über dem Meeresspiegel, New Orleans dagegen sogar teilweise zwei Meter darunter, und diese einfache Tatsache trennte den Norden vom Süden. Wir hätten genauso gut in einem ganz anderen Staat sein können als dem Louisiana, das alle zu kennen glaubten.
Eagle Creek lag am unteren Rand von Dayton, sechzehn Kilometer nördlich der Interstate 20, die den Norden Louisianas von Osten nach Westen durchquert. Die kleine Stadt war angelegt wie Tausende ähnlicher Ortschaften. Am Rand, wo die Grundstücke billig waren, lagen Büros, Fabriken und ein Einkaufszentrum. Näher zum Zentrum dann Wohnungen und Häuser, Schulen, ein Park und ein Baseballplatz für Kinder und Jugendliche.
Südlich der Interstate breitete sich eine aufgelassene Erdölraffinerie aus. Grauer Beton, verbrannte Erde und tonnenweise Stahl. Die Raffinerie mit ihrem Gewirr von Röhren, Tanks und Schornsteinen flimmerte in der sommerlichen Hitze.
Die größeren Villen lagen inmitten gepflegter Grünanlagen im Nordwesten. Die Autobahn konnte man dort nicht hören, die alte Raffinerie nicht sehen und zum Golfplatz war es auch nicht weit.
Wir drehten scharf nach rechts ab und begannen den Landeanflug auf den kleinen Flugplatz von Eagle Creek. Einige Augenblicke lang flogen wir so tief über die Felder, dass man sie fast mit der Hand hätte berühren können. Es kam dieser Moment, in dem man nur hoffte, dass der Pilot wusste, was er tat, dann erschien aus dem Nichts die Landebahn. Wir setzten auf und die Schubumkehr der Triebwerke bremste uns ab.
Es war fast drei Uhr nachmittags. Der Flug von Charleston nach Eagle Creek hatte genau zwei Stunden gedauert. Vor meinem geistigen Auge sah ich die weißen Ziffern auf schwarzem Grund des auf null zurückzählenden Countdowns. 09:06:34.
Als wir ausstiegen, traf mich die Hitze wie ein Schlag ins Gesicht, als wäre ich in den Tropen gelandet. Die Luft roch auch genau so, nach Kerosin und sonnendurchtränkter Vegetation.
Ich stieg auf der Beifahrerseite in den Streifenwagen, der neben dem Hangar geparkt war, Taylor zwängte sich hinter das Steuer. Die Trennwand nach hinten war herausgenommen worden und sein Sitz so weit wie möglich zurückgeschoben, aber es sah trotzdem so aus, als säße er in einem Spielzeugauto.
»Sue«, sagte ich. »Sie sind der Junge namens Sue.«
»Wovon reden Sie?«
»Das ist ein Song von Johnny Cash.«
»Meine Eltern stehen mehr auf Motown.«
»Dann vielleicht Marvin? Wie Marvin Gaye. Marvin Taylor? Klingt irgendwie gut.«
Taylor lachte und ließ den Motor an. Helles Sonnenlicht durchflutete den Wagen und ich setzte meine Sonnenbrille auf.
»Geben Sie lieber gleich auf, Winter. Sie kommen da nie drauf.«
»Das klingt nach einer Herausforderung.«
»Keine Herausforderung, eine Tatsache.«
»Und Sie wären bereit, Ihren Worten Taten folgen zu lassen? Wie wär’s mit einer Wette über fünfzig Dollar?«
»Fünfzig? Machen wir es doch ein bisschen interessanter. Wie wär’s mit zweihundert?«
»Sind Sie sicher, dass Sie sich das von Ihrem Anfängergehalt leisten können?«
Taylor lachte tief und dröhnend. »Diese Wette verliere ich auf keinen Fall.«
»Abgemacht. Wenn ich Ihren Vornamen nicht bis zu meiner Abreise herausgefunden habe, zahle ich Ihnen mit Vergnügen zweihundert Dollar.«
Ich streckte die Hand aus und Taylor nahm sie. Wieder verschwand meine Hand in seiner sanften Pranke.
»Sie können mir die zweihundert Dollar auch gleich zahlen, Winter. Dann sparen Sie sich die Mühe.«
Ich lächelte und lehnte mich zurück. Die Sonne schien durch die Windschutzscheibe und wärmte mein Gesicht. »Das Gleiche wollte ich auch gerade zu Ihnen sagen.«
6
Fünf Minuten nach Verlassen des Flugplatzes bogen wir auf die Main Street ein. Wir kamen von Süden und mein Fahrer hielt die Geschwindigkeitsbegrenzung exakt ein. Das erste größere Gebäude, das ich sah, war eine Kirche. An der Plakatwand daneben hing ein riesiges Plakat, auf dem in einen Meter hohen, blutroten Buchstaben stand: JESUSISTFÜRDICHGESTORBEN! WÜRDESTDUFÜRIHNSTERBEN?
So tief in der südlichen Ödnis grassierte die Armut. Kleine Ortschaften lagen buchstäblich im Sterben, geradezu als hätte die Pest zugeschlagen. Man sah überall verlassene, baufällige Häuser, und zugenagelte Läden waren die Regel, nicht die Ausnahme. Viele Gebäude waren heruntergekommen und hatten ungepflasterte Höfe und verrostete Maschendrahtzäune.
Nicht so in Eagle Creek. Wohin man blickte, leuchteten frisch gestrichene Mauern und glänzten gut geputzte Fenster. Die Straße war so glatt, als wäre sie erst in der vergangenen Woche neu geteert worden.
Die Häuser um den Park in der Ortsmitte flimmerten in der Nachmittagshitze. Im Gegensatz zu der niedrigen zweistöckigen Bebauung der restlichen Main Street standen hier große, wichtig aussehende graue und weiße Gebäude. Gericht, Rathaus und Bücherei.
In der Mitte der Parks stand die aus weißem Stein gehauene Statue eines streng dreinblickenden Mannes. Daneben hing an einem Fahnenmast das Sternenbanner. Die Fahne klebte schlaff an der Stange, denn kein Lüftchen rührte sich. Das Rot, Weiß und Blau leuchtete so grell, dass es in den Augen wehtat. Der gepflegte Rasen hatte Golfplatzqualität.
Das Sheriff’s Department war in einem größeren Gebäude am nördlichen Ende der Main Street untergebracht. Taylor fuhr auf den Hof dahinter und parkte rückwärts neben anderen Polizeifahrzeugen ein. Links von uns standen vier Autos, rechts fünf, Limousinen und Geländewagen, von denen das älteste vielleicht zwei Jahre alt war. In den Fuhrpark waren offenbar in jüngster Zeit mehrere hunderttausend Dollar investiert worden.
Beim Aussteigen schlug mir heiße Luft wie aus einem Hochofen entgegen. Es war Nachmittag und das Thermometer zeigte bestimmt an die vierzig Grad. Die Hitze war wie eine Wand, gegen die man prallte und die einem die Luft nahm. Bereits beim Überqueren des Parkplatzes brach mir der Schweiß aus und die Luftfeuchtigkeit gab einem den Rest.
Taylor führte mich durch ein Labyrinth von Gängen zu einer Tür mit einer Rauchglasscheibe, auf der in goldenen Lettern SHERIFFPETERFORTIER stand. Er klopfte kurz und eine Stimme auf der anderen Seite rief uns hinein.
Fortiers Büro war wie das übrige Revier in makellosem Zustand. Beherrscht wurde es von einem aufgeräumten Schreibtisch aus Eiche mit einem großen Ledersessel. Die Menge der Post in Ein- und Ausgangskorb sah übersichtlich aus. Die weiß getünchten Wände waren tatsächlich weiß, die Neonröhren erst vor kurzem gereinigt worden.
An einer Wand hingen Bilder von Booten und Fischen. Auf allen war Fortier abgebildet. Er trug eine zerknautschte blaue Mütze, auf deren Vorderseite ein roter Anker eingestickt war, und stand am Steuerrad. Oder er präsentierte den Fang des Tages, wieder mit derselben Mütze. Der lächelnde, gebräunte Fischer unterschied sich beträchtlich von dem Mann mit grimmigem Gesicht hinter dem Schreibtisch.
Er kam mir mit ausgestrecktem Arm um den Schreibtisch entgegen und gab mir die Hand. Seine fühlte sich an wie ein Schraubstock. Er musterte mich, allerdings bemüht, es nicht zu auffällig zu tun. Ich war es gewohnt, angestarrt zu werden, deshalb störte es mich nicht weiter.
Während Fortier mich betrachtete, machte ich mir ein Bild von ihm. Er war Mitte fünfzig und seine Uniform war so makellos wie sein Büro. Bügelfalten an den richtigen Stellen, die Schuhe blitzblank gewienert.
Allerdings wirkte er müde, geradezu erschöpft, bar jeglicher Energie. Vermutlich würde er bei der nächsten Wahl nicht mehr als Sheriff kandidieren. Wenn er diese Entscheidung nicht schon länger getroffen hatte, hatte der Mord an Sam Galloway den Ausschlag gegeben. Der Mann vor mir sehnte sich danach, der Mühsal der wirklichen Welt den Rücken zu kehren. Wahrscheinlich starrte er tagsüber die Bilder an der Wand seines Büros an und träumte davon, seine restlichen Jahre mit Fischen und Bourbontrinken zu verbringen.
»Danke, dass Sie so kurzfristig gekommen sind«, sagte er.
»Gern geschehen.«
»Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass Sie überhaupt dazu bereit waren. Ich weiß, dass Sie sonst nur bei Serienmördern ermitteln und unser Mann ist kein Serienmörder. Aber ich habe Ihre Arbeit in South Carolina verfolgt, und da Charleston mit dem Flugzeug nicht weit weg ist, dachte ich mir, was soll’s, einen Versuch ist es wert. Wenn Sie uns also irgendwie helfen können – wir sind für jede Anregung dankbar. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie es einfach.«
Die Worte klangen einstudiert, als hätte er sie den ganzen Vormittag über geübt. »Serientäter«, sagte ich.
»Verzeihung?«
»Serientäter. Ich befasse mich mit allen. Entführern, Vergewaltigern, Brandstiftern, Erpressern und Mördern. Und ich sage es nur ungern, aber unser Mann ist tatsächlich ein Serienmörder.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Wegen der Art und Weise, wie der Mord an Sam Galloway inszeniert wurde. Hier eine Frage an Sie: Was, glauben Sie, wird passieren, wenn der Countdown abgelaufen ist?« Sein Blick sagte mir, dass er darüber bereits nachgedacht hatte und zum selben Schluss gekommen war wie ich. »Wenn Sie den Kerl nicht schnappen, und zwar schnell, wird er immer wieder töten. Er wird es wieder tun, bis jemand ihn stoppt. Glauben Sie mir, er hat eben erst angefangen.«
»Es handelt sich Ihrer Meinung nach also nicht um eine einmalige Tat?«
»Auf keinen Fall.«
Fortier schien förmlich zu schrumpfen. Er hatte ganz offensichtlich auf eine andere Antwort gehofft. Trotzdem schien er nicht übermäßig überrascht. Sein Leben würde in der nächsten Zeit nicht leichter werden. Ein Mord war schon schlimm genug, aber eine ganze Serie ein Albtraum.
»Wie steht es mit der Presse?«, fragte ich.
»An dieser Front ist alles ruhig. Es gibt in der Stadt eine Wochenzeitung, den Eagle Creek Courier. Er ist mehr oder weniger eine Einmannshow. Harry Spindler, der Typ, der ihn herausgibt, trinkt lieber, als dass er schreibt. Die nächste Ausgabe erscheint erst kommende Woche. Solange Harry bis dahin eine Schlagzeile für die Titelseite hat, macht er uns keine Schwierigkeiten.«
»Und außerhalb von Eagle Creek?«
»Die nächsten Großstädte sind Shreveport und Monroe. In Eagle Creek ist nicht viel los, die Reporter würden wahrscheinlich nicht einmal den Weg zu uns finden.«
»Aber jetzt ist schon etwas los.«
»Ich werde schon mit ihnen fertig, wenn sie kommen.«
Das bezweifelte ich nicht. Meiner Erfahrung nach war der typische Sheriff zu fünf Prozent Polizist und zu fünfundneunzig Politiker. Fortier mochte jetzt einen Durchhänger haben, er schien aber lange genug im Geschäft zu sein, um uns die Presse ohne allzu große Anstrengung vom Leib halten zu können.
»Es wäre gut, wenn wir den Fall so lange wie möglich aus den Schlagzeilen heraushalten könnten«, sagte ich. »Unser Mann sucht nach einem Publikum. Wenn er das nicht bekommt, lässt er sich vielleicht zu einer Dummheit verleiten, um auf sich aufmerksam zu machen. Und je größer die Dummheit, desto leichter schnappen wir ihn.«
Fortier lächelte und einen kurzen Moment lang sah ich den Mann, der er vor dreißig Jahren gewesen war, einen Mann mit Ehrgeiz und Träumen, die nicht am nächsten Flussufer endeten.
»Ich werde tun, was ich kann.«
»Dasselbe gilt für die Website. Auch davon sollte möglichst niemand erfahren. Der Täter will damit Aufmerksamkeit erregen. Wer weiß davon?«
Das Lächeln erlosch und der alte Mann, der von Fischen und Bourbon träumte, kehrte zurück. »Zu viele. Hier im Department wissen es alle und natürlich habe ich den Chef der städtischen Polizei unterrichtet. Und den Bürgermeister, er musste es wissen.«
»Dann sorgen Sie für Schadensbegrenzung. Weisen Sie die anderen an, möglichst wenig darüber zu sprechen. Es nützt wahrscheinlich nichts, aber man weiß nie.«
»Pferde und offene Stalltüren.« Fortier schüttelte den Kopf. »Ich hätte daran denken sollen.«
»Immerhin campieren keine Presseleute auf Ihrem Parkplatz. Das zeigt, dass sie von der Website noch nichts mitgekriegt haben. Auf die werden sie sich begieriger stürzen als auf einen toten Anwalt, darauf können Sie wetten. Wer weiß, vielleicht können Sie ja den Deckel draufhalten.« Ich überlegte kurz und fügte hinzu: »Dumme Frage, aber in der Stadt weiß inzwischen wahrscheinlich jeder von Sam Galloways Ermordung?«
Fortier lachte schnaubend. »Was glauben Sie denn?«
»Es wäre ein Wunder, wenn es in einer so kleinen Stadt anders wäre, und ich glaube nicht so recht an Wunder.«
»Wir haben noch nicht über Ihr Honorar gesprochen.«
»Keine Sorge, ich verlange das, was sich die Leute nach meiner Einschätzung leisten können. Mich interessiert der Fall mehr als das Geld. Ich verspreche Ihnen, ich werde Sie nicht in den Bankrott treiben.«
Fortier grinste. »Versuchen Sie das mal.«
»Was heißt das?«
Der Sheriff wischte die Frage mit einer Handbewegung beiseite. »Schicken Sie einfach die Rechnung, wenn Sie fertig sind. Und vergessen Sie nicht die Spesen. Sie wollen sich wahrscheinlich erst noch auf den neuesten Stand bringen, bevor Sie ein Profil erstellen.«
Ich warf Taylor einen Blick zu, wartete, bis er ihn erwiderte, und sagte dann: »Das hat Officer Taylor bereits im Flugzeug getan. Wenn Sie wollen, bekommen Sie Ihr Profil gleich.«
7
Sheriff Fortier führte uns einen Gang entlang und blieb vor einer Tür stehen, auf deren Rauchglasscheibe in goldenen Buchstaben CAPTAINANTHONYSHEPHERD, KRIMINALABTEILUNG