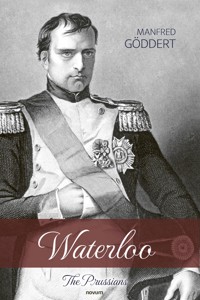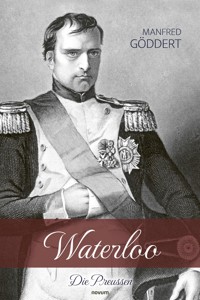
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Um die Schlacht bei Waterloo am 18. Juni 1815 ranken sich zahlreiche Mythen, handelt es sich doch mit größter Wahrscheinlichkeit um die letzte Schlacht Napoleon Bonapartes. Die Schlacht wurde vermutlich deshalb so berühmt, weil sie den Untergang Napoleons besiegelte und zum Tod tausender Soldaten führte. Eben erst – im März 1815 – aus der Verbannung auf Elba zurückgekehrt, endete die zweite Regierungszeit Napoleons mit der Niederlage bei Waterloo und seiner Verbannung auf die Südseeinsel St. Helena, wo er 1821 verstarb. Doch was geschah an diesem 18. Juni 1815 wirklich? Der Autor liefert einen präzisen Überblick über den Ablauf dieses historischen Tages und der Tage davor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0532-0
ISBN e-book: 978-3-7116-0533-7
Lektorat:Leon Haußmann
Umschlagabbildung: Georgios Kollidas | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Manfred Göddert
www.novumverlag.com
18. Juni 1815
„Ob er nun fürchtete, sich selbst oder seiner Armee dadurch etwas zu vergeben – ich weiß es nicht, indeß er (Wellington) hatte in seinem vorläufigen Berichte nach England die Schlacht wahrscheinlich bereits
„Schlacht bei Waterloo“
genannt, denn er war gewohnt, seine in Indien und Spanien gewonnenen Schlachten nach seinem Hauptquartiere zu benennen.“
Müffling, Aus seinem Leben.
„An mein Volk!“
„Als ich in der Zeit der Gefahr mein Volk zu den Waffen rief, um für die Freiheit und Selbstständigkeit des Vaterlandes zu kämpfen, da zog die gesamte Jugend wetteifernd zu den Fahnen, um mit freudiger Entsagung ungewohnte Beschwerden zu ertragen und entschlossen selbst dem Tode entgegenzugehen; da trat die Kraft des Volkes unerschrocken in die Reihen Meiner tapferen Soldaten und Meiner Feldherren führten mit Mir ein Heer von Helden in die Schlacht, die des Namens ihrer Väter, als Erben ihres Ruhmes sich würdig erwiesen. So eroberten wir und unsere Verbündeten, von Siegen begleitet, die Hauptstadt des Feindes; unsere Fahnen weheten in Paris, Napoleon entsagte der Herrschaft; dem deutschen Vaterlande war Freiheit, den Thronen Sicherheit und der Welt die Hoffnung eines dauerhaften Friedens gegeben.
Diese Hoffnung ist verschwunden, wir müssen von Neuem in den Kampf. Den Mann, der zehn Jahre hindurch unsägliches Elend über die Völker verbreitet, hat eine verräterische Verschwörung nach Frankreich zurückgeführt. Das bestürzte Volk hat seinen bewaffneten Anhängern nicht widerstehen können; seine Thronentsagung, obwohl er selbst noch im Besitz einer beträchtlichen Heeresmacht, sie für ein freiwilliges, dem Glück und der Ruhe Frankreichs dargebrachtes Opfer erklärt hatte, achtet er, wie jeden Vertrag, für nichts; er steht an der Spitze eidbrüchig gewordener Soldaten, die den Krieg verewigen wollen; Europa ist von Neuem bedroht, es kann den Mann auf Frankreichs Thron nicht dulden, der die Weltherrschaft als den Zweck seiner stets erneuerten Kriege laut verkündete, der die sittliche Welt durch fortgesetzte Wortbrüchigkeit zerstörte und deshalb für eine friedliche Gesinnung keine Bürgschaft bieten kann.
Von Neuem also in den Kampf! Frankreich selbst bedarf unserer Hülfe und ganz Europa ist mit uns verbündet. Mit Euern alten Siegesgefährten verbunden, durch neue Waffenbrüder verstärkt, geht ihr, brave Preußen mit Mir, mit den Prinzen Meines Hauses, mit den Feldherren, die Euch zu Siegen geführt, in einen nothwendigen, gerechten Krieg. Die Gerechtigkeit der Sache, die wir verfechten, sichert uns den Sieg …
Wien, 07. April, Friedrich-Wilhelm König von Preußen
Blücher
Napoleon über Blücher:
„Blücher ist ein sehr braver Soldat, ein bon sabreur, ein tüchtiger Säbler. Er ist wie der Stier, der die Augen schließt und, da er keine Gefahr sieht, losstürmt. Er beging ungezählte Fehler; hätten sich nicht Umstände ins Mittel gelegt, ich hätte ihn und den größten Teil seiner Armee verschiedene Male gefangen nehmen können. Blücher ist störrisch und zähe, nicht zu ermüden, er fürchtet sich vor Nichts, er hängt mit großer Liebe an seinem Vaterlande, ein talentvoller General ist er nicht. Ich erinnere mich, dass, als ich in Preußen war, er, nachdem er sich ergeben hatte, mein Tischgast war; er wurde von meiner Umgebung für einen gewöhnlichen Menschen gehalten.“
Barry E. O’Meara, St. Helena, 09. November 1816
Gerhard Leberecht, Fürst Blücher von Wahlstadt, wurde 1742 in Rostock geboren. Mit 15 Jahren trat er in das schwedische Husarenregiment Sparre ein. 1760 erfolgte sein Übertritt in die preußische Armee. Nachdem er sich 1770 in seiner Beförderung übergangen fühlte und Protest beim König einlegte, wurde er neun Monate inhaftiert. Erst 1787 wurde er von Friedrich-Wilhelm II. wieder als Major eingestellt. 1791 wird er Oberst und 1794 zum Generalmajor ernannt. Er starb am 12. September 1817 bei Krieblowitz in Schlesien.
Nach Aussage von Müffling missfiel dem General von Kleist die derbe, oft rohe Außenseite nebst den leichtfertigen Gesprächen Blüchers, die ihn stets in Verlegenheit setzten, oft erröten machten.
Blücher wusste, dass er ein Mann des Volkes war. In seinen Reden ging es um Vaterlandsliebe und Befreiung vom Druck des Tyrannen. Er hatte sich daran gewöhnt, bei größeren Versammlungen öffentlich zu sprechen. Dabei hielt er seine Reden mit so viel Nachdruck, dass sie ihre Wirkung nie verfehlten. Nach dem Sieg über die Franzosen erhielt er von dem englischen König eine Einladung zu einem Besuch nach England. Dort machte er den gleichen positiven Eindruck auf die Massen.
Aber was sagt Müffling weiter:
„Aber wie war es mit Blücher wirklich? Es war in ganz Europa kein Geheimnis geblieben, dass der alte Fürst Blücher, mittlerweile über siebzig Jahre alt, von der Kriegsführung gar nichts verstand. So wenig, dass wenn ihm ein Plan zur Genehmigung vorgelegt wurde, selbst wenn es eine unbedeutende Operation betraf, er sich kein klares Bild davon machen und kein Urteil darüber fällen konnte, ob er gut oder schlecht war.
Dieser Umstand bedingte, dass ein Mann an seine Seite gestellt wurde, zu dem er Vertrauen hatte und dem die Neigung und das Geschick beiwohnte, es zum allgemeinen Wohl zu nutzen. Als einen solchen hatte sich Gneisenau während zwei Feldzügen bewährt, und da Blücher durch diese beiden Feldzüge gerade seinen europäischen Ruf erlangt hatte, so war kein Grund vorhanden, ihm dasKommando über die preußische Armee nicht eben so, wie in den beiden vergangenen Jahren, zu übergeben.
Allein, je mehr es bekannt geworden war, dass Gneisenau die Armee kommandierte, und Blücher nur in der Schlacht als der Tapferste, bei Anstrengungen als der Unermüdlichste, das Beispiel gab und durch feurige Anreden zu begeistern verstand, je mehr brach die Unzufriedenheit der vier Generale (Bülow, Kleist, York, Tauentzien) hervor, welche 1814 Armee-Corps geführt hatten und älter in ihren Patenten waren, als Gneisenau.
Es darf jedoch auch hier nicht übergangen werden, dass zwischen diesen Generalen und Gneisenau eine gegenseitige Abneigung aus den Jahren 1811 und 1812 bestand, welche die Generale von dem Knesebeck, Borstell mit den meisten höheren Offizieren der Armee teilten. Gneisenau, Boyen Grolmann wurden als die tätigsten Mitglieder des Tugendbundes bezeichnet, der sehr antiroyalistischer Tendenzen beschuldigt wurde. Gneisenau, der seine Gegner genau kannte, hatte das System angenommen, ihnen offen und mit großer Energie entgegenzutreten. Führte ihn der Dienst in ihre Nähe, so war er kalt abgeschlossen, und man erkannte die Absicht abzustoßen, was ihm denn auch reichlich erwidert wurde.“
Soweit Müffling.
Um weitere Schwierigkeiten zu verhindern, wurden die drei ersten Corps unter die Befehle von Zieten, Borstell und Thilemann versetzt. Diese drei Generale waren jünger als Gneisenau. Das vierte, als Reserve in die Rhein-Provinzen bestimmt, stand unter den Befehl von Bülow. Man ging hier davon aus, dass dieses Corps nicht zum Kampfeinsatz kommen würde. Tauentzien, York und Kleist erhielten andere ehrenvolle Bestimmungen.
Die Tatsache, dass Borstell nicht mehr als Corps-Kommandeur in Erscheinung trat, lag daran, dass er von Blücher suspendiert wurde. Anlass war, das Borstell den Auftrag zur Bestrafung des sächsischen Garde-Bataillons, welches in Lüttich revoltiert hatte, nicht in der Form wie verlangt nachgekommen war. Laut Auftrag sollte die Bataillonsfahne, gestickt von der sächsischen Königin, verbrannt werden. Seinen Posten erhielt General von Pirch II. Borstell wurde zu Festungshaft verurteilt.
Nach dem Gefecht bei Lübeck, 1806, kam Blücher in französische Gefangenschaft. Diese verbrachte er unter der Aufsicht von Bourrienne in Hamburg. Was sagte dieser über Blücher? Dazu aus dessen Memoiren:
Blücher schien mir einer der Männer zu sein, die man gern genauer näher kennen lernt, daher sah ich ihn oft. Ich fand, dass er ein übertriebener preußischer Patriot, übrigens tapfer, kühn bis zur Verwegenheit unternehmend war; im Unterricht war er in seiner Jugend vernachlässigt worden, hatte eine unersättliche Lust, sich zu vergnügen, auch schonte er seine Gesundheit, solange er in Hamburg war, keinesweges. Er saß gern lange Zeit an der Tafel, und bei aller seiner Vaterlandsliebe ließ er Frankreichs Weinen volle und häufige Gerechtigkeit widerfahren. Seine Leidenschaft für die Weiber war höchst unmäßig, auch konnte er keinen angenehmeren Zeitvertreib, als beim Pharaospiel während mehrerer Stunden Gold zu empfangen oder auszugeben.
Blücher war ein Mann von einem fröhlichen Charakter, und bloß als Gesellschafter betrachtet, sehr liebenswürdig. Seine originelle Umgangssprache gefiel mir ungemein. Er war von der künftigen Befreiung Deutschlands so vollkommen überzeugt, dass alles Unglück der preußischen Armee diesen seinen Glauben nicht erschütterte.
Gneisenau
Der Taktiker – zuständig für die Ausführung.
August Wilhelm Anton Neidhardt Graf von Gneisenau, geboren am 27. Oktober 1760 in Schilda, vor der Schlacht von Torgau, als der Sohn eines sächsischen Artillerieleutnants von Neidhartd, aus alter österreichischer Familie. 1779 erfolgte sein Eintritt in das Österreichische Husarenregiment Wurmser. Schon im gleichen Jahr musste er die österreichische Armee wegen eines Duells wieder verlassen. 1782 wurde er Offizier in Diensten des Markgrafen Alexander von Bayreuth-Ansbach. Noch im selben Jahr ging er mit seinem Regiment infolge des Soldatenhandels in englischem Sold nach Amerika und kämpfte gegen die aufständischen Kolonien.
1786 erfolgte seine Übernahme in das Heer Friedrichs des Großen. 1806 kämpfte er bei Saalfeld. 1807 wurde er zum Kommandant in Kolberg an der Ostsee ernannt. Er hielt die schwer bedrängte Festung drei Monate, bis zum Abschluss des Friedens von Tilsit.
Aus Anerkennung wurde er zum Oberstleutnant befördert und mit dem Orden „Pour le mérite“ ausgezeichnet. 1807 wurde er vom König in die Militär-Reorganisations-Kommission berufen. Mit Stein und Scharnhorst arbeitete er an der Wiedererneuerung des preußischen Staates. 1809 wurde er zum Oberst befördert und zum Inspektor aller Festungen und Chef des Ingenieurkorps ernannt. Nach der Entlassung von Stein trat er 1809 aus der preußischen Armee aus und bereiste Österreich, Russland und England.
1813, zu Beginn des Befreiungskrieges, kehrte er zurück. Er wurde General-Quartiermeister und nach dem Tod von Scharnhorst Generalstabschef des Schlesischen Heeres. Als solcher wusste er Blüchers stürmische Initiative meisterhaft zu leiten. Der Marsch des Schlesischen Heeres vom Schlachtfeld von Ligny 1815 auf das von Waterloo, zur Unterstützung von Wellington, ist sein Verdienst.
Gneisenau hat niemals selbstständig ein Heer geführt, dennoch war er ein großer Feldherr. Bereits 1816 zog er sich ins Privatleben zurück. Als 1831 der polnische Aufstand ausbrach, wurde er zurückgerufen. Hier erlag er am 24. August 1831, als Oberbefehlshaber von vier Armeekorps in Posen, der Cholera.
Der Feldzug von 1815 im Überblick
Stärke der preußischen Armee am 15. Juni
Siehe genaue Aufstellung
Stärke der französischen Armee am 15. Juni:
89.400
Mann Infanterie
22.300
Mann Kavallerie
12.300
Mann Artillerie
124.000
Mann mit 344 Geschützen
Stärke der englischen Armee am 15. Juni:
70.700
Mann Infanterie
16.000
Mann Kavallerie
8.700
Mann Artillerie
95.400
Mann mit 186 Geschützen
Verlauf des Feldzuges:
15. Juni
4.00 Uhr Die preußischen Vorposten in Thuin werden vom franz. Korps Reille zurückgedrängt. Erste Verluste der Preußen. Rückzug über Marchienne, Dampremy auf Gilly zu.
8.00 Uhr Die Division Domon vom franz. Korps Vandamme greift die Preußen bei Charleroi an. Am Mittag rückt die Junge Garde in Charleroi ein. Die Preußen, die zur Brigade Pirch II vom Ziethenschen Korps gehören, ziehen sich in Richtung Fleurus, ihrem Sammelpunkt, zurück.
17.00 Uhr Das franz. Korps Reille trifft bei Gosselies auf die Brigade Steinmetz. Nach einem kurzen Geplänkel ziehen sich die Preußen zurück. Die Brigade Pirch II, die sich bei Gilly verschanzt hat, wird von starken französischen Verbänden unter Grouchy geworfen und zum Teil niedergehauen. Rückzug über Lambusart nach Fleurus. Die Verluste der Preußen vom 15. Juni betrugen etwa 1.200 Mann.
Bewegungen der anderen preußischen Korps: Auf Befehl Blüchers rückten die Korps Pirch I und Thielemann auf Sombreffe vor, um sich hier zu sammeln. Blücher hatte hier sein Hauptquartier aufgeschlagen. Bülow hatte am Abend sein Hauptquartier noch in Lüttich. Eine plausible Erklärung dafür gab es nicht.
20.00 Uhr Wellington befiehlt seinen Truppen, sich zu vereinigen und zum sofortigen Abmarsch bereitzuhalten.
23.00 Uhr Wellington erteilt seinen Truppen den Befehl, ihre vorgesehenen Bereitstellungsräume einzunehmen.
16. Juni
8.00 Uhr Napoleon erteilt die neuen Marschbefehle. Ney soll auf Quatre-Bras vorrücken, während er selbst mit Grouchy auf Sombreffe vorrückt.
10.00 Uhr Wellington trifft mit seinem Stab in Quatre-Bras ein. Die Franzosen besetzen Fleurus.
13.00 Uhr Wellington trifft Blücher bei der Mühle von Bussy nahe Ligny. Hier gibt er das Versprechen, dass er die Preußen im Kampf gegen die Franzosen unterstützen werde. Auf dieses Versprechen hin nimmt Blücher die Schlacht von Ligny an.
14.30 Uhr Der Angriff von 68.000 Franzosen (13.000 Reiter und 210 Geschütze) gegen 87.000 Preußen (8.500 Reiter und 224 Geschütze) beginnt. Die erste Angriffsrichtung der Franzosen ist St. Armand.
15.00 Uhr Der französische Angriff in Richtung Ligny beginnt. Es entbrennt auf der ganzen Linie ein mörderischer Häuser- und Straßenkampf.
18.30 Uhr Das Armeekorps Erlon (ca. 20.000 Mann) trifft auf dem Schlachtfeld ein. Die Möglichkeit, mit frischen Truppen den rechten preußischen Flügel aufzurollen, wird von Napoleon nicht genutzt. Das Korps Erlon kommt an diesem Tag nicht mehr zum Einsatz.
20.30 Uhr Die Alte Garde und die Garde-Reiterei, auf Befehl Napoleons zum Angriff vorgehend, erreichen Ligny. Mit ihrer Angriffswucht werden die preußischen Stellungen, die auf keine Reserven mehr zurückgreifen können, gesprengt.
21.00 Uhr Eine preußische Attacke gegen die vordringenden Franzosen scheitert. Blücher wird unter seinem erschossenen Pferd begraben. Sein Adjudant Nostitz rettet ihn vor den Franzosen.
21.30 Uhr Die Franzosen beziehen Stellung zwischen Brye und Sombreffe. Auf eine nächtliche Verfolgung der geschlagenen Preußen verzichtet Napoleon.