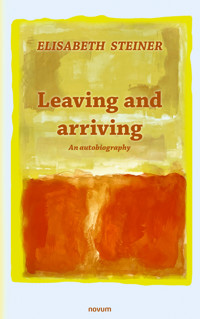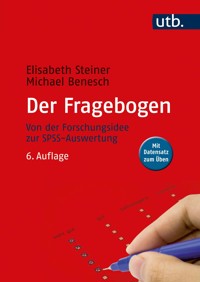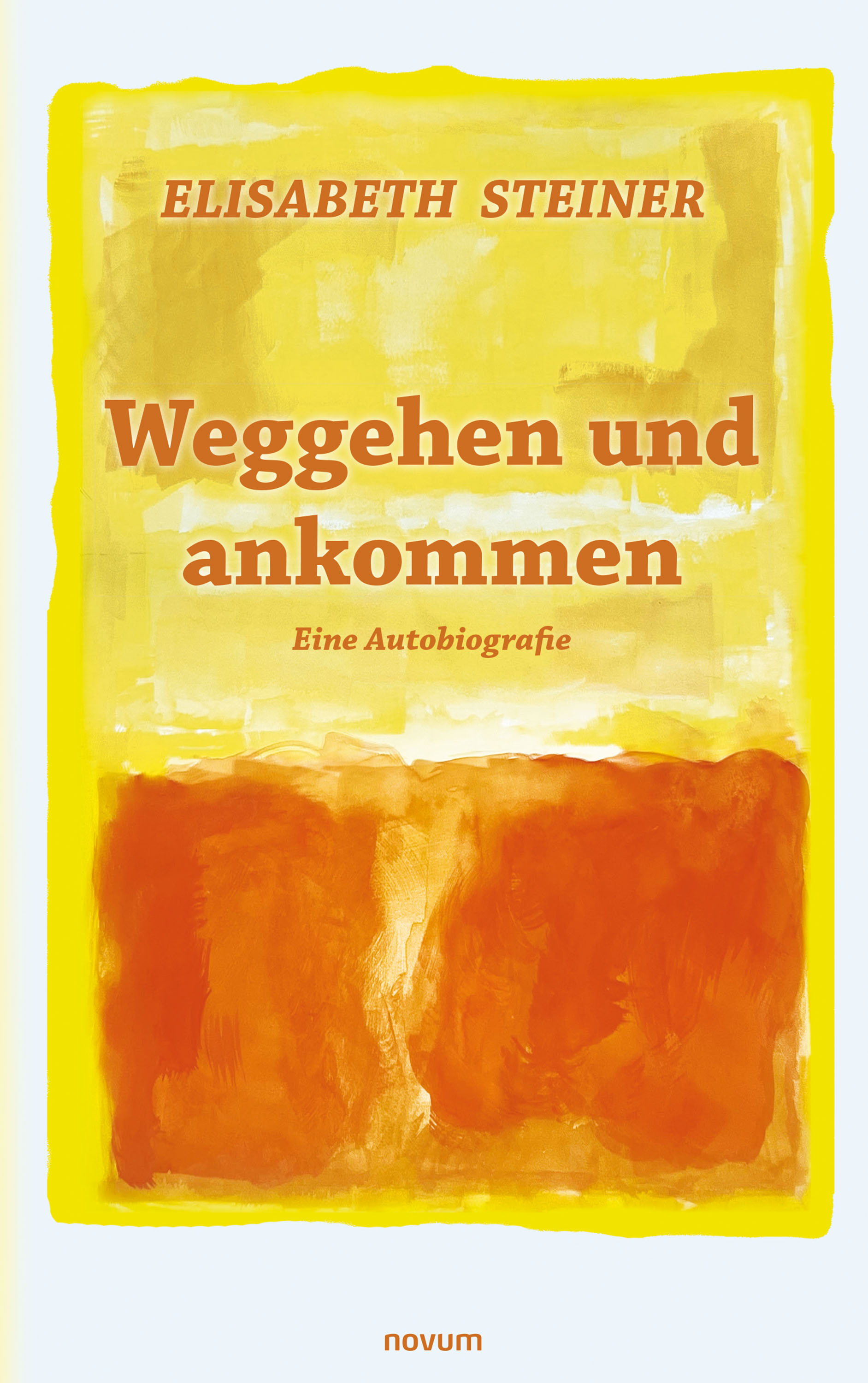
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bern nach dem zweiten Weltkrieg, deutsche Kriegsflüchtlinge, Bauern im Emmental, bizarre und schräge Originale. Das Mädchen wächst privilegiert auf im Villenviertel. Mutter und Vater, beide gefühlskarg, sind psychoanalytisch geschulte Ärzte und vergöttern Sigmund Freud. Das hat weitreichende Folgen. Der Leser erlebt die turbulente geistige und erotische Entwicklung der jungen Frau, Siege und Niederlagen im Beruf und ihre Liebesbeziehungen. Sie kämpft als Psychotherapeutin gegen Elend und für ein besseres Los von Flüchtlingen, etwa in Ruanda und während der Balkankriege. Die Biografie illustriert ein faszinierendes Stück Zeitgeschichte. Offen, selbstkritisch und berührend. Das Buch wurde 2023 an der Universität Zürich mit dem zweiten Preis des Schweizer Autobiografie-Award ausgezeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
2. Auflage
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-812-7
ISBN e-book: 978-3-99146-813-4
Lektorat: Alexandra Eryiğit-Klos
Umschlagabbildung: Elisabeth Steiner, 2023, Aquarell, in Anlehnung an den Stil von Mark Rothko
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Autorenfoto: Elisabeth Steiner
www.novumverlag.com
Kurzbiografie
Geboren in Bern. Sie studierte Psychologie an der Universität Zürich mit Abschluss Lizentiat. Danach bildete sie sich in freudscher Psychoanalyse am Freud Institut Zürich aus. Sie arbeitete viele Jahre als Psychotherapeutin für Gewaltopfer in eigener Praxis in Zürich und in der Entwicklungszusammenarbeit. Ihr Leben führte sie nach Kosovo und Ruanda, zu den Schauplätzen von Kriegen und Massakern. In Fachjournalen publizierte sie zahlreiche Artikel zu diesen Themen ehe sie sich dem Schreiben der eigenen Biografie zuwandte.
Vorbemerkung
Ich beschreibe keine objektive Wahrheit und erhebe auch keinen Anspruch darauf. Eine objektive Wahrheit gibt es nicht, da jede Person ein Ereignis anders wahrnimmt. Die im Text erwähnten Menschen beschreibe ich aus einer sehr subjektiven Sicht, sie ist naturgemäß einseitig.
Agnes, meine Mutter
Meine Mutter stammt von Eltern, die über Generationen Bauern im Emmental waren. Sie liebt ihren Vater, er ist für sie Leitbild. Als Jugendliche gerät sie in einen Streit mit ihm. Sie will studieren. Der Vater sagt: „Eine anständige Frau studiert nicht, sondern hat sich um Mann und Kinder zu kümmern.“ Für eine Frau sei ein Beruf überflüssig. Sie wehrt sich, sie sei keine Frau mit Suppenlogik und Knödelargumenten. Sie brauche weder Bettlaken noch Kochtöpfe. Ein Studium sei für sie die schönste Aussteuer. Mit einem Studium kann sie am schnellsten und am besten dem engen, bäurischen Kleinbürgertum entkommen. Ein Leben als Bohemienne erscheint ihr reizvoll. Um studieren zu können, ist sie jedoch auf das Geld des Vaters angewiesen. Nach langem Hin und Her willigt der Vater schließlich ein, für ihr Studium aufzukommen. Sie besucht das Gymnasium, studiert Medizin in Bern und Wien. In der Jugendzeit hat sie einen riesigen Hunger nach Literatur, nach Kunst und Schönheit. Sie verschlingt die französischen Klassiker. Das ist die Luft, die sie zum Atmen braucht. Aus den aufregenden Studienjahren erzählt sie oft und gerne. In dieser Zeit ist sie eine heitere, lustige, unterhaltsame junge Frau. Mit ihrer schönen Altstimme singt sie die frechen Songs aus der Dreigroschenoper, „Mackie Messer“, „Seeräuber-Jenny“, „Surabaya Johnny“, und unterhält damit die Studienkollegen. Wenn sie guter Laune ist, kann ich sie dazu bewegen, diese Songs uns Kindern vorzutragen. Singend mimt sie mit kecker Miene verwegen Laszivität und wiegt die Hüften. An der Uni lernt sie Friedhelm, meinen Vater, kennen. Friedhelm ist ein junger Mann mit Charme, Witz und Schalk in den Augen, immer Flausen im Kopf, er hat ein beschwingtes Wesen, das zieht sie an. „Si pecca, pecca fortiter» (wenn du sündigst, dann sündige kräftig) pflegt er zu sagen, das findet sie umwerfend und entzündet ihre Lebensfreude. 1935 in Wien wird sie Zeugin von schrecklichen Szenen an der Universität. Die jüdischen Kollegen werden aus dem Vorlesungssaal gewiesen. Ohnmächtig sieht sie zu.
Nach dem Staatsexamen bildet sie sich zur Kinderärztin aus. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges heiratet sie Friedhelm. Sie will ohne kirchliche Trauung heiraten. Dem Frieden mit den Eltern zuliebe tut sie es allerdings doch. Ein befreundeter Pfarrer verspricht, das Paar ohne Jawort zu trauen. Der schlaue Pfarrer aber hält sich nicht an sein Versprechen. So kommt es, dass sie ungewollt und unbeabsichtigt die Ehe mit christlichem Segen schließt. Auf der Hochzeitsfotografie ist sie in elegantem, schwarzem Deuxpièces zu sehen, also modern und gegen die damalige Konvention. Die Feier ist schlicht und findet ohne Pomp und Brimborium im engen Freundeskreis statt. Vier Jahre wartet das Paar auf ein Kind, bis mein Bruder und ich, Zwillinge, 1943 zur Welt kommen. Wegen des Krieges fehlen Ärzte auf dem Lande und viele Praxen sind verwaist. Meine Mutter übernimmt in diesen Jahren Praxisvertretungen. Wir Zwillinge werden von einer Kinderkrankenschwester betreut. Dann kaufen Agnes und Friedhelm in Bern ein großes Haus, damit sie eine Praxis eröffnen können, Friedhelm als Internist und sie als Kinderärztin. Es folgen arbeitsame, ausgefüllte Jahre. Nach dem Tode meiner Mutter erhalten wir viele Briefe von ehemaligen Patienten. Sie lassen uns spüren, wie geschätzt und geliebt sie als Kinderärztin gewesen war: „Sie verstand es, Zuversicht zu vermitteln, die kranken Kinder und die besorgten Eltern zu trösten.“ Zu Kindern, die Angst vor der Spritze hatten, sagte sie: „Ich werde dir jetzt mit der Spritzennadel für einen Augenblick wehmachen. Danach darfst du mich in den Arm klemmen.“
Agnes ist eine glänzende Organisatorin. Sowohl in der Praxis wie in der Familie laufen bei ihr alle Fäden zusammen. Für den Haushalt ist ein Dienstmädchen angestellt. Die administrativen Arbeiten für die beiden Praxen macht sie selbst. Im medizinischen Labor arbeitet eine Praktikantin, meine Mutter bildet sie zur Laborantin aus. Mein Vater hält in verschiedenen Gremien Vorträge zu Themen der Psychosomatik. Agnes hilft ihm beim Schreiben, da sie sich sprachlich besser ausdrücken kann als er. Sie lektoriert seine Vorträge und schreibt ganze Abschnitte um. Abends bringt sie uns Kindern die Regeln der deutschen und französischen Grammatik bei, sie hilft bei den Schulaufgaben und bereitet uns auf die Prüfung zum Eintritt ins Progymnasium vor. Sie kennt und erfindet einprägsame, lustige Eselsbrücken in Form von Reimen:Venez mes choux, mes bijoux, mes joujoux sur mes genoux et jetez des cailloux à ces hiboux plein de poux! Das sind die sieben Ausnahmen bei der Pluralbildung von Nomen mit der Endung –ou, die am Schluss des Wortes nicht ein s sondern ein x haben. Oder im Latein: nach si, nisi, ne, num, quo, quanto, ubi, cum fällt unser ali um. Nach den aufgezählten Konjunktionen verliert das unbestimmte Fürwort „aliquis/aliquid“ die Vorsilbe „ali“. Die Eselsbrücken bleiben bis heute im Gedächtnis. An einer Schule für Krankenschwestern und Kindererzieherinnen unterrichtet sie Entwicklungspsychologie. Dies alles bringt sie im Alltag unter einen Hut. Wie sie das schafft, ist mir ein Rätsel. Ihre Schaffenskraft ist enorm. Alle Aufgaben macht sie gern und mit Hingabe, manchmal aber wirkt sie erschöpft.
Überdies macht sie während vieler Jahre eine Psychoanalyse bei einem Analytiker, den sie verehrt. Zu ihrem Unglück war er befreundet mit meinem Vater. Ich schreibe mit Absicht zu ihrem Unglück. Wie kann ein Analytiker seine Arbeit gut machen, wenn er den Ehemann der Analysandin persönlich kennt und noch dazu mit ihm befreundet ist? Heutzutage wäre das ein schwerwiegender Kunstfehler. Damals waren die Auswirkungen solcher Befangenheit noch zu wenig bekannt.
Eines Tages, ich bin neun, komme ich von der Schule nach Hause, ich gehe gerade die Treppe hinauf. Die Mutter hat mein Kommen nicht bemerkt. Sie steht vor der Küche, ist aufgebracht. Zornig sagt sie zum Vater: „… sonst nehme ich die Kinder mit!“ Was bedeuten diese Worte? Hatte sie meinem Vater gesagt, sie wolle ihn verlassen? Sicher war da ein Streit vorausgegangen. Diese Worte, die ich da aufschnappe, sind verwirrend, ich will sie gar nicht wissen und zur Kenntnis nehmen. Fortan wirkt die Mutter leidend, während vieler Jahre ist sie geplagt von Magenschmerzen, welche sie mit Schmerzmitteln bekämpft. Von der lustigen, frechen Agnes, welche revolutionäre Lieder sang und in Szene setzte, ist nun nicht mehr viel übrig geblieben. Mir fällt auf, dass der Vater immer häufiger allein in die Ferien fährt, ohne Mutter, ohne Bruder und mir. Sie sagt dazu, Ehepartner müssten nicht immer aneinanderkleben, Unabhängigkeit sei auch wichtig und gut. Ich bin in der Folge stolz, so moderne Eltern zu haben, die unabhängig voneinander Ferien verbringen. Heute staune ich, wie gutgläubig und naiv ich damals als Kind war.
Die Mutter hat außer einem klugen Kopf vielfältige handwerkliche Begabungen. Sie näht Kleider, am Sonntag, wenn das Dienstmädchen freihat, kocht sie, arbeitet im Garten, pflanzt Blumen. Defekte elektrische Leitungen und Geräte kann sie selbst instand setzen, ohne einen Fachmann beizuziehen. Sie liebt es, selbst herumzuwerken und herumzubasteln. Ab und zu sind die Reparaturen aus ihrer Hand gewagt und gefährlich, sodass es Kurzschlüsse gibt und knallt.
Halb ernst, halb selbstironisch lacht sie und sagt: „Ihr könnt die vertrockneten, verschrumpelten Orangen mir geben, ich esse sie gerne.“ Wie meint sie das? Macht sie sich lustig über ihre Neigung, sich aufzuopfern, oder meint sie es ernst? Was erwartet sie von uns Kindern? Mein Bruder und ich nehmen sie beim Wort und freuen uns über die saftigen Orangen.
Sich aufopfern für andere und eigene Bedürfnisse hintanstellen ist die eine Seite von Agnes. Aber wenn es um ihr Haus im Emmental, das Stöckli geht, setzt sie ihre Wünsche durch und bestimmt allein. Ihre eigene Schwester, als zweite Eigentümerin des Hauses, bezieht sie in Entscheidungen nicht ein, sie tut dies meist so, dass die Schwester dies nicht durchschaut.
Nachdem ich wegen des Studiums nach Zürich gezogen war – mein Bruder wohnt bis zum medizinischen Staatsexamen zu Hause in Bern –, widmet sie sich ihrem Interesse für Kunstgeschichte, insbesondere für moderne Kunst und Literatur. Einmal bemerkt sie traurig: „Ich bin mir bewusst, dass die Kontakte, die ich jetzt habe, mit zunehmendem Alter weniger werden. Das ist zwangsläufig so.“ Das sagt sie traurig, als ob man nichts gegen Vereinsamung tun könnte und dieser ausgeliefert wäre.
1964 erkrankt mein Vater an einem Hirntumor, er ist gezwungen, seine Praxis aufzugeben. Die ersten Symptome sind Sprachstörungen, er leidet an einer Aphasie. Sie geht mit ihm zur Logopädin, macht mit ihm Sprachübungen, die aber wegen des wachsenden Tumors wenig bewirken. Jetzt ist der Vater oft wütend, weil er sich mit Worten nicht mehr ausdrücken kann. Mutter und Bruder erleben hautnah seine zunehmende Ohnmacht und Verzweiflung. Wir sehen hilflos zu, wie sein Gehirn sukzessive vom Tumor zerstört wird. Nach einiger Zeit kann er nur mehr lallen. Ich bin etwas weiter weg, ich sehe den kranken Vater nur gelegentlich am Wochenende bei Besuchen zu Hause.
Neben der Arbeit für die Praxis pflegt sie meinen schwer kranken Vater während zweier Jahre zu Hause bis zu seinem Tod. Sie ist jetzt fünfundfünfzig. Nach seinem Tod lernt sie Neugriechisch, unternimmt Wanderreisen nach Griechenland und vertieft sich in eine alte Leidenschaft, die griechische Mythologie. Sie hatte schon immer Bescheid gewusst, welche Götter in welcher Weise miteinander verwandt sind.
Viele Jahre nachdem mein Vater gestorben war, lüftet die Mutter ein Geheimnis, das sie bis anhin für sich behalten hatte. Ich war damals fünfunddreißig. Sie bekennt, der Vater habe seit vielen Jahren eine heimliche Liebschaft zu Florence gehabt. Das sagt sie mit Tränen in den Augen. Friedhelm habe es ihr schon früh gestanden. Für mich ist offensichtlich, dass sie das tief Verletzende und Beschämende während Jahren in eine tiefe Trauer gestürzt und in große Not gebracht hatte. Die Untreue des Vaters habe sie vor uns Kindern verheimlicht, weil wir mit einem ungetrübten Bild des Vaters aufwachsen sollten. Jetzt erkenne sie, dass die Verheimlichung ungute Auswirkungen auf uns Kinder gehabt habe. Wir hätten ja öfter gesagt, der Vater bleibe ein Rätsel. Lange habe sie über eine Trennung oder eine Scheidung nachgedacht. Sie habe sich gegen einen solchen Schritt entschieden, weil sie sich davor fürchtete, als geschiedene Frau geächtet zu sein. Sie sei nicht der Mensch, der rasch Kontakt und einen neuen Partner finde. Während sie spricht, spüre ich, wie schwer ihr dieses Bekenntnis gefallen ist, wie jahrelanges Ringen dahintergestanden und wie sehr sie Gesichtsverlust und Entwertung gefürchtet hatte. Gleichzeitig ist sie erleichtert, dass sie sich zum Geständnis entschieden hat.
Schon bevor meine Mutter das Geheimnis aufdeckte, hatte ich als Kind irgendwie gewusst, dass Florence im Leben des Vaters eine wichtige Figur gewesen war. Bis dreißig wollte ich nichts Genaueres darüber wissen. Aber gleichzeitig wusste ich es doch. Dieses „Wissen“ hatte bis zu Mutters Aufdeckung im Dunkel meines Unbewussten, genauer im Vorbewussten geschlummert. Als die Mutter mich einweihte, fiel es mir mit einem Schlag wie Schuppen von den Augen. Das war erleichternd. Meine dunklen Ahnungen bestätigten sich. Ich hatte mir als Kind nichts eingebildet. Die bittere Tatsache von Vaters häufiger Abwesenheit wegen seiner Liebschaft konnte ich fortan besser ertragen, als ich gedacht hatte.
Warum hat sie Friedhelm so lange ohne Hilfe gepflegt, nachdem er sie mit Untreue so verletzt hatte? Wie war ihr das möglich gewesen? Sie sagte dazu: „Ich habe mit der Pflege vieles abarbeiten können.“ Eine geheimnisvolle, schwer zu deutende, wenig klare Bemerkung. Meinte sie ihre Wut auf Friedhelm? Hatte sie bei der Pflege geheime Triumphgefühle über den jetzt todkranken, gehirnlosen Ehemann?
In unserer Familie war es üblich, Auseinandersetzungen, wann immer möglich, zu vermeiden. Unter uns pflegte man Gefühle wie Wut, Ärger, Enttäuschung, Verletzung, Triumph selten offenzulegen. Lange Zeit war die Beziehung zwischen meiner Mutter und mir nicht gut gewesen. Eines Tages sagte ich ihr, ich hätte eine neue Analyse angefangen, nicht zuletzt auch um die Beziehung zu ihr zu verbessern. Das hat sie berührt. Seither sind Nähe und Verbundenheit zwischen uns entstanden.
Friedhelm, mein Vater
Friedhelm, mein Vater, starb, als ich dreiundzwanzig war. Er bleibt für mich bis heute ein Geheimnis, so manches seiner Persönlichkeit ist mir bis heute ein Rätsel. Viele Fragen bleiben offen und werden wohl nie beantwortet werden. Das hat mehrere Gründe: Er war ein Mensch, der sich meist bedeckt hielt. Oft war er abwesend, manchmal habe ich ihn eine ganze Woche nicht gesehen. War er im Haus, dann arbeitete er entweder in seiner Praxis oder war in der Studierstube, wo er seine Ruhe wünschte. Im Alltag war er kaum greif- und erreichbar; sein eigentliches Leben hat er nicht mit uns Kindern geteilt. Selten sprach er von seiner Jugendzeit oder über sich selbst.
Jetzt stelle ich mir ihn vor, wie er im Jahre 1951, in seinem zweiundvierzigsten Lebensjahr, in Bern in einer Bar sitzt und auf seinen Jugendfreund Don wartet. Ich stelle mir vor, was er in der Bar denkt und fühlt: Die Stimmung in der Bar tut ihm gut. Zwar heißt es, Barbesuche seien anrüchig, aber das lässt ihn kalt. Er möchte endlich weg, weg vom Gefühl, nicht richtig zur Familie zu gehören, weg vom Gefühl, in der Nebenrolle ein Statist zu sein. Hier, in der Pianobar, kann er sich von der Arbeit erholen. Er kommt öfter hierher, gerne hört er dem Pianisten zu. Der singt gerade ein Lied von Édith Piaf, das er so gerne hat und ihn zum Träumen verführt. Er denkt an die goldene Zeit des Cabaret Cornichon in Zürich mit den mutigen, frechen Songs über die Faschisten, das waren für ihn Sternstunden. Er schaut um sich. Einige junge, hübsche Frauen sind hier, er guckt sie gerne an. Er überlegt. Dort hinten links, die junge, kecke Frau ist sicher eine Französin. Die Französinnen können sich ja jeden Fetzen um den Leib drapieren, immer sind sie elegant. Die erotisch aufgeladene Atmosphäre beschwingt ihn. Er weiß, dass er gut aussieht, Charme und Ausstrahlung hat und wegen seines heiteren Wesens wie ein Sonnyboy wirkt. Er hat den Ruf, ein schelmischer Schlingel zu sein. Er bewegt sich mit beschwingtem, federndem Schritt. Er überlegt, ob er die hübsche Französin ansprechen soll. Er beschließt, es nicht zu tun und stattdessen auf seinen Jugendfreund Don zu warten. Er mag Don, weil er gute Witze zu erzählen weiß. Als Jugendliche hatten sie oft gemeinsam Schabernack getrieben. Gerne denkt er an diese Zeit. Einmal hatte er Don besucht. Im Haus, in dem Don wohnte, befand sich ein Restaurant, wo die Gäste im Sommer auf einer Terrasse das Mittagessen einnahmen. Sie hatten beide im ersten Stockwerk aus dem offenen Fenster auf die tafelnden Gäste hinuntergeschaut. Plötzlich war Don aufgestanden und hatte ein kleines Flobert-Gewehr aus dem Kasten geholt, eine Patrone eingelegt und sich am Fenster in Position gebracht. Auf dem Tisch war ein Salzfässchen gestanden. Don hatte es ins Visier genommen und dieses vor den Nasen der Gäste weggeschossen. Don war in der Tat schon immer ein begabter Schütze gewesen. Nach diesem Lausbubenstreich hatten die Lehrer gesagt, sie seien beide kleinkriminell. Friedhelm überlegt: Nein, er war nicht kleinkriminell, es war einfach eine pubertäre Dummheit gewesen. Eine weitere Anekdote fällt ihm ein. Er hatte im Spital eine Patientin besucht. Dort arbeiteten in der Pflege katholische Krankenschwestern. Im Zimmer einer Patientin war ihm ein Kruzifix aufgefallen. Zur Schwester hatte er gesagt: „Der Gekreuzigte trägt einen hübschen Bikini.“ Die Frau hatte ziemlich betreten reagiert. Ein Bekannter hat ihm, Friedhelm, einmal gesagt, er sei ein taktloser Rüpel. Friedhelm findet, nein, er ist kein Rüpel, er sagt und meint halt vieles ironisch. Er hat einfach Spaß, Menschen zum Lachen zu bringen. Religion und Aberglauben nerven ihn. Mit beidem hat er nichts am Hut. Als Atheist ist er halt ein aufgeklärter Geist.
Weiter stelle ich mir vor, dass mein Vater beim Warten auf Don über eine seiner Marotten nachdenkt. Er pflegt vor Agnes, seiner Ehefrau, Geld zu verstecken, manchmal an geheimen, besonderen Orten. Einmal im Gepäckraum seines Chevrolets, seines Autos, eine Tausendernote, ein anderes Mal eine Banknote in einem Buch seiner Bibliothek. Nach einiger Zeit hatte er vergessen, wo das Geld war. Die Putzfrau fand es bei der Frühlingsreinigung, steckte es dann in die eigene Tasche. Beim Geld im Gepäckraum hatte er ebenso Pech. Erst nachdem das Auto schon verkauft war, ist ihm eingefallen, dass er dort Geld versteckt hatte. Warum bringt er sich auf diese dumme Weise um sein Geld?, überlegt er. Ärgert es ihn, dass Agnes, seine Frau, mehr Geld auf der hohen Kante hat als er? Wäre es ein Triumph, wenn er mehr Erspartes hätte als sie? Er kann keine Antwort finden und schaut auf die Uhr. Schon eine Stunde wartet er hier in der Bar. Er beschließt, nach Hause zu gehen.
Nach diesem Barbesuch vergehen zwölf Jahre. Im Winter lässt sich Friedhelm jeweils von einem Höhensonnengerät bräunen. Er denkt, braun gebrannt sähe er attraktiver aus. Zu dieser Zeit ist noch nicht bekannt, dass starke Bestrahlung von Höhensonnen kanzerogen wirken kann. Im Alter von vierundfünfzig erleidet Friedhelm einen epileptischen Anfall. Er meint, der Anfall habe mit Herzproblemen zu tun. Die Diagnose Hirntumor kann er zuerst nicht glauben. Im Alter von sechsundfünfzig stirbt Friedhelm. War es die Höhensonne, die ihn getötet hat? Hatte die Eitelkeit ihm das Leben gekostet?
Für meine Mutter wie auch für uns Kinder war es unerträglich, seinen mentalen Zerfall miterleben zu müssen. Während der letzten Wochen seines Lebens lachen wir oft und ausgiebig über die lustigen Geschichten rund um Friedhelm. Wir brauchen das Lachen, um mit dem Verlust und der Trauer fertig zu werden. Einige Wochen vor seinem Tode erscheint Florence, sie möchte Abschied nehmen. Wir Kinder wissen noch nicht, wer sie ist und welche Bedeutung sie in seinem Leben hatte.
Außer der Geschichte mit dem weggeschossenen Salzfässchen hatte sich mein Vater in der Jugend noch andere Tricksereien erlaubt, dessen bin ich mir sicher. Darüber hat er aber kaum geredet. Ich habe ihn auch nicht gefragt. Seine Jugendstreiche hatten wahrscheinlich mit dem strengen, jähzornigen eigenen Vater zu tun, mit meinem Großvater, den er immer gefürchtet hatte. Friedhelms Lust an Provokationen, sein Drang, Autoritäten vor den Kopf zu stoßen oder zu erschrecken, empfand ich oft als taktlos und verletzend. Das verriet eine manchmal fehlende Einfühlung in die religiösen Gefühle anderer. Fühlte er sich deshalb zu Provokationen gedrängt, weil er seine Angst und Ohnmacht auf diese Weise nicht mehr passiv erleiden musste, sondern in einer aktiven Rolle bekämpfen konnte?
Heute habe ich zur Liebschaft meines Vaters zwiespältige Gefühle. Heimliche Liebschaften sind ja nichts Besonderes und kommen oft vor. Viele Dichter, von Goethe bis Flaubert, erzählen davon. Über die Gründe seiner Untreue, wie es dazu kam und weshalb, habe ich mit den Eltern nie geredet. Ob er wegen der Geliebten ein schlechtes Gewissen hatte, ob er sich Selbstvorwürfe machte, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vermutungen wären reine Spekulation. Als Erwachsene finde ich es heute auf der einen Seite lumpig, dass er meiner Mutter über Jahre hinweg eine Geliebte zugemutet hat. Andererseits sehe ich seine Liebschaft aber auch als Zeichen von Lebenslust, als Lust am Abenteuer, als Unbekümmertheit, als Lust am Ausbruch, als Angst, in der Ehe gefangen zu sein. Seine Liebschaft fand ich auch interessant und sogar sympathisch. Dass er das Leben auskosten wollte, verzeihe ich ihm. Aber es macht mich traurig, dass meine Eltern miteinander keine andere, weniger leidvolle Lösung der Konflikte gefunden haben. Enttäuschend, dass ihm der Mut fehlte, vor uns Kindern zu seiner Liebesbeziehung zu stehen. Enttäuschend, dass er als Psychoanalytiker, der doch der Wahrheit verpflichtet sein sollte, zu Täuschungsmanövern griff und nicht merkte, dass das in die Irre führt und sich nicht lohnt. In meinen Augen ist er kein verantwortungsloser Luftikus. Aber gegenüber der Mutter und uns Kindern ist er seiner Verantwortung ausgewichen. Hat er uns Kinder angeschwindelt, weil er Angst hatte, wir würden ihn verachten und er würde unsere Liebe verlieren, wenn wir die Wahrheit wüssten? Auch dies weiß ich nicht. Sicher aber bin ich mir: Es war ihm recht, dass auch ich Konfrontationen scheute, dass ich ihn als Jugendliche in einem verklärten, rosigen Licht sah. Damals wäre ich nicht in der Lage gewesen, hinter Vaters glatte, geschönte, freundliche Fassade zu schauen. Zu stark war mein Bedürfnis, ihn zu verehren, ihn auf einen Sockel zu heben. Groß war die Enttäuschung, als ich nach seinem Tode entdeckte, dass er außer einigen wenigen Vorträgen der Nachwelt weder Schriftstücke noch andere Zeugnisse seines Wirkens hinterlassen hat.
Erste Erinnerungen – Kindheit in der Nachkriegszeit in einer Arztfamilie