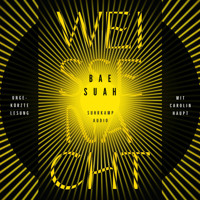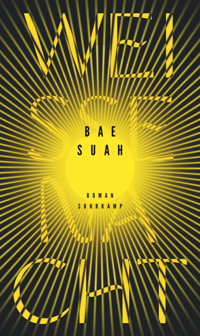
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 28-jährige Ayami ist Assistentin im einzigen Hörtheater von Seoul, nun wird es für immer geschlossen. Ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie ihr Leben künftig aussehen soll, streift sie bis spät in die Nacht mit dem Theaterdirektor durch die Straßen der Stadt, sie suchen nach einer gemeinsamen verschollenen Freundin und sprechen über Lyrik, Teilzeitjobs und die Vergeblichkeit von Liebe. Am nächsten Tag verdingt sie sich als Dolmetscherin eines gerade angereisten Krimiautors, sie sprechen über Literatur, Fotografie und die Vergeblichkeit, in den Norden zu reisen. Und während die Sommerhitze Seoul in einen Tempel betäubender Mattigkeit verwandelt, hält allmählich die Vergangenheit Einzug und lässt die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Traum zerfließen.
Weiße Nacht ist ein flirrender Fiebertraum, in dem wir eine Welt eintauchen, die unter dem Sichtbaren liegt. Eine Welt, in der mehrere Versionen unserer selbst gleichzeitig existieren und die von Schönheit und Güte und Abgründigem bewohnt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Bae Suah
Weisse Nacht
Roman
Aus dem Koreanischen von Sebastian Bring
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
1
2
3
4
Informationen zum Buch
Textnachweis
Impressum
Hinweise zum eBook
1
Die ehemalige Schauspielerin Ayami saß auf dem zweiten Treppenabsatz des Hörtheaters, das Gästebuch in der Hand.
Sie war allein. Zu diesem Zeitpunkt war nichts anderes bekannt.
Bei erloschenem Licht wirkte das Innere des Theaters wie in trübes Wasser getaucht. Objekte zersetzten sich sanft, Identitäten wurden vage, fast undurchsichtig. Nicht nur Licht und Formen, auch Töne und Klänge. Der Theatersaal fasste nur fünf Zweiersofas. Die links und rechts davon schräg zulaufenden Treppen dienten als weitere Zuhörerplätze.
Die Zeit nach der Vorführung, wenn Ayami die Türen des Theaters verschlossen hatte und mit dem Gästebuch in der Hand auf ihrem üblichen Platz saß, war kostbar für sie. Zwar waren die Einträge der Theaterbesucher meist nichts Besonderes. Manchmal schrieben einige blinde Gäste etwas in Braille hinein, wovon Ayami jedoch nichts entziffern konnte. Aber sie hatte das Buch auch nicht in der Hand, um darin zu lesen, sondern um still einer Stimme zu lauschen, die in unregelmäßigen Abständen zu hören war.
Geh nicht weit weg, selbst nicht für einen Tag, weil
Weil … ein Tag lang ist und
Ich auf dich warten werde.
Ayami saß im Theatersaal, weil sich immer um diese Zeit ein irgendwo zwischen den tontechnischen Geräten verborgen liegendes, altes Radio von selbst einschaltete. Da sich Ayami vor der elektromagnetischen Strahlung fürchtete, die von Geräten, Kabeln, Mikrofonen und Lautsprechern ausgeht, und davon überzeugt war, dass die durch Schallwellen verursachten Interferenzen ihrem Körper schaden könnten, wagte sie es nicht, die massigen technischen Apparaturen zu berühren oder auch nur einen Blick dahinter zu werfen, um dort nach einem Radio zu suchen, das absichtlich versteckt oder achtlos zurückgelassen worden war. Obwohl sie eine feste Stelle beim Theater hatte, beschränkte sich ihr Umgang mit der Soundanlage darauf, eine CD in das Abspielgerät zu schieben und auf »Play« zu drücken. Hin und wieder kam ein Tontechniker im Auftrag der Stiftung vorbei, um die Geräte zu warten, doch Ayami hatte niemals mit ihm gesprochen.
Der Techniker trug eine Baseballkappe, die er immer so tief in die Stirn gezogen hatte, dass sein Gesicht verdeckt war und er damit wie sein eigener Schatten aussah. Meistens kam er mit dem Kleinbus, auch wenn ihn niemand begleitete und er keine schweren Geräte zu transportieren hatte. Der Bus war weiß und trug das Logo der Stiftung. Der Direktor des Hörtheaters wurde im Voraus über die genaue Ankunftszeit des Technikers informiert und sprach mit ihm, falls es etwas zu besprechen gab. Er begrüßte den Techniker bei dessen Ankunft und begleitete ihn, wenn er wieder ging, zum Bus.
Eines Tages wollte Ayami dem Direktor von dem Radio erzählen, das sich von selbst ein- und ausschaltete. Bisher war das noch nicht während einer Vorstellung passiert. Falls es sich nun doch einschalten würde, hätten sie ein Problem, und so fand sie, der Direktor müsse informiert werden, zumal er ihr Vorgesetzter und einziger Kollege war.
Ayami hielt vor der offen stehenden Bürotür des Direktors inne, als sei ihr dieser Gedanke ganz plötzlich gekommen, und sagte zu ihm: »Vielleicht gibt es ein Problem mit den Leitungen. Vielleicht ist ein Lautsprecherkabel fälschlicherweise mit dem Radio verbunden.«
Der Direktor schaute von seinem Schreibtisch auf. »Ich weiß von keinem Radio im Vorführsaal.«
»Merkwürdig«, sagte er, »diese Stimme ist mir noch nie aufgefallen. Zugegebenermaßen bin ich mit keinem sonderlich guten Gehör gesegnet.«
»Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob sie wirklich aus einem Radio kommt«, sagte Ayami zögerlich. Aber nun hatte sie schon damit angefangen und fühlte sich gezwungen weiterzusprechen. »Es ist nur eine Vermutung. Jedenfalls sind im Vorführsaal, wenn es im Theater ganz still ist, manchmal Stimmen zu hören, wobei ich besser sagen müsste, man fühlt, dass man etwas hört.«
»Was genau hörst du denn? Musik?«
»Nein, es klingt so, als lese jemand ganz langsam aus einem Buch vor, als murmele jemand etwas aus weiter Entfernung, ja, wie ein Selbstgespräch … eine monotone Stimme wie beim Seewetterbericht, bewusst langsam gesprochen, damit die Seeleute die Vorhersage mitschreiben können. Südöstliche Wellen 2,5 Meter, südwestliche Wellen, leichte Bewölkung, Regenbogen im Süden, Regenschauer, nordöstlicher Hagel, 2, 35, 7, 81 … so etwa.«
»Und du hörst diese Stimme meistens nach Ende der Vorstellung, also abends, wenn die Tontechnik abgeschaltet ist?«
»Ja.«
»Könnte es nicht vielleicht ein Klangschatten sein, der nach der Vorstellung noch zu hören ist?«
»Ein Klangschatten?«
»So was wie eine unbekannte Stimme.«
Ayami starrte den Direktor an, unsicher, ob er diese Bemerkung ernst gemeint oder nur einen Scherz gemacht hatte. Als sie noch mit ihrer Antwort haderte, weil sie sich kaum mit den ganzen Geräten auskannte, begann der Direktor wieder zu sprechen.
»Wenn übermorgen der Techniker kommt, werde ich ihn bitten, sich um die Sache zu kümmern, in Ordnung?«
»Ja, das wäre gut. Aber ich …«
»Was?«
»Ich dachte nur, es ist meine Pflicht, dich über Probleme zu informieren … deshalb fand ich, du solltest von der Sache wissen.«
»Und?«
»Um ehrlich zu sein … ganz egal, ob diese Stimmen nun von einem Radio oder einer Art Klangschatten stammen … sie sind nicht sehr laut. Wenn sich das Radio während der Vorstellung einschaltet, würde es sowieso von der Aufführung übertönt werden.«
Die Lippen des Direktors schienen sich kurz zu einem Lächeln formen zu wollen, vielleicht war es aber auch nur eine Muskelzuckung. »Das heißt also, du wolltest mich wissen lassen, dass es rätselhafte Radiogeräusche gibt, die dich aber nicht weiter stören?«
»So ist es.«
Bevor der Direktor noch irgendetwas erwidern konnte, war Ayami bereits zu ihrem Stammplatz in der Bibliothek geeilt.
Am späten Nachmittag, als sich die Sonne am Himmel tief neigte, strömten gelbrote Strahlen ihres letzten Lichts horizontal in das Gebäude, doch seine Innenwelt, in der die Lichter erloschen waren, lag bereits im Halbdunkel. Die Vorstellung wurde an diesem Tag von fünf hochgewachsenen Oberschülern besucht, einem Mann, der ihr Klassenlehrer zu sein schien, und einem stark sehbehinderten Mädchen, dessen Augen hinter schmalen Schlitzen verborgen lagen. Während der Vorstellung rutschten die Jungen unruhig auf ihren Plätzen hin und her und sprangen auf, noch bevor die Vorstellung vollständig beendet war. Fast fluchtartig stürmten sie aus dem Theatersaal und hasteten lärmend und drängelnd durch die gläserne Eingangstür. Die Tür schwang so plötzlich zurück, dass die Jungen von ihren Schatten getrennt wurden, die wie dunkle Geister zurückblieben.
Das sehbehinderte Mädchen verließ als letzte Besucherin das Theater. Als sie sich von Ayami verabschiedete, strich sie mit ihrem Mittelfinger über Ayamis Handrücken, um sich dann zu einem bestimmten Punkt auf der Innenseite ihres Handgelenks vorzutasten. Dort übte sie sanften Druck aus, als wolle sie Ayamis Puls fühlen. Für einen kurzen Augenblick dachte sie, das Mädchen wolle sie auf ganz eigene Weise einladen.
Das Mädchen war ungewöhnlich gekleidet, sie trug einen schlichten, grob gewebten, weißen Baumwoll-Hanbok – die traditionell koreanische Frauenbekleidung –, der einen intensiven Stärkegeruch verströmte. Ihr dichtes, schwarzes Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden, unter ihrem Rocksaum schauten einfache Hanfsandalen hervor.
Ayami war nicht die einzige ehemalige Schauspielerin, die gleichzeitig als Bürokraft, Bibliothekarin und Kartenverkäuferin in dem von der Stiftung betriebenen Theater geendet war.
Auch vor ihr hatten einige Frauen, die Verbindungen zur Theaterbranche hatten, diesen Job gemacht, fast alle waren Schauspielerinnen. Die Frau, die am längsten ausharrte, hatte es auf drei Monate gebracht, während es eine andere nicht länger als drei Stunden durchhielt. Niemand war auch nur annähernd so lange dabei geblieben wie Ayami, nämlich zwei Jahre. Der Job war, offen gestanden, langweilig und monoton, besonders für junge Frauen, die davor das abwechslungsreiche Leben einer Schauspielerin geführt hatten. Die einzigen Menschen, denen sie hier begegneten, waren die Theaterbesucher, hauptsächlich Oberschüler, Studenten oder Blinde. Ayamis Vorgängerinnen hatten alle ihre Stelle vorzeitig gekündigt, wohl auch deshalb, weil die Chancen, währenddessen Männer kennenzulernen, gering bis inexistent waren. Nicht einfach nur irgendwelche Männer, sondern solche, die für junge und ambitionierte Frauen infrage kamen, deren Mittel aber leider ihren Vorhaben nicht standhielten.
Ayami wusste fast nichts über ihre Vorgängerinnen. Sie hatte keine von ihnen je zu Gesicht bekommen und kannte nicht einmal ihre Namen. Alles, was sie hinterlassen hatten, waren einige Kugelschreiber und Notizzettel, auf denen Beschimpfungen und Flüche zu lesen waren, die sich an niemanden zu richten schienen. Sie tappte ebenso im Dunkeln, was die Stiftung anging, die das Theater betrieb und Ayamis Gehalt bezahlte. Anders, als man vermuten könnte, hatten ihr keine persönlichen Kontakte zur Stiftung den Job im Hörtheater verschafft. Irgendwann hatte sie kaum mehr Engagements erhalten, nicht einmal bei ihrer angestammten Theatergruppe. Als sich die Gruppe dann wegen Führungsunstimmigkeiten schließlich ganz auflöste, wurde sie von einer ehemaligen Schauspielkollegin dem Hörtheater empfohlen.
Niemand hatte Ayami an ihrem ersten Tag empfangen, und weil ihr auch nicht gesagt wurde, an wen sie sich wenden sollte, hatte sie erst einmal die verwaiste Lobby des Theaters betreten. Nach einer Weile war schließlich jemand erschienen, es war der Direktor. Obwohl sie genau gegenüber dem Eingang gestanden hatte, war er von ihr unbemerkt ins Theater gekommen. Er schien die Lobby durch ein Tor aus Licht betreten zu haben, das inmitten der Staubpartikel und Sonnenstrahlen geschwebt hatte. Der Direktor setzte sich mit Ayami auf den zweiten Treppenabsatz im Vorführsaal, führte ein kurzes Bewerbungsgespräch und teilte ihr anschließend mit, sie sei angestellt.
Im Vorführsaal gab es weder eine Bühne noch eine Leinwand. Die sogenannte Vorstellung bestand aus dem Abspielen einer aufgenommenen Lesung durch eine Soundanlage. Die zahlenmäßig meist spärlichen Theatergäste nahmen auf den im Saal aufgestellten Sofas Platz oder setzten sich auf die Treppen, die seitlich davon verliefen. Somit gab es im Theater keine Schauspieler, eine Berufsbezeichnung, die Ayami aufgeben musste, weil sie von nun an als gewöhnliche Büroangestellte arbeitete, die in erster Linie Verwaltungsarbeiten erledigte. Das Theater bestand neben dem kleinen Vorführsaal aus einer langgezogenen Lobby und einer winzigen Bibliothek, hinter der das Büro des Direktors lag. Ayami verbrachte ihren Arbeitstag meistens in einer Ecke der Bibliothek. Vor der täglichen Abendvorführung verkaufte sie am Eingang des Theaters Eintrittskarten – sie waren günstig, sogar günstiger als eine Tasse Kaffee –, bevor sie kurz vor Beginn der Aufführung den Vorführsaal betrat, um dem Publikum einen kurzen Einblick in das Stück zu geben. Schließlich sagte sie: »Und jetzt beginnt die Vorstellung.« Manchmal verirrte sich ein Gast in die Bibliothek, um sich ein Drehbuch oder eine Broschüre zu einem Stück, die Autobiographie eines Schauspielers oder die CD zu einer Aufführung auszuleihen.
Ayami hatte alle zu erledigenden Arbeiten beendet. Sie hatte die Einnahmen aus der Abendkasse berechnet – was nicht gerade viel Zeit in Anspruch nahm –, die Bestände der Bibliothek mit der Datenbank abgeglichen und die notwendigen Unterlagen an die Stiftung verschickt. Jetzt musste sie nur noch die Eingangstür des Theaters abschließen und die Schlüssel in den Briefkasten im Erdgeschoss werfen. Ihr Gehalt würde bis Ende des Monats ausgezahlt werden, das war alles.
Das Telefon in der Bibliothek klingelte. Ayami hielt kurz inne, um sich zu vergewissern, dass es wirklich das Telefon war und nicht das rätselhafte Radio, ging zum Schreibtisch und nahm den Hörer ab. Es war wie üblich ein Anruf wegen des Programms der nächsten Woche.
»Nächste Woche gibt es keine Vorstellungen«, erklärte Ayami. »Heute war die letzte, ab morgen schließt das Theater für immer.«
»Was? Sie schließen für immer?« Die Stimme klang entsetzt. »Warum war davon nichts in den Zeitungen zu lesen?«
Vielleicht wurde davon berichtet. Aber dafür war die Presseabteilung der Stiftung zuständig, von der Ayami über eine solche Meldung nicht informiert wurde. Zog man die geringen Besucherzahlen in Betracht, war die Schließung des Theaters kein so folgenschweres Ereignis, für das es der Anrufer gehalten hatte. Zumindest nicht folgenschwer genug, um in der Zeitung erwähnt zu werden.
Das Theater schloss für immer, so dass Ayami ab morgen arbeitslos sein würde. Natürlich hatte die Stiftung das bereits vor einigen Monaten entschieden, und Ayami war genügend Zeit geblieben, sich einen neuen Job zu suchen. Sie hatte aber zu lange nicht als Schauspielerin gearbeitet, um in diesem Beruf erneut Fuß zu fassen, außerdem schien ihr diese Phase ihres Lebens mehr und mehr unwirklich, besonders jetzt, da sie schmerzlich erkannte, dass sie ohnehin nie groß nachgefragt worden war. Auch wurde ihr zu spät bewusst, dass ihre Anstellung im Theater ihr bei der Suche nach einem neuen Job absolut nicht hilfreich sein würde. Das von der Stiftung betriebene Hörtheater war weit und breit das einzige in Seoul und ihr Job vermutlich einmalig auf der Welt. Ayami besaß keinerlei praktische Qualifikation, die einen neuen, potentiellen Arbeitgeber hätte beeindrucken können. Keine formalen Qualifikationen, die ihre Eignung bestätigten oder sie als mögliche Lehrerin befähigten, nichts also, was man auch nur entfernt als offizielles Dokument hätte bezeichnen können. Sie hatte zwar begonnen, Jura zu studieren, das Studium aber vor Ende des ersten Semesters abgebrochen, so dass sie von einem Abschlusszeugnis weit entfernt war. Nicht einmal einen Führerschein besaß sie.
Zwischen ihren Engagements als Schauspielerin jobbte sie als Kellnerin, aber auch das war ein ähnlicher Reinfall wie ihre eigentliche Karriere. Das Problem beim Kellnern bestand darin, dass sie zu groß wirkte. Außerdem glich ihr Gesicht, wenn sie eine Bestellung aufnahm, einer ausdruckslosen Theatermaske, und ihre Bewegungen, Gesten und ihr Gang schienen bewusst übertrieben, als wolle sie einen schauspielerischen Akzent setzen. Dieses sonderbare Verhalten rief bei den Gästen oft ein latentes Unbehagen hervor, wenn sich Ayami ihren Tischen näherte. Um ihre Verlegenheit zu überspielen, fragten manche der Gäste sie nach ihrer Körpergröße und reagierten ungläubig auf ihre Antwort, bevor sie prüfend auf die Absätze ihrer Schuhe blickten. Ayami trug immer vollkommen flache Schuhe, ohne jenen noch so kleinen Absatz, wie ihn die meisten Hersteller normalerweise anbringen. Auch wenn sie nicht besonders hochgewachsen war, wirkte sie größer und schien einige Zentimeter über dem Boden zu schweben, eine optische Täuschung, die dadurch verstärkt wurde, dass die Gäste sie im Restaurant aus der sitzenden Perspektive sahen.
Ayami war sich bewusst, dass ihr Körper eher für physische Arbeit geeignet war als für den Umgang mit Kunden, der intensive kommunikative Fähigkeiten erforderte. Schauspielern war ihrer Überzeugung nach eine physische Tätigkeit.
Der Direktor, der von Ayamis Problemen bei der Jobsuche wusste, riet ihr zu einer Bewerbung bei der Stiftung. Da sie direkt beim Theater angestellt war, einer separaten Einrichtung, bestand für sie weder die Notwendigkeit noch die Gelegenheit, die Stiftung zu besuchen oder die Kollegen dort zu treffen. Die gesamte Kommunikation mit der Stiftung lief über den Direktor. Ayami hatte nur einige kurze, förmliche Telefongespräche mit jemandem aus der Kunstabteilung geführt – und das auch nur in äußerst dringenden Notfällen. Der Direktor schlug ihr vor, ihren Lebenslauf mit einem Anschreiben an die Personalabteilung der Stiftung zu schicken. Möglicherweise ergäbe sich eine geeignete Stelle innerhalb der Stiftung, natürlich nicht sofort, oder vielleicht würde die Stiftung ja, auch wenn es sehr unwahrscheinlich war, erneut in ein gemeinnütziges Kulturunternehmen investieren oder sogar das Hörtheater wiedereröffnen.
»Wie du weißt, schreibt die Stiftung Stellenangebote nicht öffentlich aus, es funktioniert nur durch persönliche Empfehlungen, aber eine Bewerbung ist trotzdem einen Versuch wert«, wollte der Direktor sie motivieren.
Doch Ayami nahm seinen Rat nicht an. Dabei war es nicht so, dass sie keinen Job brauchte oder ihr die Arbeit in der Stiftung nicht gefiel. Obwohl der Direktor nicht offen darüber gesprochen hatte, war es Ayami bewusst, dass auch er nur schwer eine neue Anstellung würde finden können, zumindest keine mit angemessenem Gehalt und guter Position. Falls die Stiftung ihnen wohlgesinnt war oder ein bloßer Brief für Wohlwollen sorgen konnte, hätte der Direktor mit seinen wesentlich engeren Verbindungen zur Stiftung kaum solche Schwierigkeiten gehabt. Der Direktor hatte eine erstklassige Ausbildung vorzuweisen, einen Abschluss an einer ausländischen Universität, und er war offenkundig sehr gebildet. Der einzige Schwachpunkt in seinem Lebenslauf – falls man es als Schwachpunkt bezeichnen wollte –schien die Tätigkeit im gemeinnützigen Hörtheater zu sein, bei der er nur eine Angestellte unter sich hatte.
Aus einem wolkenlosen Himmel schien die Abendsonne über der Stadt. Die Eingangstür des Theaters war ganz aus Glas. Nachdem Ayami das Telefongespräch beendet hatte, blickte sie nach draußen in die Dämmerung. Die letzten Sonnenstrahlen tauchten die Umgebung in rötliches Licht. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße stand ein ärmlich gekleidetes Paar mittleren Alters und schaute zum Theater herüber. Jedes Mal, wenn ein Auto durch die enge Gasse fuhr, trat die Frau einen Schritt zurück und balancierte so lange unsicher auf den niedrigen Pflastersteinen, bis das Auto vorbeigefahren war. Beide konnten ihren Blick nicht von etwas lösen, das ihr Interesse geweckt hatte – ein Aushang am Eingang des Theaters, der das heutige Programm ankündigte.
Die beiden wirkten wie ein gewöhnliches Paar auf einem Abendspaziergang, vielleicht waren sie aber auch zwei Klassenkameraden aus Grundschulzeiten, die sich nach vierzig Jahren wiedertrafen. Als die Frau aufschaute und ihr unnatürlich schwarzes Haar dabei ihr Gesicht freilegte, bemerkte Ayami Pockennarben auf ihrer dunklen Haut. Der Mann hob seine schwielige Hand und wies auf den Aushang. Vermutlich wussten sie nicht, dass heute die letzte Vorstellung stattfinden würde. Die Frau schüttelte ihren Kopf, was wie eine Geste des Bedauerns wirkte. Könnten das meine Eltern sein? Dieser Gedanke durchzuckte Ayami, bevor er verblasste und sich verflüchtigte.
»Merkwürdig«, murmelte die Frau, »wieso ist uns dieses Hörtheater bis jetzt nie aufgefallen? Ein richtiges Schild wäre besser, nicht bloß ein angeklebter Zettel an der Eingangstür. Wenn man nicht direkt davorsteht, sieht es eher wie ein buddhistischer Tempel oder eine Nachhilfeschule aus!«
Als der Mann näher an die Frau herantrat, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern, legte sie den Kopf an seine Schulter und kicherte wie ein Kind. Ayami betrachtete die kleine Statur des Mannes. Könnte das ihr Vater sein, ein Obsthändler, der von sich behauptete, ein entfernter Verwandter des Bürgermeisters von Seoul zu sein?
Für einen Augenblick schienen der Mann und die Frau das Theater vergessen zu haben, das so plötzlich in ihrem Leben aufgetaucht war.
Sie blickten gleichzeitig in den Himmel.
Es war heiß, der Himmel wolkenlos. Keine Spur von aufziehendem Regen.
»Was ist wohl im Innern?«, murmelte die Frau, als sie durch die Glastür des Theaters spähte, das sie auf unerklärliche Weise anzog. Der Mann folgte ihrem Blick, auch wenn er nichts von tontechnischen Geräten verstand und keinerlei Interesse hatte an einer Einrichtung, die sich Hörtheater nannte. Beide schienen Ayami hinter der Glastür nicht zu sehen.
»Sieh mal, hier steht, es gibt eine Bibliothek und einen Audioerlebnisraum. Audioerlebnisraum … meinst du, das ist dasselbe wie ein Musikerlebnisraum? Oh, hier heißt es, das Theater schließt für immer! Schade, wir konnten uns nicht mal darin umschauen.«
Die beiden setzten sich gleichzeitig in Bewegung, vielleicht, um sich auf den Heimweg zu machen, blieben aber sofort wieder stehen. Sie schienen zu zögern, als fragten sie sich, wohin sie gehen sollten. Plötzlich wandte sich die Frau dem Mann zu und schaute ihn so durchdringend an, dass sich Falten auf ihrer Stirn bildeten. »Liebling, du willst mich doch nicht wirklich verlassen, wie du es in diesem Brief geschrieben hast, oder?«
Ihr Rock flatterte wie ein altes Geschirrtuch in der stehenden Luft der Gasse, dabei kamen ihre dünnen, von drahtigen Muskeln durchzogenen Waden, ihre erbärmlich kleinen Füße und ihre neu scheinenden, aber wie abgetragen wirkenden Schuhe zum Vorschein.
Schweiß rann in einer Bahn von ihrem Haaransatz über ihre pockennarbigen Wangen. Aus ihrem Rock strömte der Geruch von reifen Früchten, Zigarettenrauch, feuchter Wäsche und Fischeinschlagpapier.
Der »Audioerlebnisraum« war eigentlich kein besonderer Raum, sondern nur eine Ecke in der Bibliothek, wo ein CD-Player samt Kopfhörer stand. Dort konnten die Besucher die Aufführungen hören und entscheiden, ob sie die Aufnahme ausleihen wollten. Die Bezeichnung »Audioerlebnisraum« war sicher hochtrabend.
Könnten das meine Eltern sein?, fragte sich Ayami erneut.
Während der zwei Jahre im Theater hatte Ayami niemals einen Tag freigenommen, abgesehen von der einen Woche im August, in der das Theater offiziell geschlossen war. In dieser Zeit war die Schwüle fast unerträglich, deshalb stellte die Stiftung ihren Betrieb ein, kappte die Telefonleitungen und gab allen Angestellten eine Woche Urlaub. Die Stadt schien sich dann in ein riesiges Lebewesen zu verwandeln, das unter einem feuchtheißen, dampfenden Erdhaufen langsam erstickte.
Aus dem glühend heißen Asphalt, der jeden Quadratzentimeter des Bodens versiegelte, und den in den Himmel ragenden Strukturen aus Beton, Eisen und Glas quoll flammender Rauch wie aus Krematorien, während sich die Straßen in kraterähnliche Gruben verwandelten, in denen alle Arten organischer Materie, wie rohes Fleisch, Haut, Augäpfel, Haare und Schweiß, verbrannten. In welche Richtung man seinen Kopf auch wandte, Augen und Haut wurden sofort von einem Hagel flammender Pfeile getroffen, die tödliche Brandwunden hervorriefen. Tausende Sterne explodierten gleichzeitig. Meteore verglühten, Gas verbrannte und das Himmelszelt war überzogen mit schwarzer Asche. Alles Licht war erloschen. Die Nacht brach herein. Doch die Hitze wollte nicht weichen. In der Dunkelheit erschlafften die Fasern, die Körperstrukturen und Fleisch zusammenhielten, und flatterten, wirbelten am Rande des Bewusstseins. Die Identität der Zellen, die den Schlaf bestimmten, löste sich auf. Der DNA