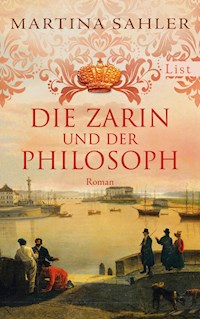9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Wolgasiedler-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Die große Auswanderer-Trilogie über mutige Frauen, tiefe Freundschaften und wahre Liebe: der Auftakt der fulminanten Wolgasiedler-Trilogie über drei mutige Schwestern und ihr dramatisches Familien-Schicksal von Bestseller-Autorin Martina Sahler Das Ufer der Wolga - ein Versprechen vom Neuanfang und unendlicher Weite! Deutschland im 18. Jahrhundert. Nach dem Ende des siebenjährigen Krieges herrscht in dem kleinen Dorf Waidbach in Hessen Hoffnungslosigkeit. Die Schwestern Christina, Eleonora und Klara Weber leiden nach dem Tod ihrer Mutter besonders in der schwierigen Lage. Der Ruf Katharinas der Großen, in Russland ein neues Leben zu beginnen, kommt gerade recht. Angezogen von großartigen Versprechungen auf Land und Geld machen sich die Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, gemeinsam auf die Reise. Doch die Wirklichkeit entspricht weder ihren Erwartungen noch ihren Hoffnungen, erweist sich vielmehr als rau und grausam: Statt eines sorgenfreien Lebens in Wohlstand erwarten die Schwestern zunächst kalte Winter und schwere Arbeit. Werden sie es schaffen, sich an der Wolga ein neues, besseres Leben aufzubauen? Martina Sahler überzeugt mit vielschichtigen Protagonistinnen, ihrem einfühlsamen Schreibstil und großer historischer Genauigkeit. Weiße Nächte, weites Land ist ein wunderbarer historischer Roman, der mit seinen lebendigen Figuren und unberechenbaren Wendungen vor dem Hintergrund der Deutsch-Russischen-Geschichte fasziniert und begeistert. Ausgezeichnet mit dem silbernen HOMER in der Kategorie »Biographie / historisches Ereignis«!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Ähnliche
Martina Sahler
Weiße Nächte, weites Land
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Das Dorf und die Kolonie Waidbach sowie sämtliche Bewohner sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit den Menschen, die tatsächlich im 18. Jahrhundert dem Ruf der russischen Zarin gefolgt und nach Russland ausgewandert sind, wären rein zufällig.
Die Auswanderer aus Waidbach im Jahr 1766:
Christina Weber (20), voller Lebenslust und stets auf der Suche nach ihrem eigenen Vorteil.
Eleonora Scheid, geborene Weber (21), Christinas zurückhaltende Schwester, die ihren Mann Andreas im Siebenjährigen Krieg verloren hat.
Sophia Scheid (3), Eleonoras Tochter.
Klara Weber (8), die jüngste der Schwestern, die auf keinen Fall nach Russland will.
Johann Röhrich (47), Flickschuster und Onkel der Weber-Schwestern. Seine Frauengeschichten sind dorfbekannt.
Marliese Röhrich (41), Johanns Frau, Tante der Weber-Schwestern, dem Alkohol verfallen.
Bernhard Röhrich (20), ältester Sohn der Röhrichs mit großem Verantwortungsgefühl.
Alfons Röhrich (16), zweiter Sohn der Röhrichs, von Geburt an schwachsinnig.
Helmine Röhrich (13), einzige Tochter der Röhrichs, die ihre Mutter aus tiefstem Herzen verachtet.
Franz Lorenz (23), großmäuliger Wirtshausschläger und Knecht auf dem elterlichen Hof.
Matthias Lorenz (21), wortkarger Bruder von Franz und ebenfalls Knecht auf dem elterlichen Hof.
Veronica Mai (22), Schwester der Lorenz-Brüder, die ins Nachbardorf Schönbrunn geheiratet hat.
Adam Mai (24), Veronicas Mann, der ihre gemeinsame Tochter abgöttisch liebt.
Frieda Mai, das neugeborene Kind von Veronica und Adam.
Sebastian Mai (8), Adams jüngerer Bruder, wenig beachteter Nachkömmling mit verkrüppelter Hand, der sich nach Menschen sehnt, die zu ihm gehören.
Anja Eyring (22), einzige Tochter des verwitweten Apothekers Friedrich Eyring mit feuerrotem Brandmal im Gesicht.
Auswanderer, die in Lübeck auf die Waidbacher treffen:
Daniel Meister (25), charmanter Berliner Handwerksgeselle auf Wanderschaft, der eigentlich nach Amerika will.
Anton von Kersen (30), preußischer Offizier und verarmter Adeliger, der hofft, in die Dienste der Zarin treten zu können.
Freunde in Sankt Petersburg:
Nikolaj Petrowitsch (23), bildhübscher Offizier, Liebhaber der Zarin und Lebemann ohne Geldsorgen.
Maria Petrowna (25), Nikolajs Schwester, Studentin der Malerei an der Akademie der Künste in Sankt Petersburg.
… und natürlich: Katharina II. (1729–1796), genannt Katharina die Große, Zarin von Russland seit 1762.
Prolog
Zarskoje Selo bei Sankt Petersburg, Katharinenpalast, Juli 1765
Sie kommen zu Tausenden, Kolja.« Katharina blickte aus dem geöffneten Fenster ihres Schlafgemachs in den Schlosspark, als könnte sie die anreisenden Menschen von ihrem Platz aus sehen.
Die milde Nachtluft trug den Duft von Rosen und Lavendel mit sich und vertrieb den süßlichen Schweißgeruch, der sich nach ihrem Liebesspiel in den Seidenlaken, den Volants und den Brokatvorhängen des Prunkbetts verfangen hatte.
Ein Schimmer wie von Perlmutt erhellte das Zimmer, beleuchtete auf eine unwirklich scheinende Art die mit Gold überzogenen Stuckarbeiten der Decke und die bernsteinfarbenen Intarsien des Toilettentischs.
Die Zarin liebte die Zeit der Weißen Nächte in Sankt Petersburg, doch mehr noch als rauschende Ballnächte in den Palästen genoss sie die intimen Rendezvous, die sie in ihren privaten Gemächern im Katharinenpalast zelebrierte.
Nikolaj Petrowitsch wusste, welches Privileg ihm zuteilwurde, indem er auserwählt worden war, Russlands Alleinherrscherin beizuwohnen.
Andererseits erschien die Wahrscheinlichkeit, zu einem Gespielen der Kaiserin erkoren zu werden, nicht gering, wenn man wie Nikolaj mit einem makellosen Gesicht und einem Körper wie eine griechische Statue gesegnet war.
Weit über Russlands Grenzen hinaus lästerte man in den Wirtsstuben grölend, bei den Banketten hinter vorgehaltenem Fächer, dass Katharina, die im Mai ihren sechsunddreißigsten Geburtstag gefeiert hatte, ihre Sinnlichkeit und Wollust wahrlich keinen Zwängen unterwarf. Sie nahm sich, was ihr gefiel, und genoss die Kunstfertigkeiten der besten Liebhaber – neben den Gefälligkeiten ihres ständigen Begleiters Grigorij Orlow, dem kein noch so ehrgeiziger Günstling den Rang ablaufen konnte, wie man in den Kreisen der jungen Offiziere munkelte.
Nikolaj nippte an seinem Champagnerglas, während er quer auf dem riesigen Bett der Zarin inmitten zerwühlter Tücher lag, die Ecke eines Überwurfs mit flandrischer Spitze nachlässig über die Hüfte gezogen, den Kopf seitlich auf eine Hand gestützt. Sein Oberkörper glänzte im hereinfallenden Licht, die Muskelstränge entlang seiner Oberschenkel verliefen wie von einem Bildhauer gemeißelt.
»Sie folgen Eurem Ruf, Kaiserliche Hoheit. Ihr habt ihnen den Himmel auf Erden versprochen«, sagte Nikolaj.
Katharina lachte, ohne sich umzudrehen. Tief sog sie die Nachtluft ein.
Nikolaj betrachtete ihre festen Schultern, den Schwung ihrer Wirbelsäule, die Rundung ihrer Hüfte, die kräftigen Schenkel. Sie trug nur ein dünnes, bodenlanges Negligé mit schmalem Nerzbesatz an den weit fallenden Ärmeln und Aufschlägen. Links rutschte es ihr von der Schulter und entblößte ihre cremeweiße Haut wie zufällig, aber wer die Zarin kannte, der wusste, dass sie nichts dem Zufall überließ.
Wie sie da fast nackt stand und aus dem Fenster schaute, im Licht des nächtlichen Sommerhimmels wie von innen heraus leuchtend, brauchte sie weder Prunk noch Pomp: Die Haltung ihres Kopfes, die Nackenlinie, die schlanken Hände, die sich auf die Fensterbrüstung stützten – mit jeder Faser ihres Körpers war sie die mächtigste Frau der Welt.
Nikolaj spürte eine allzu bekannte Regung unter der Spitzendecke, während er seine Kaiserin betrachtete. Obwohl er mit seinen dreiundzwanzig Jahren sonst den frisch erblühten Hoffräulein in den Pavillons und – wenn es sich ergab – auch mit besonderem Vergnügen den ganz jungen, verschämt kichernden Zofen in lauschigen Ecken den Vorzug gab, musste er sich im kaiserlichen Schlafgemach eingestehen, dass er nicht vor dem erotisierenden Flair der Macht gefeit war. Es hatte in der Tat seinen ganz eigenen Reiz, wenn die Alleinherrscherin Russlands unter den kraftvollen Stößen seiner Lenden wie von Sinnen um mehr und immer mehr bettelte und spitze Schreie der Lust ausstieß.
»Nicht den Himmel auf Erden, Kolja.« Sie wandte sich ihm zu wie einem Schüler, der einer Belehrung bedurfte. Ein Lächeln umspielte ihren Mund, aber ihre Augen blieben ernst, verhangen noch von den vor wenigen Minuten genossenen Freuden. Eine Strähne hatte sich aus ihrem mit Perlen und Kämmen hochgesteckten Haar gelöst. »Es ist ein Angebot auf Gegenseitigkeit. Meine Landsleute haben erkannt, welch Nutzen ihnen diese Möglichkeit bietet.«
»Auf Gegenseitigkeit? Welchen Nutzen habt Ihr, Eure Majestät, wenn Ihr diese Deutschen holt?« Fragen zu stellen galt als bewährtes Mittel, die Zarin bei Laune und in Plauderstimmung zu halten, wusste Nikolaj. Die Zarin mochte es, ihre Untergebenen über ihre Wohltaten zu unterrichten. Kritische Betrachtungen verkniff man sich lieber, solange man nicht zu dem handverlesenen Kreis ihrer persönlichen Berater gehörte. Davon war der junge Gardeoffizier weit entfernt.
Dass ihn die Zarin in seinem Urteilsvermögen unterschätzte, nahm Nikolaj ohne die geringste Gefühlsregung hin. Sein Ehrgeiz lag nicht darin, die Zarin durch scharfsinnigen, analytischen Verstand zu beeindrucken.
»Nun, das liegt doch auf der Hand, Koletschka.« Sie kam näher und ließ sich neben ihm auf dem Bett nieder, strich mit einem Finger über seine Brust bis zum Schlüsselbein und den Arm hinab. »Der Fleiß der Deutschen ist sprichwörtlich – sie werden nicht mal eine Generation benötigen, um an der Wolga einen wichtigen Stützpunkt für den Handel mit dem Orient, vor allem mit Persien, zu schaffen. Die Bauern unter ihnen werden das Land im Süden urbar machen, sie werden sich vermehren, ihre Dörfer vergrößern, zu Städten anwachsen lassen und so innerhalb kürzester Zeit ein Bollwerk gegen die Steppenvölker bilden, die seit Jahrzehnten mit ihren Angriffen genau da für Unruhe sorgen, wo ich über wenig Handhabe verfüge.«
»Russland ist groß, und die Zarin ist weit«, murmelte Nikolaj zum Zeichen, dass er sie verstanden hatte.
»Genau das meine ich.« Katharina nickte mit einem Lächeln. »Im Gegenzug erhalten die Kolonisten ihr eigenes Land und zinslose Kredite für alle Anschaffungen, die sie zur Errichtung ihrer bäuerlichen Betriebe benötigen. Sie brauchen nicht zum Militär, dürfen ihre Religion frei ausüben – alles Vergünstigungen, die ihnen in ihrem eigenen Land verwehrt bleiben. Insofern – ja, vielleicht ist es für manch einen tatsächlich der Himmel auf Erden, was ich ihnen biete.« Wieder lächelte sie. »Es beglückt mich, wenn meine Landsleute meiner Einladung folgen. Ich mag sie gern hier haben, die Deutschen. Sie werden unserem Land Gutes tun. Wir werden sie mit Samthandschuhen anfassen, damit sie sich hier wohl fühlen.«
Nikolaj nahm einen weiteren Schluck Champagner. Die Zarin hatte sich in eine leidenschaftliche Rede hineingesteigert – die Besiedlungspolitik gehörte zu ihren Lieblingsthemen, wie er wusste. Aber es war unverkennbar, dass sie nicht deshalb mit ihm sprach, weil ihr auch nur ein Deut an seinem Urteil lag. Längst hatte sie ihre Entscheidungen gefällt, ihr Manifest, das Einreisewillige aus den deutschen Fürstentümern nach Russland einlud, wurde in allen Städten und auf den Dörfern verteilt und fand ein gewaltiges Echo, das noch nicht verklungen war. Bei der Festung Kronstadt standen die Soldaten bereit, um die Schiffe aus Lübeck mit den Emigranten in Empfang zu nehmen und die Weiterreise an die Wolga zu organisieren.
Der Plan der Kaiserin ging auf: Die wirtschaftliche Not zwang die deutschen Bauern in die Knie, die sozialen Bedingungen nach dem Siebenjährigen Krieg verschlechterten sich ins Unerträgliche. Das Verlassen der Heimat bereitete ihnen keinen Schmerz, sondern erfüllte sie mit frischem Mut.
Wie verlockend erschien es, ein neues, sorgenfreies Leben im sagenumwobenen Russland zu beginnen, für dreißig Jahre befreit von allen Abgaben und Diensten, mit freiem Schiffstransport und Kostgeld … Nikolaj verstand, was die Menschen antrieb, die in diesen Tagen mit all ihren Habseligkeiten in Bündeln und mit großer Hoffnung im Herzen bei Kronstadt an Land gingen.
Doch konnte die Kaiserin ihre Versprechungen halten? Konnte sie die Lage weit im Süden des Landes an der unteren Wolga kontrollieren, wie sie es plante? Nikolaj bezweifelte es, aber er schwieg.
Die Hand der Kaiserin wanderte von seiner Schulter zu seinem Gesicht, wo sie mit dem Daumen zart über Nasenwurzel und Brauen strich, als wollte sie eine Falte glätten. »Du verstehst das nicht, Kolja, und das brauchst du auch nicht. Vertrau deiner Kaiserin«, flüsterte sie, als hätte er es tatsächlich gewagt, Einwände vorzubringen.
Nikolaj wusste, welche Rolle ihm in dieser Weißen Nacht in Zarskoje Selo zugedacht war, und er beabsichtigte nicht, sie abzustreifen. Ganz im Gegenteil hegte er die nicht unberechtigte Hoffnung, dass ihr nächtliches Rendezvous in nicht allzu ferner Zukunft eine Wiederholung finden könnte. Nikolaj strebte als einer der Liebhaber der russischen Zarin weder Exklusivität an noch eine Sonderstellung als innenpolitischer Ratgeber. Ihm genügte es vollends, im Dunstkreis Ihrer Majestät von ihrer Zuneigung zu profitieren. Wann immer es vonnöten sein sollte.
Ein Glitzern trat in ihre Augen, als sie sich nun über ihn beugte und die Lippen beim Lächeln öffnete, um sie mit der Zungenspitze zu befeuchten. Das Negligé schwang auf und entblößte ihre üppige Brust, als sie in einer langsamen Bewegung einen Schenkel über seine Hüfte hob.
Nikolaj erwiderte ihr Lächeln.
Er war bereit.
Buch 1: Aufbruch
Februar 1766 bei Büdingen
1. Kapitel
Waidbach, Februar 1766
Ihr könnt jetzt zu ihr gehen.« Ein kalter Lufthauch wehte aus der mit Vorhängen abgedunkelten Kammer, als Pastor Jäckel heraustrat. Er zog den Kopf mit dem grauen Haarkranz ein, um nicht gegen den Balken zu stoßen.
Er nickte Christina zu, die vor der Tür gewartet hatte, und nahm dann die hinter ihr stehende Eleonora in die Arme. Christina sah, wie er die knochigen Schultern beugte, ihre Schwester an sich drückte und ihr dabei väterlich über den Rücken streichelte.
Christina hob das Kinn und verschränkte die Arme vor der Brust. Dass sie nicht zu seinen liebsten Schäfchen in der Gemeinde zählte, war kein Geheimnis. Doch wen kratzte das? Wer brauchte die Zuwendung eines weltfremden Pfaffen? Er sollte seines Amtes walten, wann immer er gebraucht wurde wie jetzt am Sterbebett ihrer Mutter, und sich ansonsten aus den Dingen heraushalten, die ihn nichts angingen.
Ob er Mitleid für ihre Schwester empfand? Weil der verfluchte Krieg ihr früh den Mann genommen hatte und sie mit ihrer knapp dreijährigen Tochter zusehen musste, wie sie über die Runden kam?
Aber nein. Nicht die Umstände erwärmten des Pastors Herz für ihre Schwester und ließen eine Zornesfalte zwischen seinen Brauen wachsen, wann immer er in ihre, Christinas, Richtung blickte. Es lag an ihren so unterschiedlichen Wesen.
Dem Pastor passte es seit ihrer frühesten Jugend nicht, dass sie das Leben in vollen Zügen zu genießen verstand und sich mit flinken Fingern als Erste die Rosinen herauspickte, wo immer es Kuchen gab.
Das bescheidene Auftreten ihrer Schwester hingegen, ihre Sanftmut, ihr Gemeinschaftssinn und ihr geradliniges Denken fanden von Kindheit an seine Zustimmung und zauberten, wann immer er ihr begegnete, ein unerträglich gütiges Lächeln auf sein langes, faltiges Gesicht.
»Komm jetzt!« Sie packte Eleonora an der Schürze, die sie über ihrem Winterkleid trug, und riss sie aus der Umklammerung des Geistlichen.
»Ich will auch zu Mutter, ich will auch!« Die schrille Stimme der achtjährigen Klara erklang aus der Wohnstube, dann das Poltern, als sie die drei Stufen hinauf zum ersten Stockwerk des Fachwerkhauses hastete.
»Pst«, zischte Christina ihr zu.
Pastor Jäckel nahm Klaras von Sommersprossen übersätes Gesicht in beide Hände und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. »Geh mit deinen Schwestern, Klara, und nimm Abschied in Würde.«
»Abschied? Oh, nein, Herr Pastor, bitte nicht. Bitte machen Sie, dass sie noch nicht stirbt! Sie darf noch nicht sterben. Was soll aus uns werden, wenn sie nicht mehr da ist? Bitte, Herr Pastor, helfen Sie ihr …«
»Kindchen, Kindchen …« Der Geistliche presste das Mädchen an sich, streichelte über die zu Kringeln aufgedrehten honigfarbenen Zöpfe. »Gott ruft sie zu sich. Ihre Stunde ist gekommen. Hilf ihr, in Ruhe und Frieden zu gehen.«
Klaras Schluchzen an seinem Bauch verebbte. Zitternd zog sie die Nase hoch und wischte sie sich mit dem Blusenärmel ab.
Eleonora drängte sich in dem engen Flur, in dem sich der Geruch nach feuchtem Holz mit dem abgestandenen Rauch des Bollerofens aus der Küche mischte, an dem Pastor vorbei. »Wo ist Sophia? Hast du nicht gerade noch mit ihr gespielt, Klara?«
Christina unterdrückte ein Seufzen. Selbst in der Todesstunde der Mutter galt die größte Sorge ihrer Schwester wie stets dem Töchterchen.
Klara wies mit dem ausgestreckten Arm in die Wohnstube. »Sie spielt mit dem Kochgeschirr und den Löffeln auf den Dielen. Ich habe ihr eine Wolldecke untergelegt, wegen der Kälte vom Boden.«
Eleonora linste um die Ecke, um sich selbst zu vergewissern, dass es dem Kind an nichts fehlte. Der sorgenvolle Blick in ihren Augen blieb.
Nacheinander betraten die drei Schwestern das Sterbezimmer der Mutter. Das herb-bittere Aroma von Kräutern überlagerte den Modergeruch der Holzbalken. Der Doktor hatte strenge Anweisung gegeben, die Fenster nicht mehr zu öffnen, und so wölkte sich seit Tagen über dem schmalen Holzbett etwas wie der Hauch des Todes, den Theresa Weber mit jedem Ausatmen verströmte.
Christina setzte sich links von ihr auf den einzigen Hocker. Das Holz knarrte. Rechts von ihr ging Eleonora auf die Knie. Klara kauerte sich ans Fußende, umklammerte durch die Laken hindurch die Beine der Mutter und bettete den Kopf in ihren Schoß, während die Tränen über die Kinderwangen liefen.
»Mutter …« Christinas Stimme klang belegt, als sie das Gesicht der Sterbenden betrachtete. Wächsern wölbten sich die Wangenknochen unter der grauen Haut. Die Augen lagen tief in den Höhlen, von Schatten umgeben. Der Mund war eingefallen, die Lippen nach innen geglitten, die Unterlippe bebte bei jedem Ausatmen, das der Sterbenden Mühsal zu bereiten und den letzten Rest ihrer Lebenskraft zu kosten schien. Ihre Brust hob und senkte sich unter dem Tuch.
Theresa griff nach Christinas Ellbogen, mit der Rechten tastete sie nach Eleonora, die die knochigen Finger der Mutter mit beiden Händen umfing. Theresas Blick unter halbgeschlossenen, wimpernlosen Lidern heftete sich auf Christina. »Du musst es mir versprechen«, hauchte sie.
Christinas Herz begann zu pochen, während sie näher mit dem Ohr an den Mund der Sterbenden ging. »Was soll ich dir versprechen, Mutter? Was?«
»Du musst mir versprechen, dass du dich um deine Schwestern kümmerst. Dass du die Weberei fortführst mit allen Kräften, zu denen du fähig bist …« Ein heftiger Hustenanfall unterbrach Theresa. Kraftlos röchelte sie und atmete pfeifend ein. Endlich beruhigte sie sich so weit, dass sie fortfahren konnte. »Die Weberei ist alles, was ihr besitzt. Ihr müsst neue Kunden gewinnen, reichere Kunden, bessere Garne erwerben, nicht nur den Flachs von der Wiese verspinnen … Der Pastor wird euch helfen …«
»Mutter, die Weberei … ich … Ich verspreche dir, dass ich die Schwestern nicht im Stich lasse. Wir werden einen Weg finden. Du kannst in Frieden schlafen, wir werden es schaffen …«
»Die Weberei, Christina, das Lebenswerk eures Vaters. Er hat es sich so sehr gewünscht …«
»Ja, Mutter, wir versprechen es!« Klaras helle Mädchenstimme unterbrach das Flüstern der beiden. »Wir versprechen, dass wir die Weberei fortführen! Ich werde von morgens bis abends am Webstuhl sitzen, des Nachts das Spinnrad treten und mich bis nach Büdingen umhören, wo Leinwand vonnöten ist, damit wir neue Aufträge bekommen.«
Christina schoss ihr einen strafenden Blick zu, sah dann zu Eleonora, die die Stirn auf die Hand der Mutter gedrückt hielt. Ihre Schultern bebten.
Christina strich der Mutter die verfilzten Haare aus dem Gesicht. »Ich werde mich um alles kümmern. Du kannst dich auf mich verlassen. Uns wird es bessergehen als jemals zuvor, das schwöre ich dir beim Andenken unseres Vaters.«
Eigentlich hätte es Eleonora zugestanden, dieses letzte Gespräch mit der Mutter zu führen. Mit ihren einundzwanzig Jahren war sie die älteste der drei Weber-Töchter, Christina ein Jahr jünger. Klara war gerade erst acht geworden.
Es stellte aber schon seit vielen Jahren unter den Weber-Frauen niemand in Frage, dass Christina bei allen wichtigen Entscheidungen das Sagen hatte. Wie lebenstüchtig, schlau und zäh sie war, hatte sie bei vielerlei Gelegenheiten in ihrem Weiberhaushalt bewiesen. Sie war diejenige, die immer einen Laib Brot, einen Korb Eier oder ein Huhn von irgendwoher auftrieb, wenn der Hunger gar zu sehr drückte. Die irgendein Mannsbild – einen Knecht vom Nachbarhof, einen Gesellen auf der Wanderschaft – ins Haus schob, wenn der alte Webstuhl im Kellergewölbe mal wieder hakte und sich festgezurrt hatte. Die eine Handvoll fröhlicher Mägde überredete, beim Spinnen zu helfen, und ihnen dafür als Lohn im Weber-Haus lustige Gesellschaft mit den Burschen aus der Nachbarschaft bot.
Christina füllte diese Führungsrolle in der Familie mit Selbstverständlichkeit aus. Eleonora war nicht der Typ Frau, der sie ihr streitig machte. Klara war von einem anderen Schlag, aber wiederum viel zu jung, als dass sie überhaupt jemand ernst nahm.
»Ruhe in Frieden, Mutter«, flüsterte Eleonora nun, da die Atemzüge der Mutter immer dünner wurden und sich ein Engelslächeln wie von einem Neugeborenen auf ihren Zügen ausbreitete.
»Ruhe in Frieden«, hauchte auch Christina in dem Moment, als Theresa ihren letzten Atemzug tat und die Luft kaum vernehmbar zwischen ihren Lippen ausströmte.
Klara schluchzte auf und schlug die Hand vor den Mund, um den Laut wie von einem gequälten Tier zu unterdrücken.
Eleonoras und Klaras Augen waren immer noch rot verquollen, als die drei Schwestern wenig später in der Stube saßen und in kleinen Schlucken heiße Milch tranken. Gleich würde der Tischler klopfen. Wie stets würde er der erste Dorfbewohner sein, der Eintritt ins Trauerhaus erhielt, um die Maße für den Sarg zu nehmen.
Sie wärmten ihre klammen Finger an den Bechern, aber die innere Kälte blieb.
»Wie geht es weiter mit der Weberei?«, fragte Klara schließlich. Sie streckte Sophia einladend die Arme entgegen, aber das Kind kuschelte sich nur noch enger auf dem Schoß der jungen Mutter zusammen. Eleonora schlang die Arme um ihr Töchterchen, als müsste sie es beschützen vor dem Tod, der durch das Haus geschlichen war und sich geholt hatte, wonach ihn verlangte.
»Gar nicht geht es weiter mit der Weberei«, gab Christina zurück. Der Tod der Mutter verursachte ein wehes Ziehen in ihrem Herzen. Andererseits kam er nicht unerwartet – sie hatten sich seit vielen Wochen, in denen die Mutter das Bett nicht mehr verlassen hatte und nicht einmal die dünne Suppe bei sich behalten konnte, darauf vorbereitet.
Klara erstarrte.
Eleonora blickte ihre Schwester an. »Was hast du vor?«
Noch bevor sie antworten konnte, sprang Klara so abrupt auf, dass der Stuhl hinter ihr zu Boden polterte und gegen das hölzerne Spinnrad stieß. Mit dem Zeigefinger wies sie auf ihre Schwester, als wollte sie sie aufspießen. »Du hast es ihr versprochen! Du hast versprochen, dass du dich um die Weberei kümmerst. Kaum ist sie tot, da brichst du deinen Schwur schon wieder. Ich hasse dich, Christina, ich hasse dich so sehr!« Die Tränen zogen Spuren durch den Schmutz auf ihren Wangen.
Christina schüttelte den Kopf. »Denk nach, Klara. Ich habe Mutter nichts versprochen, was mit der Weberei zu tun hat. Das warst du.«
Klara fiel der Kiefer herab. Sie rückte das Spinnrad zurecht, hob den Stuhl wieder auf und ließ sich auf die geflochtene Sitzfläche plumpsen. »Wie … wie meinst du das? Eleonora, du hast gehört, was Christina gesagt hat, oder? Kümmern wollte sie sich!« Flehend wandte sie sich an ihre Lieblingsschwester.
Eleonora vergrub die Nase in den dichten Haaren ihrer Tochter, deren Farbe von Holunderbeeren sie ihr vererbt hatte. Die dunkelhaarige junge Mutter mit den saphirblauen Augen, den markanten schmalen Brauen, den weichen Gesichtszügen und den vollen Lippen und das Mädchen in ihrem Arm, das ihr jüngeres Ebenbild war, boten einen Anblick, der jedem Maler entzückt hätte. Nur der trauernde Ausdruck störte den Moment der Schönheit. »Man muss vorsichtig sein mit Schwüren, Klara. Niemals darf man leichtfertig etwas versprechen, von dem man nicht weiß, ob man es halten kann. Wie sollte es uns ohne Mutter gelingen, dem Flachsanbau, der Spinnerei, dem Weberbetrieb neuen Aufschwung zu geben, wenn es uns schon mit ihr nicht gelungen ist? Ich weiß, wie sehr sie es sich wünschte, aber bei klarem Verstand hätte sie das niemals von uns verlangt. Es ist unmöglich. Wir haben in den vergangenen Jahren nichts unversucht gelassen, und trotzdem … Am Ende wissen wir nicht einmal, wie wir den Tischler bezahlen sollen, der ihren Sarg zimmert.« Sie schluckte.
»Es ging ihr darum, dass wir versorgt sind«, widersprach Klara. »Was haben wir denn sonst außer dem Geschäft mit der Leinwand? Wovon sollen wir leben?« Eleonora gegenüber verlor ihre Stimme an Schärfe, auch wenn sie immer wieder bitterböse Blicke in Christinas Richtung warf.
Diese lauschte dem Gespräch ihrer Schwestern, während sie den Becher auf dem Tisch in den Händen drehte. Einzelne Locken ihrer Haarpracht, die sie unter einer Haube mit Klammern und Spangen zu bändigen versuchte, ringelten sich um ihr herzförmiges Gesicht. Die Wimpern warfen sichelförmige Schatten auf ihre Wangenknochen, als sie die Lider senkte.
War dies nun der rechte Zeitpunkt, um die Schwestern in ihre Pläne einzuweihen? Die Mutter war kaum eine Stunde tot …
Ein Winkelzug des Schicksals, dass ausgerechnet Pastor Jäckel den Weg gewiesen hatte. Das hatte er sich doch stets gewünscht, oder? Seit er vor fünf Wochen nach dem Gottesdienst das Manifest der russischen Zarin Wort für Wort, kommentarlos und mit stoischer Miene der Gemeinde der Protestanten vorgetragen hatte, war Christina wie besessen von der Idee, alle Brücken abzubrechen und in der Fremde ein neues Leben zu beginnen. Alles, alles klang verlockend – die freie Schiffspassage, das Handgeld, das kostenlose Land, die zinslosen Kredite … Welche Möglichkeiten sich da auftaten!
Christina fühlte Schwindel, wann immer sie von ihrem neuen Leben zu träumen begann, aber sie wusste auch, dass ihre Mutter niemals ihre Zustimmung gegeben hätte. Deswegen hatte sie ihren Plan bis zu diesem traurigen Tag gehütet wie einen kostbaren Schatz, obwohl sie schier platzte vor Abenteuerlust.
»Ich habe mich bereits nach neuen Möglichkeiten für uns umgehört«, unterbrach sie nun mit immer noch gesenktem Blick und unterdrückter Begeisterung den Wortwechsel zwischen Eleonora und Klara.
Schweigen senkte sich über die drei Schwestern. Mit vorgeneigtem Kopf starrten Klara und Eleonora sie an, während Sophia in den Armen ihrer Mutter am Daumen nuckelte.
Endlich hob Christina die Lider. Ihre Augen funkelten vor Übermut und Lebenshunger. Nur wer den Mut hat zu träumen, hat auch die Kraft zu kämpfen, dachte sie. »Wir ziehen nach Russland«, sagte sie.
Johann Röhrich schritt in der Wohnstube auf und ab wie ein Bär an der Kette. Das Stampfen seiner Schritte hallte von den Backsteinwänden wider, während er die Hände zu Fäusten geballt hielt.
Wann immer er das Fenster zur Dorfstraße erreichte, lugte er hinaus auf den Weg, der zu seinem Hof führte, wo er Rinder und Kleinvieh hielt. Ansonsten betrieb er hier seine Flickschusterwerkstatt, die ihm und seiner Familie in den besseren Wochen das tägliche Brot sicherte. Zu seinen wertvollsten Besitztümern gehörten drei Milchkühe. Butter, Quark und drei Sorten Käse verkauften oder tauschten die Röhrichs in den umliegenden Dörfern.
Auf dem unebenen Weg, der das Langdorf Waidbach schnurgerade durchschnitt und von dem der Pfad zum Hof abzweigte, rumpelte ein Treck mit vielleicht einem Dutzend Fuhrwerken vorbei. Die Alten und die kleinen Kinder hockten zwischen dem mit Seilen und Tüchern befestigten und gegen das Wetter geschützten Mobiliar, alle anderen liefen nebenher, viele in ihrem Sonntagsstaat. Männer trieben schnalzend die Gäule an und zogen mit ausholenden Schritten in Richtung Büdingen. Ihr munterer Wandergesang drang zu Johann.
Der Flickschuster presste die Lippen aufeinander. Bald, bald, dachte er. In den Wirtshäusern in Büdingen grassierte schon lange das Russlandfieber. Er beabsichtigte allerdings nicht wie viele andere Bauern, Handwerker und Tagelöhner, seinen Besitz unter Wert an einen der Juden zu verkaufen, die die russische Zarin ausdrücklich von der Einladung in ihr riesiges Reich ausgeschlossen hatte. Er wollte einen Höchstpreis erzielen, obwohl das bedeutete, dass er sich noch gedulden musste, bevor er mit seiner Familie aufbrechen konnte. Eile war kein guter Begleiter, wenn es ums Geschäftemachen ging.
Am letzten Sonntag hatten sie seine Schwester zu Grabe getragen, die Theresa Weber, deren Mann genau wie ihr Schwiegersohn im Siebenjährigen Krieg gefallen war und die drei Töchter hinterließ. Zwei von ihnen waren allerdings keine Kinder mehr, nein, weiß Gott keine Kinder.
Johann stieß ein heiseres Lachen aus, während er wieder durch die Scheibe nach draußen stierte. Er kratzte sich im Schritt. Wo blieb sie nur?
Einmal die Woche kam seine Nichte Christina auf den Hof, um die Milch für die Familie Weber zu holen. Und um die Rechnung zu begleichen, wobei es Johann weder um klingende Münzen noch um grobes Leinen ging. Er leckte sich über die Lippen und griff sich ein weiteres Mal zwischen die Beine, um sein anschwellendes Glied in eine bequemere Lage zu bringen.
Es war wie verhext. Er brauchte nur an Christina zu denken, an ihre jungen Brüste, die wie saftige Äpfel in seine Pranken passten, an das weiße Fleisch ihrer Hinterbacken, die sich ihm lustvoll entgegenreckten, und ihm platzte schier die Hose vor Geilheit. Es verwunderte ihn vor allem deshalb, weil sie sich schon seit mittlerweile zwei Jahren zu ihren heimlichen Stelldicheins trafen, seine Lust auf sie aber immer noch zu wachsen schien.
Johann Röhrich hatte so viele Frauen in seinem Leben gevögelt, dass er nicht auskäme, wenn er an jedem Finger zehn abzählte. Die Namen hatte er alle vergessen. In den meisten Fällen hatte ein einziges Mal gereicht, um seine Gier zu stillen.
Nur mit Christina lief es anders. Das Luder verstand es, allein durch ihren wiegenden Gang, durch diese ganz eigene Art, ihm glutvolle Blicke hinter halbgesenkten Lidern zuzuwerfen, durch ihr tiefes Lachen oder eine scheinbar zufällige Berührung sein Feuer immer wieder aufs Neue zu entfachen. Vielleicht aber, und diesen Gedanken spann Johann Röhrich lieber nicht weiter, lag es auch daran, dass sie ihm zu einer Zeit in die Hände gefallen war, in der er sich dem Tod näher fühlte als dem Leben. Er war siebenundvierzig Jahre alt, und der Kriegsdienst sowie die Hungerwinter hatten ihre Spuren hinterlassen.
»Was … stapfst du hin und her?«
Johann fuhr herum und starrte zu dem langen Esstisch, an dem soeben noch seine Frau Marliese, den Kopf auf den Unterarm gebettet, geschnarcht hatte. Nun richtete sie sich auf, wischte sich mit dem Ärmel über das feuchte Kinn und versuchte, ihren Oberkörper im Gleichgewicht zu halten, während sie ihren Mann lallend ansprach.
»Geh ins Bett!«, erwiderte er mühsam beherrscht. »Schlaf deinen Rausch aus, alte Vettel.« Er presste die Fäuste zusammen, dass die Haut sich spannte. Ihn juckte es in den Händen, der Alten mit ein paar Schlägen das Maul zu stopfen. Wie sie ihn anekelte. Wie sie sich an dem Tisch breitmachte, auf dem er im Geiste bereits die gespreizten Schenkel unter den hochgeschobenen Röcken seiner Nichte gesehen hatte.
Von Jähzorn gepackt, sprang er auf seine Frau zu, zerrte sie an den Schultern hoch. »Pack dich, du Schlampe! Ich will dich hier nicht mehr sehen.«
»Ich … will hier sein. Gib mir noch Branntwein!«
Johanns Kopf ruckte herum, bis sein Blick auf den halbvollen Becher fiel. Er nahm ihn und setzte ihn seiner Frau an die Lippen, schüttete und schüttete, obwohl sie zu husten begann und der scharfe Schnaps ihre Mundwinkel und ihren Hals hinablief. Sie japste und röchelte, doch er ließ sie erst los, als der letzte Tropfen vergossen war.
»So, hast du nun genug?« Er drehte sie herum, führte sie mit eisenhartem Griff in die angrenzende Kammer, gab ihr einen Stoß, so dass sie vor dem Bett zusammenbrach. Dann warf er die Tür zu.
Er atmete schwer, als er in die Wohnstube zurückkehrte.
Wo blieb Christina nur, verdammt. Marliese jedenfalls würde ihn in der nächsten Stunde nicht stören, seinen Sohn Bernhard wusste er in der Werkstatt, die er nicht vor den Abendstunden schließen würde. Seine dreizehnjährige Tochter Helmine verdingte sich als Helferin bei den Waschfrauen am Dorfbrunnen.
An seinen Sohn Alfons verschwendete Johann keinen Gedanken – er war von Geburt an schwachsinnig und verbrachte den größten Teil seiner Zeit brabbelnd im Bett, wo er zusammengekrümmt wie ein Säugling lag und seine Finger betrachtete oder beleckte.
Was hätte Johann darum gegeben, wenn ihm seine verlotterte Frau und der Schwachkopf weggestorben wären, bevor er in sein neues Leben aufbrach. Wie Eitergeschwüre hingen ihm die beiden am Bein. Johann hegte die Hoffnung, dass die wochenlange Reise nach Russland über ihre Kräfte gehen würde, und malte sich in beglückenden Träumen aus, wie die erkalteten Körper seiner Frau und seines Sohnes über die Reling des Schiffes, das sie von Lübeck nach Kronstadt bringen würde, gehievt wurden und auf den Grund der Ostsee sanken.
Endlich ging die Tür auf. Beleuchtet vom trüben Licht der Februarsonne, stand sie vor ihm wie ein Engel, in der Hand die blecherne Milchkanne, im Gesicht dieses Lächeln, das mehr Einladung als Gruß war.
Er trat auf sie zu und riss sie in die Arme, um sie atemlos zu küssen. Seine Bartstoppeln kratzten über ihre Samthaut. Gleichzeitig nestelte er mit der Rechten an ihrem Mieder, gierig darauf, endlich das zarte Fleisch zu kneten. Scheppernd ging die Milchkanne zu Boden.
Christina stemmte sich mit den Fäusten gegen die Brust des Onkels. Dann löste sie eine Hand, ließ sie tiefer gleiten und umfasste durch den Stoff der Beinlinge sein angeschwollenes Glied, während sie ihn triumphierend anschaute.
Johann stöhnte auf und legte den Kopf in den Nacken, als er ihre Finger spürte, die so feingliedrig waren und doch so fest zugreifen konnten. Der eben noch erlebte Jähzorn heizte seine Triebe an wie Öl das Feuer. Er war wie von Sinnen vor Begierde, und dieses Luder spielte mit ihm.
»Ich sehe, du hast auf mich gewartet.« Christina lachte auf.
»Komm rein, ich besorg’s dir hier gleich auf dem Tisch«, keuchte er. »Dir wird das Lachen schon vergehen, du Miststück.«
»Wo ist Tante Marliese?«
»In der Schlafkammer. Die wird uns nicht stören, die Alte. Sturzbesoffen ist sie mal wieder.«
»Wenn sie aufwacht?«
»Wird sie nicht. Komm schon …« Wieder wollte er sie küssen, mit den Lippen ihre frei liegenden Brüste umfangen, aber sie entwand sich ihm und knöpfte das Mieder zu.
»Das ist zu riskant. Ich möchte nicht von Tante Marliese überrascht werden.«
»Gehen wir in die Scheune.« Schon packte er sie am Ellbogen und zog sie hinter sich her.
Christina kicherte über seine Eile. Ihre Unbeschwertheit spornte ihn nur noch mehr an.
In der Scheune ließ er sich nicht länger aufhalten. Er drehte Christina in seinen Armen herum, drückte ihren Rücken nieder, so dass sie sich mit beiden Händen an einem der Holzbalken festhalten musste, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Mit einer Hand hob er ihre Röcke, mit der anderen öffnete er seine Gürtelschnalle und ließ die Hose auf die Waden fallen. Tief drang er in sie ein, stieß im rasenden Rhythmus wieder und wieder gegen ihr weiches Fleisch, bis er zu explodieren glaubte.
Mit geübtem Griff glitt er aus ihr heraus und erleichterte sich stöhnend ins Heu. Fast übermenschliche Überwindung kostete ihn dieser Schritt jedes Mal, aber er nahm es in Kauf, weil ihm die Nichte als kecke Gespielin tausendmal lieber war denn als trächtige Stute.
Während Christina ihre Röcke wieder ordnete und ihr Mieder zuknöpfte, ließ sich Johann, tief ermattet, breitbeinig auf dem mit Stroh bedeckten Boden nieder. Sein schlaffes, feucht glänzendes Glied lag wie ein toter Wurm zwischen seinen behaarten Beinen. Er atmete mit geöffnetem Mund und hielt die Lider geschlossen. Als er die Augen aufschlug, stand Christina immer noch da, fertig angezogen, abwartend.
»Worauf …? Ach so.« Er grinste und beugte sich vor, um in den an seinem Gürtel befestigten Lederbeutel fassen zu können. Von unten schnipste er ihr eine Münze zu, die sich mehrmals in der Luft drehte.
Christina fing sie gekonnt auf und steckte sie in ihr Dekolleté. Sie knickste und neigte spöttisch lächelnd den Kopf. »Danke, Onkel.«
»Wo die Milch steht, weißt du«, fügte er noch hinzu.
Sie nickte, warf ihm eine Kusshand zu und wandte sich zum Gehen.
»Ach, Christina?«
Schon am Scheunentor, drehte sie sich noch einmal um. Fragend hob sie eine Braue.
»Habt ihr schon einen Termin vom Werber?«
Christina schüttelte den Kopf. »Es … es gibt da noch einiges zu erledigen …«, erwiderte sie vage.
»Wir sollten es so einrichten, dass wir als Großfamilie gemeinsam losziehen.«
Aus Christinas Gesicht wich die Farbe. »Wie … wie meinst du das? Gemeinsam? Wollt ihr auch Haus und Hof verlassen und nach Russland übersiedeln?«
Johanns Brust bebte vor Lachen. »Was dachtest du denn? Die Steuern hier fressen den größten Teil meiner Einnahmen. Bei den Russen brauchen wir dreißig Jahre lang keine Abgaben zu zahlen. Stell dir das vor!«
»Aber … aber … was ist mit Tante Marliese, mit Alfons? Die beiden … wie wollen sie die Reise überstehen? Ich dachte, wegen ihnen würdest du bleiben?«
Johann spuckte neben sich aus, rappelte sich auf die Beine, zog die Hose hoch und begann, den Gürtel zu schnallen. »Geht mich das was an? Wenn sie mitwollen, werden sie die Zähne zusammenbeißen müssen. Wenn sie krepieren, brauche ich zwei hungrige Mäuler weniger zu stopfen. Ich weine ihnen keine Träne nach.«
Wieder lachte er, während Christina erschauderte und ohne ein weiteres Wort verschwand.
Christina legte das Schultertuch über ihren Scheitel, als sie den Weg zum Weber-Haus einschlug. Die Schneeschmelze hatte erst vor wenigen Tagen eingesetzt. Matschig und voller Schlaglöcher, in denen sich das Eiswasser sammelte, lag die Straße vor ihr.
Obwohl sie die Worte ihres Onkels nicht unvermittelt trafen – sie kannten sich lange genug – und obwohl sie selbst genau wie er dazu neigte, ihre eigenen Belange weitaus wichtiger zu nehmen als die Gefühle ihrer Mitmenschen, verursachte ihr seine Grausamkeit leichtes Unbehagen.
Bevor Tante Marliese jedes Maß beim Trinken verloren hatte, galt sie im Dorf als eine durchaus liebenswerte Frau, deren Melancholie jeden anrührte, nur nicht ihren eigenen Mann.
Und Alfons, der Idiot? Einmal hatte sie ihm aus einer Laune heraus an Weihnachten einen Strohstern gebracht. Er hatte gestottert, unverständliches Zeug gebrabbelt und vor Freude geweint wie ein Kind, das er mit seinen sechzehn Jahren nicht mehr war. Der Speichel war aus seinen Mundwinkeln auf ihre Schulter getropft, als er sie viel zu fest umarmte.
Aber dass Johann mit seiner Familie beabsichtigte, genau wie sie nach Russland auszuwandern – damit hatte sie nicht gerechnet.
Es passte ihr nicht in die Pläne.
Ebenso wie ihr ärmliches Leben im Weber-Haus wollte sie den Onkel mit seinen fordernden Pranken hinter sich lassen.
Hatte es sie anfangs mit Stolz erfüllt, ein gestandenes Mannsbild mit ihrem jungen Körper schier in die Raserei zu treiben, empfand sie ihn inzwischen nur noch als eine Last. Obwohl er es nie aussprach, wusste sie, dass er auf seinem Alleinrecht an ihren Gefälligkeiten bestand. Wären da nicht die Milch für die Schwestern und die Münzen, die er ihr für besondere Wünsche zuwarf, hätte sie die Angelegenheit schon lange beendet.
War es nicht eine Schande, dass sie ihre Jugend an diesen alten Mann verschwendete?
Wenn sie mit einem Lächeln auf den Lippen nackt vor dem fast blinden, gesprungenen Spiegel in ihrer Kammer posierte und dem Herrgott für die Vollkommenheit ihres Körpers dankte, fragte sie sich in den letzten Wochen immer häufiger, ob sie mit ihrer weit über die Dorfgrenzen hinaus gerühmten Schönheit nicht viel mehr erreichen konnte. Sehr viel mehr.
Sie sprang zur Seite, als sie hinter sich das Rumpeln eines Karrens vernahm. Familie Melcher zog an ihr vorbei, der Vater führte mit dem jugendlichen Konrad den Gaul, die Mutter schritt, das Kopftuch unterm Kinn geknotet, neben dem Wagen einher, auf dem die beiden jüngsten Sprösslinge hockten. Sie nickten ihr zu. Konrad grinste und drehte sich zu ihr, um ihr zuzuzwinkern.
Christina hob den freien Arm. »Wohlan! Gute Reise!«
»Worauf wartest du noch, Christina?«, rief Konrad beherzt. »Komm, schließ dich uns an!« Das brachte ihm einen kräftigen Schlag mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Die Ohren des Jungen glühten dunkelrot ob der Demütigung.
Christina lachte ihn aus. Sie wusste, dass die Melchers nach Büdingen zogen, wo sich in diesen Tagen alle Auswanderer der Grafschaft Ysenburg sammelten.
Ein paar Tage eindringliche Überzeugungskraft hatte es sie gekostet, ihrer Schwester Eleonora die Auswanderung nach Russland als ihre einzige Chance darzustellen. Letzten Endes gab wohl ihre Beteuerung, dass nur dort auf Sophia eine sorglose Zukunft wartete, den Ausschlag, dass sich Eleonora nicht länger widersetzte.
Es war schon ein Kreuz mit Eleonora, befand Christina. Während sie selbst das Glück bei jeder sich bietenden Gelegenheit beim Schopfe packte, brauchte Eleonora für alle Entscheidungen eine schier unendliche Zeit des Nachdenkens und Abwägens. Niemals setzte sie auf Risiko, niemals entschied sie aus dem Bauch heraus.
Auch äußerlich waren sie so verschieden, dass keiner sie für Schwestern hielt. Während Christina die hellen Haare und die Haut der Mutter geerbt hatte, schimmerten Eleonoras Haare nachtschwarz wie die der Großmutter väterlicherseits, die längst das Zeitliche gesegnet hatte.
Wer von ihnen beiden nun die Schönere war, vermochte kein Mensch zu beurteilen. Fest stand nur, dass Christina mehr Eifer darein legte, ihr Aussehen gewinnbringend einzusetzen, während sich Eleonora schon in jungen Jahren an den gleichaltrigen Andreas gebunden, ihn mit siebzehn geheiratet und noch im selben Jahr wieder verloren hatte. Nun saß sie da mit ihrer Schönheit und ihrem Kind. Welcher Mann wollte schon eine Frau mit dem Blag eines anderen?
Christina lächelte, als sie daran dachte, wie einfach es war, eine Schwangerschaft zu verhindern. Beim ersten Mal hatte sie gestaunt, als Johann seinen Samen statt in sie auf den Boden verspritzte. Aber dann erkannte sie, dass dies die schlicht perfekte Methode war, um zu verhüten, dass ein Kind in ihr heranwuchs.
Warum nur machten das nicht alle so?, fragte sie sich. Wie viel Leid könnte verhindert werden, wenn der Samen der Männer nicht in den Frauen aufging, sondern auf dem Boden vertrocknete?
Ganz davon abgesehen war ein Kind, gar von Johann, das Letzte, was sie in ihrem Leben gebrauchen konnte. Mütterliche Regungen bei anderen gingen ihr auf die Nerven. Noch das beste Gefühl, das sie überkam, wenn ihre Schwester das Töchterchen abherzte, war Unverständnis.
Eleonora hatte sie von ihren Auswanderungsplänen überzeugen können, aber Klara führte sich bockiger als ein Maultier auf, seit sie wusste, dass es sich bei Christinas Ankündigung, die Heimat zu verlassen, keineswegs um einen üblen Scherz, sondern um einen bereits ausgeklügelten Plan handelte.
Geschrieen und gestampft hatte sie wie der Leibhaftige und Flüche ausgestoßen, die selbst Christina vor Scham das Blut in die Wangen trieben. Christina hatte die Hand gegen die Schwester erhoben, aber noch im Rauslaufen hatte Klara ihre Beschimpfungen fortgesetzt.
In Erinnerung daran kochte erneut Zorn in Christina hoch. Was bildete sich dieses missratene Geschöpf ein? Glaubte sie tatsächlich, auf diese Art ihre Pläne durchkreuzen zu können? Keinesfalls würde sie sich von der jüngeren Schwester in die Suppe spucken lassen. Sie würde zu drastischen Erziehungsmaßnahmen greifen, falls die Göre sich noch länger gebärdete wie tollwütig. Was konnte schlimm daran sein, der Einladung der mächtigsten Frau der Welt in ihr Land zu folgen? Zarin Katharina war selbst Deutsche. Hatte es ihr etwa geschadet, die Heimat zu verlassen?
Christina sah auf, als ihr eine hagere Gestalt entgegenkam, den Kopf gesenkt gegen den leichten Wind, die Kapuze des Umhangs, der um sie flatterte wie um das hölzerne Gerippe einer Vogelscheuche, weit in die Stirn gezogen. Trotzdem erkannte Christina sie sofort – Anja Eyring, die Tochter des Apothekers.
Mit einem flüchtigen Nicken wollte Anja an ihr vorbeilaufen, aber Christina sprach sie an. »Gott zum Gruße, Anja! Dank dir nochmals für die Kräutersalbe, die du gebracht hast.«
Christina kannte die zwei Jahre ältere Frau wie alle Bewohner von Waidbach und den angrenzenden Dörfern. In der kurzen Zeit der Kindheit hatten sie miteinander auf den Feldern herumgetollt, bevor das Leben sie lehrte, ums Durchhalten zu kämpfen und die Schüsseln auf dem Tisch zu füllen, statt übermütig den Feldhasen hinterherzujagen und Wildblumen zu Kränzen zu binden.
Offenbar widerwillig blieb Anja stehen und linste unter der Kapuze hervor, ohne sie abzunehmen. Christina wusste, dass sie jede Möglichkeit nutzte, das Feuermal, das sich von ihrer linken Wange über den Hals bis zur Brust zog, zu verbergen. »Hat ja nun nichts genutzt. Mein Beileid noch, Christina, zum Tod der Mutter.«
»Danke, Anja. Doch, hat was genutzt. Immerhin konnte sie deshalb die letzten Tage besser atmen.«
Anja hob die Schultern. »Ich muss weiter. Die Veronica kommt nieder. Die Hebamme hat nach mir rufen lassen wegen der Salbe zum Dehnen …«
Christina nickte und setzte ihren Weg fort. Solcherart Neuigkeiten kümmerten sie nicht.
Links bog sie zum Weber-Haus ab. Aus der Entfernung erschien ihr das morsche Fachwerk mit den rissigen Füllungen, als könnte der nächste kräftige Windstoß es umpusten wie ein Kartenhaus.
Der Vorgarten lag um diese Zeit brach, der Schnee hatte das Herbstunkraut niedergedrückt, das nun in braunen, fauligen Halmen wieder zum Vorschein kam.
Vor ein paar Jahren noch war gerade dieses Gartenstück Mutters Lieblingsplatz gewesen. Die drei Apfelbäume, der Walnussbaum, die zahlreichen Kräuter zwischen Findlingen und Mutterboden, die Möhren und Zwiebeln, die den Kohleintopf verfeinerten … Die Läden der Kellerfenster, hinter denen sich der Webstuhl und der Lagerraum für das Leinen befanden, hingen schief in den Angeln. Einige zersplitterte Holzbalken ragten hervor und faulten in der spätwinterlichen Luft.
Nein, das Weber-Haus machte keinen heimeligen Eindruck mehr. Christina würde das Zuhause ihrer Kindheit nicht vermissen. Noch bevor sie die zwei Stufen zum Eingang erreichte, wurde die hölzerne Tür knarrend aufgerissen.
Mit Sophia auf dem Arm stand Eleonora vor ihr, ihr Gesicht weiß wie Sauermilch, die Augen angstvoll aufgerissen. »Christina, endlich …«, stieß sie hervor.
Christina verhielt den Schritt vor den Stufen, starrte zur Schwester hinauf. »Was ist passiert?«
»Klara … Sie ist verschwunden.«
2. Kapitel
Marliese Röhrich wusste nicht, wie lange sie auf dem Boden der Schlafkammer gelegen hatte. Als sie erwachte, fühlte sie einen stechenden Schmerz hinter ihren Schläfen. Sie blinzelte und stöhnte. Schräg fielen die Strahlen der Nachmittagssonne auf die Bodenbretter.
Wie lange war sie bewusstlos gewesen? Ein paar Stunden, ein paar Minuten? Ein schepperndes Geräusch hatte sie geweckt, aber Marliese wusste es nicht einzuordnen.
Sie stützte die Handflächen auf den Boden, um sich aufzurichten. In ihrem Kopf begann es sich zu drehen, die Übelkeit in ihrem Magen trieb einen sauren Geschmack in ihren Mund.
Sie schluckte mehrfach, um gegen den Drang, sich zu übergeben, anzukämpfen, doch vergeblich. Mit einem lauten Würgen erbrach sie sich auf allen vieren am Fußende des Ehebettes. Tränen und Speichel flossen über ihr Gesicht. Sie wischte es sich mit der flachen Hand ab.
Endlich gelang es ihr, sich aufzurichten.
Sie setzte sich auf das Bett, starrte auf ihre im Schoß gefalteten Hände und versuchte, ruhig zu atmen.
Er hatte sie in die Kammer getrieben wie ein störrisches Stück Vieh, sie geschubst, so dass sie hart auf den Boden fiel … Sie biss sich auf die Lippen.
Auch ohne die neuerliche Demütigung wusste Marliese, wie sehr ihr Mann sie verachtete, wie sie ihn anwiderte und anekelte. Konnte sie es ihm verübeln? Der Frau, die sie heute war, gebührte kein Respekt. Unwillig wischte sie mit zwei Fingern eine Träne weg.
Wie Gift sickerte aus ihrem tiefsten Inneren dieser Schmerz hervor, den sie mehr als alles andere in ihrem Leben fürchtete und den sie nur auf eine einzige Art zu betäuben verstand. Ihre Hände begannen zu zittern.
Branntwein, sie brauchte Branntwein.
Die letzten Schlucke hatte sie herausgewürgt. Ihr Körper fieberte vor Gier nach neuem Schnaps.
Sie erhob sich, verharrte einen Moment und bemerkte zu ihrer Erleichterung, dass das Schwindelgefühl nachließ. Mit staksigen Schritten verließ sie die Kammer, trat in die Wohnküche.
Der Raum war leer, das Feuer im Ofen fast niedergebrannt, die Tür zum Hofplatz stand sperrangelweit offen. Sie zog die Schultern hoch, als ein Frösteln ihren Körper schüttelte.
Dann begann sie mit fahrigen Fingern, die Schränke und Regale nach Branntwein zu durchstöbern.
Sie atmete schwer, als ihre Suche erfolglos blieb, stützte sich auf den Küchentisch, bemühte sich, ihre flatternden Gedanken zu ordnen, während sich auf ihrer Stirn Schweißperlen bildeten.
Im Schuppen … Hatte Johann das Fässchen Branntwein, das er aus Büdingen mitgebracht hatte, bei seinen Werkzeugen versteckt? Wo sonst? Das sähe ihm ähnlich, den Schnaps vor ihr in Sicherheit zu bringen und sie verdursten zu lassen.
Sie wandte sich um und trat aus der Tür. Der Schuppen mit den zerborstenen Fenstern und dem löchrigen Dach lag dem Haus schräg gegenüber, rechts davon die langgezogene Scheune und der Kuhstall.
Der Gedanke, die freie Fläche des Hofs zu überqueren, ließ Panik in ihr aufsteigen. Sie atmete schneller, kämpfte gegen die unvermittelt einsetzende Todesangst an. Es musste sein, ihr blieb keine Wahl.
Wie eine Marionette setzte sie einen Fuß vor den nächsten. Sie wusste, warum sie das Haus selten verließ, obwohl sie sich diese Ängste nicht erklären konnte. Ihr Herz hämmerte, als wollte es aus der Brust springen. Die Luft wurde ihr knapp.
Doch weiter, weiter! Der Schnaps würde ihr helfen und die Panik eindämmen.
Geräusche ließen sie innehalten, als sie an der Scheune vorbeistakste, deren Tor weit offen stand. Rasch verbarg sich Marliese mit immer noch rasendem Pulsschlag in der Nische zwischen den beiden Gebäuden hinter dem Misthaufen. Sie starrte in das Dämmerlicht des Schobers, während das Blut in ihren Ohren rauschte.
Sie sah den weißen, schlaffen Hintern ihres Mannes, zwischen seinen gespreizten Beinen schlanke junge Schenkel. Wie ein brünstiges Tier grunzte Johann im Rhythmus seiner Bewegungen.
Wieder stieg das Würgen in Marliese hoch. Mit offenem Mund atmend, stützte sie sich auf die Mistgabel, die gegen die äußere Wand des Schuppens lehnte, bis sie grüne Flüssigkeit erbrach, deren Geschmack sich gallebitter in ihrem Mund ausbreitete.
Wie gehetzt ging ihr Blick wieder zu Johann. Und … Christina. Natürlich. Das hätte sie sich denken können, er konnte die Finger von dem jungen Ding nicht lassen.
Dass er sich schon kurz nach der Hochzeitsnacht andere Weibsbilder genommen hatte, wusste Marliese. Sie erinnerte sich schwach, wie es in den ersten Jahren geschmerzt hatte. Bis sie herausfand, welch wirkungsvolles Mittel es gab, alles Fühlen zu betäuben.
Als sie nun beobachtete, wie Christina ihre Röcke richtete und Johann auf den Boden sank, mischte sich in die Panik ein unbändiger Hass. Wie er da neben seinem Erguss hockte mit seinem verrunzelten Glied, der benebelte Ausdruck in seinen kleinen Augen, die feuchten, wulstigen Lippen beim Atmen geöffnet …
Der Gestank des Misthaufens neben ihr drang in ihre Lunge, als sie tief Luft holte. Wie viel Leid hatte dieser Mann über sie gebracht. Wie hatte er sie gedemütigt, getreten, geschlagen, bespuckt … Und wie selbstgefällig nahm er sich, was ihm gefiel und worauf er glaubte, ein Anrecht zu haben.
Zum ersten Mal seit vielen Jahren verspürte Marliese heftige Regungen, die sie mit dem Kiefer mahlen und die Mistgabel so fest umklammern ließen, dass sich die pergamentdünne Haut über ihren Fingerknöcheln zum Zerreißen spannte. Sie wusste, dass der nächste Schluck Schnaps diese Empfindungen auf der Stelle dämpfen und schließlich verklingen lassen würde.
Schon wollte sie ihren Weg fortsetzen, den Schuppen nach dem ersehnten Fässchen durchsuchen, da wandte sich Christina um.
Sofort verbarg sich Marliese, drückte sich an die Holzwand. Hörte wie durch trübes Wasser den kurzen Wortwechsel der beiden, bevor die junge Frau davonlief, um hinter dem Kuhstall die Milch abzufüllen und sich auf den Heimweg zu begeben.
Wenn sie krepieren, brauche ich zwei hungrige Mäuler weniger zu stopfen. Ich weine ihnen keine Träne nach.
Marliese wusste, was ihr Mann von ihr hielt. Aber diese Worte trugen dazu bei, dass sich der Hass in ihr verdichtete und gefährlich zu brodeln begann. Sie griff sich an den Hals, glaubte einen kurzen Moment lang zu ersticken, kniff die Augen zusammen.
Als sie sie wieder öffnete, stand er vor ihr.
Auf seinen Zügen machte der Ausdruck der Überraschung einer spöttischen Miene Platz, als er sie anstarrte. »Was gaffst du hier, Alte?« Sein Lachen ging in ein Husten über, aber die Fältchen um seine glitzernden Augen blieben. »Geilt es dich auf, mir beim Vögeln zuzuschauen, ja? Hat es deine vertrocknete Pflaume zum Leben erweckt?« Ein verächtliches Grinsen breitete sich in seinem Gesicht aus, als er mit ausgestreckter Hand, als wollte er sie im Schritt berühren, auf sie zutrat.
Sie wich zurück, die Mistgabel fest umklammert.
Er stierte auf die Zinken. Wieder ein hohnschnaubendes Lachen. »Was willst du mit der Harke? Willst du sie mir in den Bauch rammen? Mach dir nichts vor, Alte, selbst dafür fehlt dir die Kraft. Du bist zu gar nichts mehr zu gebrauchen.«
Als sie ein weiteres Stück zurückwich, um seiner Hand auszuweichen, stolperte sie und landete auf dem Misthaufen.
Johann stützte die Hände in die Hüften und legte beim Lachen den Kopf in den Nacken. »Ja, drück dich in die Hühnerscheiße, alte Vettel! Da gehörst du hin.«
Wie eine Rotte hungriger Ratten verbiss sich jedes einzelne Wort ihres Mannes in ihr. Marliese wollte schreien vor Schmerz, aber kein Laut drang aus ihrem weit geöffneten Mund. So oft hatte er sie in den letzten Jahren gedemütigt, aber nun, da sie fast ausgenüchtert war und vor Verlangen nach Schnaps am ganzen Körper zitterte, war es, als fehlte eine Schutzwand, und all seine Bosheit drang bis in ihr tiefstes Inneres.
Dann war es, als explodierte etwas in ihr, gefolgt von einem gleißenden Blitz hinter ihrer Stirn. Es war, als verließe sie ihren Körper und beobachtete sich selbst, wie sie auf einmal die Zähne knirschend zusammenbiss, sich emporstemmte, mit beiden Händen die Mistgabel packte, sie anhob. Sie sah, wie das Grinsen aus seinem Gesicht fiel, wie er die Arme hochreckte und einen Schritt zurückwich. Dann sah sie sich wieder selbst, wie sie zustieß.
Ein tiefer Schrei hallte über Haus und Hof. Marliese bemerkte erst einen Wimpernschlag später, dass sie selbst ihn hervorgebracht hatte, während die Zinken der Mistgabel durch Johanns Leinenhemd und in seine Gedärme drangen wie durch ranzige Butter. Das vergilbte Weiß des Hemdes färbte sich zu dunklem Rot.
Ungläubigkeit breitete sich in den verzerrten Zügen ihres Mannes aus. Dickflüssiges Blut gluckerte aus seinem Mund, die Augen schienen aus ihren Höhlen zu quellen. Wie eine Ewigkeit erschien es Marliese, während sie auf ihren wankenden Mann starrte, bis er endlich zusammenbrach. Der durchbohrte Leib sank seitlich vor ihre Füße, der Kopf mit dem Gesicht voran auf den im Schatten dampfenden Misthaufen.
Nicht weit entfernt, in der Schusterwerkstatt, plazierte Bernhard Röhrich an der Werkbank einen Flicken auf dem Sonntagsschuh des Schlachters, den dieser verschämt abgegeben hatte: »Mach nur das Nötigste dran, Bernhard. Du weißt …«
Bernhard hatte genickt. »Schon in Ordnung, Wilhelm.«
Der Schlachter gehörte zu den wenigen, die ihre Schuhe noch zum Ausbessern brachten. Die meisten anderen trugen sie, bis sie ihnen in Fetzen von den Füßen fielen, oder hielten sie mit umwickelten Stoffbahnen zusammen, bis sie an den ersten warmen Tagen barfuß laufen konnten. In diesen Zeiten hatte keine Familie in Hessen einen Kreuzer zu viel.
Im Herbst nach der letzten Schlachtung hatte ihm Wilhelm vorsorglich einen Kübel Talg vorbeigebracht, wertvolles Material, um die für den Winter dringend benötigten Kerzen gießen zu können. Deswegen war er ihm nun einen kleinen Dienst schuldig. Eine komplette Erneuerung, die das Schuhwerk dringend gebraucht hätte, ging allerdings über das hinaus, was ein Kübel Talg wert war. Das wusste Bernhard so gut wie sein Kunde.
Trotzdem verrichtete Bernhard das vom Vater erlernte Handwerk sorgfältig und konzentriert, als wäre ein Edelmann aus der Stadt der Kunde und nicht etwa der zerlumpte Wilhelm vom Nachbarhof.
Alles, was Bernhard anpackte, erledigte er mit Bedacht und höchstem Anspruch an sich selbst.
Der harzig-würzige Geruch nach altem Leder und Leim umgab ihn, die milchige Sonne blinzelte durch die Fenster der Werkstatt und ließ aufgewirbelte Staubkörner blinken. Bernhard strich sich eine Strähne der schulterlangen Haare, die er im Nacken mit einem Lederband zusammenhielt, hinter die Ohren und griff nach der Drahtbürste, um den Schmutz rund um das Loch im Schuh zu entfernen. Bis zum Einsetzen der Dunkelheit sollte er diese Arbeit erledigt haben.
Die Flickschusterei war nicht das, was sich der Zwanzigjährige vom Leben erträumte. Es gab allerdings auch nichts anderes, wonach er sich gesehnt hatte, bis vor wenigen Wochen in der Kirche zum ersten Mal das Manifest verlesen worden war.
Ein, zwei Abende lang hatte er in der Stille vor dem Einschlafen, wenn der Mond in seine Kammer schien, mit dem Gedanken gespielt, ganz allein nach Russland aufzubrechen, allem Elend den Rücken zu kehren, aber sein Gewissen ließ ihm keine Ruhe.
Er konnte sie nicht im Stich lassen.
Seine hilflose Mutter nicht, nicht den schwachsinnigen Bruder und die Schwester, die an ihm mit einer so unerschütterlichen Zuneigung hing, dass ihm der Gedanke, sie zu enttäuschen, das Herz schwer machte. Dem Familienvater sollten Liebe und Respekt gehören, aber Johann hatte schon vor vielen Jahren mit seinem herrischen, jähzornigen Gebaren alles Ansehen eingebüßt.
Schließlich hatte der Vater selbst die Angelegenheit zur Sprache gebracht. Warum nicht auswandern, wenn sie ohnehin nichts mehr zu verlieren hätten?
Bernhard hatte gezögert. Was sollte drüben, in dem großen Reich, anders sein, wenn sie ihr erbärmliches Familienleben dort fortsetzten? Er bezweifelte, dass der Himmel über Russland Einfluss auf den Charakter seines Vaters haben würde, und Fusel für die Mutter, der sie zu einem hilflosen Wrack verkommen ließ, gab es überall.
Trotzdem aber unterstützte Bernhard seinen Vater, holte sich alle notwendigen Auskünfte von einem der zahlreichen Werber der Zarin, hörte sich nach zahlungskräftigen Käufern für die Werkstatt, den Hof und das Vieh um.
Ein Schrei, der ihm durch Mark und Bein ging, ließ ihn in seiner Flickarbeit innehalten. Er lauschte.
Was war das? Ein verletztes Tier? Eine der Hofkatzen, die sich am Waldrand mit einem Fuchs anlegte? Aber nein, der Schrei kam von drüben, von der Scheune her.
Bernhard legte Schuh und Werkzeug beiseite, wischte sich die Hände an den Beinlingen ab und öffnete die Werkstatttür. Sein ungewöhnlich hoher Wuchs hatte ihn schon in frühester Jugend gelehrt, mit gebeugtem Rücken zu gehen, um nicht gegen Türrahmen zu stoßen. Die krumme Haltung gehörte zu seinem Erscheinungsbild wie der mit einem Lederband umwickelte Zopf im Nacken.
Die Hof lag keine zwanzig Schritte entfernt, dazwischen nur der Gemüsegarten, in dem die Mutter Rüben und Kohl zog und früher, als sie noch Freude an solchen Dingen hatte, Levkojen und Lilien.
Bernhard hastete weit ausschreitend über den von Unkraut überwucherten, mit glitschigen Kieselsteinen bedeckten Weg zwischen den verwilderten Beeten und um die Scheune herum.
Nach Atem ringend, blieb er stehen, sah, dass die Haustür weit offen stand. Die mageren Hühner pickten im Schlamm auf dem Hof.
Neben dem Misthaufen entdeckte er seine Mutter. Sie stand da wie ein Gespenst mit ihren ungekämmten, vom Kopf abstehenden grauen Haarflusen, das Gesicht kalkweiß, den Mund zu einem Schrei verzogen, die Augen blutunterlaufen. Die Arme hatte sie von sich gestreckt, die Hände und Finger verkrampft. Das dünne graue Kleid schlotterte um ihren knochigen Körper.
»Mutter!« Bernhard rannte los. Er wusste nicht, wann er sie das letzte Mal unter freiem Himmel gesehen hatte. Was hatte sie bewogen, die Sicherheit des Hauses zu verlassen? Und was, in Gottes Namen, hatte sie bewogen, so markerschütternd zu schreien?
Wenige Schritte vor ihr erkannte Bernhard, was sie aus der Fassung gebracht hatte. Er fühlte sich, als liefe ein eiskaltes Rinnsal über seinen Rücken. Der Stiel der Mistgabel, die noch in seinem Vater steckte, zeigte wie ein anklagender Finger auf die Mutter. Ein Gemisch aus Blut und Gedärm sickerte aus dem Körper des Toten in den Hofschlamm.
Bernhard riss den Blick von seinem toten Vater los und starrte in die wässrig rötlichen Augen der Mutter. Worum flehte sie stumm? Er möge die Tat ungeschehen machen? Er möge sie in den Arm nehmen und trösten, ihr beistehen im Angesicht des Toten?
»Bernhard, ich …«, begann sie schließlich mit heiserer Stimme zu stammeln.
Mit einem Satz war er bei ihr, umfasste, so sanft es ihm ob seiner brennenden Gefühle möglich war, ihre Schultern. »Was ist passiert, Mutter? Was?«
Sie schluckte. »Er war … Er hat wieder …«
»Hast du ihn umgebracht, Mutter? Hast du es getan?« Sein Herz brannte vor Mitgefühl, als er die Qual in ihren Augen erkannte. Tränen lösten sich und suchten sich ihren Weg zwischen den Furchen ihres Gesichts.
»Ich wollte es nicht, Bernhard. Du musst es mir glauben, ich … er …« Ihre Stimme schwoll an, klang nun fast hysterisch.
Wie gut konnte er sie verstehen … Ein Wunder, dass sie es nicht schon früher getan hatte.
Was konnte ein Mensch ertragen an Erniedrigung? Bernhard wusste um das Leid seiner Mutter, hatte in all den Jahren mit ihr gelitten, als Junge in die Kissen geweint, als Heranwachsender versucht, Herr über die Wut zu werden, die in ihm kochte wie Lava in einem Vulkan. Wut auf den Vater, Wut auf dieses Leben, zu dem er verdammt war … Nein, er würde keine Träne um den Toten weinen, der mit dem Gesicht im Misthaufen zu seinen Füßen lag.
Bernhard versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Die Situation war eindeutig. Jeder, der seinen Vater so liegen sah, würde wissen, dass er ermordet worden war.
Das durfte nicht geschehen …
Seine Mutter war viel zu verwirrt und schwach, um sich zur Wehr zu setzen. Sie würde alles gestehen, wenn nur ein scharfer Blick sie traf.
Er musste es anders arrangieren …
Er musste seine Mutter da heraushalten.
Sie hatte es nicht verdient, am Galgen zu hängen – wenn das einer verdient hatte, dann der Tote zu seinen Füßen, dem der letzte Rest Lebenssaft aus dem Körper floss.
Bernhard holte tief Luft, schaute hinab auf den Vater, in die Scheune, fasste einen Plan …
»Es war ein Unfall, Mutter«, sagt er schließlich. »Komm, pack mit an!«
»Was … was redest du da, Bernhard?« Hilflos hob Marliese die Arme und ließ sie wieder sinken. »Es war kein Unfall, ich habe ihn getötet …«
Mit einem Ruck wandte er sich ihr wieder zu, umfasste kräftig ihre Oberarme. »Wir ziehen ihn unter den Heuboden und verwischen alle Spuren … Am Ende wird es aussehen, als sei er unglücklich von oben herabgestürzt und geradewegs mit dem Bauch in die Mistgabel …«
»Aber … aber das ist nicht richtig, Bernhard. Der Herrgott wird uns strafen …«