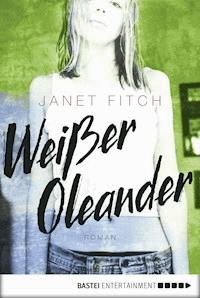
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der weiße Oleander blüht in Kalifornien im Hochsommer. Dann, wenn die Hitze unerträglich erscheint. Für die zwölfjährige Astrid beginnt zu dieser Zeit eine turbulente und dramatische Odyssee von Pflegefamilie zu Pflegefamilie. Ihre Mutter, eine exzentrische Schriftstellerin, die zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt ist, übt trotz allem einen starken Einfluss auf sie aus. Erst allmählich gelingt es dem sensiblen und klugen Mädchen, einen eigenen Platz im Leben zu finden. Es zeigt sich, dass Astrid so stark wie der weiße Oleander ist, der selbst dann blüht, wenn man ihn immer wieder verpflanzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 754
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Vorwort
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Danksagung
Unsere Empfehlungen
Über die Autorin
Janet Fitch lebt mit ihrer Familie in Los Angeles, dem Schauplatz dieses Buches. Sie hatte bereits zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht, als die berühmte Kollegin Joyce Carol Oates sie ermutigte, einen Roman zu schreiben. Von der amerikanischen Kritik als erstaunlichstes Debüt der letzten Jahre gefeiert, von Oprah Winfrey hoch gelobt, führte WEISSEROLEANDER über Monate hinweg die Bestsellerlisten der New York Times an und fand weltweit Beachtung: Das Buch wird verfilmt und erscheint in mehr als zwanzig Ländern.
JANET FITCH
WEISSEROLEANDER
Aus dem amerikanischen Englisch vonUte Leibmann
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
White Oleander
© 1999 by Janet Fitch
Published by arrangement with Little,
Brown and Company; Boston, New York, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2000 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Judith Mandt
All rights reserved
Umschlaggestaltung: Bettina Reubelt
Titelbild: Christina Cody/Photonica
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-2284-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
In der Zeit der Santa-Ana-Winde war meine Mutter nicht sie selbst. Ich war zwölf Jahre alt und hatte Angst um sie. Ich wünschte mir, dass es so wäre wie früher, dass Barry hier wäre, dass der Wind aufhörte zu wehen. – Astrids Wünsche erfüllen sich nicht. Im Gegenteil: Das sensible, kluge Mädchen wird bald auch seine Mutter vermissen. Denn Ingrid tötet ihren Liebhaber Barry und wird zu lebenslanger Haft verurteilt – eine Strafe auch für Astrid. Für sie beginnt eine Odyssee: Sie wandert in Los Angeles von Pflegefamilie zu Pflegefamilie – jeweils ein neuer Kosmos mit ganz eigenen Gesetzen und Ritualen – und macht dort Erfahrungen, die den Leser nicht mehr loslassen werden.
Zäh, unbeugsam, komisch und warmherzig – Astrid ist eine der eindrücklichsten Romanfiguren der letzten Jahre. WEISSEROLEANDER ist ein bewegender Roman über die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Nähe, der frei ist von jeder Rührseligkeit. Die Autorin erzählt in poetischen Bildern von der Stärke des Ichs und der Sprengkraft der Fantasie, aber auch von dem Gift und der Heilkraft der Liebe.
Für den Mannaus Council Bluffs
Alle Figuren und Ereignisse in diesem Buch sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen sind rein zufälliger Natur und keinesfalls von der Autorin beabsichtigt.
1
Die heißen Santa-Ana-Winde wehten aus der Wüste herüber und dörrten die letzten Frühlingshalme zu bleichem Stroh. Nur die Oleanderbüsche gediehen, die zarten, giftigen Blüten, die Blätter scharf wie Dolche. In den heißen, trockenen Nächten konnten wir nicht schlafen, meine Mutter und ich. Ich erwachte um Mitternacht und sah, dass ihr Bett leer war. Ich fand sie auf dem Flachdach; ihr blondes Haar leuchtete weiß wie eine Flamme im Licht des Dreiviertelmondes.
»Oleanderzeit«, sagte sie. »Liebende, die sich jetzt gegenseitig umbringen, werden es auf den Wind schieben.« Sie hielt ihre schmale, lange Hand in die Höhe, spreizte die Finger und ließ den trockenen Wüstenwind hindurchwehen. In der Zeit der Santa Anas war meine Mutter nicht sie selbst. Ich war zwölf Jahre alt und hatte Angst um sie. Ich wünschte mir, dass es wieder so wäre wie früher, dass Barry hier wäre, dass der Wind aufhörte zu wehen.
»Du solltest ein bisschen schlafen«, schlug ich ihr vor.
»Ich schlafe nie«, sagte sie.
Ich setzte mich neben sie, und wir blickten auf die Stadt hinunter, die wie ein Computerchip in einer rätselhaften Maschine summte und glitzerte und ihr Geheimnis wie ein Pokerspieler vor uns verbarg. Der Saum ihres weißen Kimonos flatterte im Wind, und ich konnte ihre Brust sehen, tief und voll. Ihre Schönheit war wie die Schneide eines sehr scharfen Messers.
Ich legte den Kopf auf ihr Bein. Sie roch nach Veilchen. »Wir sind die Stäbe«, sagte sie. »Wir streben nach Schönheit und Harmonie. Wir suchen das Sinnliche, nicht das Sentimentale.«
»Die Stäbe«, wiederholte ich. Sie sollte wissen, dass ich ihr zuhörte.
Unsere Tarotfarbe, die Stäbe. Sie legte mir immer die Karten und erklärte ihre Farben – Stäbe und Münzen, Kelche und Schwerter –, doch sie hatte aufgehört, sie zu deuten. Sie wollte nichts mehr über die Zukunft wissen.
»Wir haben unsere Farbe von den Nordländern«, sagte sie. »Haarige Wilde, die ihre Götter in Stücke hackten und das Fleisch an den Bäumen aufhängten. Wir sind diejenigen, die Rom geplündert haben. Fürchte nur die Schwäche des Alters und den Tod im Bett. Vergiss nie, wer du bist.«
»Ich verspreche es«, sagte ich.
Unter uns in den Straßen Hollywoods heulten die Sirenen und sägten an meinen gespannten Nerven. Während der Santa-Ana-Winde brannten die Eukalyptusbäume wie riesige Kerzen, ölfette Chaparral-Hänge gingen plötzlich in Flammen auf und trieben halbverhungerte Kojoten und Hirsche bis hinunter zur Franklin Avenue.
Sie hob ihr Gesicht zum angesengten Mond empor und tauchte es in seinen finsteren Schein. »Rabenaugenmond.«
»Käsecräckermond«, erwiderte ich, den Kopf auf ihr Knie gelegt.
Sie strich mir sanft über das Haar. »Verrätermond.«
Diese Verletzung – dieser Wahnsinn – wäre im Frühjahr gar nicht vorstellbar gewesen, doch sie hatte vor uns gelegen wie eine verborgene Landmine. Damals hatten wir den Namen Barry Kolker noch nicht einmal gehört.
Barry. Als er auftauchte, war er so klein gewesen. Kleiner als ein Komma, unbedeutend wie ein Hüsteln. Irgendjemand, den sie mal auf einer ihrer Lesungen getroffen hatte. Es war im Garten eines Weinlokals in Venice gewesen. Wie bei all ihren Lesungen trug meine Mutter Weiß; ihr Haar hob sich wie Neuschnee von ihrer leicht gebräunten Haut ab. Sie stand im Schatten eines gewaltigen Feigenbaumes, der seine Blätter wie Hände über sie streckte. Ich saß an einem Tisch hinter den Bücherstapeln, die ich nach der Lesung verkaufen sollte, dünne Bände, die bei der Blue Shoe Press in Austin, Texas, erschienen waren. Ich zeichnete die Hände des Baumes und die Bienen, die das Fallobst umschwärmten, die gegorenen Früchte aussaugten und berauscht zu Boden taumelten, wenn sie versuchten, wieder wegzufliegen. Ihre Stimme machte mich betrunken, tief, sonnengewärmt, mit der Spur eines fremdartigen Akzents; schwedischer Singsang, der noch eine Generation später nachklang. Wer sie einmal gehört hatte, kannte die Macht dieser hypnotisierenden Stimme.
Nach der Lesung umdrängten die Leute uns und gaben mir Geld für die Zigarrenkiste, während meine Mutter einige Bücher signierte. »Ach – das Dichterleben!«, sagte sie ironisch, als mir die Leute ihre zerknitterten Ein- und Fünf-Dollar-Scheine in die Hand drückten. Doch sie liebte Lesungen, genauso wie sie die langen Abende liebte, an denen sie mit ihren Schriftstellerfreunden bei einem Glas Wein und einem Joint bekanntere Dichter in der Luft zerriss. Gleichzeitig hasste sie sie aber auch, ebenso wie sie ihre geistlose Arbeit bei der Zeitschrift Cinema Scene hasste. Dort machte sie den Klebeumbruch und montierte Artikel, deren Verfasser fünfzig Cent pro Wort für das Auskotzen ihrer schamlosen Klischees, abgedroschenen Substantive und lustlosen Verben verdienten, während meine Mutter sich stundenlang mit der Frage quälen konnte, ob sie nun »ein« oder »der« schreiben sollte.
Beim Signieren ihrer Bücher hatte sie ihr übliches halbes Lächeln aufgesetzt, eher innerlich als äußerlich, so als mache sie sich im Stillen über die Leute lustig, wenn sie ihnen für ihr Kommen dankte. Ich wusste, dass sie auf einen ganz bestimmten Mann wartete; ich hatte ihn schon entdeckt: ein scheuer Blonder, der ein ärmelloses T-Shirt und eine Holzperlenkette im Ethnolook trug. Er hielt sich im Hintergrund und betrachtete sie hilflos, völlig von ihr gefangen. Nicht umsonst war ich zwölf Jahre lang Ingrids Tochter gewesen; inzwischen konnte ich diese Typen im Schlaf ausmachen.
Ein stämmiger Mann, der sein dunkles Haar zu einem lockigen Pferdeschwanz zurückgebunden hatte, drängte sich vor und schob ihr sein Buch hin, um es signieren zu lassen. »Barry Kolker. Mir gefällt deine Arbeit«, sagte er. Sie signierte sein Buch und gab es ihm zurück, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. »Was hast du nach der Lesung vor?«
»Ich bin verabredet«, erwiderte sie und griff nach dem nächsten Buch.
»Dann danach«, sagte er. Mir gefiel sein Selbstvertrauen, aber er war nicht ihr Typ. Er war untersetzt, dunkel und trug einen Anzug, der aussah, als sei er aus einer Sammlung der Heilsarmee.
Sie wollte natürlich den schüchternen Blonden, der erheblich jünger war als sie und ebenfalls dichterische Ambitionen hatte. Er war es auch, der uns schließlich nach Hause begleitete.
Ich lag auf meiner Matratze auf dem überdachten Balkon hinter den Fliegengittern und wartete darauf, dass er ging. Ich sah, wie das Blau des Abends sich in ein samtenes Indigo verwandelte, das wie eine unausgesprochene Hoffnung verweilte, während meine Mutter und der blonde Mann auf der anderen Seite der Fliegengittertür murmelten. Es duftete nach Aromaöl, eine ganz besondere Sorte, die sie in Little Tokyo gekauft hatte, ein teures Öl ohne irgendwelche Süße; es roch nach Holz und grünem Tee. Eine Hand voll Sterne erschien am Himmel, doch in L.A. konnte man keines der Sternbilder richtig sehen, deshalb verband ich sie zu neuen Konstellationen: die Spinne, die Welle, die Gitarre.
Als er weg war, traute ich mich wieder in das große Zimmer. Sie saß im Schneidersitz auf dem Bett, in ihren weißen Kimono gehüllt, und schrieb mit einem Füllfederhalter, den sie immer wieder in ein Tintenfass tauchte, in ein Notizheft. »Erlaube einem Mann niemals, über Nacht zu bleiben«, sagte sie zu mir. »Das Morgengrauen lässt die Magie der Nacht schal erscheinen.«
Die Magie der Nacht, das klang wunderbar. Eines Tages würde ich auch Liebhaber finden und hinterher ein Gedicht schreiben. Ich betrachtete den weißen Oleander, mit dem sie an diesem Morgen den Couchtisch dekoriert hatte: drei Blütenstände, die den Himmel, die Menschen und die Erde verkörpern sollten. Ich dachte an die Musik ihrer Stimmen in der Dunkelheit, an ihr leises Lachen, an den Geruch des Aromaöls. Ich berührte die Blumen. Himmel, Mensch. Ich hatte das Gefühl, kurz vor der Enthüllung eines wichtigen Geheimnisses zu stehen. Etwas hatte mich umgeben wie ein Mullverband, und ich begann ihn abzuwickeln.
Den ganzen Sommer lang ging ich mit ihr in die Redaktion. Sie plante nie weit genug voraus, um mich für eine Jugendfreizeit anzumelden, und von der Möglichkeit eines Sommerkurses erzählte ich ihr nichts. Die Schule selbst machte mir Spaß, doch es fiel mir schwer, mich als ein Mädchen zwischen vielen anderen einzufügen. Die Mädchen in meinem Alter schienen einer ganz anderen Spezies anzugehören; ihre Belange kamen mir so fremdartig vor wie die des Dogon-Stammes in Mali. Die siebte Klasse war besonders quälend gewesen, und ich erwartete sehnsüchtig den Moment, in dem ich wieder mit meiner Mutter zusammen sein konnte. Die Layout-Abteilung von Cinema Scene mit ihren Filzschreibern, einem Drehkarussell von vielfarbigen Buntstiften, mit Papierbögen in Tischgröße, Zurichtebogen, Kleberastern und Klebestreifen, mit ausrangierten Überschriften und Fotos, die ich aufkleben und zu Collagen verarbeiten konnte, war ein Paradies für mich. Es gefiel mir, wie die Erwachsenen sich unterhielten; sie vergaßen immer, dass ich da war, und erzählten sich die merkwürdigsten Dinge. In diesem Sommer tratschten die Redakteure und Marlene, Art Director der Zeitschrift, über die Affäre zwischen dem Verleger und der Chefredakteurin des Magazins. »Ein ziemlich bizarrer Auswuchs von Santa-Ana-Fieber«, kommentierte meine Mutter vom Montagetisch. »Die spitzschnabelige Magersüchtige und der toupierte Chihuahua. Das ist mehr als grotesk! Ihre Kinder wüssten wahrscheinlich gar nicht, ob sie Körner picken oder bellen sollten.«
Sie lachten. Meine Mutter sprach immer aus, was die anderen nur dachten.
Ich saß an dem leeren Zeichentisch, der neben dem meiner Mutter stand, und zeichnete die Jalousetten, die das hereinfallende Licht wie einen Käse in Scheiben schnitten. Ich wartete darauf, was meine Mutter als Nächstes sagen würde, doch sie setzte sich wieder ihre Kopfhörer auf, so wie man einen Punkt ans Ende eines Satzes setzt. Das war ihre Art, den Umbruch zu machen: Sie hörte exotische Musik und gab vor, weit weg in einem duftenden Königreich aus Feuer und Schatten zu schweben, statt an einem Skizzentisch in einer Zeitschriftenredaktion zu sitzen und für acht Dollar die Stunde Interviews mit Schauspielern zu montieren. Sie konzentrierte sich auf die Bewegungen des stählernen Papiermessers, während sie die Spalten schnitt. Sie zog die langen Papierstreifen ab, die am Messer hängen blieben. »Ich ziehe ihnen die Haut ab«, sagte sie immer. »Die Haut dieser geistlosen Schreiberlinge, die ich dann auf die Seiten transplantiere, um Monster der Bedeutungslosigkeit zu schaffen.«
Die Redakteure lachten verlegen.
Niemand nahm Notiz davon, als Bob, der Verleger, den Raum betrat. Ich senkte den Kopf und legte eifrig den Kreuzwinkel an, so als ob ich irgendetwas Hochoffizielles erledigte. Bis jetzt hatte er noch kein Wort darüber verloren, dass ich meine Mutter immer zur Arbeit begleitete, doch Marlene hatte mir geraten, »tief zu fliegen und den Radar zu meiden«. Er schien mich nie zu bemerken. Bloß meine Mutter. An diesem Tag trat er dicht hinter ihren Schemel und spähte über ihre Schulter hinweg auf den Umbruch. Er wollte wohl nur nahe bei ihr stehen, ihr Haar berühren, das so weiß wie Gletschermilch war, und versuchen, ob er nicht einen Blick in ihren Ausschnitt erhaschen konnte. Ich sah die Verachtung auf ihrem Gesicht, als er sich über sie beugte und sich dann, so als habe er das Gleichgewicht verloren, mit der Hand auf ihrem Oberschenkel abstützte.
Sie tat so, als ob sie aufschreckte, und schnitt ihm in einer einzigen sparsamen Bewegung mit der scharfen Klinge des Papiermessers in den nackten Unterarm.
Er betrachtete seinen Arm, verwundert über den Blutfaden, der an die Oberfläche quoll.
»Oh, Bob!«, sagte sie. »Es tut mir so Leid, ich habe dich gar nicht gesehen. Alles in Ordnung?« Doch der Blick, den sie ihm aus ihren kornblumenblauen Augen zuwarf, zeigte ihm, dass sie ihm genauso gut die Kehle hätte durchschneiden können.
»Kein Problem, nur ein kleines Missgeschick.« Dort, wo der Ärmel seines Polohemdes endete, prangte ein fünf Zentimeter langer Schnitt. »Nur ein Missgeschick«, wiederholte er etwas lauter, so als ob er alle beruhigen wollte, und zog sich hastig in sein Büro zurück.
Während der Mittagspause fuhren wir in die Berge und parkten im Halbschatten einer großen Platane, deren puderweiße Rinde sich wie ein weiblicher Körper vor dem unwirklich blauen Himmel abzeichnete. Wir aßen Joghurt aus Pappbechern und hörten eine Kassette, auf der Anne Sexton ihre Gedichte in ihrem schaurigen, ironisch gedehnten Tonfall vorlas. Sie las gerade, wie sie bei der Musiktherapie in einer psychiatrischen Klinik die Glöckchen klingen ließ. Meine Mutter hielt die Kassette an. »Sag mir die nächste Zeile auf.«
Ich mochte es, wenn meine Mutter versuchte, mir etwas beizubringen, wenn sie mir Beachtung schenkte. Oft genug erschien sie mir unerreichbar. Wenn sie dann aber ihre Aufmerksamkeit auf mich richtete, spürte ich eine Wärme, wie Blumen sie wohl fühlen, wenn sie durch den Schnee nach oben dringen und die ersten gebündelten Sonnenstrahlen erhaschen.
Ich musste nicht lange nach der Antwort suchen. Sie kam wie ein Lied. Das Licht brach sich in den Blättern der Platane, während die verrückte Anne ihr Glöckchen in es-Moll läutete und meine Mutter nickte.
»Gedichte solltest du immer auswendig lernen«, sagte sie. »Sie müssen zu deinem Knochenmark werden. Wie Fluor im Wasser machen sie deine Seele unempfindlich gegen die schleichende Karies der Welt.«
Ich stellte mir vor, dass meine Seele Worte aufsog, ähnlich wie die Bäume im Petrified Forest Kieselerde aufgesogen hatten, und dass sich mein Holz in gemustertes Achat verwandelte. Ich mochte es, wenn meine Mutter mich formte. Ich glaubte, dass Ton sich in der Hand einer guten Töpferin wohl fühlen müsse.
Am Nachmittag fiel die Chefredakteurin in die Layout-Abteilung ein und zog eine Wolke orientalischen Duftes hinter sich her, die noch lange, nachdem sie gegangen war, in der Luft hing. Kit war eine dünne Frau mit sehr hellen Augen und den hektischen Bewegungen eines aufgeschreckten Vogels; sie lächelte etwas zu fröhlich mit ihren leuchtend roten Lippen, während sie hin und her flatterte, sich das Layout anschaute, den Seitenaufbau überprüfte, über die Schultern meiner Mutter hinweg die Schriften kontrollierte und Verbesserungen vorschlug. Meine Mutter warf ihr Haar zurück wie eine Katze, die noch einmal zuckt, ehe sie einen mit den Klauen packt.
»Ihre langen Haare!«, sagte Kit. »Ist das nicht gefährlich bei Ihrer Arbeit? Mit dem Fixogum und dem ganzen Klebezeug?« Sie trug einen kurzen geometrischen Haarschnitt, tintenschwarz gefärbt und im Nacken ausrasiert.
Meine Mutter ignorierte sie, ließ jedoch das Papiermesser fallen, sodass es sich wie ein Wurfspeer in die Tischplatte bohrte.
Nachdem Kit wieder gegangen war, sagte meine Mutter zu Marlene: »Ich bin sicher, dass sie mich am liebsten mit einem Bürstenschnitt sehen würde. Genauso schwarz geteert wie ihrer.«
»Farbton ›Tanz der Vampire‹«, sagte Marlene.
Ich blickte nicht auf. Ich wusste, dass sie nur wegen mir hier war. Wenn ich nicht wäre, müsste sie keine solchen Arbeiten annehmen. Sie wäre irgendwo am anderen Ende der Welt, würde sich in einem türkisfarbenen Meer treiben lassen oder im Mondlicht zu Flamenco-Klängen tanzen. Ich fühlte meine Schuld wie ein Brandmal.
An diesem Abend ging sie allein aus. Ich zeichnete eine Stunde lang, aß ein Sandwich mit Erdnussbutter und Mayonnaise und klopfte dann gelangweilt bei Michael, unserem Nachbarn, an. Auf der anderen Seite der Tür wurden drei Riegel zurückgeschoben. »Gerade läuft ›Königin Christina‹!« Er lächelte mich an, ein freundlicher, weicher Mann, ungefähr so alt wie meine Mutter, aber aufgedunsen und blass, weil er trank und nie an die frische Luft ging. Er räumte einen Stapel dreckiger Klamotten und einige Variety-Hefte von der Couch, damit ich mich setzen konnte.
Sein Apartment sah ganz anders aus als unseres, voll gestopft mit Möbeln, Andenken, Kinoplakaten, Variety-Heften, Zeitungen und leeren Weinflaschen. Auf den Fensterbänken vegetierten einige Tomatenpflanzen vor sich hin und kämpften um die wenigen Lichtstrahlen. Selbst tagsüber war es dunkel, da die Fenster nach Norden gingen, doch man hatte einen sensationellen Blick auf den Hollywood-Schriftzug; aus diesem Grund hatte Michael das Apartment auch bezogen.
»Immer nur Schnee«, sprach er im Chor mit der Garbo und verzog das Gesicht genau wie sie. »Ewiger Schnee.« Er reichte mir eine Schüssel mit Sonnenblumenkernen. »Ich bin die Garbo.«
Ich knackte die Kerne zwischen den Zähnen und streifte die Plastiksandalen ab, die ich seit April trug. Ich konnte meiner Mutter unmöglich sagen, dass ich schon wieder herausgewachsen war. Ich wollte sie nicht daran erinnern, dass ich der Grund dafür war, dass sie zwischen Stromrechnungen und zu klein gewordenen Kinderschuhen gefangen war, der Grund dafür, dass sie sich wie Michaels welke Tomaten nach ein paar Lichtstrahlen recken musste. Sie war eine schöne Frau, die einen Klumpfuß hinter sich herzog – und dieser Klumpfuß war ich. Ich war der Mühlstein, den sie mit sich herumschleppte, ich war ihr Stahlkorsett.
»Was liest du gerade?«, fragte ich Michael. Er war Schauspieler, arbeitete allerdings nicht besonders viel – und für das Fernsehen wollte er nichts machen, sodass er sein Geld vor allem damit verdiente, Bücher für »Books on Tape« zu lesen. Er musste das unter einem Pseudonym tun, Wolfram Malevich, weil er in der Schauspielergewerkschaft war, aber der Verlag die gewerkschaftlichen Tarifverträge umging. Wir hörten ihn jeden Morgen sehr früh durch die dünne Wand, wenn er seine Bücher las. Aus seiner Zeit bei der Armee konnte er etwas Deutsch und Russisch. Er hatte für den Nachrichtendienst, die Army Intelligence, gearbeitet – ein Widerspruch in sich, wie er immer sagte –, deshalb hatte man ihm jetzt die deutschen und russischen Autoren zugeteilt.
»Kurzgeschichten von Tschechow.« Er beugte sich vor und reichte mir das Buch vom Couchtisch. Es war voll mit Anmerkungen, Klebezettelchen und Unterstreichungen.
Ich blätterte das Buch durch. »Meine Mutter hasst Tschechow. Sie sagt, dass jedem, der ihn einmal gelesen hat, klar sein muss, wieso es zur Revolution kam.«
»Deine Mutter!« Michael lächelte. »Dir würde er vielleicht sogar gefallen. Tschechow ist so herrlich melancholisch!« Wir drehten uns beide zum Fernseher, um die beste Stelle in »Königin Christina« nicht zu verpassen, und sprachen im Chor mit der Garbo: »Der Schnee ist wie ein weißes Meer. Man könnte hinausgehen und sich darin verlieren – und die ganze Welt vergessen.«
Ich stellte mir meine Mutter als Königin Christina vor, kühl und traurig, die Augen auf einen fernen Horizont gerichtet. Dort gehörte sie eigentlich hin, in Pelze gehüllt, Paläste mit seltenen Schätzen, mit Kaminen, die so groß waren, dass man ein ganzes Rentier davor rösten konnte, Schiffe aus schwedischem Ahorn. Meine größte Angst war, dass sie eines Tages dorthin zurückkehren und nie mehr wiederkommen würde. Deshalb blieb ich immer wach und wartete auf sie, wenn sie abends ausging, so wie jetzt, egal wie spät sie nach Hause kam. Ich musste ihren Schlüssel im Schloss hören und ihr Veilchenparfum riechen.
Und ich versuchte, es nicht noch schlimmer zu machen, indem ich sie um Dinge bat oder sie mit meinen Problemen herunterzog. Ich hatte schon oft beobachtet, wie andere Mädchen nach neuen Kleidern jammerten oder sich darüber beschwerten, was ihre Mütter ihnen zum Abendessen gekocht hatten. Ich schämte mich dann immer. Wussten sie denn nicht, dass sie ihre Mütter an den Boden fesselten? Hatten Ketten kein schlechtes Gewissen gegenüber den Gefangenen?
Doch wie ich sie darum beneidete, dass ihre Mütter auf ihren Bettkanten hockten und erfahren wollten, was sie dachten! Meine Mutter zeigte, was mich betraf, kein bisschen Neugier. Ich fragte mich oft, was ich eigentlich für sie war: ein Hund, den sie vor irgendeinem Geschäft anbinden konnte, ein Papagei auf ihrer Schulter?
Ich erzählte ihr nie, dass ich mir einen Vater wünschte, dass ich im Sommer gern ins Feriencamp fahren würde, dass sie mir manchmal Angst einjagte. Ich befürchtete, sie würde dann davonfliegen und mich allein zurücklassen. Dass ich dann an einem Ort leben müsste, wo es zu viele Kinder und zu viele Gerüche gab; an einem Ort, wo Schönheit und Stille und der Zauber ihrer Worte, die sich in die Luft erhoben, so weit weg wären wie Saturn.
Draußen vor dem Fenster verschwamm das Leuchten des Hollywood-Schriftzugs im Juninebel. Eine weiche Nässe auf den Hügeln ließ den Geruch nach Salbei und Chamisosträuchern aufsteigen. Feuchtigkeit, die das Fensterglas mit Träumen beschlug.
Sie kam um zwei nach Hause, als die Bars schlossen. Ihrer Ruhelosigkeit war für den Augenblick Genüge getan. Ich saß auf ihrem Bett, sah ihr dabei zu, wie sie sich umzog, und bewunderte jede ihrer Bewegungen. Eines Tages würde ich auch so die Arme kreuzen und mir ein enges Kleid über den Kopf ziehen, die hochhackigen Schuhe abstreifen. Ich probierte sie an und bewunderte sie an meinen Füßen. Sie hatten fast die richtige Größe. In etwa einem Jahr würden sie mir passen. Sie setzte sich neben mich, gab mir ihre Bürste, und ich bürstete ihr helles Haar, bis es weich war, und sprenkelte die Luft mit ihrem Veilchengeruch. »Ich hab den Ziegenbock wieder gesehen«, sagte sie.
»Was für einen Ziegenbock?«
»Aus dem Weinlokal, erinnerst du dich? Den grinsenden Pan mit den Pferdefüßen?«
Ich konnte uns beide in dem runden Wandspiegel sehen, unser lang herabhängendes Haar, unsere blauen Augen. Nordische Frauen. Wenn ich uns so sah, erinnerte ich mich beinahe daran, wie es gewesen sein musste, als wir in kalten, tiefen Wassern fischten. Ich roch Dorsch und Holzkohlenfeuer, dachte an unsere Fellstiefel, unser seltsames Alphabet, dessen Runen wie Stöcke aussahen, an unsere Sprache, die wie das Pflügen des Feldes war.
»Er hat mich die ganze Zeit über angestarrt«, sagte sie. »Barry Kolker. Marlene hat erzählt, dass er Essays schreibt.« Ihre fein geschwungenen Lippen verzogen sich zu langen missbilligenden Kommas. »Er war mit dieser Schauspielerin aus dem ›Kaktusgarten‹ da, Jill Lewis.«
Ihr Haar, hell wie ungebleichte Seide, glitt zwischen den Wildschweinborsten hindurch.
»Mit dem fetten Ziegenbock? Kannst du dir das vorstellen?« Sie konnte es offenbar nicht. Schönheit war meiner Mutter Gesetz, ihre Religion. Man konnte tun, wozu man Lust hatte, solange man schön war, solange man die Dinge schön gestaltete. War man es nicht, existierte man einfach nicht. Sie hatte es mir seit frühester Kindheit eingehämmert. Allerdings hatte ich inzwischen gemerkt, dass die Realität nicht immer den Vorstellungen meiner Mutter entsprach.
»Vielleicht mag sie ihn«, sagte ich.
»Sie muss vollkommen verrückt sein«, bemerkte meine Mutter, nahm mir die Bürste ab und bürstete dann mein Haar, wobei sie fest auf meine Kopfhaut drückte. »Sie könnte doch jeden Mann haben! Was findet sie bloß an ihm?«
Sie traf ihn völlig unverhofft in ihrer Lieblingsbar in der Stadt wieder. Sie sah ihn auf einer Party in Silverlake. Sie konnte hingehen, wo sie wollte – so beschwerte sie sich –, immer war der Ziegenbock schon da.
Ich vermutete, dass es sich bloß um Zufälle handelte, doch eines Abends während einer Performance in Santa Monica, bei der wir einem ihrer Freunde dabei zuschauten, wie er auf Mineralwasserflaschen schlug und pathetisch die Trockenheit beschwor, sah ich ihn ebenfalls, vier Reihen hinter uns. Er versuchte die ganze Zeit, ihren Blick zu erhaschen. Er winkte mir zu, und ich winkte unauffällig zurück, damit sie es nicht sah.
Nachdem die Performance vorbei war, wollte ich mit ihm sprechen, doch sie zog mich schnell aus dem Raum. »Ermutige ihn nicht noch!«, zischte sie mir zu.
Als er auf der alljährlichen Verlegerparty von Cinema Scene auftauchte, musste auch ich zugeben, dass er ihr nachstellte. Die Feier fand draußen im Hof eines alten Hotels auf dem Sunset Boulevard statt. Die Hitze des Tages ließ allmählich nach. Die Frauen trugen hauchdünne Kleider, meine Mutter hatte sich wie ein Falter ganz in weiße Seide gehüllt. Ich bahnte mir einen Weg durch die Menge zum Vorspeisenbuffet und füllte schnell meine Handtasche mit Dingen, von denen ich glaubte, dass sie ein paar Stunden ohne Kühlschrank überstehen könnten – Krebsscheren und Spargelröllchen, Leber in Schinken –, und da war plötzlich Barry, der seinen Teller mit Garnelen belud. Kaum hatte er mich erblickt, suchten seine Augen die Menge nach meiner Mutter ab. Sie stand hinter mir und schwatzte mit Miles, dem Bildredakteur, einem hageren, stoppelbärtigen Engländer mit gelbfleckigen Nikotinfingern. Sie hatte Barry noch nicht gesehen. Er schob sich durch die Partygäste in ihre Richtung. Ich folgte dicht hinter ihm.
»Ingrid«, sagte Barry und sprengte ihren Zweierzirkel. »Ich habe schon nach dir Ausschau gehalten!« Er lächelte. Ihr unbarmherziger Blick glitt über seine senffarbene, schiefhängende Krawatte, über das braune Hemd, das an den Knöpfen spannte, über seine unregelmäßigen Zähne, über die Garnele, die er in seiner plumpen Faust hielt. Ich konnte die eisigen Winde Schwedens hören, doch er schien die Kälte nicht zu spüren.
»Ich habe an dich gedacht«, sagte er und schob sich sogar noch näher.
»Mir wäre lieber, du würdest das lassen!«, erwiderte sie.
»Du wirst deine Meinung über mich schon noch ändern«, sagte er. Er tippte sich mit dem Finger an die Nase, zwinkerte mir zu und ging dann zu einer anderen Gruppe von Leuten hinüber, legte seinen Arm um ein hübsches Mädchen und küsste sie auf den Nacken. Meine Mutter drehte sich weg. Dieser Kuss verstieß gegen alle ihre Grundsätze. In ihrem Universum passierte so etwas nicht.
»Kennst du Barry?«, erkundigte sich Miles.
»Wen?«, erwiderte meine Mutter.
In dieser Nacht konnte sie nicht schlafen. Wir gingen runter zum Pool des Apartmenthauses und schwammen langsam, leise plätschernd unter den örtlichen Sternen: der Krebsschere und der Riesengarnele.
Meine Mutter beugte sich über ihren Montagetisch und schnitt ohne Hilfe eines Lineals in langen, eleganten Strichen die Spalten aus. »Das ist Zen«, sagte sie. »Kein Makel, kein langes Zaudern. Ein Fenster zur Anmut.« Sie sah richtig glücklich aus. So ging es ihr manchmal, wenn sie etwas exakt montiert hatte. Sie vergaß dann völlig, wo sie war, warum sie da war; vergaß, wo sie hergekommen war und lieber wieder sein würde; vergaß alles bis auf die Gabe, eine perfekte, gerade Linie mit der freien Hand zu schneiden, eine Freude, die genauso rein war, als hätte sie gerade einen schönen Satz geschrieben.
Doch dann sah ich, was sie noch nicht gesehen hatte: Der Ziegenbock betrat die Layout-Abteilung. Ich wollte ihren Moment der Anmut nicht zerstören, deshalb klebte ich weiter an meinem chinesischen Baum aus Papierresten und aussortierten Standbildern von »Salaam Bombay«. Als ich hochschaute, fing er meinen Blick auf, legte den Finger an die Lippen, schlich sich hinter sie und tippte ihr auf die Schulter. Ihr Papiermesser schoss durch die Satzvorlage. Sie fuhr herum, und ich dachte schon, dass sie ihm den Bauch aufschlitzen wollte, doch er zeigte ihr etwas, was sie davon abhielt: einen kleinen Umschlag, den er auf den Tisch legte.
»Für dich und deine Tochter«, sagte er.
Sie öffnete ihn und zog zwei blau-weiße Eintrittskarten heraus. Ihr Schweigen, während sie sie untersuchte, erstaunte mich. Sie betrachtete zuerst die Karten, dann ihn, dann stieß sie die Spitze ihres Papiermessers in die Gummiauflage des Tisches, ein Pfeil, der dort einen Moment lang stecken blieb, ehe sie ihn wieder herauszog.
»Nur das Konzert«, sagte sie dann. »Ich gehe weder abendessen noch tanzen!«
»Einverstanden«, antwortete er, doch ich konnte sehen, dass er ihre Worte nicht wirklich ernst nahm. Er kannte sie noch nicht.
Die Karten waren für ein Gamelan-Konzert im Kunstmuseum bestimmt. Nun war mir klar, weshalb sie so schnell eingewilligt hatte. Ich fragte mich bloß, woher er so genau wusste, was er ihr vorschlagen musste – die einzige Einladung kannte, die sie niemals ausschlagen würde. Hatte er sich in den Oleanderbüschen vor unserem Haus versteckt? Ihre Freunde ausgefragt? Irgendjemanden bestochen?
Die Nacht knisterte, als meine Mutter und ich im Foyer des Museums auf ihn warteten. Die Hitze hatte alles statisch aufgeladen. Ich kämmte mir die Haare, weil ich sehen wollte, ob die Spitzen Funken schlugen.
Meine Mutter, gezwungen zu warten, machte kurze, ungeduldige Handbewegungen. »Zu spät! Wie verabscheuungswürdig! Ich hätte es gleich wissen müssen! Wahrscheinlich bespringt er gerade irgendwo in einem Feld ein paar Ziegen! Erinnere mich gelegentlich daran, nie wieder Verabredungen mit Vierbeinern zu treffen!«
Sie trug immer noch ihre Arbeitsklamotten, obwohl sie genug Zeit gehabt hätte, sich umzuziehen. Damit wollte sie ein Zeichen setzen, ihm zeigen, dass es sich gar nicht um eine richtige Verabredung handelte, dass ihr der Anlass völlig unwichtig war. Die anderen Frauen, die sommerliche Seidenkleider trugen und teure Parfumdüfte hinter sich herzogen, beäugten sie kritisch. Die Männer blickten sie bewundernd an, lächelten und starrten ihr hinterher. Sie starrte unverblümt zurück, mit ihren stechend blauen Augen, so lange, bis es den Männern peinlich wurde und sie sich verlegen wegdrehten.
»Männer«, sagte sie. »Egal wie unattraktiv sie sind – jeder glaubt, er sei was ganz Besonderes!«
Ich sah Barry über den Platz kommen, eine massige Gestalt auf kurzen Beinen. Er grinste und enthüllte dabei seine Zahnlücke. »Tut mir Leid, aber der Verkehr war die Hölle!«
Meine Mutter ignorierte die Entschuldigung. Nur Trampel hielten es für nötig, sich zu entschuldigen, hatte sie mir beigebracht. Entschuldige dich nie, erkläre nie etwas.
Das Gamelan-Orchester bestand aus zwanzig kleinen, dürren Männlein, die vor kunstvoll geschnitzten Glockenspielen, Gongs und Trommeln knieten. Die Trommel begann, begleitet von den tieferen Glockenspielen. Dann fielen immer mehr Instrumente in den anschwellenden Klang ein. Rhythmen entstanden und breiteten sich aus, verschlungen wie Lianen. Meine Mutter sagte, das Gamelan verursache beim Hörer eine Hirnwelle jenseits aller Alpha-, Beta- und Thetawellen. Eine Welle, die die normalen Gedankenkanäle lahmlegte und in bisher unberührten Gegenden des Geistes neue erzwang, ähnlich wie parallele Blutgefäße entstehen, um ein beschädigtes Herz zu versorgen.
Ich schloss die Augen und betrachtete die winzigen Tänzer, die wie juwelengeschmückte Vögel über die dunkle Leinwand meiner Augenlider hüpften. Sie zogen mich mit sich und redeten mit mir in Sprachen, die keine Worte hatten für seltsame Mütter mit eisblauen Augen, für Apartmenthäuser mit hässlichen Glitzersteinen auf der Eingangstür und verwelkten Blättern im Pool.
Nach der Vorstellung klappte das Publikum die plüschigen Samtsessel hoch und drängte zu den Ausgängen, doch meine Mutter rührte sich nicht. Sie blieb mit geschlossenen Augen auf ihrem Sessel sitzen. Sie verließ gern als Letzte den Saal. Sie hasste Menschenaufläufe, und es widerstrebte ihr, den Leuten dabei zuzuhören, wie sie nach einer Vorstellung ihre Ansichten äußerten oder – noch schlimmer – sich darüber austauschten, ob und wie lange man wohl auf der Toilette warten müsse oder wo man im Anschluss essen solle. Es verdarb ihr die Stimmung. Sie befand sich immer noch in einer anderen Welt und wollte dort so lange wie möglich bleiben, während sich die parallelen Gedankenkanäle wie Korallen durch ihre Großhirnrinde bohrten.
»Es ist vorbei«, sagte Barry.
Sie hob die Hand und signalisierte ihm, still zu sein. Er blickte mich an, und ich zuckte mit den Schultern. Ich war daran gewöhnt. Wir warteten, bis auch das letzte Geräusch im Zuschauerraum verstummt war. Schließlich öffnete sie die Augen.
»Also, wollt ihr eine Kleinigkeit essen?«, fragte er.
»Ich esse nie«, sagte sie.
Ich hatte Hunger, doch wenn meine Mutter einmal eine Position bezogen hatte, war sie unerschütterlich. Wir gingen nach Hause, wo ich Thunfisch aus der Dose aß, während meine Mutter in Anlehnung an die Rhythmen des Gamelans ein Gedicht über Schattenspielfiguren und Schicksalsgötter schrieb.
2
In dem Sommer, als ich zwölf war, streifte ich gern durch die Anlage, in der die Kinozeitschrift ihre Büros hatte. Der Komplex aus den zwanziger Jahren, ein ehemaliges Einkaufszentrum, hieß Crossroads of the World; in der Mitte des Hofes stand ein Gebäude im Art-déco-Stil, das einem Ozeandampfer nachempfunden war und heute von einer Werbeagentur genutzt wurde. Ich saß auf einer Steinbank und stellte mir vor, dass Fred Astaire, bekleidet mit einer Schiffermütze und einem blauen Blazer, an der Messingreling des Dampfers lehnte.
Die Häuser, die den gepflasterten Hof umgaben, waren in den verschiedensten Fantasiestilen – von den Gebrüdern Grimm bis zu Don Quijote – erbaut worden und beherbergten heute Fotostudios, Casting-Agenturen und Satzstudios. Ich zeichnete eine lachende Carmen, die sich unter dem herabhängenden Korb mit roten Geranien in der sevillanischen Eingangstür der Model-Agentur rekelte, und eine sittsam bezopfte Gretel, die die germanischen Stufen des Fotostudios mit einem Reisigbesen kehrte.
Während ich zeichnete, beobachtete ich die hochgewachsenen schönen Mädchen, die durch die Türen ein und aus gingen und zwischen Casting-Agentur und Fotostudio hin- und herliefen, wo sie das schwer verdiente Geld aus Teilzeitjobs ausgaben, um ihre Karriere voranzutreiben. Alles Geldschneiderei, pflegte meine Mutter zu sagen, und ich hätte den Mädchen gern diese Erkenntnis weitergegeben, doch sie schienen bereits durch ihre Schönheit gegen alles gefeit zu sein. Was konnte solchen Mädchen schon zustoßen, langbeinig in hautengen Hosen und durchsichtigen Sommerkleidchen, mit klaren Augen und ebenmäßigen Gesichtern? Selbst die Vormittagshitze ließ ihre Makellosigkeit unberührt; sie schienen in einem anderen Klima zu leben.
Gegen elf tauchte meine Mutter im gefliesten Eingangsbereich von Cinema Scene auf, und ich klappte mein Heft zusammen, weil ich dachte, dass sie eine frühe Mittagspause machen wollte. Doch wir gingen nicht zum Auto. Stattdessen folgte ich ihr um die nächste Straßenecke, wo Barry Kolker neben einem alten goldenen Lincoln auf uns wartete. Er trug ein grelles, großkariertes Jackett.
Meine Mutter blickte ihn einmal kurz an und schloss die Augen. »Dieses Jackett ist ja grässlich! Ich kann gar nicht hinsehen! Hast du es einer Leiche geklaut?«
Barry grinste und hielt meiner Mutter und mir die Autotüren auf. »Wart ihr noch nie beim Pferderennen? Man muss sich schrill anziehen, das ist so üblich.«
»Du siehst aus wie ein Sofa in einem Altersheim«, sagte sie, während wir einstiegen. »Gott sei Dank wird mich wenigstens keiner meiner Bekannten mit dir sehen!«
Wir machten einen Ausflug mit Barry. Ich konnte es kaum fassen. Ich war davon überzeugt gewesen, dass wir ihn nach dem Gamelan-Konzert nie mehr wieder treffen würden. Und jetzt hielt er mir die hintere Tür des Lincoln auf. Ich war noch nie auf der Rennbahn gewesen. Es war nicht die Art Freizeitvergnügen, die meiner Mutter in den Sinn kam: draußen an der frischen Luft, Pferde, niemand, der ein Buch las oder über den Zusammenhang von Schönheit und Schicksal nachdachte.
»Normalerweise würden mich keine zehn Pferde dorthin bringen, wie es so passend heißt«, sagte meine Mutter, während sie den Sicherheitsgurt umlegte. »Aber der Gedanke, die Arbeit für ein paar Stündchen zu schwänzen, ist einfach herrlich.«
»Es wird dir gefallen.« Barry setzte sich hinter das Lenkrad. »Der Tag ist viel zu schön, um in der alten Tretmühle zu schwitzen.«
»Dazu ist eigentlich jeder Tag zu schade«, gab meine Mutter zurück.
Am Cahuenga Boulevard nahmen wir den Freeway, fuhren Richtung Norden an Hollywood vorbei ins Valley und dann ostwärts Richtung Pasadena. Die Hitze lag wie ein Deckel über der Stadt.
Santa Anita lag am Fuß der San-Gabriel-Berge, ein blauer Granitwall, der wie eine Flutwelle jäh über der Stadt aufragte. Bunte Blumenrabatten und makellos grüne Rasenflächen gaben ihren schweren Duft in die Smogluft ab. Meine Mutter lief ein paar Schritte vor Barry her und gab vor, ihn nicht zu kennen, bis ihr schließlich aufging, dass hier alle so gekleidet waren wie er: weiße Schuhe und grünes Polyester.
Die Pferde erinnerten an empfindliche Maschinen auf Stahlfedern, sie glänzten wie Metall, und die Satinhemden der Jockeys leuchteten in der Sonne, während sie ihre Reittiere um den Platz führten, jedes Jungpferd von einem älteren, ruhigeren Partner begleitet. Die Pferde, ganz Nerven und Hitze, scheuten vor Kindern hinter der Absperrung, vor Fahnen.
»Such dir ein Pferd aus«, forderte Barry meine Mutter auf.
Sie entschied sich für Nummer sieben, eine weiße Stute, wegen ihres Namens: Medeas Stolz.
Die Jockeys hatten Schwierigkeiten, die Pferde in die Startmaschine zu dirigieren, doch kaum hatten sich die Tore geöffnet, donnerten sie wie eine Einheit über die Rennbahn.
»Los, Sieben!«, schrien wir. »Schneller, Sieben!«
Sie gewann. Meine Mutter lachte und umarmte mich, umarmte sogar Barry. So hatte ich sie noch nie erlebt, aufgeregt, lachend, sie schien plötzlich ganz jung zu sein. Barry hatte zwanzig Dollar für sie gesetzt und händigte ihr den Gewinn aus, hundert Dollar.
»Was haltet ihr von einem Abendessen?«, fragte er sie.
Ja, bitte sag ja, betete ich. Wie konnte sie ihm jetzt noch etwas abschlagen?
Sie führte uns zum Essen in das nahe gelegene Restaurant namens Surf ’N’ Turf. Barry und ich bestellten Salat und Steaks mit Folienkartoffeln und saurem Rahm. Meine Mutter trank nur ein Glas Weißwein. Das war Ingrid Magnussen. Sie stellte ihre eigenen Regeln auf, und plötzlich waren sie in den Stein von Rosette gemeißelt, waren aus einer Höhle unter dem Toten Meer geborgen worden, waren auf Schriftrollen aus der Tang-Dynastie verewigt.
Während des Essens erzählte Barry uns von seinen Reisen in den Orient, von Orten, an denen wir nie gewesen waren. Sein Erlebnis, als er sich in einer Strandhütte auf Bali Zauberpilze bestellt hatte und hinterher am türkisfarbenen Meer entlanggelaufen war und halluzinierte, er sei im Paradies. Sein Ausflug zu den Tempeln von Angkor Wat im Dschungel von Kambodscha, begleitet von thailändischen Opiumschmugglern. Die Woche, die er in den schwimmenden Bordellen Bangkoks verbracht hatte. Meine Anwesenheit hatte er völlig vergessen, er war zu sehr damit beschäftigt, meine Mutter zu hypnotisieren. Seine Stimme beschwor Gewürznelken und Nachtigallen herauf, sie trug uns auf Gewürzmärkte in Celebes, wir trieben mit ihm auf einem Hausboot über das Korallenmeer. Wir waren wie Kobras, die der Bambusflöte ihres Schlangenbeschwörers folgen.
Auf dem Nachhauseweg ließ sie ihn ihre Taille berühren, während sie ins Auto stieg.
Barry lud uns zum Abendessen zu sich nach Hause ein und sagte, er würde uns gern ein paar indonesische Gerichte kochen, die er dort gelernt hatte. Ich wartete bis zum Nachmittag, um ihr zu sagen, dass ich mich nicht wohl fühlte, dass sie ohne mich gehen sollte. Ich hungerte nach Barry, ich dachte, er könnte vielleicht der Richtige sein; jemand, der uns ernähren, uns festhalten und uns Wirklichkeit schenken konnte.
Sie verbrachte eine geschlagene Stunde damit, Kleider anzuprobieren, weiße indische Pajamas, das blaue Gazekleid, das Kleid mit dem Ananas- und Hulamädchen-Muster. Ich hatte sie noch nie zuvor so unschlüssig gesehen.
»Das blaue«, sagte ich. Es hatte einen tiefen Ausschnitt, und das Blau entsprach genau der Farbe ihrer Augen. Niemand konnte ihr widerstehen, wenn sie das blaue Kleid trug.
Sie entschied sich für die indischen Pajamas, die jeden Zentimeter ihrer goldenen Haut bedeckten. »Ich komme früh zurück«, sagte sie.
Nachdem sie gegangen war, lag ich auf ihrem Bett und stellte sie mir zusammen vor, das Duett ihrer tiefen Stimmen im Halbdunkel über der Reistafel. Ich hatte keine Reistafel mehr gegessen, seit wir aus Amsterdam weggezogen waren, wo wir gelebt hatten, als ich sieben war. Damals war der Geruch immer durch unsere Nachbarschaft gezogen. Meine Mutter sagte immer, dass wir eines Tages nach Bali reisen würden. Ich stellte mir dann vor, wie wir in einem Haus mit außergewöhnlich hohem, spitzem Dach wohnten, von wo aus wir über grüne Reisfelder und unglaublich klares Meer blickten und morgens zu Gongklängen und dem Meckern der Ziegen erwachten.
Nach einer Weile schmierte ich mir ein Käsebrot und ging nach nebenan zu Michael. Er hatte gerade eine halbe Flasche Rotwein von Trader Joe’s ausgetrunken – »Luxus für Arme«, wie er sagte, da die Flasche einen Korken hatte – und weinte, weil er sich gerade einen Lana-Turner-Film ansah. Ich mochte Lana Turner nicht und hatte keine Lust, mir die sterbenden Tomatenpflanzen anzuschauen. Deshalb las ich Tschechow, bis Michael einpennte, dann ging ich nach unten und schwamm im tränenwarmen Pool. Ich ließ mich auf dem Rücken treiben und schaute zu den Sternen empor, betrachtete den Ziegenbock, den Schwan, und hoffte, dass meine Mutter sich verliebte.
Das ganze Wochenende lang verlor sie kein Wort über ihr Rendezvous mit Barry, aber sie schrieb Gedichte, knüllte die Blätter zusammen und warf sie in den Papierkorb.
In der Layout-Abteilung las Kit über die Schulter meiner Mutter hinweg Korrektur, während ich an meinem Tisch in der Ecke saß, Figuren aus aussortierten Fotos schnitt und eine Tschechow-Collage klebte: die Dame mit dem Hündchen. Marlene ging ans Telefon und legte dann die Hand über die Muschel.
»Barry Kolker ist dran.«
Beim Klang dieses Namens hob Kit ruckartig den Kopf, wie eine Marionette in den Händen eines ungeschickten Puppenspielers. »Ich nehme das Gespräch in meinem Büro entgegen.«
»Er will Ingrid sprechen«, sagte Marlene.
Meine Mutter blickte nicht von ihrem Montagebogen auf. »Sag ihm, dass ich nicht mehr hier arbeite.«
Ohne mit der Wimper zu zucken, gab Marlene die Lüge weiter.
»Woher kennen Sie denn Barry Kolker?«, fragte die Chefredakteurin und riss ihre schwarzen Olivenaugen auf.
»Bloß eine Zufallsbekanntschaft«, antwortete meine Mutter.
An diesem Abend lockte die lange Sommerdämmerung die Leute aus ihren Wohnungen; sie führten ihre Hunde spazieren, tranken Mixgetränke am Pool und ließen die Füße ins Wasser hängen. Der Mond ging auf und machte sich vor dem unnatürlichen Blau des Himmels breit. Meine Mutter kniete vor ihrem Tisch und schrieb, während ich auf ihrem Bett lag; eine leichte Brise streifte das Windspiel, das wir im alten Eukalyptusbaum aufgehängt hatten. Ich hätte diesen Moment gern für immer eingefroren: den Klang des Windspiels, das leise Plätschern des Wassers, das Klimpern der Hundeleinen, das Gelächter am Pool, das Kratzen des Federhalters auf dem Papier, den Baum, die Stille. Am liebsten hätte ich ihn in ein Medaillon gesperrt und mir um den Hals gehängt. Ich wünschte mir, dass jetzt, in dieser Sekunde, ein tausendjähriger Schlaf über uns hereinbrechen möge wie über Dornröschens Schloss.
Ein Klopfen an der Tür störte unseren Frieden. Niemand kam je an unsere Tür. Sie legte ihren Federhalter hin, stand auf und griff nach dem Klappmesser, das sie in dem Krug mit den Stiften aufbewahrte, mit einer Klinge, die scharf genug war, eine Katze zu rasieren. Sie klappte es an ihrem Oberschenkel auf und legte den Finger auf die Lippen. Sie raffte den weißen Kimono über ihrer nackten Haut zusammen.
Es war Barry, der von draußen rief: »Ingrid!«
»Wie kann er es wagen!«, sagte sie. »Er kann doch nicht so einfach vor meiner Tür aufkreuzen, ohne dass ich ihn eingeladen habe!«
Sie öffnete die Tür. Er trug ein zerknittertes Hawaiihemd und hatte eine Flasche Wein und eine Papiertüte dabei, aus der herrliche Gerüche stiegen. »Hi«, grüßte er. »Ich war grad in der Gegend und dachte mir, ich schau mal vorbei.«
Sie stand im Türrahmen und hielt immer noch das offene Messer in der Hand. »So – dachtest du das?«
Dann tat sie etwas, was ich ihr nie zugetraut hätte. Sie klappte das Messer zu und bat ihn herein.
Er blickte sich in unserem vornehm kahlen Zimmer um. »Gerade eingezogen?« Sie sagte nichts. Wir wohnten schon seit mehr als einem Jahr dort.
Als ich aufwachte, schien die Sonne heiß durch die Fliegengitterfenster des Balkons und erhellte die milchige abgestandene Luft, die wie ein feuchtes Handtuch über dem Morgen hing. Ich konnte einen Mann singen hören; die Wasserrohre klirrten, als er die Dusche abstellte. Er war über Nacht geblieben. Sie hatte ihre Grundsätze gebrochen. Sie waren doch nicht in Stein gemeißelt. Sie waren so klein und zerbrechlich wie Papierkraniche. Während sie sich für die Arbeit anzog, starrte ich sie verwundert an und wartete auf eine Erklärung, doch sie lächelte nur.
Die Veränderungen, die nach dieser Nacht eintraten, waren erstaunlich. Sonntagmorgens gingen wir gemeinsam zum Farmers Market. Sie und Barry kauften Spinat und grüne Bohnen, gelbe Tomaten, blaue Weintrauben, die kaum größer waren als Reißzwecken, und einen papierartigen Knoblauchzopf, während ich hinter ihnen herzockelte, stumm vor Verblüffung über meine Mutter, die plötzlich Gemüseauslagen untersuchte, als handele es sich um einen Ausflug in einen Buchladen. Meine Mutter, für die eine Mahlzeit gewöhnlich aus einem Becher Joghurt oder einer Büchse Sardinen und Salzcracker bestand. Sie konnte wochenlang Erdnussbutterbrote essen, ohne es zu merken. Ich sah, wie sie achtlos an den Ständen mit ihren geliebten weißen Blumen, den Lilien und Chrysanthemen, vorbeiging und stattdessen einen Strauß riesiger roter Mohnblumen mit dicken schwarzen Blütenstempeln kaufte. Auf dem Heimweg hielten sie Händchen und sangen gemeinsam mit tiefen, schmachtenden Stimmen alte Hits aus den Sechzigern: »Wear your love like heaven« und »Waterloo Sunset«.
So vieles, das ich mir nie hätte träumen lassen. Sie schrieb kleine Gedichte, die sie ihm in die Jackentasche schob. Wann immer ich eine Gelegenheit fand, fischte ich sie heimlich heraus, um sie zu lesen. Was sie geschrieben hatte, ließ mich rot werden: Mohnblüten bluten Blätter puren Übermaßes. Du und ich, auf unserem süßen Schlachtfeld.
Eines Morgens in der Redaktion zeigte sie mir in einem der wöchentlichen Klatschblätter, Caligula’s Mother, ein Foto, das bei einer Premierenfeier aufgenommen worden war. Sie sahen beide sturzbetrunken aus. In der Bildunterschrift wurde sie als Barrys neue Flamme bezeichnet. Über so etwas regte sie sich sonst ungeheuer auf: eine Frau als Anhängsel eines Mannes. Nun war sie so stolz, als ob sie einen Wettbewerb gewonnen hätte.
Leidenschaft. Nie hätte ich erwartet, dass ihr so etwas zustoßen könnte. In diesen Tagen konnte sie sich manchmal selbst im Spiegel nicht wiedererkennen, die Augen schwarz vor Leidenschaft, ihr Haar zerzaust und moschusduftend, nach Barrys Bockgeruch.
Sie gingen zusammen aus, und hinterher erzählte sie mir lachend davon. »Die Frauen machen ihn an und kreischen mit ihren Pfauenstimmen: ›Barry? Wo hast du bloß gesteckt?‹ Doch das stört mich gar nicht. Jetzt ist er mit mir zusammen. Ich bin die Einzige, die er begehrt.«
Die Leidenschaft beherrschte sie. Vergessen waren die Anspielungen auf seine Ähnlichkeit mit einem Ziegenbock, auf die dringend nötige Zahnbehandlung, seinen schlaffen Körper, seinen erbärmlichen Kleidergeschmack, sein miserables Englisch, seine schamlosen Klischees, die geradezu kriminelle Trivialität seines Werkes, ein Mann, der »Einzigste« schrieb. Ich hätte nie gedacht, dass ich meine Mutter eines Tages dabei beobachten würde, wie sie im Flur vor unserem Apartment an einem untersetzten Mann mit Pferdeschwanz hing, oder dass sie ihm gestatten würde, während des Abendessens in einem dunklen Hunan-Restaurant in Chinatown die Hand unter ihren Rock zu schieben. Ich sah, wie sie ihre Augen schloss, und konnte die Wellen der Leidenschaft spüren, die sich wie Parfum über die Teetassen hinweg ausbreiteten.
Morgens lag er oft bei ihr auf der breiten, weißen Matratze, wenn ich das Zimmer auf dem Weg zur Toilette durchquerte. Sie sprachen dann sogar mit mir, ihr Kopf in seinen Arm geschmiegt, das Zimmer voll mit dem Duft ihres Liebesakts, als sei es die natürlichste Sache der Welt. Ich hätte am liebsten laut gelacht. Im Hof von Crossroads of the World saß ich unter einem Peruanischen Pfefferbaum und schrieb »Mr. und Mrs. Barry Kolker« in mein Notizheft. Vor dem Badezimmerspiegel übte ich den Satz: »Darf ich dich ›Dad‹ nennen?«
Ich erzählte meiner Mutter nie, dass ich mir einen Vater wünschte. Ich hatte dieses Thema bisher erst ein einziges Mal angesprochen. Es muss während meiner Kindergartenzeit gewesen sein; wir waren in jenem Jahr in die Staaten zurückgekehrt und lebten in Hollywood. Der Tag war heiß und dunstig, und meine Mutter hatte schlechte Laune. Sie holte mich spät aus dem Kinderhort ab, um mit mir auf den Markt zu gehen. Wir fuhren in dem alten Datsun, den sie damals besaß; ich erinnere mich noch an den heißen Sitz mit Waffelmuster und daran, dass ich durch ein Loch im Bodenblech die Straße sehen konnte.
Die Vorschule hatte gerade angefangen, und unsere junge Erzieherin, Mrs. Williams, hatte sich nach unseren Vätern erkundigt. Die Väter wohnten in Seattle, Panorama City oder San Salvador; einige waren sogar tot. Sie waren Rechtsanwälte, Trommler oder montierten Autofenster.
»Wo ist mein Vater?«, fragte ich meine Mutter.
Sie schaltete gereizt in einen niedrigen Gang, wobei ich unsanft in den Gurt gedrückt wurde. »Du hast keinen Vater«, erwiderte sie.
»Jeder hat einen Vater«, sagte ich.
»Väter sind unwichtig. Glaub mir, du hast Glück gehabt. Ich hatte einen, ich weiß, wovon ich rede. Vergiss es einfach.« Sie drehte das Radio an, und lauter Rock ’n’ Roll erklang.
Es war, als ob ich blind sei und sie mir gesagt hätte, das Augenlicht sei unwichtig, es sei ohnehin besser, nichts zu sehen. Ich fing an, Väter zu beobachten, in Läden, auf Spielplätzen, wenn sie ihren Töchtern auf den Schaukeln Schwung gaben. Es gefiel mir, dass sie anscheinend genau wussten, was sie zu tun hatten. Sie kamen mir vor wie ein Raumschiffdock, sicher und fest mit der Welt verbunden, nicht haltlos schwebend wie wir. Ich hoffte, dass Barry Kolker so ein Vater sein konnte.
Ihre geflüsterten Zärtlichkeiten waren meine Schlaflieder. Sie waren mein Wunschkästchen und verhießen mir Wäsche, Urlaub im Feriencamp, neue Schuhe und ein richtiges Weihnachtsfest. Ich sah gemütliche Familienessen vor mir, ein eigenes Zimmer, ein Fahrrad, Elternabende. Ein Jahr, das endlich genauso sein würde wie das vorhergehende, genauso wie das folgende, eine sichere Brücke. Und noch viel mehr sah ich; namenlose, kleine Dinge, wie sie sich vaterlose Mädchen wünschen.
Am Vierten Juli ging Barry mit uns zum Baseballspiel ins Dodger-Stadion und kaufte uns Dodger-Kappen. Wir aßen Hot Dogs, sie tranken Bier aus Pappbechern, und er erklärte ihr Baseball, als sei es eine Philosophie, der Schlüssel zum amerikanischen Charakter. Barry warf dem Erdnussverkäufer Geld zu und fing die Tüte auf, die der Mann zurückwarf. Wir ließen unsere Erdnussschalen auf den Boden fallen. Ich erkannte uns in unseren blauen Schirmmützen kaum wieder. Wir waren wie eine richtige Familie. Ich stellte mir vor, wir seien Vater, Mutter und Kind. Wir rissen die Arme empor und machten die Welle, und sie küssten sich während des gesamten siebten Inning, während ich kleine Gesichter auf die Erdnüsse malte. Das anschließende Feuerwerk setzte sämtliche Autoalarmanlagen auf dem Parkplatz in Gang.
An einem anderen Wochenende machte er mit uns einen Ausflug nach Catalina. Auf der Fähre wurde ich furchtbar seekrank, und Barry kühlte mir mit seinem Taschentuch die Stirn und besorgte mir Pfefferminzbonbons zum Lutschen. Ich mochte seine braunen Augen, seinen besorgten Blick, so als habe er noch nie ein Kind kotzen sehen. Als wir endlich angekommen waren, hielt ich mich im Hintergrund, denn ich hoffte, dass er ihr einen Heiratsantrag machen würde, während sie zwischen den Segelbooten herumschlenderten und Schrimps aus einer Papiertüte aßen.
Irgendetwas geschah. Ich erinnere mich nur daran, dass die Santa-Ana-Winde eingesetzt hatten. Das skelettartige Rasseln des Windes in den Palmen. Ein Abend, an dem Barry eigentlich um neun kommen wollte, doch dann war es plötzlich elf, und er war immer noch nicht aufgetaucht. Meine Mutter hörte die Kassette mit der peruanischen Flötenmusik, um ihre Nerven zu beruhigen, dann irische Harfenmusik, bulgarische Gesänge, doch nichts half. Die beruhigende, harmonische Musik bekam ihrer Stimmung nicht. Ihre Bewegungen waren unruhig und abgehackt.
»Lass uns schwimmen gehen«, schlug ich vor.
»Ich kann nicht«, erwiderte sie. »Vielleicht ruft er noch an.«
Schließlich riss sie die Kassette aus dem Recorder und legte stattdessen eine von Barrys Jazzkassetten ein, Chet Baker, romantische Musik, mit der man sie früher hätte jagen können.
»Cocktailbarmusik. Für Leute, die dabei in ihr Bier heulen wollen«, sagte sie. »Aber ich habe kein Bier im Haus.«
Er verließ die Stadt, um Aufträgen für verschiedene Zeitschriften nachzugehen. Er sagte ihre Verabredungen ab. Meine Mutter konnte nicht schlafen; sie fuhr jedes Mal hoch, wenn das Telefon klingelte. Es war schrecklich, ihren Gesichtsausdruck zu sehen, wenn es nicht Barry war. Ein Tonfall, den ich noch nie an ihr gehört hatte, schlich sich in ihre Stimme ein, scharf gezackt wie ein Sägeblatt.
Ich verstand nicht, wie das passieren konnte, wie er uns Feuerwerke und Catalina schenken konnte, wie er meine Stirn mit dem Taschentuch kühlen und darüber reden konnte, mit uns nach Bali zu reisen – und dann unsere Adresse vergaß.
Eines Nachmittags hielten wir unangekündigt vor seinem Haus.
»Er wird total sauer sein!«, sagte ich.
»Wir waren gerade in der Nachbarschaft. Dachten uns, wir schauen mal vorbei«, sagte meine Mutter.
Ich konnte sie ebenso wenig von ihrem Vorhaben abhalten, wie ich die Sonne davon abhalten konnte, an einem Augustmorgen aus dem heißen Smog aufzutauchen, doch ich wollte wenigstens nicht dabei zusehen. Ich wartete im Auto. Sie klopfte an die Tür, und er öffnete, gekleidet in einen Seersucker-Bademantel. Ich brauchte sie gar nicht zu hören, um zu wissen, was sie sagte. Sie trug ihr blaues Gazekleid, der heiße Wind kräuselte den Rocksaum, und die Sonne, die ihr im Rücken stand, ließ es durchsichtig wirken. Er lehnte im Türrahmen und versperrte den Eingang; sie neigte den Kopf zur Seite, trat näher, fasste sich ins Haar. Ich fühlte, wie sich ein Gummiband in meinem Hirn dehnte, weiter und weiter, bis sie schließlich in seinem Haus verschwanden.
Ich ließ das Radio laufen, klassische Musik. Ich konnte es nicht ertragen, irgendetwas zu hören, in dem Worte vorkamen. Ich stellte mir vor, wie ich mit meinen eigenen eisblauen Augen einen Mann anblickte und ihm sagte, er solle verschwinden, ich sei beschäftigt. »Du bist nicht mein Typ!«, sagte ich kühl zum Rückspiegel.
Eine halbe Stunde später tauchte sie wieder auf, stolperte zum Auto und fiel dabei fast über einen Rasensprenger, als ob sie blind wäre. Sie stieg ein, setzte sich hinter das Lenkrad und wiegte sich vor und zurück; ihr Mund war zu einem Rechteck geöffnet, doch kein Ton kam heraus. Meine Mutter weinte. Das Unvorstellbare war geschehen.
»Er hat eine Verabredung«, flüsterte sie schließlich mit einer Stimme, als hielten zwei Hände ihre Kehle umklammert. »Er hat mit mir geschlafen und mir dann gesagt, dass ich verschwinden muss. Weil er eine Verabredung hat.«
Ich wusste, wir hätten nicht kommen dürfen. Nun wünschte ich, dass sie ihre Grundsätze nie gebrochen hätte. Ich verstand, weshalb sie so eisern an ihnen festgehalten hatte. Wenn man einmal den ersten gebrochen hatte, fielen sie alle in sich zusammen, einer nach dem anderen, zerbarsten wie Feuerwerkskörper auf einem Parkplatz am Vierten Juli.
Ich hatte Angst, sie in diesem Zustand fahren zu lassen, mit Augen, die blind waren vor Zorn. Sie würde uns beide in den Tod reißen, ehe wir drei Häuserblöcke passiert hätten. Doch sie ließ den Motor nicht an. Sie saß nur da, starrte durch die Windschutzscheibe, hielt ihren Oberkörper mit den Armen umklammert und wiegte sich vor und zurück.
Ein paar Minuten später fuhr ein Auto in die Auffahrt, ein neues Sportwagenmodell mit heruntergelassenem Verdeck, das von einer Blondine gesteuert wurde. Sie war sehr jung und trug einen sehr kurzen Rock. Sie beugte sich vornüber, um ihre Handtasche vom Rücksitz zu nehmen.
»Sie ist längst nicht so hübsch wie du«, sagte ich.
»Aber sie ist wohl weniger kompliziert«, flüsterte meine Mutter mit bitterer Stimme.
Kit beugte sich über die Arbeitsplatte in der Layout-Abteilung, die magentaroten Lippen zu einem wölfischen Lächeln verzogen.
»Ingrid, stellen Sie sich mal vor, wen ich gestern Abend im Virgins gesehen habe«, sagte sie, die schrille Stimme atemlos vor Gehässigkeit. »Unseren gemeinsamen Freund Barry Kolker.« Sie seufzte theatralisch auf. »Mit einer kleinen Blondine, halb so alt wie er. Männer haben kein besonders gutes Gedächtnis, nicht wahr?« Ihre Nasenlöcher kräuselten sich, während sie ein Lachen unterdrückte.
In der Mittagspause forderte meine Mutter mich auf, alles, was mir gefiel, aus der Layout-Abteilung mitzunehmen. Wir gingen und würden nicht mehr wiederkommen.
3
»Ich sollte mir den Kopf scheren«, sagte sie. »Mir das Gesicht mit Asche einreiben.«
Ihre Augen sahen eigenartig aus, sie waren dunkel umrandet wie von Blutergüssen; ihr Haar hing glatt und fettig herunter. Sie lag auf dem Bett oder starrte sich im Spiegel an. »Wie kann ich Tränen über einen Mann vergießen, dem ich nie hätte erlauben sollen, mich auch nur anzufassen?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























